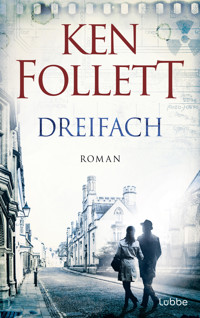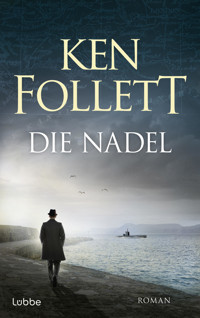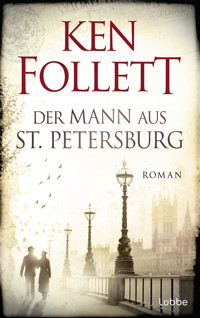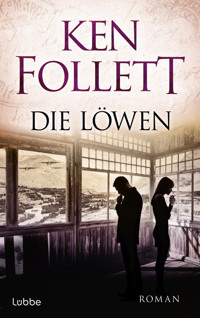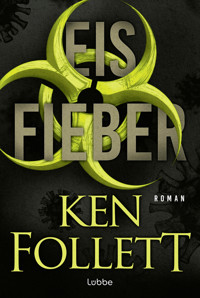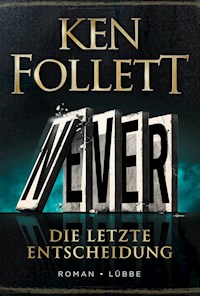
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mehr als ein Thriller - Ken Folletts neuester, actiongeladener Roman führt tief in die Verstrickungen unserer globalisierten Welt und stellt die Frage "Was wäre, wenn ...?"
"Eine fesselnde Geschichte, und nur allzu realistisch" Lawrence H. Summers, ehemaliger US-Finanzminister
In der Sahara folgen westliche Geheimdienstagenten der Spur mächtiger Drogenschmuggler. Die Amerikanerin Tamara und ihr französischer Kollege Tab gehören zu ihnen. Für ihre Liebe riskieren sie ihre Karriere - und im Einsatz für ihr Land ihr Leben. Nicht weit entfernt macht sich die junge Witwe Kiah mit Hilfe von Schleusern auf den Weg nach Europa. Als sie sich gegen Übergriffe verteidigen muss, hilft ihr ein Mitreisender. Doch er scheint nicht zu sein, was er vorgibt.
In China kämpft der hohe Regierungsbeamte Chang Kai gegen die kommunistischen Hardliner. Er hat ehrgeizige Pläne, und er befürchtet, dass die Kriegstreiberei seiner Widersacher das Land und dessen Verbündeten Nordkorea auf einen Weg leitet, der keine Umkehr zulässt.
In den USA führt Pauline Green, die erste Präsidentin des Landes, ihre Amtsgeschäfte souverän und bedacht. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die USA in einen unnötigen Krieg eintreten müssen. Doch wenn ein aggressiver Akt zum nächsten führt, wenn alle diplomatischen Mittel ausgereizt sind, die letzte Entscheidung gefallen ist - wer kann dann noch das Unvermeidliche verhindern?
In Ken Folletts neuestem Roman begegnen sich Heldinnen und Schurken, falsche Propheten und mutige Kämpfer, Liebe und Hass. Er fragt: Wenn sich die Welt nur einen Schritt vor dem Abgrund befindet - was kann jeder Einzelne dann noch tun? NEVER ist atemberaubend - und ein Weckruf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1099
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Mehr als ein Thriller – Ken Folletts neuester, actiongeladener Roman führt tief in die Verstrickungen unserer globalisierten Welt und stellt die Frage »Was wäre, wenn …?«
»Eine fesselnde Geschichte, und nur allzu realistisch« Lawrence H. Summers, ehemaliger US-Finanzminister
In der Sahara folgen westliche Geheimdienstagenten der Spur mächtiger Drogenschmuggler. Die Amerikanerin Tamara und ihr französischer Kollege Tab gehören zu ihnen. Für ihre Liebe riskieren sie ihre Karriere – und im Einsatz für ihr Land ihr Leben. Nicht weit entfernt macht sich die junge Witwe Kiah mit Hilfe von Schleusern auf den Weg nach Europa. Als sie sich gegen Übergriffe verteidigen muss, hilft ihr ein Mitreisender. Doch er scheint nicht zu sein, was er vorgibt.
In China kämpft der hohe Regierungsbeamte Chang Kai gegen die kommunistischen Hardliner. Er hat ehrgeizige Pläne, und er befürchtet, dass die Kriegstreiberei seiner Widersacher das Land und dessen Verbündeten Nordkorea auf einen Weg leitet, der keine Umkehr zulässt.
In den USA führt Pauline Green, die erste Präsidentin des Landes, ihre Amtsgeschäfte souverän und bedacht. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die USA in einen unnötigen Krieg eintreten müssen. Doch wenn ein aggressiver Akt zum nächsten führt, wenn alle diplomatischen Mittel ausgereizt sind, die letzte Entscheidung gefallen ist – wer kann dann noch das Unvermeidliche verhindern?
In Ken Folletts neuestem Roman begegnen sich Heldinnen und Schurken, falsche Propheten und mutige Kämpfer, Liebe und Hass. Er fragt: Wenn sich die Welt nur einen Schritt vor dem Abgrund befindet – was kann jeder Einzelne dann noch tun? NEVER ist atemberaubend – und ein Weckruf.
Über den Autor
Ken Follett, Autor von über zwanzig Bestsellern, wird oft als »geborener« Erzähler gefeiert. Betrachtet man jedoch seine Lebensgeschichte, so erscheint es zutreffender zu sagen, er wurde dazu »geformt«.
Ken Follett wurde am 5. Juni 1949 im walisischen Cardiff als erstes von drei Kindern des Ehepaares Martin und Veenie Follett geboren. Nicht genug, dass Spielsachen im Großbritannien der Nachkriegsjahre echte Mangelware waren – die zutiefst religiösen Folletts erlaubten ihren Kindern zudem weder Fernsehen noch Kinobesuche und verboten ihnen sogar, Radio zu hören. Dem jungen Ken blieben zur Unterhaltung nur die unzähligen Geschichten, die ihm seine Mutter erzählte – und die Abenteuer, die er sich in seiner eigenen Vorstellungswelt schuf. Schon früh lernte er lesen; er war ganz versessen auf Bücher, und nirgendwo ging er so gern hin wie in die öffentliche Bibliothek.
»Ich hatte kaum eigene Bücher und war immer dankbar für die öffentliche Bücherei. Ohne frei zugängliche Bücher wäre ich nie zum eifrigen Leser geworden, und wer kein Leser ist, wird auch kein Schriftsteller.«
Als Ken Follett zehn Jahre alt war, zog die Familie nach London. Nach seinem Schulabschluss studierte er Philosophie am University College; dass der Sohn eines Steuerinspektors sich für dieses Fach entschied, mag auf den ersten Blick befremden, aber bedenkt man, dass Kens religiöse Erziehung viele Fragen aufgeworfen und offengelassen hatte, erscheint sie gar nicht mehr so untypisch. Ken Follett ist der Überzeugung, dass die Entscheidung für dieses Studienfach ihm die Weichen in seine Zukunft als Schriftsteller gestellt hat.
»Zwischen der Philosophie und der Belletristik besteht ein Zusammenhang. In der Philosophie beschäftigt man sich mit Fragen wie zum Beispiel: ‚Wir sitzen hier an einem Tisch, aber existiert der Tisch überhaupt?’ Eine verrückte Frage, aber beim Studium der Philosophie muss man solche Dinge ernst nehmen und braucht eine unorthodoxe Vorstellungsgabe. Beim Schreiben von Romanen ist es genauso.«
In einem Hörsaal danach zu fragen, was wirklich ist, war eine Sache – doch plötzlich sah sich Ken mit einer ganz anderen Wirklichkeit konfrontiert: Er wurde Ehemann und Vater. Er heiratete seine Freundin Mary am Ende seines ersten Semesters an der Universität. Im Juli 1968 kam ihr Sohn Emanuele zur Welt. »So etwas plant man nicht, wenn man erst achtzehn ist, aber als es geschah, war es ein unglaubliches Erlebnis. Ich fühlte mich doppelt bereichert: Ich verbrachte eine herrliche Zeit an der Universität, aber es war auch äußerst aufregend, ein Baby zu haben und sich darum zu kümmern. Wir hatten Emanuele sehr lieb, und er war überaus liebenswert. Das ist er noch heute.«
An der Universität, in der hitzigen Atmosphäre der späten Sechzigerjahre und des Vietnam-Kriegs, entdeckte Ken Follett auch seine Leidenschaft für Politik.
»Ständig wurde über Politik diskutiert. Uns kam es vor, als wären die Studentenproteste zu einem weltweiten Phänomen geworden. Und obwohl wir jung und voller jugendlicher Arroganz waren – wenn ich mir die Kernfragen betrachte, für die wir eintraten, glaube ich, dass wir im Großen und Ganzen richtig lagen.«
Im September 1970, gleich nach der Universität, trat Ken Follett mit einem dreimonatigen Journalistenkurs den Weg an, der ihn zur Schriftstellerei führte. Zuerst arbeitete er als Zeitungsreporter für das South Wales Echo in Cardiff, nach der Geburt seiner Tochter Marie-Claire 1973 als Kolumnist für die Evening News in London.
Als Ken Follett sah, dass sein Traum, ein »berühmter Enthüllungsjournalist und Starreporter« zu werden, nicht in Erfüllung gehen würde, begann er, an den Abenden und Wochenenden Romane zu schreiben. 1974 verließ er die Zeitungswelt und nahm eine Stellung bei dem kleinen Londoner Verlag Everest Books an.
Seine Feierabend-Schriftstellerei führte zwar zur Veröffentlichung einiger Bücher, von denen sich aber keines gut verkaufte. Schon in dieser Zeit wurde er vom amerikanischen Literaturagenten Al Zuckerman ermutigt und beraten. Dann kam der Tag, an dem sie beide wussten, dass Kens neuer Roman das Zeug zum Bestseller besaß, und Zuckerman sagte: »Dieser Roman wird eine ganz große Sache – mach dich auf Steuerprobleme gefasst.«
Die Nadel (Eye of the Needle) war dieser Roman; er wurde 1978 veröffentlicht und machte Ken zum Bestseller-Autor. Die Nadel gewann den Edgar-Award und verkaufte sich mehr als 10 Millionen Mal. Der Erfolg dieses Buches ermöglichte es Ken, seinen bisherigen Beruf aufzugeben, eine Villa im Süden Frankreichs anzumieten und sich völlig seinem nächsten Roman namens Dreifach (Triple) zu widmen. »Ich machte mir große Sorgen, dass ich es nicht wieder schaffen würde. Das passiert vielen Schriftstellern. Sie schreiben ein hervorragendes Buch, aber das nächste ist schon schwächer und verkauft sich auch nicht mehr so oft. Das dritte Buch ist dann nicht sonderlich gut, und ein viertes schreiben sie nicht mehr. Ich war mir voll bewusst, dass mir das Gleiche passieren könnte. Deswegen arbeitete ich sehr hart an Dreifach, um ihn ebenso spannend wie Die Nadel zu machen.«
Drei Jahre später kehrten die Folletts nach England zurück, denn Ken vermisste Kino und Theater und die anregende Atmosphäre in London. Auch wollte er wieder von seinem Wahlrecht Gebrauch machen können. Das Paar ließ sich in Surrey nieder, wo Ken sich bei der Beschaffung von Geldern und den Wahlkampagnen der Labour Party engagierte. Dort lernte er auch Barbara Broer kennen, die Sekretärin des dortigen Parteibüros, verliebte sich in sie und heiratete sie 1985 nach seiner Scheidung. Die beiden leben jetzt in Hertfordshire in einem alten Pfarrhaus, das auch Kens Kindern aus erster Ehe sowie Barbaras Sohn und ihren beiden Töchtern sowie deren Partnern und Kindern offensteht.
Barbara war Parlamentsabgeordnete von Stevenage – ihren Sitz hatte sie 1997 erstmals errungen und wurde 2001 und 2005 wiedergewählt. Als Gleichstellungsministerin gehörte sie 2007 der Regierung Gordon Browns an. 2010 zog sie sich aus der aktiven Politik zurück und ist seither nicht nur CEO des Ken Follett Office, sondern auch die Agentin ihres Mannes, die ihn international vertritt. Ken unterstützte sie beim Wahlkampf und durch seine Mitarbeit an anderen Aktivitäten der Partei. Obwohl Ken sich politisch engagiert, lässt er sich durch die Politik niemals von der Schriftstellerei abhalten. Er beginnt schon vor dem Frühstück zu schreiben und arbeitet bis etwa siebzehn Uhr: »Ich bin ein Morgenmensch. Sobald ich aufgestanden bin, möchte ich an den Schreibtisch. Am Abend entspanne ich mich gern, möchte essen und trinken und Dinge tun, die mich nur wenig belasten.«
In den letzten 40 Jahren hat Ken Follett 30 Romane verfasst. Seine ersten fünf Bestseller waren Spionageromane: Die Nadel (1978), Dreifach (1979), Der Schlüssel zu Rebecca (The Key to Rebecca – 1980), Der Mann aus St. Petersburg (The Man from St. Petersburg – 1982) und Die Löwen (Lie Down with Lions – 1986). Auf den Schwingen des Adlers (On Wings of Eagles – 1983) ist die wahre Geschichte zweier Angestellter von Ross Perot, die während der Revolution in 1979 aus dem Iran gerettet werden.
Und dann überraschte er seine Leser mit einem radikalen Genre-Wechsel: 1989 erschien Die Säulen der Erde (The Pillars of the Earth), ein Roman über den Bau einer fiktiven Kathedrale im Mittelalter. Das Buch erhielt begeisterte Kritiken und führte sechs Jahre lang die deutschen Bestsellerlisten an. In der 2004 vom ZDF durchgeführten Umfrage »Unsere Besten – Das große Lesen« landete Die Säulen der Erde auf Platz 3 der beliebtesten Bücher der Deutschen, gleich nach J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe und der Bibel. Weltweit hat sich der Roman bislang 23 Millionen Mal verkauft.
Die folgenden drei Romane, Nacht über den Wassern (Night Over Water – 1991), Die Pfeiler der Macht (A Dangerous Fortune – 1993) und Die Brücken der Freiheit (A Place Called Freedom – 1995), waren eher historische Romane als Thriller. Mit dem Roman Der dritte Zwilling (The Third Twin – 1996) kehrte er jedoch wieder ins Thriller-Genre zurück. 1997 stand dieser Roman in der jährlichen Übersicht der internationalen Belletristik-Bestseller in Publishing Trends gleich hinter John Grishams The Partner an zweiter Stelle. Sein nächstes Werk, Die Kinder von Eden (The Hammer of Eden – 1998) war wieder ein Kriminalroman, der in der Gegenwart angesiedelt ist, gefolgt von Das zweite Gedächtnis (Code to Zero – 2000), einem Thriller, der zur Zeit des Kalten Krieges spielt.
Für die beiden anschließenden Romane wählte Ken wieder den 2. Weltkrieg als Hintergrund: Die Leopardin (Jackdaws – 2001) ist die Geschichte einer Gruppe von Frauen, die an Fallschirmen über dem besetzten Frankreich abspringen, um ein strategisch wichtiges Fernmeldeamt zu zerstören (der Roman gewann 2003 den begehrten Corine-Preis), und in Mitternachtsfalken (Hornet Flight – 2002) geht es um ein junges dänisches Paar, das tollkühn versucht, mit einem restaurierten Doppeldecker, einer Hornet Moth, aus dem besetzten Dänemark nach England zu flüchten. Mit im Gepäck haben sie wichtige Informationen über ein neues deutsches Radarsystem.
Eisfieber (Whiteout – 2004) ist ein Thriller, der in der Gegenwart spielt und vom Diebstahl eines tödlichen Virus aus einem Forschungslabor handelt. Schauplatz ist das schottische Hochland während einer stürmischen, verschneiten Weihnacht, geprägt von Eifersucht, Misstrauen, sexueller Spannung und Rivalitäten, mit arglistigen Verrätern und unvermuteten Helden.
Die Tore der Welt (World Without End – 2007) ist die lang erwartete Fortsetzung zum immens beliebten Die Säulen der Erde. In diesem Roman kehrt Ken zweihundert Jahre später nach Kingsbridge zurück und berichtet von den Nachkommen der Figuren in Die Säulen der Erde. Breit angelegt und von gewaltigem Umfang, konzentriert es sich auf eine Handvoll Menschen, deren Leben vom Schwarzen Tod bedroht wird, der Pestepidemie, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts Europa befiel.
Die nächsten drei Romane des Meisters des Geschichtenerzählens umspannen fünf Generationen auf drei Kontinenten und bilden die sogenannte »Jahrhundert-Saga«. Sturz der Titanen (Fall of Giants, 2010) verfolgt das Schicksal von fünf Familien aus den USA, Deutschland, Russland, England und Wales, die in gegenseitiger Beziehung stehen, in den Wirren des 1. Weltkriegs und der Russischen Revolution und beim Kampf um das Frauenwahlrecht. Sturz der Titanen wurde gleichzeitig in vierzehn Ländern veröffentlicht, war eine internationale Sensation und führte mehrere Bestsellerlisten an.
Winter der Welt (Winter of the World, 2012) nimmt die Fäden des ersten Buches wieder auf, als auf die fünf Familien eine Zeit gewaltiger gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Umwälzungen zukommt, und führt sie durch den Aufstieg des »Dritten Reiches«, den Spanischen Bürgerkrieg und die dramatischen Wendungen des 2. Weltkriegs bis zu den Explosionen der ersten amerikanischen und sowjetischen Atombomben und dem Beginn des langen Kalten Krieges.
Der dritte Band der Jahrhundert-Saga, Kinder der Freiheit (Edge of Eternity), der das Schicksal der fünf Familien vor dem Hintergrund der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen vom Anfang der 1960er bis zum Ende der 1980er Jahre schildert, ist im September 2014 erschienen und handelt vom Kampf um die Bürgerrechte, von Attentaten und den großen Massenbewegungen, von Vietnam und der Kubakrise, Präsidentschaftsskandalen, Revolutionen und vom Rock ‚n‘ Roll bis hin zum Fall der Berliner Mauer.
Bisher hat sich die Jahrhundert-Saga weltweit über 12 Millionen Mal verkauft.
Die Nadel wurde mit großem Erfolg mit Donald Sutherland in der Hauptrolle verfilmt. Sechs weitere Follett-Romane dienten als Vorlage für Mini-Serien für das Fernsehen: Der Schlüssel zu Rebecca, Die Löwen, Auf den Schwingen des Adlers, Der dritte Zwilling – die CBS erwarb die TV-Rechte an diesem Roman für die Rekordsumme von $1.400.000 –, Die Säulen der Erde und Die Tore der Welt. Die beiden letzten Verfilmungen wurden in viele Sprachen synchronisiert und in zahlreichen Ländern ausgestrahlt. Ken verwirklichte sich mit einem Gastauftritt als Diener in Der dritte Zwilling – und später als Händler in Die Säulen der Erde – einen lebenslangen Traum, aber er wird die Schriftstellerei nicht an den Nagel hängen.
Die großen Freuden in Kens Leben, abgesehen von den ihm nahe stehenden Menschen, sind gutes Essen und Wein, Shakespeare und Musik.
Musik war ihm schon immer sehr wichtig. Beide Eltern spielten Klavier, und Ken spielt Bassgitarre in einer Band mit Namen »Damn Right I Got The Blues«, mit der er auch ein Album namens Don’t Quit Your Day Job (»Häng deinen richtigen Beruf nicht an den Nagel«) aufgenommen hat – ein recht passender Titel für einen Mann, der keine übertriebenen Vorstellungen in Bezug auf sein musikalisches Talent hegt.
»In einer Band zu spielen ist eine sehr sinnliche Beschäftigung, die Schriftstellerei reine Hirnarbeit. Meine Romane folgen, wie in der Unterhaltungsliteratur üblich, einem vorher festgelegten Handlungsgerüst, und ich denke ständig über die Mechanismen der Erzählung nach. Das Spielen in einer Band ist dagegen vollkommen emotionaler Natur. Zwischen den Ohren und den Fingerspitzen besteht eine direkte Verbindung, die die bewusste Vernunft umgeht.«
Obwohl Ken ein rühriges Leben führt, in dessen Mittelpunkt Arbeit, Familie und Politik stehen, findet er Zeit, sich in seiner Gemeinde zu engagieren. 1998-99 war er Vorsitzender des National Year of Reading, einer staatlichen Initiative zur Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeit. Zehn Jahre lang war er Präsident der Dyslexia Action, einer Organisation zur Legasthenikerhilfe. Er ist Fellow der Welsh Academy, der Royal Society of Arts und des University College, London.
2007 verlieh ihm die University of Glamorgan die Ehrendoktorwürde in Literatur und die Saginaw Valley State University in Michigan einen ähnlichen Titel; dort gibt es auch ein eigenes »Ken-Follett-Archive«, wo seine Unterlagen aufbewahrt werden. 2008 schloss sich die University of Exeter an. Er ist in mehreren Stevenage-Wohlfahrtsstiftungen aktiv und war zehn Jahre lang Mitglied im Aufsichtsgremium der Grundschule von Roebuck, darunter vier Jahre als Vorsitzender.
KENFOLLETT
NEVER
DIE LETZTEENTSCHEIDUNG
Roman
Übersetzung aus dem Englischen vonDietmar Schmidt und Rainer Schumacher
LÜBBE
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen.
Titel der englischen Originalausgabe:
»Never«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2021 by Ken Follett
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Helmut W. Pesch, Köln
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Johannes Wiebel; spacedrone808/shutterstock.com; ifong/shutterstock.com; Free Textures/shutterstock.com; Sabphoto/shutterstock.com; The7Dew/shutterstock.com; Lizard/shutterstock.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-1584-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Bei meinen Recherchen für Sturz der Titanen stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass niemand den Ersten Weltkrieg gewollt hatte. Auf keiner Seite wünschte sich ein europäischer Staatenlenker einen derartigen Konflikt. Trotzdem trafen die Monarchen und Staatschefs eine Entscheidung nach der anderen – logische, moderate, nachvollziehbare Entscheidungen –, von denen uns jede einzelne einen kleinen Schritt näher an den furchtbarsten Konflikt brachte, den die Welt je erlebt hatte. Ich gelangte zu der Auffassung, dass der Erste Weltkrieg nur ein tragischer Unfall gewesen war.
Und ich fragte mich: Könnte so etwas wieder passieren?
Zwei Tiger können sich nicht den gleichen Berg teilen.
Chinesisches Sprichwort
MUNCHKIN COUNTRY
PROLOG
Den Titel des kleinsten US-Präsidenten aller Zeiten hatte mit fünf Fuß vier Zoll lange James Madison gehalten; das entspricht einem Meter dreiundsechzig. Bis Präsidentin Green seinen Rekord brach. Pauline Green maß vier Fuß elf Zoll, nicht ganz einen Meter fünfzig. Sie wies gern darauf hin, dass Madison bei seiner Wahl einen gewissen Dewitt Clinton geschlagen habe, der es auf sechs Fuß drei Zoll brachte, einen Meter einundneunzig.
Ihren Besuch in Munchkin Country hatte sie zweimal verschoben. In jedem Jahr ihrer Amtszeit war er einmal angesetzt gewesen, aber beide Male war etwas Wichtigeres dazwischengekommen. Nun, beim dritten Mal, musste sie unbedingt hin, fand sie. Es war ein milder Septembermorgen im dritten Jahr ihrer Präsidentschaft.
Die Army nannte es einen Rehearsal of Concept Drill. Die Trockenübung sollte führende Regierungsangehörige mit den Abläufen vertraut machen, die sie in einem Notfall zu beachten hatten. Pauline tat demnach so, als hätte sie die Meldung erhalten, dass die USA angegriffen würden, und ging mit raschen Schritten vom Oval Office zum Südrasen des Weißen Hauses.
Hastig folgte ihr eine Handvoll Schlüsselpersonen, die ihr kaum jemals von der Seite wichen: ihr Nationaler Sicherheitsberater, ihre leitende Assistentin, zwei Bodyguards vom Secret Service und ein junger Army-Captain mit einem ledernen Aktenkoffer, den man den Atomic Football nannte und der alles enthielt, was Pauline brauchte, um einen Atomkrieg zu beginnen.
Ihr Hubschrauber gehörte zu einer ganzen Flotte, und jeweils der, in dem sie sich befand, hieß Marine One. Wie stets nahm ein Marineinfanterist in blauer Ausgehuniform Haltung an, als die Präsidentin näher kam und leichtfüßig die Rampe hochstieg.
Ihren ersten Flug mit einem Hubschrauber, der ungefähr ein Vierteljahrhundert zurücklag, hatte Pauline als unangenehm empfunden. Sie erinnerte sich noch an die harten Metallsitze und die Enge, an den Lärm, der jedes Gespräch unmöglich machte. In diesem Hubschrauber war es anders. Das Innere des Helikopters ähnelte mehr einem Privatjet. Die bequemen Sitze waren mit hellbraunem Leder bezogen. Der Innenraum war klimatisiert, und die Maschine verfügte über eine kleine Toilettenkabine.
Gus Blake, der Nationale Sicherheitsberater, nahm neben ihr Platz. Gus war pensionierter General, ein großer Mann mit dunkler Haut und kurzen grauen Haaren. Ihn umgab eine Aura beruhigender Kraft. Mit fünfundfünfzig hatte er Pauline fünf Jahre voraus. Beim Präsidentschaftswahlkampf war er ein wichtiges Mitglied ihres Teams gewesen, und jetzt war er ihr engster Mitarbeiter.
»Danke für Ihr Verständnis«, sagte er, als sie abhoben. »Ich weiß, Sie haben anderes zu tun.«
Er hatte recht. Die Ablenkung kam ihr ungelegen, und sie konnte es kaum abwarten, die Sache hinter sich zu bringen. »Eine der Pflichten, die erledigt sein wollen«, sagte sie.
Der Flug war kurz. Während der Hubschrauber in den Sinkflug ging, betrachtete sich Pauline in einem Taschenspiegel. Ihr kurzer blonder Bob saß tadellos, sie hatte nur leichtes Make-up aufgetragen. Aus ihren schönen nussbraunen Augen sprach Mitgefühl, wie sie es oft empfand, aber ihre Lippen konnten einen geraden Strich bilden und unerbittliche Entschlossenheit ausdrücken. Mit einem Klicken klappte sie den Spiegel zusammen.
Sie landeten vor einem Lagerhaus in einer Vorstadt in Maryland. Offiziell hieß die Stätte US Government Archive Overflow Storage Facility No. 2, als würden dort überzählige Regierungsakten gelagert, aber die wenigen Personen, die ihre wahre Funktion kannten, nannten sie Munchkin Country nach dem Ort, an den es Dorothy in Der Zauberer von Oz während des Tornados verschlägt.
Munchkin Country war geheim. Jeder kannte den Raven Rock Complex in Colorado, den unterirdischen Atombunker, in dem die obersten Militärs sich während eines Atomkriegs zu verschanzen gedachten. Die Einrichtung gab es wirklich, und sie war wichtig für den Fall der Fälle, aber der US-Präsident würde sich nicht dorthin zurückziehen. Viele wussten auch, dass unter dem Ostflügel des Weißen Hauses das Presidential Emergency Operations Center lag, das Lagezentrum, das in Krisen wie 9/11 zum Einsatz kam. Für eine langfristige Nutzung nach der nuklearen Apokalypse war diese Notzentrale allerdings nicht gedacht.
Munchkin Country konnte hundert Personen ein Jahr lang am Leben erhalten.
Präsidentin Green wurde von einem Generalleutnant Whitfield empfangen. Er war Ende fünfzig, füllig mit rundem Gesicht, aber liebenswürdigem Gebaren und einem auffälligen Mangel an militärischer Aggressivität. Pauline hatte kaum einen Zweifel, dass er nicht im Geringsten daran interessiert war, Gegner zu töten – nun, dafür hatte man schließlich Soldaten. Seine Friedfertigkeit durfte der Grund sein, weshalb er auf diesem Kommandeursposten gelandet war.
Der erste Eindruck, den man bekam, war der eines ganz normalen Lagerbetriebs; Schilder leiteten Lieferfahrzeuge zu einer Laderampe. Whitfield führte die Gruppe durch einen schmalen Seiteneingang, und hinter dieser Tür schlug die Stimmung um.
Vor ihnen versperrte eine schwere Stahltür den Weg, die mit ihren beiden Flügeln auch als Eingang zu einem Hochsicherheitsgefängnis getaugt hätte.
Der Raum, den man durch die Stahltür betrat, wirkte bedrückend. Er hatte eine niedrige Decke, und die Wände schienen zusammengerückt zu sein, als wären sie mehrere Fuß dick. Die Luft roch wie aus der Dose.
»Dieser druckwellengesicherte Raum dient hauptsächlich zum Schutz der Aufzugschächte«, erklärte Whitfield.
Als sie in den Lift stiegen, verlor Pauline rasch das ungeduldige Gefühl, an einer Übung teilzunehmen, die kaum erforderlich war. Die Sache erschien ihr immer unheimlicher.
»Mit Ihrer Erlaubnis, Madam President, fahren wir erst ganz nach unten und arbeiten uns nach oben vor.«
»Einverstanden, General. Ich danke Ihnen.«
Während der Lift hinunterfuhr, sagte er stolz: »Ma’am, diese Einrichtung bietet Ihnen einhundertprozentigen Schutz, sollten die USA von einer der folgenden Bedrohungen betroffen sein: einer Pandemie oder Seuche, einer Naturkatastrophe wie dem Einschlag eines großen Meteoriten auf der Erde, einem Aufstand und größeren zivilen Unruhen, der erfolgreichen Invasion durch konventionelle Streitkräfte, einem Cyberangriff oder einem nuklearen Konflikt.«
Wenn diese Auflistung möglicher Katastrophen dazu gedacht war, Pauline zu beruhigen, so verfehlte sie ihren Zweck. Sie erinnerte sie vielmehr daran, dass ein Ende der Zivilisation im Rahmen des Möglichen lag und sie sich vielleicht in diesem Loch im Boden verstecken müsste, damit sie versuchen konnte, die Überreste der Spezies Mensch zu retten.
Wenn schon sterben, dann lieber an der Oberfläche, dachte sie.
Die Aufzugskabine fuhr rasch und schien tief zu fallen, bevor sie verlangsamte. Als sie endlich anhielt, sagte Whitfield: »Für den Fall von Aufzugproblemen gibt es eine Treppe.«
Das sollte eine geistreiche Bemerkung sein, und die jüngeren Mitglieder ihrer Gruppe lachten über den Gedanken, wie viele Stufen es wären. Pauline erinnerte sich jedoch daran, wie lange die Menschen gebraucht hatten, um im brennenden World Trade Center die Treppen hinunterzusteigen, und verzog keine Miene. Gus blieb genauso ernst wie sie, wie sie mit einem Seitenblick feststellte.
Die Wände waren in einem friedlichen Grün, beruhigendem Cremeweiß und entspannendem Pastellrosa gestrichen, aber es war und blieb ein unterirdischer Bunker. Das unheimliche Gefühl verließ sie auch nicht, als man ihr der Reihe nach die Präsidentensuite, die Unterkünfte mit ihren Feldbettenreihen, das Lazarett, die Sporthalle, die Kantine und den Supermarkt zeigte.
Der Lageraum war eine Nachbildung des Einsatzzentrums im Keller des Weißen Hauses. In der Mitte gab es einen langen Tisch, an den Wänden Stühle für Adjutanten und Assistenten. Darüber hingen große Bildschirme. »Wir können Ihnen alle visuellen Daten liefern, die Sie im Weißen Haus erhalten würden, und genauso schnell«, sagte Whitfield. »Wir können einen Blick in jede Stadt der Welt werfen, indem wir uns in Verkehrsüberwachungs- und Sicherheitskameras hacken. Militärische Radaranlagen liefern uns Ortungsergebnisse in Echtzeit. Wie Sie wissen, dauert es bei Satellitenfotos gut zwei Stunden, bis sie zur Verfügung stehen, aber wir erhalten sie zeitgleich mit dem Pentagon. Wir können jeden Fernsehsender empfangen, was bei den seltenen Gelegenheiten nützlich ist, bei denen CNN oder Al Jazeera eine Story bringen, bevor uns Geheimdienstmeldungen vorliegen. Und uns wird ein Team von Übersetzern zur Verfügung stehen, das in Echtzeit Untertitel für fremdsprachige Nachrichtensendungen erstellt.«
Die Techniketage verfügte über ein Kraftwerk mit einem Dieselkraftstoffreservoir von der Größe eines Sees, ein Heiz- und Kühlsystem und einen Zwanzig-Millionen-Liter-Wasserspeicher, den eine unterirdische Quelle speiste. Pauline neigte nicht zur Klaustrophobie, aber ihr stockte der Atem bei dem Gedanken, hier eingesperrt zu sein, während die Außenwelt in Schutt und Asche fiel. Mit einem Mal bemerkte sie, wie sie gepresst Luft holte und wieder ausstieß.
Als lese er ihre Gedanken, sagte Whitfield: »Unsere Luftversorgung kommt von außen durch eine Reihe von Filtern, die nicht nur Explosionen standhalten, sondern auch Schadstoffe abfangen, seien sie chemischer, biologischer oder radioaktiver Natur.«
Gut, dachte Pauline, aber was ist mit den Millionen Menschen an der Oberfläche, die keinen Schutz haben?
Am Ende der Führung sagte Whitfield: »Madam President, wir wurden verständigt, dass Sie nicht zu Mittag essen möchten, bevor Sie uns wieder verlassen, aber wir haben einen Imbiss vorbereitet für den Fall, dass Sie sich umentscheiden.«
Das passierte ihr ständig. Jedem gefiel die Vorstellung, ein Stündchen zwanglos mit der Präsidentin plaudern zu können. Sie empfand einen Schwall von Sympathie für Whitfield, der unterirdisch auf seinem wichtigen, aber unsichtbaren Posten festsaß, aber wie immer musste sie dem Drang widerstehen und sich an ihren Terminplan halten.
Nur selten verschwendete Pauline ihre Zeit, indem sie mit jemandem aß, der nicht ihrer Familie angehörte. Zum Austausch von Informationen und Treffen von Entscheidungen hielt sie Besprechungen ab, und wenn eine Sitzung zu Ende war, begab sie sich in die nächste. Die Anzahl der formellen Bankette, an denen sie als Präsidentin teilnahm, hatte sie radikal zusammengestrichen. »Ich bin die Anführerin der freien Welt«, hatte sie gesagt. »Wozu soll ich mich drei Stunden lang mit dem belgischen König unterhalten?«
Sie sah Whitfield in die Augen. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, General, aber ich muss zurück ins Weiße Haus.«
Als sie wieder im Hubschrauber saß, schnallte sie sich an und nahm einen Plastikbehälter aus der Tasche, der nicht größer war als eine kleine Brieftasche. Der Behälter wurde der Biscuit genannt. Er konnte nur geöffnet werden, indem man die Kunststoffhülle zerbrach. Darin befand sich eine Karte mit einer Reihe von Buchstaben und Ziffern: die Codes zur Anordnung eines nuklearen Angriffs. Als Präsidentin musste sie den Biscuit ständig bei sich tragen und ihn nachts an ihrem Bett aufbewahren.
Gus bemerkte, was sie tat. »Gott sei Dank ist der Kalte Krieg vorbei.«
»Dieser schreckliche Bunker hat mir vor Augen geführt, wie dicht am Rand des Abgrunds wir noch immer leben.«
»Wir müssen nur dafür sorgen, dass er nie gebraucht wird.«
Und dafür war Pauline Green verantwortlich, mehr als jeder andere Mensch auf der Welt. An einigen Tagen spürte sie die Last auf ihren Schultern. Heute wog sie besonders schwer.
Sie schloss kurz die Augen. »Wenn ich jemals nach Munchkin Country zurückkehre, dann weiß ich, dass ich versagt habe.«
DEFCON 5
Niedrigste Alarmstufe
KAPITEL 1
Von einem Flugzeug aus betrachtet hätte der Wagen wie ein Käfer gewirkt, dessen glänzender schwarzer Panzer in der Sonne funkelte, während er behäbig über einen endlosen Strand kroch. Tatsächlich legte das Fahrzeug dreißig Meilen pro Stunde zurück, die maximal mögliche Geschwindigkeit auf einer Straße, die ständig mit Schlaglöchern und Rissen aufwartete. Niemand riskierte in der Sahara eine Reifenpanne.
Von N’Djamena, der Hauptstadt des Tschad, führte die Straße durch die Wüste zum Tschadsee, der größten Oase der Sahara. Die Landschaft bot ein lang gestrecktes, flaches Panorama aus Sand und Felsen mit seltenen blassgelben vertrockneten Büschen, übersät mit kleinen und großen Steinen, alles im gleichen Hellbraun und so öde wie die Mondoberfläche.
Wenn die Wüste beunruhigend an den Weltraum erinnerte, sann Tamara Levit, war das Auto ihr Raumschiff. Wenn mit ihrem Raumanzug etwas schiefging, konnte sie sterben. Der Vergleich war abstrus, und sie musste unwillkürlich lächeln. Trotzdem warf sie einen Blick in den hinteren Teil des Wagens, wo zwei beruhigend große Ballonflaschen aus Plastik mit Wasser standen, genug, um sie alle im Notfall am Leben zu erhalten, bis Hilfe eintraf. Normalerweise.
Der Wagen war ein amerikanisches Modell. Er war für schwieriges Terrain gebaut, hohe Bodenfreiheit, kurze Geländeuntersetzung. Seine Scheiben waren getönt, und Tamara trug eine Sonnenbrille, aber trotzdem glühte die Sonne auf der Betonpiste und schmerzte ihr in den Augen.
Alle vier Insassen des Wagens trugen Sonnenbrillen. Ali, der Fahrer, war ein Einheimischer, im Tschad geboren und aufgewachsen. In der Stadt kleidete er sich in Bluejeans und T-Shirt, aber heute trug er ein bodenlanges Gewand, das man Dschallabija nannte, dazu ein voluminös umgeschlagenes Baumwolltuch um den Kopf, die traditionelle Schutzkleidung vor der gnadenlosen Sonne.
Auf dem Beifahrersitz neben Ali saß ein amerikanischer Soldat, Corporal Peter Ackerman. Die Waffe, die er sich locker über die Knie gelegt hatte, war das übliche leichtgewichtige Sturmgewehr der US Army mit kurzem Lauf. Er war um die zwanzig, einer dieser jungen Männer voll überbordender munterer Freundlichkeit. Tamara, die fast dreißig war, erschien er absurd jung, um ihm eine tödliche Waffe anzuvertrauen. Aber an Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht – einmal hatte er sich sogar erkühnt, sie um ein Rendezvous zu bitten. »Ich kann Sie gut leiden, Pete«, hatte sie entgegnet, »aber Sie sind viel zu jung für mich.«
Neben Tamara auf der Rückbank saß Tabdar Sadoul, genannt »Tab«, ein Attaché der EU-Mission in N’Djamena. Tab trug seine glänzenden mittelbraunen Haare modisch lang, aber davon abgesehen wirkte er in seiner Khakihose und dem himmelblauen Button-Down-Hemd mit hochgeklappten Manschetten, die seine gebräunten Handgelenke zeigten, wie ein Geschäftsmann im Urlaub.
Tamara gehörte der US-Botschaft in N’Djamena an und trug ihre übliche Arbeitskleidung, ein langärmeliges Kleid über einer Hose und ein Kopftuch, das ihre dunklen Haare bedeckte. Es war eine praktische Kleidung, die niemanden kränkte, und mit ihren braunen Augen und der olivfarbenen Haut sah sie nicht einmal wie eine Ausländerin aus. In einem Land mit hoher Verbrechensrate wie dem Tschad war man sicherer, wenn man nicht auffiel, und das galt ganz besonders für eine Frau.
Sie behielt den Kilometerzähler im Auge. Seit zwei Stunden waren sie unterwegs und näherten sich nun ihrem Ziel. Tamara sah dem bevorstehenden Treffen mit Anspannung entgegen. Eine Menge hing davon ab, ihre eigene Karriere eingeschlossen.
»Unsere Legende ist ein Forschungsauftrag«, erinnerte sie. »Wissen Sie genug über den See?«
»Es reicht, denke ich«, antwortete Tab. »Der Schari entspringt in Zentralafrika, fließt vierzehnhundert Kilometer weit und mündet hier in den Tschadsee. Das Gewässer wiederum versorgt mehrere Millionen Menschen in vier Staaten mit Trinkwasser: Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad. Es sind Kleinbauern, Viehzüchter und Fischer. Der begehrteste Fisch ist der Viktoriabarsch, der bis zu zwei Meter lang und zweihundert Kilogramm schwer werden kann.«
Franzosen, die Englisch sprechen, klingen immer, als wollten sie einen ins Bett kriegen, dachte Tamara. Bei ihm könnte ich es mir sogar vorstellen. Sie sagte: »Ich schätze, sie fangen nicht mehr viele Barsche, seit das Wasser so niedrig steht.«
»Da haben Sie recht. Der See bedeckte einmal fünfundzwanzigtausend Quadratkilometer, aber jetzt sind es nur noch dreizehnhundert. Sehr viele der abhängigen Menschen hier stehen am Rand des Hungertods.«
»Was halten Sie von dem chinesischen Plan?«
»Ein Kanal von zweieinhalbtausend Kilometern Länge, der Wasser vom Kongo hierherschafft? Der Präsident des Tschad ist heiß darauf, was nicht überrascht. Vielleicht funktioniert es sogar – die Chinesen bringen erstaunliche Dinge zustande –, aber es wird nicht billig, und es wird seine Zeit dauern.«
Chinas Investitionen in Afrika wurden von Tamaras Vorgesetzten in Washington und Tabs Vorgesetzten in Paris mit der gleichen Mischung aus staunender Bewunderung und tiefem Argwohn betrachtet. Beijing gab Milliarden aus und brachte einiges zustande, aber was waren die wahren Absichten der chinesischen Führung?
Aus dem Augenwinkel sah Tamara etwas aufblitzen, weit entfernt, fast wie Sonnenlicht auf Wasser. »Ist das da schon der See?«, fragte sie Tab. »Oder nur eine Luftspiegelung?«
»Wir müssen dicht dran sein«, sagte er.
»Halten Sie nach einer Abfahrt nach links Ausschau«, sagte sie zu Ali und wiederholte es auf Arabisch. Sowohl Tamara als auch Tab sprachen Arabisch und Französisch fließend, die beiden Hauptsprachen im Tschad.
»La voilà«, antwortete Ali auf Französisch: Da ist sie.
Der Wagen verlangsamte, während er sich einer Ausfahrt näherte, die nur durch einen Steinhaufen markiert war.
Sie bogen von der Straße auf einen Weg ab, der über kiesigen Sand führte. Stellenweise war es schwierig, den Weg von der umgebenden Wüste zu unterscheiden, aber Ali schien zu wissen, was er tat. In der Entfernung sah Tamara in der flimmernden Hitze immer wieder kurz verschwommene grüne Flecke, vermutlich Büsche und Bäume, die am Wasserrand wuchsen.
Abseits der Straße tauchte das Skelett eines lange toten Peugeot-Pick-ups auf, eine verrostete Karosserie ohne Räder oder Fensterscheiben, und bald zeigten sich weitere Anzeichen menschlicher Besiedlung: ein Kamel, an einem Busch festgebunden, ein Mischlingshund mit einer Ratte im Maul, verstreute leere Bierdosen, nackte Felgen und zerfetzte Plastikfolie.
Sie fuhren an einem Gemüsefeld vorbei, auf dem ein Mann die ordentlichen, geraden Pflanzenreihen mit einer Gießkanne bewässerte, dann kamen sie in ein Dorf aus fünfzig oder sechzig verstreuten Gebäuden ohne irgendwelche sichtbaren Straßen. Die meisten Behausungen waren traditionelle Einraumhütten mit runden Lehmziegelwänden und spitzen hohen Dächern aus Palmwedeln. Ali fuhr Schritttempo und schlängelte den Wagen zwischen den Häusern hindurch, wich barfüßigen Kindern, gehörnten Ziegen und Kochfeuern unter freiem Himmel aus.
Schließlich hielt er an. »Nous sommes arrivés«, verkündete er: Wir sind da.
Tamara fragte: »Pete, würden Sie bitte das Gewehr in den Fußraum legen? Wir wollen wie Wissenschaftler aussehen.«
»Klar, Miss Levit.« Er schob es zwischen seine Füße und versenkte den Gewehrkolben unter den Sitz.
»Das war einmal ein wohlhabendes Fischerdorf«, sagte Tab, »aber schauen Sie, wie weit das Wasser jetzt weg ist – anderthalb bis zwei Kilometer.«
Die Siedlung war herzzerreißend arm, der ärmste Ort, den Tamara je gesehen hatte. Er grenzte an einen lang gezogenen flachen Strand, der früher vermutlich unter Wasser gestanden hatte. Windmühlen, die einmal das Wasser zu den Feldern gepumpt hatten, standen jetzt halb verfallen weit vom Seeufer entfernt; ihre Flügel drehten sich sinnlos. Eine Herde magerer Schafe graste an einem Busch, bewacht von einem kleinen Mädchen mit einem Stock in der Hand. Tamara sah den See in der Ferne glitzern. Papyrusstauden und Akazien säumten das Ufer. Kleine Inselchen sprenkelten den See. Tamara wusste, dass die größeren Inseln den Dschihadistenbanden, von denen die Einheimischen terrorisiert wurden, als Versteck dienten. Sie raubten das wenige, was die Leute besaßen, und schlugen jeden zusammen, der versuchte, sie aufzuhalten. Menschen, die ohnehin schon verarmt waren, wurden von ihnen völlig in Not und Elend gestürzt.
»Wissen Sie, was diese Leute im See treiben?«, fragte Tab.
Im seichten Wasser stand ein halbes Dutzend Frauen und hantierte mit Schalen. Tamara konnte seine Frage beantworten. »Sie schöpfen essbare Algen von der Oberfläche ab. Bei uns heißen sie Spirulina; das arabische Wort ist dihé. Sie filtern sie heraus, dann werden sie in der Sonne getrocknet.«
»Haben Sie das jemals probiert?«
Sie nickte. »Es schmeckt scheußlich, aber offenbar ist es nahrhaft. Man kann es in Reformhäusern kaufen.«
»Nie davon gehört. Klingt nicht nach etwas, das einen französischen Gaumen erfreuen würde.«
»Sie müssen es ja wissen.« Tamara öffnete die Autotür und stieg aus. Kaum hatte sie den klimatisierten Wagen verlassen, als die Luft sie traf wie sengende Glut. Sie zog sich das Kopftuch in die Stirn, um ihr Gesicht zu schützen. Danach nahm sie ein Handyfoto des Strandes auf.
Tab verließ das Fahrzeug, setzte sich einen Strohhut mit breiter Krempe auf und trat neben Tamara. Der Strohhut stand ihm nicht – er sah sogar ein wenig albern aus –, aber das schien ihn nicht weiter zu bekümmern. Er war gut gekleidet, aber nicht eitel. Das gefiel ihr.
Beide musterten sie das Dorf. Zwischen den Häusern lagen bestellte Felder, die von Bewässerungsgräben durchzogen wurden. Das Wasser musste von weit her herangeschafft werden, und Tamara war sich mit bedrückender Überzeugung sicher, dass dies die Aufgabe der Frauen war. Ein Mann in einer Dschallabija schien Zigaretten zu verkaufen, schwatzte freundlich mit den Männern, flirtete ein wenig mit den Frauen. Tamara erkannte die weiße Schachtel mit dem goldenen Sphinxkopf: eine ägyptische Marke namens Cleopatra, die beliebteste Zigarette in Afrika. Die Zigaretten waren vermutlich Schmuggelware oder Diebesgut. Vor den Hütten waren etliche Motorräder und Motorroller geparkt, dazu ein sehr alter VW Käfer. In diesem Land war das Motorrad das beliebteste individuelle Transportmittel. Tamara nahm mehrere Fotos auf.
Der Schweiß rann ihr unter den Kleidern am Leib herunter. Mit dem Ende ihres Baumwollkopftuchs wischte sie sich die Stirn. Tab zog ein rotes Taschentuch mit weißen Punkten hervor und tupfte sich den Hals unter dem Hemdkragen ab.
»Die Hälfte der Hütten ist unbewohnt«, sagte er.
Tamara sah genauer hin und erkannte, dass einige Bauwerke im Verfall begriffen waren. In den Palmwedeldächern klafften Löcher, und einige Lehmziegel bröckelten.
»Die Menschen haben das Gebiet in Scharen verlassen«, sagte Tab. »Ich schätze, jeder, der irgendwo anders hinkonnte, ist fort. Aber Millionen sind noch hier. Die ganze Gegend ist ein Katastrophengebiet.«
»Und nicht nur hier, richtig?«, fragte Tamara. »Was hier vorgeht, diese Wüstenbildung am Südrand der Sahara, geschieht in ganz Afrika, vom Roten Meer bis zum Atlantik.«
»Auf Französisch nennen wir die Region Le Sahel.«
»Im Englischen ist es das gleiche Wort. Der Sahel.« Sie warf einen Blick zurück zum Auto. Der Motor lief noch. »Ali und Pete bleiben wohl sitzen.« Drinnen war es kühl, dank Klimaanlage.
»Wenn sie einen Funken Verstand besitzen.« Tab machte eine besorgte Miene. »Ich sehe nirgends unseren Mann.«
Auch Tamara sorgte sich. Er konnte tot sein. Sie antwortete jedoch gelassen: »Unsere Anweisungen lauten, uns von ihm finden zu lassen. Inzwischen müssen wir in der Rolle bleiben, also sehen wir, dass wir abtauchen.«
»Was?«
»Gehen wir los und schauen uns um.«
»Aber was sagten Sie gerade? Abtauchen?«
»Tut mir leid. Ist wohl Slang. So redet man bei uns.«
Er grinste. »Ich könnte der einzige Franzose sein, der diesen Ausdruck kennt.« Tab wurde wieder ernst. »Aber bevor wir gehen, sollten wir den Dorfältesten unsere Aufwartung machen.«
»Warum machen Sie das nicht allein? Von einer Frau würde man sowieso niemals Notiz nehmen.«
»Klar.«
Tab ging davon, und Tamara schlenderte umher. Sie versuchte, sich unbeeindruckt zu geben, fotografierte und unterhielt sich auf Arabisch mit den Menschen. Die meisten Dorfbewohner bewirtschafteten entweder einen kleinen Streifen karges Land oder hatten ein paar Schafe oder eine Kuh. Eine Frau hatte sich auf das Flicken von Netzen spezialisiert, aber es gab nur noch wenige Fischer; ein Mann besaß einen Brennofen und stellte Töpfe her, aber nicht viele Menschen hatten Geld, um sie zu kaufen. Jeder war mehr oder weniger verzweifelt.
Ein baufälliges Gerüst aus vier Pfosten, auf dem ein Geflecht aus Zweigen ruhte, diente als Wäschetrockner, und eine junge Frau hängte Wäsche auf und hielt dabei einen Jungen von etwa zwei Jahren im Auge. Ihre Kleidung war in den lebhaften Gelb- und Orangetönen gehalten, die die Tschaderinnen so sehr liebten. Sie hängte das letzte Stück auf, nahm das Kind auf die Hüfte, sprach Tamara in sorgfältigem Schulmädchenfranzösisch mit kräftigem arabischen Akzent an und lud sie zu sich ins Haus ein.
Die Frau hieß Kiah, ihr Sohn Naji, und sie sei Witwe, sagte sie. Sie sah aus, als wäre sie um die zwanzig. Kiah war außerordentlich schön mit ihren schwarzen Brauen, kräftigen Jochbeinen und einer großen gebogenen Nase, und der Ausdruck ihrer dunklen Augen deutete auf Kraft und Entschlossenheit hin. Tamara konnte sich vorstellen, dass sie ein interessanter Mensch war.
Sie folgte Kiah durch die niedrige Tür mit dem Rundbogen. Kaum gelangte sie aus der knallenden Sonne in den tiefen Schatten, nahm sie die Sonnenbrille ab. In der Hütte war es düster, eng und wohlriechend. Tamara spürte einen dicken Teppich unter ihren Füßen und roch Zimt und Kurkuma. Als ihre Augen sich angepasst hatten, sah sie niedrige Tische, ein paar Körbe zum Verstauen und Kissen auf dem Boden, aber keine Stühle, Schränke oder anderes Mobiliar. Auf einer Seite lagen zwei strohgefüllte Pritschen als Betten und ein ordentlicher Stapel von dicken Wolldecken mit leuchtend roten und blauen Streifen zum Schutz gegen die kalten Wüstennächte.
Die meisten Amerikaner hätten es als entsetzlich armseliges Zuhause betrachtet, aber Tamara konnte sehen, dass es nicht nur behaglich war, sondern auch ein bisschen wohlhabender als der Durchschnitt. Kiah wirkte stolz, als sie Tamara eine Flasche Gala anbot, ein einheimisches Bier, das sie in einer Schüssel mit Wasser kühl hielt. Tamara hielt es für höflich, die Gastfreundschaft anzunehmen – und außerdem war sie durstig.
Ein Bild der Jungfrau Maria in einem billigen Rahmen an der Wand deutete darauf hin, dass Kiah wie rund vierzig Prozent der tschadischen Bevölkerung dem christlichen Glauben angehörte. »Sie haben eine Nonnenschule besucht, nehme ich an«, sagte Tamara. »So haben Sie Französisch gelernt.«
»Ja.«
»Sie sprechen es wirklich gut.« Das stimmte nicht ganz, aber Tamara wollte freundlich sein.
Kiah bot ihr Platz auf dem Teppich an. Ehe Tamara sich setzte, ging sie zum Eingang zurück und spähte nervös hinaus. In der plötzlichen Helligkeit musste sie die Augen zusammenkneifen. Sie sah zum Wagen hinüber. Der Zigarettenverkäufer beugte sich mit einer Stange Cleopatras in der Hand zum Fenster auf der Fahrerseite hinunter. Hinter der Scheibe sah sie Ali, das Tuch um den Kopf gewickelt, wie er den Mann mit einer verächtlichen Handbewegung abwies. Offenbar war er nicht am Kauf billiger Zigaretten interessiert. Der Verkäufer sagte etwas, und Alis Verhalten änderte sich dramatisch. Der Fahrer sprang aus dem Wagen, sah den Händler zerknirscht an und öffnete die Tür des Fonds. Der Verkäufer stieg in den Wagen, und Ali schloss rasch die Tür.
Das ist er also, dachte Tamara. Na, seine Verkleidung ist jedenfalls gut. Mich hat sie getäuscht.
Sie empfand Erleichterung. Wenigstens war er noch am Leben.
Sie sah sich um. Niemand im Dorf hatte darauf geachtet, dass der Zigarettenverkäufer ins Auto gestiegen war. Er war nun außer Sicht, hinter den getönten Scheiben verborgen.
Tamara nickte zufrieden und wandte sich zurück ins Haus.
Ihre Gastgeberin fragte: »Ist es wahr, dass alle weißen Frauen sieben Kleider haben und ein Dienstmädchen, das ihnen jeden Tag eines wäscht?«
Tamara entschied sich, auf Arabisch zu antworten, denn Kiahs Französisch reichte vielleicht nicht aus. Nach kurzem Nachdenken sagte sie: »Viele Amerikanerinnen und Europäerinnen haben viele Kleidungsstücke. Wie viele genau, hängt davon ab, ob die Frau reich ist oder arm. Sieben Kleider wären nicht ungewöhnlich. Eine arme Frau hat nur zwei oder drei. Eine reiche Frau könnte fünfzig haben.«
»Und alle haben sie Dienstmädchen?«
»Arme Familien haben keine Dienstmädchen. Eine Frau mit einer gut bezahlten Arbeit, zum Beispiel als Ärztin oder Anwältin, hat normalerweise jemanden, der ihr das Haus sauber hält. Reiche Familien haben viele Dienstboten. Warum wollen Sie das alles wissen?«
»Ich denke darüber nach, nach Frankreich zu gehen.«
Das hatte Tamara schon vermutet. »Erzählen Sie mir, wieso.«
Kiah hielt inne und ordnete ihre Gedanken. Schweigend reichte sie Tamara eine weitere Flasche Bier. Tamara schüttelte den Kopf. Sie musste einen klaren Kopf behalten.
»Salim, mein Mann, war Fischer mit eigenem Boot. Er fuhr mit drei oder vier anderen Männern hinaus, und sie teilten sich den Fang, aber Salim bekam die Hälfte, denn das Boot gehörte ihm, und er wusste, wo die Fische zu finden waren. Deshalb ging es uns besser als den meisten unserer Nachbarn.« Stolz hob sie den Kopf.
»Was ist passiert?«, fragte Tamara.
»Eines Tages kamen die Mudschahedin und wollten Salims Fang. Er hätte ihn ihnen lassen sollen. Aber er hatte einen Viktoriabarsch gefangen und wollte ihn sich nicht abnehmen lassen. Deshalb töteten sie ihn und nahmen sich den Fisch trotzdem.« Kiahs Haltung war dahin, sie kämpfte mit den Tränen. Sie schwieg einen Moment und fasste sich dann wieder. »Seine Freunde brachten mir seine Leiche.«
Tamara war erschüttert, aber nicht überrascht.
Der Westen bezeichnete sie als Dschihadisten, sie selbst nannten sich Mudschahedin, was ›Kämpfer‹ hieß, aber wie immer ihr Name lautete, sie bildeten islamistische Terrorgruppen, aber auch ganz gewöhnliche Verbrecherbanden. Beides ging Hand in Hand. Ihre Opfer gehörten zu den ärmsten Menschen der Welt. Das machte sie rasend.
»Nachdem ich meinen Mann begraben hatte«, fuhr Kiah fort, »fragte ich mich, was ich nun anfangen sollte. Ich kann kein Boot lenken, ich kann nicht sagen, wo die Fische sind, und selbst wenn ich beides könnte, würde sich kein Mann mir unterordnen. Deshalb habe ich das Boot verkauft.« Ihr Gesicht wurde grimmig. »Einige haben versucht, es für weniger zu bekommen, als es wert ist, aber ich habe mich nicht darauf eingelassen.«
Tamara merkte, dass im Zentrum von Kiahs Wesen ein Kern stählerner Entschlossenheit steckte.
In Kiahs Stimme lag jedoch ein Hauch von Verzweiflung, als sie fortfuhr: »Aber das Geld für das Boot reicht nicht ewig.«
Tamara wusste, wie wichtig die Familie in diesem Land war. »Was ist mit Ihren Eltern?«
»Meine Eltern sind tot. Meine Brüder sind in den Sudan gegangen – sie arbeiten dort auf einer Kaffeeplantage. Salim hatte eine Schwester, und ihr Mann sagte, wenn ich ihm mein Boot billig überlasse, würde er sich immer um mich und um Naji kümmern.« Sie zuckte mit den Schultern.
»Sie haben ihm nicht vertraut«, sagte Tamara.
»Ich wollte ihm nicht mein Boot gegen ein Versprechen überlassen.«
Entschlossen und nicht dumm, dachte Tamara.
Kiah fügte hinzu: »Jetzt hasst mich meine angeheiratete Verwandtschaft.«
»Also wollen Sie nach Europa – illegal.«
»Viele tun es, ständig«, sagte Kiah.
Das stimmte. Während die Wüste sich nach Süden ausbreitete, hatten Hunderttausende verzweifelte Menschen auf der Suche nach Arbeit die Sahelzone verlassen, und viele waren auf der gefährlichen Reise nach Südeuropa gestorben.
»Es ist teuer«, fuhr sie fort, »aber das Geld für das Boot reicht dafür.«
Das Geld war nicht das eigentliche Problem. Tamara hörte Kiah an, dass sie Angst hatte.
»Gewöhnlich gehen sie nach Italien. Ich spreche kein Italienisch, aber ich habe gehört, dass man von Italien leicht nach Frankreich kommt. Ist das wahr?«
»Ja.« Tamara hatte es nun eilig, zum Auto zurückzukehren, aber sie fand, dass sie Kiah eine Antwort auf ihre Fragen schuldete. »Man fährt einfach über die Grenze. Oder setzt sich in einen Zug. Aber was Sie planen, ist furchtbar gefährlich. Die Schleuser sind Verbrecher. Vielleicht nehmen sie nur Ihr Geld und verschwinden.«
Kiah schwieg und dachte nach, suchte vielleicht eine Möglichkeit, ihrer privilegierten westlichen Besucherin ihr Leben zu erklären. Nach einer Weile sagte sie: »Ich weiß, was geschieht, wenn es nicht genug zu essen gibt. Ich habe es gesehen.« Sie sah weg, als sie sich erinnerte, und ihre Stimme wurde leiser. »Das Baby wird dünner, aber zuerst scheint das nicht so schlimm zu sein. Dann wird es krank. Eine Kinderkrankheit, wie sie viele Kinder bekommen, mit Ausschlag oder einer laufenden Nase oder Durchfall, aber das hungrige Kind braucht lange, um sich zu erholen, und dann steckt es sich mit etwas anderem an. Die ganze Zeit ist es müde und quengelt viel und spielt wenig, es liegt nur ruhig da und hustet. Und eines Tages schließt es die Augen und öffnet sie nicht mehr. Manchmal ist die Mutter zu müde, um zu weinen.«
Tamara sah sie durch einen Tränenschleier an. »Es tut mir so leid«, sagte sie. »Ich wünsche Ihnen Glück.«
Kiah wurde wieder forsch. »Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie meine Fragen beantworten.«
Tamara erhob sich. »Ich muss gehen«, sagte sie unbeholfen. »Danke für das Bier. Und bitte versuchen Sie, mehr über Ihre Schleuser herauszufinden, ehe Sie ihnen Ihr Geld geben.«
Kiah lächelte und nickte, die höfliche Reaktion auf eine Plattitüde. Sie weiß besser, wie vorsichtig man mit seinem Geld sein muss, als ich es je wissen werde, dachte Tamara verlegen.
Tamara ging nach draußen und entdeckte Tab, der ebenfalls auf dem Weg zurück zum Wagen war. Es war kurz vor Mittag, und kein Dorfbewohner war mehr zu sehen. Die Leute hatten sich aus der Sonne nach drinnen verzogen, das Vieh in den Schatten unter notdürftigen Schutzdächern, die zu diesem Zweck errichtet worden waren.
Als sie sich Tab anschloss, bemerkte sie den leisen Geruch von Schweiß auf sauberer Haut und einen Hauch von Sandelholz. »Er ist im Wagen«, sagte sie.
»Wo hat er sich versteckt?«
»Er war der Zigarettenhändler.«
»Das hätte ich nicht gedacht.«
Sie erreichten den Wagen und stiegen ein. Die klimatisierte Luft fühlte sich an wie ein Eisbad. Tamara und Tab setzten sich links und rechts neben den Zigarettenhändler, der roch, als hätte er schon viele Tage nicht mehr geduscht. Er hielt einen Karton mit Zigarettenschachteln in der Hand.
Tamara konnte nicht an sich halten. »Also«, fragte sie, »haben Sie Hufra gefunden?«
***
Der Zigarettenhändler hieß Abdul John Haddad, und er war fünfundzwanzig Jahre alt. Er war im Libanon geboren und in New Jersey aufgewachsen, war amerikanischer Staatsbürger und Mitarbeiter der Central Intelligence Agency.
Vier Tage zuvor hatte er im Nachbarland Niger einen ramponierten, aber mechanisch soliden Ford-Geländewagen in der Wüste nördlich der Stadt Maradi einen lang gezogenen Hügel hinaufgelenkt.
Er trug Stiefel mit dicken Sohlen. Sie waren neu, aber man hatte sie so behandelt, dass sie alt wirkten. Die Oberteile waren künstlich abgewetzt und zerkratzt, die Schnürsenkel passten nicht zueinander, das Leder war fleckig gemacht worden, damit es abgenutzt aussah. Die dicken Sohlen hatten beide ein Geheimfach. Das eine war für ein modernes Mobiltelefon, das andere für einen Empfänger vorgesehen, der nur auf ein spezielles Signal ansprach. In seiner Hosentasche trug Abdul ein billiges Handy zur Ablenkung.
Der Empfänger aus dem zweiten Geheimfach lag nun neben ihm auf dem Sitz, und er schaute alle paar Minuten darauf. Die Anzeige bestätigte, dass die Kokainlieferung, die er verfolgte, irgendwo vor ihm zum Stehen gekommen war. Vielleicht hatten die Drogenschmuggler nur an einer Oase Halt gemacht, wo es eine Tankstelle gab. Abdul hoffte jedoch, dass es sich um ein Lager handelte, das dem ISGS gehörte, dem Islamischen Staat in der Großsahara.
Die CIA interessierte sich mehr für Terroristen als für Rauschgiftschmuggler, aber in diesem Teil der Welt waren beide identisch. Eine Reihe lokaler Gruppen, locker mit dem ISGS verbunden, finanzierte ihre politischen Aktivitäten mit den lukrativen verwandten Geschäftsfeldern des Rauschgift- und des Menschenschmuggels. Abduls Aufgabe bestand darin, die Route herauszufinden, die die Drogen nahmen, in der Hoffnung, dass sie ihn zu ISGS-Verstecken führten.
Der Mann, den man für den Kopf des ISGS hielt – und einen der übelsten Massenmörder der modernen Welt –, war unter dem Namen al-Farabi bekannt. Dabei handelte es sich beinahe mit Sicherheit um einen Decknamen: Al-Farabi war der Name eines mittelalterlichen Philosophen. Man nannte den ISGS-Führer auch den »Afghanen«, weil er ein Veteran des Afghanistankriegs war. Wenn man den Berichten glauben konnte, reichte sein Arm weit: Während er in Afghanistan stationiert war, hatte er Pakistan durchreist und die aufständische chinesische Provinz Xinjiang besucht, wo er Kontakt mit der Islamischen Partei Ostturkestans aufgenommen hatte, eine Terrorgruppe, die für die Autonomie der einheimischen Uiguren eintrat, bei denen es sich zum überwiegenden Teil um Muslime handelte.
Al-Farabi befand sich nun irgendwo in Nordafrika, und wenn Abdul ihn finden könnte, würde es dem ISGS einen Schlag versetzen, der sich durchaus als tödlich erweisen könnte.
Abdul hatte über unscharfen Teleobjektivaufnahmen gebrütet, Bleistiftskizzen von Phantombildzeichnern, PhotoFit-Panoramen und schriftlichen Personenbeschreibungen. Er war sich sicher, dass er al-Farabi erkennen würde, wenn er ihn sah: ein großer grauhaariger Mann mit schwarzem Bart, von dem oft gesagt wurde, er habe einen stechenden Blick und ihn umgebe eine Aura der Autorität. Falls Abdul dicht genug an ihn herankam, konnte er al-Farabi vielleicht sogar anhand eines unveränderlichen Merkmals identifizieren: Eine amerikanische Kugel hatte ihm den halben Daumen der linken Hand abgetrennt und einen Stumpf hinterlassen, den er oft stolz zur Schau stellte; dabei sagte er, Allah habe ihn vor dem Tod bewahrt, gleichzeitig aber ermahnt, vorsichtiger zu sein.
Ganz gleich, was geschah, Abdul sollte auf keinen Fall versuchen, al-Farabi festzunehmen, sondern nur feststellen, wo er sich aufhielt, und Meldung machen. Wie es hieß, hatte der Terroristenführer ein Versteck namens Hufra, was so viel wie »Loch« bedeutete, doch wo es sich befand, war niemandem in der gesamten Gemeinde der westlichen Nachrichtendienste bekannt.
Abdul erreichte die Kuppe der Erhebung und hielt auf der anderen Seite den Wagen an.
Vor ihm senkte sich das Gelände zu einer weiten Ebene ab, die in der Hitze flimmerte. Geblendet kniff er die Augen zusammen: Er trug keine Sonnenbrille, denn die Einheimischen betrachteten sie als äußeres Anzeichen für Reichtum, und er musste aussehen wie einer von ihnen. Vor ihm, einige Meilen entfernt, glaubte er ein Dorf zu erkennen. Er drehte sich auf dem Sitz, öffnete eine Klappe in der Verkleidung der Wagentür, nahm ein Fernglas heraus und stieg aus dem Fahrzeug.
Das Fernglas rückte die undeutlichen Umrisse in ein scharfes Licht, und was Abdul sah, ließ sein Herz schneller schlagen.
Die Siedlung bestand aus Zelten und notdürftigen Holzhütten. Er sah etliche Fahrzeuge, die meisten in wackligen Unterständen, die sie vor Satellitenbeobachtung abschirmten. Andere Wagen waren von Planen mit Wüstentarnmustern verhüllt, und den Umrissen nach, die sich darunter abzeichneten, konnte es sich um auf Lastwagen montierte Artilleriegeschütze handeln. Einige Palmen deuteten auf eine Wasserquelle in der Nähe hin.
Es gab keinen Zweifel. Das hier war ein paramilitärischer Stützpunkt.
Und ein wichtiger, das spürte er. Er vermutete, dass er mehrere Hundert Mann Besatzung hatte, und wenn er sich in Bezug auf die Geschütze nicht irrte, waren diese Männer ausgesprochen gut bewaffnet.
Bei dem Stützpunkt konnte es sich sogar um das legendäre Hufra handeln.
Er hob den rechten Fuß, um das Handy aus dem Stiefel zu nehmen, damit er ein Foto schießen konnte, aber bevor er dazu kam, hörte er hinter sich, noch fern, aber rasch näher kommend, den Motor eines Pick-ups.
Seitdem er von der befestigten Straße abgefahren war, hatte er keinen anderen Verkehr gesehen. Dies war mit ziemlicher Sicherheit ein Fahrzeug des ISGS, das zum Lager unterwegs war.
Er blickte sich um. Hier gab es nichts, wo er sich oder gar sein Auto verstecken konnte. Drei Wochen lang war er das ständige Risiko eingegangen, von den Leuten entdeckt zu werden, die er ausspähte, und jetzt war es so weit.
Er hatte seine Geschichte vorbereitet. Er konnte nichts weiter tun, als sie zu erzählen und auf das Beste zu hoffen.
Abdul warf einen Blick auf seine billige Uhr. Zwei Uhr mittags. Er sagte sich, dass die Mudschahedin einen Mann, den sie beim Gebet antrafen, vielleicht nicht kurzerhand erschossen.
Rasch bewegte er sich. Er legte das Fernglas in das Versteck hinter der Türverkleidung, öffnete den Kofferraum und nahm einen alten, abgenutzten Gebetsteppich heraus, knallte den Deckel zu und breitete den Teppich auf dem Boden aus. Er war christlich erzogen worden, aber mit muslimischen Gebräuchen kannte er sich genügend aus, um ein Gebet vorzutäuschen.
Das zweite Gebet des Tages hieß Zuhr und wurde ausgeführt, wenn die Sonne den Zenit überschritten hatte, was den Zeitraum zwischen Mittag und der Mitte des Nachmittags umfasste. Er kniete in der korrekten Haltung nieder und berührte den Teppich mit Nase, Händen, Knien und Zehen. Er schloss die Augen.
Der Pick-up kam näher, ächzte die Steigung auf der anderen Seite der Kuppe hoch.
Plötzlich fiel Abdul das Handy ein. Es lag noch auf dem Beifahrersitz. Er fluchte: Es würde ihn augenblicklich verraten.
Er sprang auf, riss die Beifahrertür auf und ergriff das Gerät. Mit zwei Fingern öffnete er die Verriegelung des verborgenen Schubfachs in seiner linken Schuhsohle. In seiner Eile fiel ihm das Gerät in den Sand. Er hob es auf und schob es in den Schuh, schloss das Fach und eilte zurück zum Teppich.
Erneut kniete er nieder.
Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie der Pick-up über die Kuppe kam und abrupt neben seinem Wagen hielt. Er kniff die Lider zu.
Die Gebete kannte er nicht auswendig, aber er hatte sie so oft gehört, um etwas murmeln zu könnte, das sich ähnlich genug anhörte.
Die Türen des Trucks öffneten sich und wurden geschlossen, dann näherten sich schwere Schritte.
»Steh auf«, sagte jemand auf Arabisch.
Abdul öffnete die Augen. Sie waren zu zweit. Der eine Mann hielt ein Gewehr, der andere hatte eine Pistole im Holster. Hinter ihnen stand ein Pick-up-Truck, dessen Pritsche mit Säcken beladen war – vermutlich voller Mehl, ohne Zweifel für die Mudschahedin bestimmt.
Der Mann mit dem Gewehr war jünger, das ging aus seinem flaumigen Bart hervor. Er trug Tarnhosen und einen blauen Anorak, der besser zu einem regnerischen Tag in New York gepasst hätte. Schroff fragte er: »Wer bist du?«
Abdul schlüpfte eilends in die Rolle des plump-vertraulichen fahrenden Händlers. Mit strahlendem Lächeln fragte er: »Meine Freunde, wieso stört ihr einen Mann beim Gebet?« Er beherrschte fließend umgangssprachliches Arabisch mit einem libanesischen Akzent: Bis zu seinem sechsten Lebensjahr hatte er in Beirut gelebt, und seine Eltern hatten zu Hause weiterhin Arabisch gesprochen, nachdem sie in die USA umgesiedelt waren.
Der Mann mit der Pistole hatte graumeliertes Haar und antwortete in gemessenem Ton: »Wir bitten Allah um Vergebung, dass wir deine Andacht unterbrechen. Aber was machst du hier auf dieser Wüstenpiste? Wohin willst du?«
»Ich verkaufe Zigaretten«, sagte Abdul. »Möchtet ihr welche? Ich mache euch einen guten Preis.« In den meisten afrikanischen Ländern kostete eine Schachtel Cleopatras den Gegenwert von einem Dollar in örtlicher Währung; Abdul verkaufte sie für die Hälfte.
Der jüngere Mann riss den Kofferraum von Abduls Wagen auf. Er war voller Cleopatra-Kartons. »Wo hast du die her?«, fragte er.
»Von einem sudanesischen Hauptmann namens Bilel.« Die Behauptung war plausibel: Jeder wusste, dass die Offiziere des sudanesischen Militärs korrupt waren.
Schweigen setzte ein. Der ältere Mudschahed zog ein nachdenkliches Gesicht. Der jüngere sah aus, als könnte er es kaum erwarten, sein Gewehr zu benutzen, und Abdul fragte sich, ob er schon einmal auf einen Menschen geschossen hatte. Der ältere Mann war weniger angespannt. Er wäre auch weniger schießwütig, aber er würde besser zielen.
Abdul wusste, dass sein Leben auf dem Spiel stand. Die beiden würden ihm entweder glauben oder versuchen, ihn zu töten. Kam es zum Kampf, würde er den Alten zuerst angreifen. Der jüngere würde feuern, aber vermutlich danebenschießen. Andererseits, auf die Entfernung konnte er vielleicht sogar treffen.
»Aber warum bist du hier?«, fragte der ältere Mann. »Was meinst du, wohin du hier kommst?«
»Dort vorn ist doch ein Dorf, oder nicht?«, fragte Abdul. »Ich konnte es nicht sehen, aber ein Mann in einem Café sagte mir, dass ich dort Kunden finden würde.«
»Ein Mann in einem Café?«
»Ich höre mich immer nach neuen Kunden um.«
Der ältere Mann sagte zum jüngeren: »Durchsuch ihn.«
Der jüngere Mann hängte sich das Gewehr um, was Abdul kurz beruhigte. Der ältere zog jedoch eine Neun-Millimeter-Pistole und richtete sie auf Abduls Kopf, während er vom jüngeren Mann abgeklopft wurde.
Der Jüngere fand Abduls billiges Handy und reichte es seinem Kameraden.
Der ältere Mann schaltete es ein und drückte geübt die Tasten. Abdul vermutete, dass er die Kontakte durchging und die Liste der letzten Anrufe. Was er fand, würde Abduls Legende bestätigen: billige Hotels, Autowerkstätten, Geldwechsler und ein paar Prostituierte.
Der ältere Mann befahl: »Durchsuch das Auto.«
Abdul stand dabei und sah zu. Der Mann begann mit dem offenen Kofferraum. Er zog Abduls kleine Reisetasche heraus und leerte ihren Inhalt auf die Piste. Viel war es nicht: ein Handtuch, ein Koran, ein paar billige Toilettenartikel, ein Handy-Ladegerät. Er warf alle Zigarettenkartons heraus und hob die Blende hoch, unter der das Ersatzrad und der Werkzeugsatz lagen. Ohne irgendetwas zurückzulegen, öffnete er die Hecktüren. Mit der Hand fuhr er durch den Schlitz zwischen Sitzfläche und Rückenlehne und bückte sich, um unter die Rückbank zu sehen.
Vorn sah er unter das Armaturenbrett, ins Handschuhfach und in die Türablagen. Er bemerkte die lockere Verkleidung in der Fahrertür und nahm sie ab. »Ein Fernglas«, sagte er triumphierend, und Abdul fröstelte vor Furcht. Ein Fernglas war nicht so verfänglich wie eine Schusswaffe, aber teuer war es, und wozu brauchte es ein fliegender Zigarettenhändler?
»Sehr nützlich in der Wüste.« Abdul empfand Verzweiflung. »Ihr habt wahrscheinlich auch eins.«
»Es sieht teuer aus.« Der Ältere musterte das Fernglas. »Made in Kunming«, las er. »Das ist aus China.«
»Genau«, sagte Abdul. »Ich habe es von dem sudanesischen Hauptmann, der mir die Zigaretten verkauft hat. Es war ein Spottpreis.«
Wieder war glaubhaft, was er sagte. Das sudanesische Militär kaufte viel aus China, dem größten Handelspartner des Landes. Viel Ausrüstung und Gerät landete auf dem Schwarzmarkt.
»Hast du es benutzt, als wir kamen?«, fragte der ältere Mann scharfsinnig.
»Das hatte ich vor, nach dem Gebet. Ich wollte wissen, wie groß das Dorf ist. Was meint ihr – fünfzig Leute? Hundert?« Er untertrieb mit Absicht, um den Eindruck zu vermitteln, dass er nicht hingesehen hatte.
»Ist egal«, sagte der Alte. »Du wirst nicht hinfahren.« Er starrte Abdul lange streng an; vermutlich überlegte er, ob er ihm glauben oder ihn erschießen sollte. Unvermittelt fragte er: »Wo ist deine Pistole?«