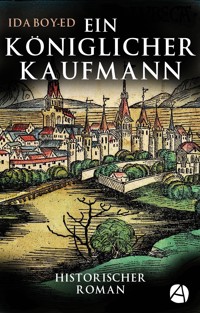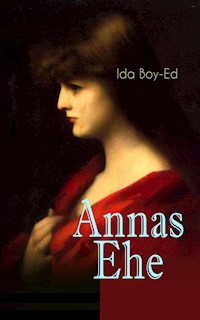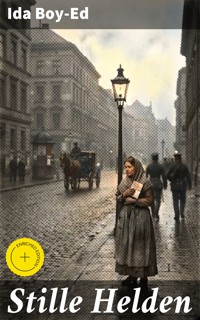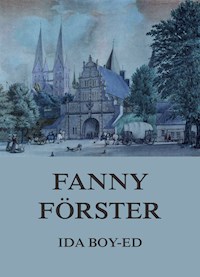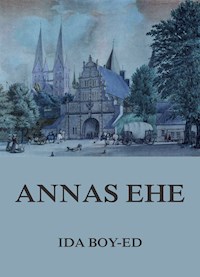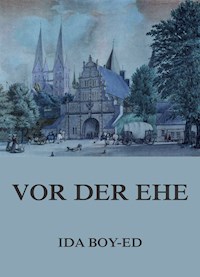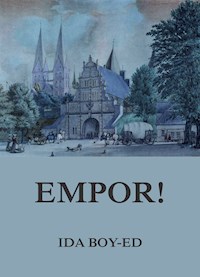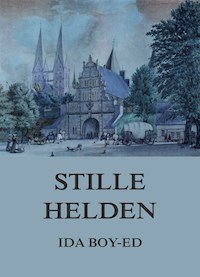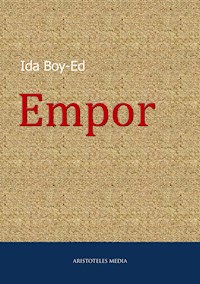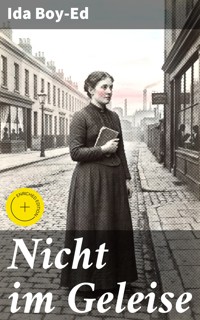
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Ida Boy-Ed's fesselndem Roman "Nicht im Geleise" entfaltet sich eine berührende Erzählung über die Komplexität menschlicher Beziehungen und die Auswirkung gesellschaftlicher Normen auf individuelle Schicksale. Der literarische Stil Boy-Ed's ist prägnant und anschaulich, wobei sie ihre Protagonisten mit großer Empathie und tiefem psychologischen Verständnis zeichnet. Der Roman ist in der Zeit der Jahrhundertwende angesiedelt und reflektiert die Herausforderungen einer sich rapide verändernden Gesellschaft, in der Altbewährtes und Moderne aufeinanderprallen und die Charaktere in ihre persönlichen Konflikte verstrickt werden. Ida Boy-Ed, eine Wegbereiterin ihrer Zeit, war nicht nur Schriftstellerin, sondern auch eine engagierte Homöopathin und Feministin. Ihre biografischen Erlebnisse in einer patriarchalischen Gesellschaft prägten ihre Erzählungen, in denen sie oft die Stimmen weiblicher Protagonisten stärkte und soziale Missstände thematisierte. Boy-Ed konnte durch ihre umfassenden Kenntnisse in der Psychologie und Sozialwissenschaften den Leser tief in die inneren Welten ihrer Figuren eintauchen lassen. "Nicht im Geleise" ist eine eindringliche Lektüre für jeden, der sich für das Zusammenspiel von individueller Identität und gesellschaftlichen Erwartungen interessiert. Boy-Ed mahnt ihre Leser, über die vorherrschenden Normen nachzudenken und die Kraft des Einzelnen zu erkennen, die zum Wandel fähig ist. Dieses Buch lädt dazu ein, über die eigene Rolle in der Gesellschaft nachzudenken und ist somit unverzichtbar für jeden Literaturinteressierten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nicht im Geleise
Inhaltsverzeichnis
Nicht im Geleise
Nicht im Geleise.
Die beiden Freunde, welche mit langsamen Schritten auf dem Bürgersteig einherwanderten, sahen oftmals ihren ruhigen Gang durch all die Hindernisse unterbrochen, welche Straßen- und Häuserauffrischungen im Sommer dem Verkehre der deutschen Residenz bieten. Hier qualmte ihnen eine Wolke von Mauerschutt entgegen; da baute sich ein Gerüst bis an die Grenzen des Fahrdammes vor; dort dampfte aus einem Asphaltkessel widriger Dunst und Arbeiter lagen auf der Erde, den schwarzen heißen Brei mit flachen Hölzern glatt auf den Boden zu streichen.
Dabei erfüllte ein unendliches Getöse die Luft, Gefährte aller Art mischten dumpf das Rollen ihrer Räder und hart klappten die trottenden Pferdehufe dazwischen.
Das Auge, welches den Himmel suchte, fand nur dessen blassen Glanz über dem steigenden Dunstgewölk, zwischen dem unentwirrbaren Hin und Her von Telephondrähten, welche droben von Dach zu Dach sich spannen. Eine fast unerträgliche Hitze[1q] beklemmte den Athem und machte im Verein mit dem Straßenlärm jedes Gespräch unmöglich.
Erst als die Freunde dem Potsdamer Platz[1] entronnen waren und sich in der Bellevuestraße[2] nebeneinander fanden, jetzt durch nichts behindert, zusammen Schritt zu halten, sagte Marbod Steinweber, das dunkle Haupt aufathmend erhoben:
„Nach dieser mehrstündigen Streiferei durch die Straßen wundere ich mich noch mehr, Dich in Berlin zu finden. Der Lärm und die Hitze sind einfach erdrückend. Ich gehorche dem Zwange, der mich am ersten August meine Stellung antreten heißt. Aber Du, unabhängig wie Du bist …“
„Ich bitte Dich,“ unterbrach der Freund ihn etwas ungeduldig, „mir nie von meiner Unabhängigkeit zu reden. Ich bin so unfrei wie möglich. Aber davon abgesehen. Du hast einen Tag mit schwülbrütender Gewitterluft getroffen, sonst ist es in Berlin gerade im Sommer reizend zu leben. Von all den Schrecknissen kannst Du Dich jetzt gut erholen. Wir finden im Zoologischen Garten einige nette oder einige unangenehme Menschen, jedenfalls Bekannte also, die ich Dir empfehlen, oder vor denen ich Dich warnen kann. Aber laß uns fahren, diese langsam vor uns schlendernden Hausväter und Hausmütter machen ja das Vorwärtskommen unmöglich.“
Dabei trug sein feines, schönes Gesicht einen Ausdruck äußerster Ermüdung. Er war blaß und sein blondes, weiches Haar umgab eine Stirn voll Adel und Gedanken. Die wohlgebildete Gestalt trug er lässig, aber mit einem gewissen vornehmen Bewußtsein.
Marbod Steinweber sah den Freund forschend und voll Sorge an. Der innige Ausdruck verklärte sein männlich kraftvolles Gesicht. Seit der Zeit, daß er und Alfred von Haumond einige Semester zusammen studiert hatten, liebte er ihn mit einem ihm selbst unerklärlichen, zärtlichen Mitleid.
Alfred fühlte den Blick des neben ihm Sitzenden. Er streckte ihm die Hand hin und nickte ihm dankbar zu.
„Mach Dir keine Gedanken meinetwegen. Du weißt, ich habe einmal nicht das Temperament zum Glücklichsein,“ sagte er lachend.
Es war noch immer das kindliche und liebenswürdige Lachen, das Marbod schon früher so an ihm geliebt; ein Lachen, mit welchem er die Sorgen, den Zorn und die Ungeduld zu entwaffnen pflegte; ein Lachen, welches sein von vielen und vorzeitigen Spuren seelischer Erregungen gezeichnetes Angesicht zu bestrickender Jugendschöne verklärte.
Marbod schüttelte den Kopf, mißbilligend, ärgerlich. Jedoch er sprach nichts weiter, er wußte, daß alle Fragen ihm nicht beantwortet würden, aber daß, in der rechten Stunde dazu, der Freund ihm sein Herz eröffnen werde.
Ihr Wagen gerieth allmählich in eine ganze Reihe anderer hinein, und Alfred hatte jetzt dieselbe Ungeduld wie vorher bei ihrem Gange unter langsam schlendernden Menschen. Alle Welt entrann der heißen Stadt und strebte dem kühlen Garten zu, wo Natur und Leben in jenem den Großstädtern gewohnten Gemisch genossen werden konnten. Alfred sagte. „Wir wollen aussteigen“ und verließ den Wagen so schnell, daß der andere über ihn lächelte wie über ein launenhaftes Kind.
„Siehst Du, das sind unsere Freuden: ein paar grüne Bäume, ein bißchen Musik, viel geputzte Menschen, umherrennende Kellner mit überlaufenden Bierseideln, zuweilen ein fernes Löwengebrüll, der Schrei eines Affen, Thiergeruch, und über dem allem der erblassende Abendhimmel. Ein Gemisch von Salon-, Wüsten- und Waldstimmung. Wo ist da Harmonie? Wenn Du wüßtest[3q], wie ich nach Harmonie lechze!“
Zu diesem Erguß seines Freundes sagte Marbod Steinweber verwundert. „Ja, warum suchst Du sie denn nicht in der Stille und Schönheit Deines Landsitzes? Wenn ich solche Scholle mein nennte, hielte mich nichts in der Stadt.“
„Du sprichst wie der Taube von Musik. die Noten kannst Du lesen, aber dem Klange ist Dein Ohr verschlossen. Was ist diese Scholle? Ein Landgut, das ich bebauen kann? Nein, die kleinen Acker- und Wiesenstreifen, die dazu gehören, ernähren kaum das Pferd und die Kuh meines Verwalters. Eine herrschaftliche Villa? Nein, es fehlt der Park, es fehlt die Dienerschaft, die Equipage, der große Stil. Es war eine sonderbare Idee von meinem einsiedlerischen Vater, sich an einem der theuersten Plätze Deutschlands in so unpraktischer Weise anzukaufen und damit den dritten Theil meines kleinen Vermögens in vollkommen nutzloser Weise todt hinzulegen. Jedes Jahr, wenn ich da in meinem Landhäuschen den Herbst verbringe, erkenne ich von neuem, daß ich für diese thatenlose Einsamkeit nicht passe. Ich brauche Menschen[2q], Menschen. Ein Weib!“
„So heirathe doch! Mit einem Weibe wird Dir die kleine Villa an dem Schwarzwald ein Paradies sein, und brauchst Du dann doch noch Menschen, hast Du Baden-Baden ja nahe genug,“ rieth Marbod herzlich.
„Heirathe! Wie Du das so einfach sagst! Ich weiß ein Weib, – eines – aber sprechen wir nicht davon! Sieh dort, unser alter Verbindungsbruder Ludolf Ravenswann mit seiner Frau. Wollen wir sie begrüßen? Ich verkehre ein wenig bei ihnen, obgleich es mir sozusagen gegen den Strich geht, denn Ravenswann ist mir nicht lieb und die Frau haßt mich, während sie mir entsetzlich ist,“ sagte Alfred, indem er den Freund am Arm festhielt und mit dem Stock auf einen fernen Tisch hindeutete, den Marbod natürlich nicht sogleich aus dem Gewirr von sitzenden Menschen herausfinden konnte.
„Wie, Ravenswann hat geheirathet? Das wird eine sehr wichtige und umständliche Sache für ihn gewesen sein, zu entscheiden, welches Mädchen er mit seiner Person beglücken solle,“ lachte Marbod. Sie waren unter einem Baume zwischen dem Musiktempel und dem Restaurationshause stehen geblieben, und Marbod setzte sich den Kneifer auf, um den Besprochenen zu suchen.
„Aber er hat wie immer das Praktischste gethan. Er hat eine schwer reiche Hansestädterin genommen, ich weiß nicht, ob aus Hamburg, Lübeck oder Bremen. Sie kocht vorzüglich, sage ich Dir, ist groß, schön gewachsen, vielleicht ein bißchen platt in der Taille, hat einen rosigen Teint und auf den Wangen einige Aederchen, die auf spätere Kupferröthe hindeuten, ist immer so glatt gekämmt, als tauche sie den Kamm in Oel oder Wasser, und trägt stets ein großkarrirtes braun-gelbes Kleid, eine Spitzenrüsche am Hals und diese mit einer großen Gemme geschlossen. Philosophische Gespräche dürfen in ihrer Gegenwart nicht geführt werden, und übrigens heißt sie Mietze.“
Steinweber lachte.
„Du bist noch immer boshaft, merke ich. Aber da entdecke ich sie, – in einem hast Du unrecht, sie hat ein helles Kleid an.“
Ernsthaft versicherte Alfred:
„Komm, sieh selbst; Du irrst Dich. Es ist gewiß gelb und braun karrirt. Es kann gar nicht anders sein. So habe ich sie zuerst gesehen und sehe sie ewig vor mir.“
Sie wanden sich durch die Menschen und Stühle und näherten sich dem Tisch, wo die von Alfred beschriebene Dame neben einem großen, mageren, blondbärtigen Manne saß. Er trug eine Brille und hatte ein ernstes, fast sorgenvolles Gesicht.
„Die Grazien standen nicht an seiner Wiege,“ murmelte Alfred noch und hob dann seine Stimme zu lauter Begrüßung.
„Meine gnädigste Frau, lieber Ravenswann, hier bringe ich einen lieben Menschen, der von nun an der unserige werden will,“ sagte er, indem er Marbod auf die Schulter schlug.
Ravenswann erhob sich, über sein trockenes Gesicht flog ein Schimmer wirklicher Freude, der Sonnenschein der Erinnerung an einstigen Jugendübermuth. Er schüttelte Marbod die Hand und stellte ihn seiner Frau vor, eine Handlung, welche Alfred mit einer ganz ernsthaften Erläuterung begleitete:
„Doktor Steinweber ist als Rechtskonsulent bei der großen Lebensversicherungsgesellschaft Borussia[4] mit einem Gehalt von zehntausend Mark angestellt. Aber er hat nebstbei, gleich mir, die üble Angewohnheit, die Erscheinungen des modernen Lebens in Feuilletons, Novellen und Aufsätzen zu glossiren, ein Beweis von Leichtsinn, meine gnädigste Frau, der ihn in Ihren Augen verdächtig machen kann, aber den Sie ihm vielleicht um seiner erst erwähnten beruhigenden Eigenschaft willen verzeihen.“
Frau Marie Ravenswann lächelte ein wenig, halb höflich, halb unbehaglich. Sie konnte der Wortgewandtheit Alfreds mit ihren erfassenden Gedanken nie schnell genug folgen, um sich gleich klar zu werden, ob er spotte oder verbindlich sei. Als sie einmal ihrem Gatten klagte, daß sein Freund sich über sie zu belustigen scheine, sagte dieser abwehrend und voll Würde. „Das wird er sich meiner Frau gegenüber nie erlauben.“
Man setzte sich und Steinweber sah seine Jugendgenossen aufmerksam an.
„Wie sehr Ihr Euch verändert habt, trotz der hundert kleinen vertrauten Züge, insbesondere in Alfreds Gesicht und Wesen! Und wie wenig muß in mir vorgegangen sein, denn soweit man über sich selbst urtheilen kann, bin ich noch ganz derselbe,“ sagte er.
„Sehr natürlich, mein Alter,“ antwortete Alfred heiter, „Du bist wie ein stolzes edles Roß Deinen ruhigen Gang vorwärts geschritten, und wenn Dir Hindernisse kamen, hast Du sie im sicheren Sprung genommen. Ravenswann dagegen wühlt wie ein Maulwurf in seiner Berufsarbeit weiter – da flieht das Licht von Stirn und Augen; und ich, nun ich bin wie ein Spatz auf dem Wege, ducke mich im Regen, lärme vergnügt im Sonnenschein und bin ein vollkommen nutzloses Individuum.“
Marbod lachte und Ravenswann mußte wenigstens seine Mundwinkel ein wenig in die Höhe ziehen.
Frau Ravenswann aber sagte gereizt: „Das geht denn doch über den S-paß, daß Sie meinen Mann mit einem Maulwurf vergleichen.“
„Aber Mietze!“ beschwichtigte sie der Gatte, dem sie oft genug die Schwäche vorgeworfen, daß er sich von Alfred von Haumond alles gefallen lasse.
„Nein, das s-teht ihm nicht an,“ beharrte sie ärgerlich.
„Womit kann ich Sie versöhnen?“ fragte Alfred und sah sie mit einem Ausdruck fast zärtlicher Neckerei an. Er hatte immer eine liebevolle Aufwallung für diejenigen, denen er eine von ihm verursachte Kränkung ansah. Und eigentlich gegen ihren Willen fühlte Frau Marie sich stets durch diesen Ton besänftigt.
Marbod begann nach alten Genossen zu fragen, die er durch einen mehrjährigen Aufenthalt im Ausland aus dem Blick verloren. Alfred war der einzige gewesen, mit dem er in Verbindung geblieben; das heißt, er hatte zuweilen geschrieben und Alfred hatte ihm, als einziges Zeichen, daß seine Briefe willkommen und erwünscht wären, die wechselnden Adressen angegeben.
Marbod vertiefte sich mit dem über alle und alles genau unterrichteten Ravenswann in ein Gespräch über Peter und Paul und Fritz und Heinrich. Frau Mietze saß schweigend dabei. Alfred begann nach fünf Minuten unruhig auf seinem Stuhl zu werden, sah nach der Uhr, las das Programm, knöpfte sein leichtes Sommerjackett zu und nach weiteren zwei Minuten wieder auf und seufzte laut.
„Und Weber?“ fragte Marbod, als sie schon fast das ganze Corps durchgegangen waren.
„Der ist von der Leiter gefallen,“ sagte Alfred.
„Was?“ fragten die beiben andern Männer wie aus einem Munde.
„Nun ja, er war schon recht hübsch hoch geklettert, da wollte er mit einem Mal einige Sprossen zugleich nehmen und stürzte herab.“
„Wie meinst Du das?“ fragte Marbod.
„Für mich,“ begann Alfred, während er abermals nach der Uhr sah, „klettert die ganze Menschheit auf einer Leiter. Ich sehe sie aufklimmen und mit zitternden Fingern und gierigen Augen emporstreben. Droben hängen, wie die Siegespreise auf einer Kletterstange, die Ziele. Glück, Ruhm, Liebe, Geld und Macht. Und im Gedränge nach oben giebt einer dem andern kräftige Fußtritte. Es kommt auch vor, daß einer den andern hinunterwirft, noch öfter aber, daß einer, der zu schnell hinaufwollte, fehl tritt und purzelt. Der arme Weber wollte Geld haben und als er zweihunderttausend beisammen hatte, sollte es auf einmal eine Million werden. Seine Spekulation mit österreichischen Kreditaktien mißrieth ihm, ein Termingeschäft mit Kaffee ebenso, er hatte einige hunderttausend Differenzen zu zahlen, anstatt sie einzuheimsen, und da erschoß er sich, der arme Kerl. – Mir ist die Kletterei in der Seele zuwider. Ich halte nicht mit.“
„Na, na,“ sagte Ravenswann, indem er glaubte witzig zu sein und komisch war, „was die Liebe anlangt, so bist Du immer voran. Das ist schon kein Klettern mehr, das ist die reine Steeplechase.“
Alfred lächelte mitleidig.
„Wann darf man denn gratuliren?“ fragte Frau Mietze mit einer gewissen spitzfindigen Betonung.
„Wozu?“ fragte er seelenruhig entgegen.
„Nun, zu Ihrer Verlobung mit der Baronin Offingen. Frau Doktor Schneider war noch heute bei mir und sagte, alle Leute s-prächen davon, es ginge gar nicht mehr anders, man sähe Sie jeden Tag bei ihr, und wenn diesem Verkehr keine Verlobung folge, sei die Dame sehr kompromittirt. Ich sagte aber, so weit ich Herrn von Haumond kenne, würde er die Welt gewiß einmal mit einer Heirathsanzeige überraschen, und so eine gewöhnliche Verlobungszeit vorher sei ihm nicht apart genug,“ erzählte sie mit vielem Behagen.
„Wie nett von Frau Doktor Schneider und ‚allen Leuten‘, sich so für mich zu interessiren!“ antwortete Alfred verbindlich, fast mit einem dankbaren Ton.
Frau Ravenswann ärgerte sich, sie hatte gedacht, er werde etwas Aufklärendes sagen, denn sie hatte sich ihrer Freundin gegenüber gerühmt, ihm ins Gewissen reden zu wollen und etwas Sicheres über diesen fragwürdigen Fall zu erfahren. Ja, sie hatte auch ihrem Manne davon gesprochen, daß es seine Aufgabe als Freund sei, Alfred auf die Pflicht, sich zu verloben, hinzuweisen, und sie glaubte fest, daß dieser dem Rathe eines so bedeutenden, gediegenen und soliden Mannes folgen müsse.
„Sie weichen mir aus,“ sagte sie, „und es wäre doch Pflicht, gegen uns, die wir Ihre nächsten Freunde sind, offen zu s-prechen.“ Immer, wenn Neugier oder Bevormundungssucht sich in die Angelegenheiten anderer drängen, nehmen sie die Maske der Freundschaft vor.
„Darin muß ich Ihnen recht geben, meine gnädigste Frau. Und wenn ich erst ‚allen Leuten‘ etwas mitzutheilen haben werde, sollen Sie von diesen die erste sein, welche etwas erfährt,“ antwortete Alfred mit einem sehr ernsthaften Gesicht.
Die Frau war befriedigt, der Mann dachte darüber nach, ob nicht eine versteckte Impertinenz in Alfreds Worten gelegen habe, doch ließ ihm Marbod nicht Zeit, sich darüber klar zu werden, sondern fragte ihn nach seiner Berufsthätigkeit. Seine Vorgesetzten, sein Bureaudienst, das Aufrücken seiner Nebenangestellten – Ravenswann war im Finanzministerium – bildeten stets dieses Mannes Lieblingsgespräch, ja, fast sein ausschließliches. Mittags unterhielt er seine Frau, abends seine Freunde mit den kleinen Vorkommnissen seines Arbeitstages und hatte die Gewohnheit, von diesen ausgehend sich soweit zu erregen, daß er eine Art Vortrag hielt, der entweder vom Bimetallismus[5] handelte, oder die Unnützlichkeit und Schädlichkeit der Parlamente und des daraus entspringenden Rechts der Abgeordneten, das Budget zu bemängeln, hervorhob. Angriffe und Beschneidungen des Staatsbudgets nahm er als persönliche Beleidigungen, und seine Frau, obschon sie von diesen Dingen weiter nichts verstand, fühlte sich dann mitbeleidigt und verachtete herzlich Menschen, die eine Sache bemängeln konnten, an der ein so bedeutender Kopf wie ihr Ludolf mitgearbeitet hatte.
Alfred sah noch zweimal nach der Uhr, während Ravenswann mit der ihm eigenen trockenen Stimme, die er in regelmäßigen Zwischenräumen kurz räusperte, in immer demselben Tonfall auf Marbod einsprach. Dabei lärmte ein von Blechinstrumenten wiedergegebenes Wagnersches Musikstück[12] durch die Luft und dicht hinter Alfred hatte sich ein unwahrscheinlich dicker Mensch auf einen der kleinen Stühle gesetzt, so zwar, daß er den breiten Rücken dieses Menschen an seinen Schultern zu fühlen glaubte. Die eisernen Stuhllehnen quetschten sich wenigstens mit einem schneidenden Geräusch aneinander. Und als der dicke Mensch nun noch gar mißtönig ausspuckte, schrak Alfred so zusammen, daß er gleich danach aufstand und mit fast bebender Stimme sagte:
„Ich halte diesen Musiklärm und dieses Menschenaneinander nicht mehr aus. Zudem ist es die Zeit, wo ich noch einer Einladung zur Baronin Offingen zu folgen habe.“
„Wie schade, ich dachte, wir könnten den Abend zusammen beendigen,“ meinte Marbod.
„Du kommst natürlich mit!“
„Geht das?“
„O,“ sagte Frau Mietze ungewöhnlich lebhaft, „die Offingen ist nicht so schwierig.“
Alfred, der ohnehin schon sehr bleich aussah, biß sich auf die Lippen. Aber es war ihm nicht mehr der Mühe werth, ein scharf verweisendes Wort zu sagen.
„Sie kennen die Dame auch? Sie verkehren auch mit ihr?“ war die natürliche Frage Marbods.
Frau Marie Ravenswann kniff ihre Lippen erst zusammen, ehe sie sie öffnete, um zu antworten:
„Kennen – o ja! Aber wir verkehren nicht.“
Darin lag eine solche Abwehr, ein solcher Richterspruch, daß Marbod erstaunt zu dem Freund aufblickte, den Frau Marie mit eben dieser Dame vorhin verlobt gesagt. Er las in Alfreds Augen aber einen so ruhigen Spott, daß er nicht mehr besorgt um die Erklärung dieser hervortretenden Feindschaft war.
„Du mußt wissen“ sagte Alfred, „die beiden Damen passen nicht besser zusammen als Wasser und Feuer. Und außerdem hat unsere verehrte Frau Assessor noch von ihrer Heimatstadt her die Gewohnheit, nur mit Leuten zu verkehren, denen sie auf irgend eine Weise verwandt ist, oder die ihr wenigstens von irgend einem Verwandten günstig geschildert worden sind.“
„Eine Vorsicht,“ meinte Ravenswann gereizt, „die nicht genug zu loben ist, besonders in unserer modernen, von fragwürdigen Elementen durchsetzten Gesellschaft.“
„Aber wir wollten ja gehen,“ mahnte Alfred ungeduldig, als hätte er gar nicht gehört, was der Assessor gesprochen.
„Sie werden uns bald besuchen?“ fragte Frau Ravenswann sehr liebenswürdig den sich erhebenden Marbod. Dieser sagte zu, und man schied von einander, wobei Alfred sich so heiter und freundlich zeigte, als wären gar keine scharfen Worte hin und her geflogen.
„Es ist doch seltsam,“ sagte er dann, als er mit dem Freunde dem Ausgang zuschritt, „im Augenblick, wo ich den Leuten Adieu biete, fühle ich immer ein Wohlwollen für sie und ich denke, daß man doch einst manche gute Stunde mit Ravenswann hatte. Freilich, doch eigentlich nicht mit ihm, sondern bloß in seiner zufälligen Gegenwart, aber auch das verbindet.“
„Haben sie Kinder?“
„Noch nicht. Und die Natur verhüte, daß sich diese steifleinene Rasse weiter fortpflanze!“
Sie schwiegen eine lange Zeit. Alfred führte den Freund durch die eleganten Villenstraßen des Thiergartenviertels. Der Abend war vollends hereingebrochen. Im Doppelschimmer der Straßenlaternen und des von kleiner Mondsichel sanft leuchtenden Himmels ergingen sich Leute auf den Bürgersteigen. Hinter den Gittern, welche die Vorgärten von der Straße trennten, blühte es reich von Rosen und Caprifolium, und die durch den Abendschatten Unsichtbaren verkündeten ihr Dasein in schweren und fast betäubenden Düften. Aus Fenstern und Veranden quoll Lichtschein, man hörte auch da und dort aus dem Dunkel sprechen und lachen.
Alfred öffnete eine Gitterpforte und trat mit dem Freunde in einen Garten, daraus ihnen aufdringlich starker Blumenduft entgegendrang.
„Wie ich diese heißen Düfte und diese schwülen, dunklen Sommerabende liebe!“ sagte Alfred, indem er vor einem Rosenparterre stehen blieb und sich im Schein des Lichts, das vom Hausthore herfiel, eine halberschlossene Blüthe suchte.
„Wie ist die Frau, zu der Du mich führst, und was ist sie Dir?“ fragte Marbod, der die Empfindung hatte, als zögere sein Freund nur bei den Rosen, um vor ihrem Eintritt in das Haus noch irgend etwas zu sagen, vielleicht eine Erklärung von Dingen, die er sehen, von Personen, die er kennen lernen sollte, und durch die Frage wollte er es ihm erleichtern.
„Ich kann doch nichts sagen. Sieh selbst!“ antwortete der andere nach kurzem Besinnen.
„Sie ist Aristokratin?“ fragte Marbod, dem es denn doch unbehaglich war, so unvorbereitet in ein vollkommen fremdes Haus zu treten.
„Eine Aristokratin des Bewußtseins; die Geburt ist ihr ein Zufall, die Freiherrnkrone ein Nebensächliches. Sie ist Witwe, jung, hat einen Knaben und lebt hier mit einer alten Tante, welche die Stelle einer dame d’honneur vertritt. Aber das ist auch wieder nur ein Zufall, weil die hilflos kränkliche alte Dame eines Anhaltes bedurfte; Gerda ist nicht die Frau, sich bloß um eines Scheines willen die Gesellschaft einer Person aufzuladen, die ihr unnöthig oder gar lästig ist. Alles andere wirst Du selbst beobachten“ sagte Alfred.
„Sind wir allein da? Wie können wir im Straßenanzug hingehen?“ fragte Marbod noch, den schon im Thore Stehenden am Arme erfassend.
„Wegen des letzteren Umstandes werde ich uns freilich entschuldigen müssen, wir haben heute den Freibrief des ‚Zugereisten‘ und des ‚Bärenführers‘ für uns. Wen wir da treffen, weiß ich nicht. Es ist unberechenbar, denn sie liebt es, ihren Salon bunt zu bevölkern,“ erklärte Alfred mit einer ihm sonst vielem Fragen gegenüber fremden Geduld, die unschwer verrieth, wie gern er über diesen Gegenstand sprach, „man trifft Leute aus der besten Gesellschaft, Damen wie Herren; große, berühmte Menschen; und dann wieder werdende Namen, Männer und Frauen, die ihr Genie vorerst nur durch einige Proben in ihrer Kunst und einige Unregelmäßigkeiten ihrer Lebensführung bewiesen haben, Leute also, die ebenso leicht Abenteurer sein, wie Monumentalerscheinungen werden können. Demzufolge ist die Sprache in ihrem Salon wie die Sprache an unseren Landesgrenzen: man spricht offiziell deutsch, aber es ist je nachdem mit französisch, holländisch, dänisch, polnisch untermischt. So spricht man bei ihr die Sprache der besten Gesellschaft, aber hier und da kommen Grenzlaute vor, Töne aus anderen Reichen. Und nun zum drittenmal: sieh selbst! Komm!“
Eine Glocke schlug an.
Die Thür der Erdgeschoßwohnung wurde von einem Diener geöffnet, dessen einfache vornehme Kleidung einen ebenso wohlthuenden Eindruck machte wie die Einrichtung des Flurs. Man sah da weder gebleichte Palmenzweige, noch orientalische Teppiche oder chinesische Vasen. Die hinter dem Schutz von weißem Milchglas brennende Lampe beschien nur einen den Boden bedeckenden Teppich, einen dunkel umrahmten Spiegel und dichtfaltige tiefbraune Vorhänge, welche alle auf den Flur mündenden Thüren verhüllten.
Ganz denselben Eindruck einer fast an Strenge grenzenden Einfachheit würden die Zimmer gemacht haben, welche die Freunde nun betraten, wenn eine Fülle von Blumen in Schalen und Vasen und exotische Pflanzen in grünender Frische nicht den Zauber von Anmuth und Freudigkeit verbreitet hätten. Es waren drei Wohnräume, deren Folge man vom Eingang aus schon durch die einander gegenüberliegenden Thüröffnungen übersah. Eine fast auffallende Helle durchströmte die Räume und ein Wohlgeruch, der zu frisch und natürlich war, um betäubend zu wirken.
Marbod befand sich in einer Spannung, die an Aufgeregtheit grenzte. Er fühlte, daß dieses Haus und seine Herrin im Dasein des Freundes jetzt das Wichtigste seien, und zitterte fast davor, einer Angelegenheit näher zu kommen, die, er wußte selbst nicht warum, ihm keineswegs einfach und glückverheißend erschien.
Im zweiten Zimmer saß eine ältliche Dame, die sich bei ihrem Eintritt nicht erhob. Marbod hatte sogleich den Eindruck, daß diese kleine, zusammengefallene Gestalt mit dem halb kindlichen, halb mißmuthigen Zug im farblosen Gesichte, wie er stets Leidenden oft eignet, nicht hierher passe. Freude am Schönen und an der Kraft, das war es, was sich in der Einrichtung dieses Heims aussprach.
Alfred begrüßte die alte Dame und wurde von ihr begrüßt in einer Art, die verrieth, daß man sich täglich sah. Er nannte sie „Tantchen“, stellte den Freund vor und fragte, wie es ihr ginge.
„Ach,“ klagte die Dame, „ich habe nur von zwölf bis halb drei und dann noch von fünf bis sechs Uhr geschlafen, trotzdem ich ein und ein halbes Schlafpulver genommen hatte. Sie müssen wissen,“ wandte sie sich erklärend an Marbod, „daß, seit ich vor sieben Jahren ein schweres Nervenfieber durchmachte, ich stets leidend bin, mir und andern zur Last.“
„Aber Tantchen,“ sagte Alfred, „niemand zur Last! Gerda pflegt Sie mit liebender Hingabe, und das wird auch später so bleiben, wenn …“ Er verstummte. Das Tantchen sah Marbod an, als wenn sie fragen wollte: Du weißt natürlich alles?
Nebenan ging eine Thür. Ein schneller kleiner Schritt wurde hörbar und dann ein Freudenruf, und fast zugleich schon sah Marbod, daß ein Knabe von etwa sechs Jahren mit glückselig leuchtendem Gesicht und ausgestreckten Armen auf Alfred zulief, mit einem Satz auf seinen Knieen war und die Händchen um seinen Nacken faltete.
„Du Strick, Du bist noch nicht zu Bett?“
„Mama hat gesagt, daß ich aufbleiben soll, bis Du kommst, und ich soll Dir leise was sagen.“
„So sag’s!“
Der schöne Knabe neigte seine zarte Wange an die Alfreds und flüsterte mit seinen Lippen in des Freundes Ohr so leise wie Kinder flüstern, und vollkommen unverständlich. Für Marbod war es ein seltsam ergreifender Anblick, das Kind mit dem schweren dunklen Haargelock sich so an das blonde Haupt Alfreds schmiegen zu sehen. Der Knabe hatte blaue, fast flammende Augen und einen Blick, wie er Kindern eigen ist, deren zarter Körper dem voreilenden Flug des sich entwickelnden Geistes nicht nachkommen kann.
„Du mußt es lauter sagen!“
Nun flüsterte das Kind so laut, wie man mit voller Anstrengung, nur ohne Stimmklang, spricht:
„Du wirst bald mein Papa![4q]“
In das leicht bewegliche Gesicht Alfreds schoß heftiges Erröthen. Er schloß die Augen. Man sah, ein fast trunkenes Glücksgefühl überwältigte ihn. Er hielt den Knaben fest an sich gepreßt, und dieser legte in seligem Frieden sein Haupt an die Schulter des von ihm Angebeteten.
Die Tante und Marbod hatten das Glückswort gehört. Die Tante führte ihr Taschentuch an die Augen, Marbod sah vor sich nieder und erwog, ob er nicht wieder gehen sollte.
Diese stummen Minuten mochten länger gedauert haben, als sich alle bewußt waren. Alfred schreckte erst auf, als an derselben Thür, durch welche der Knabe gekommen war, ein Frauenkleid rauschte. Er sprang auf, das Kind von sich gleiten lassend, und eilte in das andere Zimmer.
„Gerda!“ rief er, und dann war wieder Schweigen.
In diesen Augenblicken verwünschte Marbod den Einfall des Freundes, ihn mit hierher gebracht zu haben. Um nicht zu lauschen auf das, was nebenan vielleicht mit heißen Flüsterworten und Küssen besiegelt wurde, begann er ein Gespräch mit dem Knaben, denn die Tante hielt es für ihre Pflicht, sich jetzt heftig zu rühren, und vergoß Thränen in ihr Tüchlein.
„Wie heißt Du, mein Kind?“
„Hat er es Dir nicht gesagt? Ich bin Alexander von Offingen. Er und Mama nennen mich aber Sascha,“ antwortete der Knabe. Der freie, schöne Aufblick, den das Kind beim Sprechen hatte, war bezaubernd. Und die Art, wie er Alfred nur mit „er“ bezeichnete, verrieth eine abgöttische Liebe, wie sie eben nur begeisterungsfähige Kinder für schöne, liebenswürdige Männer haben, die ihnen viel Zeit und Neigung schenken.
Kennst Du ihn schon lange?“ fragte Marbod weiter.
„Seit wir hier wohnen, schon ein Jahr. Er besucht mich und Mama jeden Tag. Er hat mich lesen gelehrt und ‚Heil Dir im Siegerkranz‘ auf dem Klavier. Ich habe immer zu Mama gesagt, ich möchte wohl, daß er mein Papa wäre. Und nun wird er es. O, dann ist er den ganzen Tag bei uns,“ sagte Sascha mit leuchtendem Gesicht.
„Du liebst ihn wohl sehr?“ fragte Marbod, ergriffen seine Hand auf die dunklen Locken legend.
„Ja!“ sagte der Knabe.
Es war ein seltsames „Ja“. Kurz, ernst, von eiserner Bestimmtheit. Ein „Ja“ wie aus dem Munde eines Mannes, der ein Gelöbniß für das Leben macht. Marbod hatte dabei das Gefühl, daß dieses Kind beängstigend eindringlich denke und empfinde. Und ihm schien, als stände in dem blassen, durchsichtigen Antlitz eine fremde, unirdische Schrift wie auf den Stirnen von Todgeweihten.
Sein Gespräch mit Sascha, bei dem er seine wohllautende Stimme keineswegs gedämpft hatte, mochte die beiden da drinnen gemahnt haben, sich ihrem Glücksrausch zu entreißen. Sie erschienen auf der Schwelle, und das Kind lief ihnen entgegen, beider Kniee zugleich umfassend.
Marbod hatte erwartet, eine schöne Frau zu sehen. In dem Glanze des Glücks, der jetzt auf ihren Zügen lag, erschien die Baronin Offingen ihm mehr als das. Ihr Haar, ihre Augen, ja selbst die Farben und Züge des Gesichtes glichen denselben Einzelheiten bei ihrem Knaben. Ihr lächelnder Mund war von berückender Schönheit. Temperament und Güte sprachen aus den charakteristischen Linien, mit denen frühe Lebenserfahrungen ihr Antlitz gezeichnet hatten.
Wie sie und Alfred so nebeneinander standen, schien es, als müsse die Natur sie von jeher für einander bestimmt haben.
Marbod war ein wenig befangen und wußte nicht, ob er das erste Wort zu sprechen oder zu erwarten habe. Doch jetzt ging Gerda geradeswegs auf ihn zu, gab ihm die Hand und sagte:
„Ich kenne Sie. Ich bin sehr glücklich, daß Sie gerade jetzt an Alfreds Seite sind. Versuchen Sie, auch mich kennen zu lernen und liebzugewinnen.“
Noch mehr als die herzliche Klangfärbung in ihren Worten nahm ihm der edle Freimuth ihres Blickes das Gefühl, als sei er hier nicht am Platze.
„Dazu bedürfte es nicht erst des Versuches,“ sprach er ebenso herzlich, „Sie sind mir von dieser Stunde an eins mit Alfred, und ihn liebe ich, wie man nur einen Freund lieben kann.“
„Und nicht wahr, Kinder,“ fragte das alte Fräulein aus ihrer Sofaecke heraus, während ihre magern Fingerchen ein Flacon mit Riechsalz zu ihrer Nase führten, „jetzt ist Euer Entschluß ein fester und endgültiger? Ich bin wirklich den fortwährenden Aufregungen nicht gewachsen. Ihr werdet nicht morgen wieder sagen, daß es doch nicht geht?“
Auf Gerdas Angesicht erschien eine flammende Gluth. Sie streckte Alfred beide Hände hin und rief:
„Nein, tausendmal nein! Wie könnten wir ohne einander leben! Wir werden mit heißem Bemühen versuchen, uns ineinander zu fügen.“
Und sie sahen sich an, fest, gewaltig, das ganze Leben ihrer Seelen in verheißende Blicke zusammengefaßt.
„So war es ein hartes Ringen, ehe Ihr Euch einander ergabt?“ fragte Marbod.
Gerda schloß die Augen. Ein Schatten unaussprechlicher Qual verdunkelte plötzlich alle Glücksstrahlen auf ihrem Gesicht.
Sie neigte nur bejahend das Haupt.
Alfred zog sie tröstend an sich.
„Warst Du allein der gequälte Mensch?“ fragte er heiß. Sie schienen die Anwesenden zu vergessen.
Die Tante winkte Marbod zu sich heran und flüsterte:
„Nicht alle Menschen, die nicht ohne einander leben können, verstehen es, mit einander zu leben.“
Von dieser Aeußerung fühlte Marbod sich fast noch mehr betroffen als von den Schlüssen, die er aus den eben gewechselten Reden gezogen. Er kannte seinen Freund und wußte, daß das Glück, welches dieser einem Weibe zu geben vermochte, nur ein unruhvolles sein könnte.
Jetzt hörte man die Flurglocke und mehrere Stimmen, die draußen lachten und sprachen.
„Heute kommen noch Menschen?“ fragte Alfred heftig.
„Das weißt Du doch, es ist mein Dienstag!“ sagte Gerda; „auch ich bin wenig gestimmt, jetzt Gäste zu haben.“
„Du hättest absagen können oder mir erst morgen unser Glück durch Sascha verkünden lassen sollen,“ antwortete er, während zwischen seinen Brauen eine tiefe Falte erschien.
„Mein Gott, ich wußte doch heute morgen noch nicht, daß … daß Du mir jene Zeilen senden würdest! Du schreibst mir: ‚Ich ertrage diesen Zustand nicht mehr!‘ Und ich ende ihn, ohne zu bedenken, was die nächste Stunde uns für Zwang auferlegt. Willst Du mir deshalb grollen?“ fragte sie. Es war kein Vorwurf, aber eine stolze Abwehr in ihrem Ton.
Er ging hastig auf und ab.
„Wer kommt denn?“
„Nur vier oder fünf Menschen. Die Gräfin Mollin, die nie ausbleibt, dann Doktor Bendel, den ich gebeten habe, um ihn mit unserem kleinen Prasch bekannt zu machen. Du weißt doch, daß Prasch sein Buch in diesen Tagen herausgiebt. Und außerdem noch die Mara und Direktor Damberg.“
Alfred biß sich auf die Lippen.
„Diesen Menschen, vor dem ich Dich gewarnt habe!“ sagte er mit mühsam unterdrücktem Zorn.
„Bitte,“ schmeichelte Gerda mit bestrickender Liebenswürdigkeit, indem sie ihm die Wange streichelte, als wäre er ein Kind, „nicht gleich böse sein! Meine arme kleine Mara wird immer von Damberg so herunter gemacht, dem guten Ding schnürt’s schon die Kehle zu, wenn sie weiß, er sitzt im Parkett, und da habe ich ihn mir eingeladen, Du kannst Dir wohl denken, weshalb. Du wirst sehen, bei Maras nächster Rolle wird er sie für eine große Sängerin erklären.“
„Du bist für alle zart besorgt, nur nicht für mich,“ sagte er noch. Dann erschien von den besprochenen Gästen die Gräfin Mollin mit der Sängerin und Herrn von Prasch zusammen. Gerda begrüßte sie mit einer vollkommen heiteren Stirn, stellte Doktor Marbod Steinweber vor und lachte und plauderte so unbefangen, als wenn keineswegs vor wenigen Minuten die heftigsten Erregungen durch ihre Seele gezogen wären.
Alfred, den man um sein blasses Aussehen befragte, sagte, daß er Kopfweh habe, und zog sich mit Sascha in eine Zimmerecke zurück. Da saßen sie auf einem kleinen Sofa; der Knabe hatte sich aus einer Vase eine Handvoll Wasserrosen genommen und bog nun mit seinen Fingerchen die dunklen Hülsen von den wachsweißen, halberschlossenen Blüthen. Dabei hatte er sein dunkles Haupt gegen Alfreds ihn umschlingenden Arm gelegt. Sie plauderten leise zusammen. Eine Fächerpalme, die ihre Blätter von hinten herüberstreckte, warf einen Schatten auf Alfreds Gesicht.
Die Gräfin Mollin besah sich die Gruppe durch ihre langstielige Lorgnette und sagte zu Mara:
„Wie für einen Maler posirt. Wenn Gerda und Haumond sich wirklich vermählen sollten, das Kind dürfte kein Glückshinderniß werden. Diese Liebe ist wahrhaft rührend.“
Die Mara schüttelte das schwarzhaarige Haupt, und über ihr braunes, unregelmäßiges und temperamentvolles Gesicht, in dem zwei schwarzbraune Augen brannten, ging ein spöttisches Lächeln.
„Die – sich heirathen?“ sagte sie, die zarten Schultern zuckend, „nie im Leben! Einen Haumond sich zu erhalten, dazu gehört mehr Selbstüberwindung, als Gerda besitzt.“
Die Gräfin Mollin, eine übermäßig üppige Dame, deren kluges Gesicht und knabenhaft kurz abgeschnittenes Haar ihr, der Vierzigjährigen, ein fast keckes Aeußere gaben, sah, immer durch ihre langstielige Lorgnette, der Mara gerade ins Gesicht.
„Sie trauten sich diese Selbstüberwindung zu?“ fragte sie.
Es war in Gerdas Salon ein offenes Geheimniß, daß Alfred von Haumond, ehe er Gerda gekannt, die Mara stark ausgezeichnet habe und daß diese ihn noch liebe.
Unterdessen setzte Herr von Prasch, ein kleiner, sehr zierlich gewachsener Mann mit einem niedlichen Gesicht, in dem, wie vom Friseur angeklebt, ein dunkles Schnurr- und ein Kinnbärtchen saß, während er sein Haar wie ein preußischer Lieutenant trug – unterdessen setzte Herr von Prasch Gerda und Marbod den Inhalt seines Buches auseinander. Es handelte sich um eine psychologische Zergliederung Wagnerscher Frauengestalten.
Jetzt erschienen auch Doktor Bendel, ein schöner und eleganter Mann semitischer Abstammung, die seine Züge auch nicht verleugneten, und Direktor Damberg, ein ältlicher, rundlicher Herr, in dessen röthliches Gesicht graue Haarsträhne fielen und dessen helle Augen über Brillengläser hinweg, suchend halb und halb zerstreut, fortsahen. Seine Bewegungen waren hastig und unsicher, während Doktor Bendel sich mit vollkommener Sicherheit, die an Gleichgültigkeit streifte, benahm.
Bendel kannte den Namen Marbod Steinweber, freute sich, einen so talentvollen Kollegen jetzt hier zu haben, und erbat sich sogleich die Mitarbeiterschaft für sein Blatt. Damberg flüsterte darauf Prasch zu, daß dies eine Höflichkeitslüge sei, denn Bendel, dies wisse jedermann, erkenne nur einen Schriftsteller an, nämlich den Moritz Bendel.
Herr von Prasch sagte zu Bendel, daß er sich freue, dem berühmten und eminenten Kenner Wagners vorgestellt zu sein, und kam sogleich auf sein Buch. Bendel versprach etwas zurückhaltend, es zu besprechen, wenn es ihm gefiele, und zu schweigen, wenn es ihm nicht gefiele, und auch dies Schweigen sei eigentlich ein unerlaubtes Zugeständniß an den Schützling der Baronin Offingen. Prasch war gewiß, daß Bendel entzückt sein werde, und sprach viel und mit Enthusiasmus vom „Meister“.
Hierüber sagte Bendel nachher zur Gräfin: „Ein kleines Gefäß für eine so große Begeisterung!“
Gerda machte mittlerweile zwischen der Mara und Damberg die Diplomatin. Sie sprach bevormundend und eindringlich für die Freundin.
„Mara ist zu klug, um nicht den Nutzen der abfälligen Bemerkungen einzusehen, die sie andrerseits natürlich schmerzen. Wir sind uns seit langem einig, daß sie nur noch von Ihnen das lernen kann, was ihr fehlt. Deshalb bitte ich Sie: Mara soll die Carmen[11] übernehmen, studieren Sie sie ihr ein.“
„Aber meine Damen, meine Zeit ist so durch meine Musikschule und meine Berichterstatterpflichten ausgefüllt, daß ich kaum weiß …“ sagte Damberg nachdenklich.