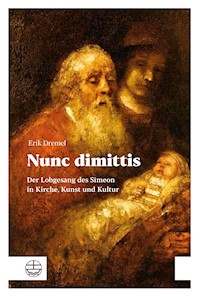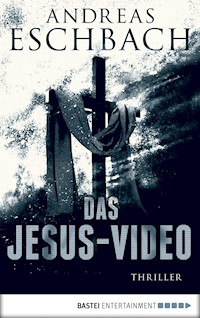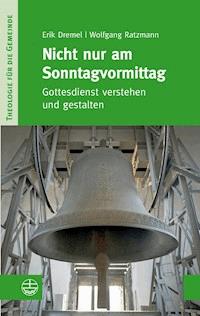
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Theologie für die Gemeinde III
- Sprache: Deutsch
Wo es christliche Gemeinden gibt, werden Gottesdienste gefeiert, meist am Sonntagvormittag und nach der Ordnung von Agende oder Messbuch. Aber Gottesdienste finden in unterschiedlicher Gestalt und auch zu ungewöhnlichen Zeiten statt. Mehr und mehr übernehmen Gemeindeglieder dabei auch eine leitende Verantwortung für deren Gestaltung. Besonders trifft das für die nebenamtlich tätigen Prädikantinnen und Prädikanten in unseren Kirchen zu. Die Veröffentlichung will ehrenamtlich für den Gottesdienst tätigen oder auch einfach liturgisch interessierten Gemeindegliedern elementare Kenntnisse vom Sinn bestimmter gottesdienstlicher Handlungen und Texte vermitteln und damit Kompetenzen vermitteln, die für die sachgemäße Gestaltung von Gottesdiensten, für das Beurteilen oder Anfertigen von Predigten oder Andachten Voraussetzung sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theologie für die Gemeinde
Im Auftrag der Ehrenamtsakademie der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens herausgegeben von Heiko Franke und Wolfgang Ratzmann
Band III/2
Erik Dremel / Wolfgang Ratzmann
Nicht nur am Sonntagvormittag
Gottesdienst verstehen und gestalten
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2014 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Kai-Michael Gustmann, Leipzig
Coverfoto: © Reinhard Marscha – Fotolia.com
Layout und Satz: Steffi Glauche, Leipzig
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015
ISBN 978-3-374-03957-9
www.eva-leipzig.de
Vorwort
Menschen fragen aus ganz unterschiedlichen Gründen nach dem Gottesdienst, nach seinem Sinn, seiner Form, seiner Gestaltung:
Die einen suchen nach kompetenter Information, weil sie selbst liturgisch beruflich oder ehrenamtlich engagiert sind.
Andere stehen dem Gemeindegottesdienst eher distanziert gegenüber, interessieren sich aber für christliche Rituale und deren Herkunft und Bedeutung.
Wieder andere suchen nach Anregungen, weil sie am unbefriedigenden Zustand des Gottesdienstes in ihrer Gemeinde leiden …
So unterschiedlich die Anlässe und Fragerichtungen sein mögen, so sehr hoffen wir als Autoren, dass wir mit dem vorliegenden Büchlein den verschiedenen Interessen unserer Leserinnen und Leser gerecht werden und dass wir ihnen etwas vom geistlichen Reichtum des Gottesdienstes nahebringen können. Insbesondere denken wir dabei an Personen, die ehrenamtlich als Kirchenvorsteherinnen bzw. Gemeindekirchenräte, als Lektorinnen oder Prädikanten, als Kirchenmusiker, Küsterinnen oder Mitglieder in einem liturgischen Arbeitskreis der Gemeinde am Gottesdienst arbeiten und von ihm aufgrund ihres Engagements mehr wissen wollen.
Das gottesdienstliche Spektrum, das wir in diesem Buch abschreiten, ist ungewöhnlich breit: Es enthält Informationen zu Liturgie und Predigt gleichermaßen. Nicht nur der Sonntagsgottesdienst wird bedacht, sondern auch die Kasualien und besonderen liturgischen Formen spielen eine Rolle. Kirchenmusikalische Anliegen sollen ebenso zum Zuge kommen wie theologisch-pastorale Interessen. Wir konnten uns dieser Breite der Themen nur stellen, indem wir aus der Fülle an möglichen Informationen das jeweils Wichtigste ausgewählt haben, und wir hoffen, dass bei dieser Auswahl nicht zu viele Wünsche auf der Strecke bleiben müssen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Darstellung auf der Erläuterung der historisch gewachsenen Formen von Gottesdienst. Das geschieht nicht aus einem Konservativismus heraus, der die gegenwärtigen gottesdienstlichen Situationen in den Gemeinden nicht zur Kenntnis nimmt. Vielmehr geht es uns um ein Verstehen des Gottesdienstes, ohne das kompetente Entscheidungen für das gottesdienstliche Feiern heute nicht getroffen werden können. Indem wir die einzelnen Elemente eines klassischen evangelischen Hauptgottesdienstes mit Predigt und Abendmahl, mit Liedern und Kirchenmusik, mit Wechselgesängen und Gebetsformen detailliert erklären, wollen wir zu einem konstruktiven und kreativen Umgang mit diesen Elementen für die jeweils gegebenen Situationen in den Gemeinden einladen. Auch die Vorstellung weiterer klassischer oder moderner liturgischer Formen hat einen ähnlichen praktisch-einladenden Sinn.
Dieses Buch ist von zwei Autoren geschrieben worden, deren Geburtsjahrgang, regionale Herkunft, Bildungswege und Tätigkeitsfelder sich bei aller Gemeinsamkeit dennoch unterscheiden. Wir haben über der Arbeit am Manuskript gespürt, wo wir in Sachen Gottesdienst jeweils eigene Akzente setzen möchten. Und wir haben versucht, diese Unterschiede für die Leserinnen und Leser fruchtbar zu machen. Denn eine vollständige Einmütigkeit hinsichtlich Liturgie lässt sich wohl nur schwer herstellen – dafür ist der Gottesdienst auch zu persönlich. Dennoch sind wir uns in einer Grundüberzeugung völlig einig: Wir lieben den Gottesdienst, und wir arbeiten liturgiewissenschaftlich-theoretisch und praktisch-gestalterisch sehr gern für ihn. Wir wären glücklich, wenn wir auch mit Hilfe dieses Büchleins unseren verschiedenen Leserinnen oder Lesern etwas von unserer Liebe zum Gottesdienst mitteilen könnten. Liebe zum Gottesdienst entsteht nicht von allein. Sie hängt auch nicht nur davon ab, ob man regelmäßig an schön gestalteten und gut besuchten Gottesdiensten teilnimmt. Nach unserer Überzeugung entwickelt sie sich auch und gerade dort, wo Menschen anfangen, sich in die inneren Fragen des Gottesdienstes hineinzudenken und mehr von seinen Intentionen und Traditionen und seinem spirituellen Potential zu verstehen. Diesem Anliegen wollen wir mit diesem Buch dienen.
Halle und Leipzig, im Februar 2014
Erik Dremel, Wolfgang Ratzmann
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
1Wozu Gottesdienst?
1.1Begriffe und Bedeutungen
1.2Gründe für den Gottesdienst
1.3Gottesdienst feiern und Gottesdienst leben
1.4 Leben ohne Gottesdienst
Zusammenfassung
2 Stationen aus der Gottesdienstgeschichte
Ein Bild anstelle einer Zusammenfassung
3 Gottesdienst nach der Agende
3.1 Agende
3.2 Das Evangelische Gottesdienstbuch (EGb)
3.3 Strukturelemente des klassischen Gottesdienstes
Zusammenfassung
4 Gottesdienst in vielen Formen
4.1 Die Einheit der Gemeinde und die Pluralität der Bedürfnisse
4.1.1 Gemeinde oder Individualität
4.1.2 Lebensweltlich oder gegenweltlich
4.2 Die klassische Vielfalt
4.2.1 Tagzeiten- und Gebetsgottesdienste
4.2.2 Andacht
4.2.3 Kasualien
4.3 Alternative Gottesdienstformen und ihre Stärken
4.3.1 Liturgien anlässlich alternativer Orte und Zeiten
4.3.2 Liturgien für bestimmte Zielgruppen
4.3.3 Milieuorientierte neuere Formen
4.4 Ein plurales Gottesdienstangebot in den Gemeinden?
Zusammenfassung
5 Der Gottesdienst als Ort der Verkündigung
5.1 Liturgische Orte der Verkündigung
5.2 Die Aufgabe der Verkündigung
5.3 Der Prediger / die Predigerin zwischen Person und Amt
5.4 Die Predigt zwischen Text und Situation
5.5 Die Predigthörer
5.6 Den Predigtentwurf gestalten
5.7 Eine Predigt halten
Zusammenfassung
6 Blickpunkt Abendmahl
6.1 Mahl und Gastfreundschaft
6.2 Mahl in der Bibel
6.3 Jüdischer Speisesegen
6.4 Jesu Pessach-Mahl
6.5 Emmaus
6.6 Abendmahl – Messe – Eucharistie?
6.7 Freude und Fürsorge
6.8 Dritte Zeitdimension – das Künftige
6.9 Streit ums Abendmahl
6.10 Probleme mit dem Abendmahl
6.11 Wort und Sakrament
6.12 Die einzelnen Stücke des Abendmahls
6.13 Abendmahl praktisch
Zusammenfassung
7 Den Gottesdienst vorbereiten
7.1 Texte auswählen und vorbereiten
7.2 Lieder und Kirchenmusik auswählen
7.2.1 Zur Bedeutung von Musik und Liedern
7.2.2 Kriterien für die Liedauswahl
7.2.3 Die Lieder im Verlauf des Gottesdienstes
7.2.4 Wer wählt die Lieder aus?
7.3 Gebete formulieren
7.4 Gottesdienstordnungen erstellen
7.5 Den Raum vorbereiten
7.6 Für den Gottesdienst beten
Editorial zur Reihe
Zu den Autoren
Weitere Bücher
1 Wozu Gottesdienst?
1.1 Begriffe und Bedeutungen
Es ist Sonntagvormittag. Die Glocken läuten. In vielen Städten und Dörfern unseres Landes gehen Menschen zum Gottesdienst. Oft sind es eher wenige und ältere Personen. Aber es gibt auch Gemeinden, beispielsweise in den Großstädten, in denen regelmäßig viele Menschen zum Gottesdienst gehen, darunter auch viele jüngere. Ihnen ist der Gottesdienstbesuch wichtig. Sie brauchen ihn. Warum? Und es fällt auf, dass an bestimmten Tagen wie zum Beispiel am Erntedankfest oder am Heiligen Abend sehr viele Menschen zur Kirche gehen, darunter auch Nichtchristen. Was erwarten sie gerade an einem solchen Tag, warum gehen sie hin?
Durchschnittlich sind es nur knapp 4% der Mitglieder der Evangelischen Kirchen in Deutschland, die sonntags einen Gottesdienst besuchen. Für viele Menschen – auch für viele Gemeindeglieder – ist der Gottesdienst also nicht so wichtig, dass sie sich wöchentlich zu ihm aufmachen würden. Wieso gehen sie nicht hin? Offenbar brauchen sie ihn nicht, jedenfalls nicht in jeder Woche. Wozu werden überhaupt Gottesdienste gefeiert? Wozu braucht man sie?
Gottesdienste werden in allen Religionen und christlichen Konfessionen gefeiert. Allgemein kann man sie als religiöse Handlungen verstehen, mit denen Gläubige Gott bzw. Götter verehren. Dabei bevorzugen die verschiedenen christlichen Konfessionen unterschiedliche Begriffe, wenn sie vom Gottesdienst reden. Die Evangelischen gebrauchen schon seit der Reformation gern die Bezeichnung Gottesdienst, wenn sie von dem reden, was sonntags oder feiertags in der Kirche geschieht. Das hängt mit Martin Luther zusammen, der gerade an diesem Begriff die Doppelbedeutung schätzte, dass hier Gott uns Menschen in besonderer Weise dient, indem er uns sein Wort und seine Sakramente (Taufe, Abendmahl) anbietet, und dass wir hier Gott dienen dürfen mit unserem Gebet und Lobgesang, d.h. mit unseren Gemeindeliedern und unserer sonstigen Musik im Gottesdienst. Diese beiden Funktionen des Gottesdienstes hatte der Reformator bei der Einweihung der Schlosskapelle in Torgau herausgestellt.
Die römisch-katholischen Christen haben bis zumII. Vatikanischen Konzil fast ausschließlich von der »Messe« gesprochen, weil in ihr die Feier der »Eucharistie«, des Abendmahls, in festlicher liturgischer Gestalt den Mittelpunkt der gemeinsamen Feier bildet. Seitdem hat sich aber hier auch mehr und mehr der Begriff Gottesdienst eingebürgert. Und in der orthodoxen Christenheit spricht man lieber von der »Heiligen Liturgie« und deutet damit an, was hier im Zentrum dieser Versammlung steht: die Teilnahme am Erlebnis der Liturgie mit ihren besonderen Gesängen, mit ihren geheimnisvollen Handlungen und mit ihrer Schau ins Heilige, das bei dieser Feier im heiligen Raum ermöglicht werden soll.
Den Begriff Liturgie verwenden wir in der Evangelischen Kirche auch. Wir bezeichnen mit ihm die konkrete Gottesdienstordnung – und manchmal wird er unsachgemäß ausschließlich für die Wechselgesänge zwischen Liturg und Gemeinde benutzt. Damit wird er völlig verkürzt und um seinen Sinn gebracht. Denn er war von Anfang an stets auf die Feier des ganzen Gottesdienstes bezogen, die Predigt mit eingeschlossen. Wenn Liturgie die gesamte Form der Feier des Gottesdienstes meint, dann kann es nie »unliturgische« Gottesdienste geben. Auch eine neue Gottesdienstform ist Liturgie. Man kann allenfalls fragen, ob unsere übliche Liturgie vielleicht zu stark traditionsorientiert geprägt ist oder ob die in unserer Gemeinde praktizierte Gottesdienstform noch das Gefühl aufkommen lässt, dass Gottesdienst eine Feier ist und nicht eine Art Unterweisung. Doch auch eine stark pädagogisierte Gottesdienstform ist eine – wenn auch schlechte – Liturgie.
1.2 Gründe für den Gottesdienst
Wozu braucht man denn Gottesdienste? Wir möchten auf diese Frage zwei Antworten geben, die sich gegenseitig ergänzen:
a) Die eine Antwort ist sozusagen eine Auskunft »von oben« her, geprägt von der Bibel und der klassischen evangelischen Theologie. Sie stellt im Anschluss an Martin Luther heraus, dass hier Gott uns Menschen »dient«, indem er uns mit seinem Wort begegnet. Dieses Gotteswort ist vor allem in den Lesungen und der Predigt enthalten. Deshalb legt gerade der evangelische Gottesdienst viel Wert darauf, dass die Lesungen sinnvoll ausgewählt und überzeugend vorgetragen werden, und dass die Predigt das biblische Wort lebendig und verständlich in unsere heutige Lebens- und Glaubenswelt übersetzt. Das Wort Gottes durchzieht aber darüber hinaus die ganze Liturgie, insofern auch unsere Lieder oder unsere Gebete von ihm mitgeprägt sind. Mit seinem Wort dient Gott den Menschen, wenn sie sich im Gottesdienst versammeln und wenn sie sich öffnen für diese Gottesanrede.
Diese erste Antwort muss noch vervollständigt werden: Gott begegnet uns im Gottesdienst nicht nur mit dem hörbaren gelesenen oder gepredigten Wort, sondern auch unter bestimmten zeichenhaften heiligen Handlungen, die wir »Sakramente« nennen. So wie wir Menschen nicht nur mit unseren Stimmen reden, sondern auch mit unseren Händen, mit unserem Gesicht, mit unserem ganzen Körper, so wendet sich Gott auch »körpersprachlich« den Menschen zu. Im Gemeindegottesdienst ist es vor allem das Heilige Abendmahl, in dem Jesus Christus uns in besonderer Weise nahekommt. Gleiches lässt sich auch von der Taufe sagen. Neben den Sakramenten erweisen sich im Gottesdienst weitere symbolische Handlungen als Zeichen der Nähe Gottes, wie z.B. das gemeinsame Beten und Singen der Lieder ebenso wie der Zuspruch des Segens.
Wir brauchen den Gottesdienst, weil hier Gott den Menschen mit seinem Wort und den Zeichen seiner Nähe dient. Er ist so gesehen unendlich wichtig, und jeder Gläubige bräuchte deswegen wöchentlich oder vielleicht noch öfters eine Teilnahme am Gottesdienst. Aber ist diese erste Antwort nicht viel zu vollmundig – angesichts mancher kümmerlich gestalteter und schwach besuchter Gottesdienste?
Nein, sie gilt, auch wenn Menschen immer wieder einmal davon wenig spüren. Das kann wohl nicht anders sein, denn Gottesdienste sind ja zugleich Versammlungen, die von Menschen verantwortet und erlebt werden und die aus ganz verschiedenen Gründen auch misslingen können. Diese erste Antwort gilt dennoch, weil sie sich auf biblische Zusagen stützt, wie z.B. auf das Versprechen Jesu, dass er da sein wird, wenn »zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind« (Mt 18,20) und weil immer wieder auch Menschen bezeugt haben, dass sie hier – bei der Predigt, beim Abendmahl, beim Singen der Lieder oder beim Segen – die Gegenwart Gottes in besonderer Weise erfahren haben und erfahren.
b) Die zweite Antwort ist demgegenüber eher eine Auskunft »von unten«, vom Menschen her. Sie bemüht sich um Argumente, die auch Nichtgläubigen einleuchten können. Sie denkt ganz von anthropologischen Perspektiven her, um die sich verschiedene Wissenschaften bemühen:
So weisen einmal Kulturphilosophen und -soziologen in ihren Forschungen darauf hin, dass der Mensch nicht nur als »Homo Faber« angelegt sei, der sich mit dem Alltag und mit seiner Arbeit begnüge, sondern dass er auch von dem Bedürfnis nach Unterbrechung des Alltags und nach Fest, Feier und Muße bestimmt sei. Er sehne sich nach dem Schönen, nicht nur nach dem Zweckmäßigen. Gottesdienste erfüllten für viele Menschen dieses Bedürfnis nach Feierlichkeit, nach dem Besonderen und Schönen, das der Entwicklung der Kultur zugrunde liege. Gottesdienste seien nicht zuerst zur katechetischen Belehrung da, sondern wären eher eine Art »heiliges Spiel«.
Zum anderen sind viele Pädagogen davon überzeugt, dass alles, was Bedeutung für Menschen haben soll, nicht nur als reiner Gedanke existieren kann, sondern seine wahrnehmbare Gestalt braucht. Wenn der Glaube für uns Menschen Bedeutung haben soll, dann braucht er Formen der Darstellung, in der er den Gläubigen immer wieder nahegebracht wird und durch die sie in ihm vergewissert werden. Das sei die besondere Aufgabe des Gottesdienstes.
Besonders wichtig ist die anthropologische Perspektive, die Ritualforscher einnehmen. Dabei spielen psychologische und ethnologische Erkenntnisse eine wichtige Rolle. Für sie ist Gottesdienst vor allem ein Ritual. Dabei sind Rituale nicht etwa als inhaltlich entleerte oder gar krankhafte Handlungen zu verstehen, sondern als Ereignisse, die ganz elementar zum Menschen gehören. Das, was dem Menschen ganz wichtig ist, das drückt er in symbolischen Handlungsfolgen aus, die man als Rituale bezeichnet. Das gilt besonders für religiöse Überzeugungen, die das Alltagswissen übersteigen und auf Gott oder das Heilige hinweisen. Rituale finden besonders in Übergangssituationen des Lebens statt, an besonderen Zeitschwellen, wie z.B. zum Beginn einer Ehe, die mit besonderen Hoffnungen und Ängsten verbunden ist. In ihnen haben solche Gefühle einen geschützten Raum und hier werden sie bearbeitet. Rituale helfen, die Zeit zu strukturieren, wichtiges kollektives Wissen zu überliefern und eine überindividuelle Sprache zur Verfügung zu stellen, die – z.B. in Krisensituationen – helfen kann, das Leben zu deuten und zu meistern.
Nimmt man diese Erkenntnisse ernst, dann entdeckt man in unseren Sonn- und Festtagsliturgien, aber auch in den Kasualgottesdiensten (Trauung, Konfirmation, Bestattung usw.), viele rituelle Momente. Und im Ganzen versteht man wohl auch besser, warum sich Gottesdienste in ihren liturgischen Formen und in ihrer Sprache oft stark an die liturgische Tradition anlehnen. Auch der christliche Gottesdienst wird offensichtlich gebraucht, weil er wichtige rituelle Funktionen erfüllen und Menschen besonders in Schwellensituationen stützen kann. Gottesdienste können eine seelsorgerliche Funktion übernehmen. Es gibt Menschen, die dringend darauf warten, den Segen zugesprochen zu bekommen, weil sie in tiefen Selbstzweifeln leben. Und andere erleben das Singen eines Liedes von Paul Gerhardt, wie z.B. »Befiehl du deine Wege«, als eine Art therapeutischen Prozess, auch wenn sie das selbst nicht so nennen würden. Das Singen des Liedes in der Gemeinschaft der Gottesdienst-Feiernden stärkt sie.
Allerdings bekommen die Kirchen in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft von verschiedenen Institutionen Konkurrenz, die ebenfalls Riten für bestimmte Lebenslagen anbieten. Dazu zählen nicht nur andere Religionen, sondern auch sich als nichtreligiös verstehende soziale Verbände und Vereine (wie z.B. Vereine, die in Ostdeutschland das »Schwellenritual« Jugendweihe neben der Konfirmation anbieten).
Es gibt also eine Fülle von Gründen, weswegen Menschen den Gottesdienst brauchen. Sie gehen auf jeden Fall über das hinaus, was jeder bzw. jede Einzelne in einer konkreten Feier erlebt. Wir feiern Gottesdienst, weil er unter der Verheißung steht, dass Gott selbst dem Menschen hier in besonderer Weise nahekommt. Das geschieht allerdings nach der evangelischen Grundüberzeugung nicht direkt, sondern immer nur indirekt: Unter der Gestalt menschlicher Worte erreicht uns Gottes Wort; unter dem gemeinsamen Essen und Trinken von Brot und Wein wird er selbst unter uns gegenwärtig; liturgische Zeichen und Handlungen weisen uns auf seine Nähe hin und sprechen uns seine Begleitung zu. Deshalb hat der heilige Benedikt schon im 6. Jahrhundert geschrieben, dass dem Gottesdienst »nichts vorzuziehen« sei. Wegen seiner zentralen Bedeutung sollte der Gottesdienst in der Mitte einer jeden Gemeindearbeit stehen, sollte er mit Sachverstand und Liebe gestaltet und von vielen Gemeindegliedern besucht werden.
1.3 Gottesdienst feiern und Gottesdienst leben
Es gibt allerdings viele Menschen, die den miteinander gefeierten Gottesdienst zur Disposition stellen, indem sie seinen Wert für die Charakterbildung und ein ethisch verantwortliches »christliches« – den Geboten Gottes gemäßes – Leben bezweifeln. Aber darf man den Sinn des gefeierten Gottesdienstes sozusagen moralisch abrechnen?
Es ist dem Gottesdienst gegenüber in der Tat nicht angemessen, ihn nur nach seinem Nutzen für die individuelle Lebenspraxis der Gläubigen zu bewerten. Und dennoch stellt schon das Neue Testament solche Zusammenhänge her. Paulus spricht beispielsweise im Römerbrief davon, dass Christen nicht einfach die ethischen Maßstäbe der »Welt« übernehmen sollen, sondern dass sie in einem durch Christus erneuerten Sinn leben sollten. Das sei ihr »vernünftigerGottesdienst« (Röm 12,1). Paulus kennt also neben dem gefeierten bzw. veranstalteten Gottesdienst sozusagen noch einen ganz anderen »Dienst für Gott«: den des christlichen Lebens. Das ganze Leben der Christen soll als Gottesdienst verstanden werden. Wenn man diese Einsicht übernimmt, dann hat das einmal Konsequenzen für die Gestaltung der Liturgie, denn sie sollte sich auf das reale Leben der Christen beziehen lassen – man denke dabei vor allem an die Predigt und die Fürbitten. Alles, was Christen tagtäglich beschäftigt, soll und kann hier in das Licht des Evangeliums gerückt werden. Zum anderen hat das Konsequenzen für die ganz alltägliche Lebenspraxis. Wenn das ganze Leben als Gottesdienst verstanden werden kann und soll, dann geht es nicht nur um eine ethisch verantwortliche Lebensgestaltung, sondern zugleich auch um eine hohe Würde, die dem einzelnen Menschen in seinem Beruf, in seinen häuslichen Tätigkeiten, in der Gestaltung von Ehe und Familienleben zukommt. Martin Luther hat diese Würde gemeint, wenn er davon spricht, dass auch die Magd, die den Hof kehrt, in ihrer Weise einen »Dienst für Gott« tut. Es kann sich also auch um Dienste handeln, die in der Gesellschaft wenig angesehen sind, die sich aber dennoch der Anerkennung Gottes erfreuen.
Der gelebte und der gefeierte Gottesdienst sind wechselseitig aufeinander bezogen: In der gottesdienstlichen Feier wird der Alltag des Lebens symbolisch vor Gott gebracht und werden Würde und Aufgabe des christlichen Lebens immer wieder neu bewusst gemacht; im Dienst für Gott im Alltag realisieren Christen ihre Zugehörigkeit zu Gott durch ihr praktisches Tun. Es geht keinesfalls um eine Alternative, wonach die einen Gott mit ihren Liedern und Gebeten und die anderen mit ihrer Hände Arbeit dienen könnten. Paulus war mit seiner Bemerkung vom »vernünftigen Gottesdienst« weit davon entfernt, mit ihr den Christen einen Dispens von der Teilnahme am christlichen Gottesdienst zu erteilen. Eine solche Deutung von Paulus oder Luther bürgerte sich erst bei vielen Evangelischen ein, die im Zuge der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft nicht mehr verstanden, wozu sie die gottesdienstliche Feier in der Gemeinde brauchen und warum sie daran teilnehmen sollten.