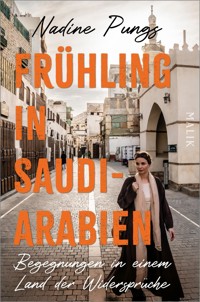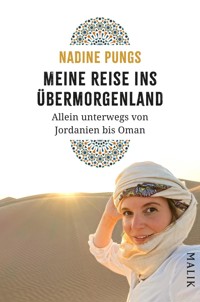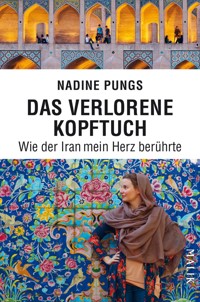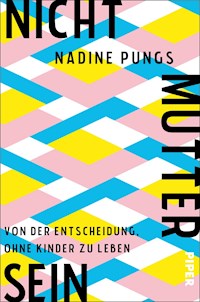
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Umstandslos glücklich Nadine Pungs möchte keine Mutter sein. In den Augen der Gesellschaft gilt sie deshalb als egoistisches Mängelwesen und muss sich immer wieder für ihre Entscheidung rechtfertigen. Mit ihrem Buch legt sie den Finger in die Wunde und argumentiert für weibliche Körperherrschaft, die sie selbst erst ganz zum Schluss radikal lebt. Sie spricht mit Müttern und Nichtmüttern über Ängste und Hoffnungen, plädiert für das Kinderwunschlosglück und zeigt, was körperliche Selbstermächtigung in letzter Konsequenz bedeutet. Mal zart, mal zornig macht Pungs klar, wie politisch für Frauen selbst das Intimste ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Meiner Mutter
Der Abdruck folgender Zitate erfolgte mit freundlicher Genehmigung von:
Die Ärzte, Abschied (Songtext), K/T: Farin Urlaub; V: Edition FUHURU/PMS Musikverlag GmbH
Gustave Flaubert, Madame Bovary. Roman; aus dem Französischen von Maria Dessauer; © Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1996
John Irving, Gottes Werk und Teufels Beitrag; aus dem Amerikanischen von Thomas Lindquist; Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1988, 1990 Diogenes Verlag AG Zürich
Janosch, Geburt, aus: Janosch, Das Wörterbuch der Lebenskunst, S. 34 © Janosch/Little Tiger Verlag GmbH, Gifkendorf
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagabbildung: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Anmerkungen
Dankwort
Literatur
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Eine Bewegung gibt es nur, wenn sich Menschen bewegen.
Gloria Steinem
Prolog
Als sie mich holen, friere ich ein wenig. Auf meinen Unterarmen haben sich die Härchen aufgestellt. Die Wände im Flur sind gelb wie Butter, der scharfe Geruch von Desinfektionsmittel hängt im Linoleumboden. Ich soll aus dem Bett aufstehen und die letzten Meter laufen, mein Hemd ist mit kleinen Quadraten bedruckt und an der Rückseite offen. Die Krankenschwester hilft mir auf eine Liege, die wie ein Altar in der Mitte des Raumes steht. Sie bindet meine Beine fest, das sei besser, sagt sie, wegen der Narkose. Auf dem Ultraschallbild sehe alles gut aus, fügt sie schnell hinzu. Sie trägt eine blaue Haube und einen Mundschutz, genauso wie der Anästhesist. Sind Sie bereit, fragt er mich. Ich bin bereit und stelle mir vor, dass er unter seinem Mundschutz lächelt. Er nimmt meinen Arm, sucht eine Vene, klopft, dann gleitet die Nadel hinein, und mein Herz beschleunigt den Takt. Ich kann jetzt spüren, wie das Propofol in meinen Blutkreislauf sickert. Zäh und schwarz. Wie Erdöl, das ins Meer fließt. Es strömt von meinem Arm hinauf in die Schultern, rinnt in den Hals, belegt die Stimmbänder, tropft in die Brust. Mein Körper wird schwer, ich verliere die Kontrolle über ihn und fürchte mich vor der Dunkelheit. Das Öl schießt in den Bauch, ergießt sich in den Schoß, füllt mich aus. Es überzieht die Oberschenkel, die Waden, flutet die Zehen. Gleich werden sie einen Beatmungsschlauch durch meinen Mund in die Luftröhre schieben. Das Öl sprudelt in die Nase, schwappt in meine Augen. Bis alles finster ist. Und still.
1
Du willst keine Kinder? Ach, das sagst du nur, weil du noch keine hast, aber erst Kinder machen das Leben lebenswert, das wirst du schon sehen, du weißt nicht, was du verpasst, warte mal, bis du welche bekommst, das ist nur eine Phase, jede normale Frau wünscht sich ein Baby, wenn der Uterus einmal anspringt und sein Recht einfordert, dann mit der Wucht eines Atomkraftwerks, dagegen bist du machtlos, außerdem wärst du eine so schöne Mutter, Babys würden dir so gut stehen, glaub mir, du hast doch ein gebärfreudiges Becken, mach was draus, und deine Mutter würde sich bestimmt über Enkel freuen, hab du erst mal Kinder, dann weißt du, was echte Liebe bedeutet, nur dann bist du komplett, wann dürfen wir mit Nachwuchs rechnen, du willst der Gesellschaft doch was zurückgeben, und es ist ja das Natürlichste der Welt, auch du hörst irgendwann die biologische Uhr ticken, ticktack, vergiss nicht, Kinder sind unsere Zukunft, ohne Kinder sterben wir aus, stell dir vor, jeder würde so denken wie du, echt traurig, wer soll denn unsere Rente bezahlen, du bist ein demografischer Blindgänger, hab du erst mal Kinder, dann weißt du, was echte Müdigkeit bedeutet, als Kinderlose hast du bestimmt viel Geld, fliegst bestimmt immer in die Karibik, aber hast du denn keine Angst, im Alter allein zu sein, niemand wird dich im Pflegeheim besuchen kommen, absolut niemand, ohne Kinder wirst du später komisch, du bist unreif, bist zu kalt, um zu lieben, ist dir deine Karriere etwa wichtiger, Muttersein ist doch der schönste Job der Welt, wer soll denn unseren Sozialstaat finanzieren, du bist egoistisch, irgendwann wirst du das bitter bereuen, es gibt Frauen, die können keine Kinder bekommen, obwohl sie sich welche wünschen, schäm dich, du liebst deinen Mann wohl nicht, wenn du dir keine Kinder von ihm wünschst, willst du deine Familie nicht erhalten, deine Gene sichern, wirst du dann so eine verrückte Katzenlady, du bist ein Freak, oder magst du etwa keine Kinder, bist du eine Kinderhasserin, du warst doch selbst mal ein Kind, was würdest du sagen, hätten deine Eltern so gedacht, du bist undankbar, mit den eigenen Kindern ist das doch etwas anderes, die wirst du lieben, glaub mir, du musst nur den Richtigen finden, du bist zu wählerisch, du bist nicht wählerisch genug, Kinder schweißen ein Paar total zusammen, du weißt aber schon, wie man Babys macht, Kinder geben einem so viel zurück, man begreift ja erst durch die Kleinen, was wichtig ist und was nicht, aber das kannst du ja nicht wissen, du bist ja noch jung, als ich so jung war wie du, wollte ich auch keinen Nachwuchs, das ändert sich, glaub mir, aber du solltest dich langsam mal beeilen, du bist ja schon alt, und irgendwann klappt es nicht mehr, das geht schneller, als dir lieb ist, und sowieso die Liebe, ach, keine Liebe ist reiner als die Mutterliebe, hab du erst mal Kinder, dann weißt du, was echte Verantwortung bedeutet, bist du denn nicht neugierig, wie es aussähe, du kannst ja gar nicht mitreden, was machst du denn den ganzen Tag, ist dir nicht langweilig, Kinder sind ein Geschenk Gottes, Babys riechen gut, und wer weiß, vielleicht würde dein Kind ja die Welt verbessern, oder bist du etwa lesbisch, man muss einfach machen, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, nicht nachdenken, es wird dir sonst später leidtun, hab du erst mal Kinder, dann weißt du, was echtes Erwachsensein bedeutet, du versäumst doch etwas, oder hast du Angst, dass du dir deine Figur ruinierst, es heißt ja nicht umsonst Gebärmutter, wozu hast du das Organ, es gibt Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, denk doch mal an die, der Körper einer Frau ist dafür gemacht, und die Geburtsschmerzen vergisst man ganz schnell, oder klappt es bei dir etwa nicht, bleib dran, es ist total normal, dass Frauen schwanger werden, das ist der Lauf der Dinge, glaub mir, ansonsten gibt es gute Kliniken dafür, und was willst du denn sonst anstellen mit deinem Leben, wenn du keine Familie gründest, du bist nur eine richtige Frau, wenn du auch ein Kind bekommen hast, diese Erfahrung macht dich vollständig, du wärst so eine tolle Mutter, das weißt du nur noch nicht, du kannst die Biologie nicht einfach so ignorieren, warst du deswegen schon beim Psychologen, hattest du etwa eine schwere Kindheit, echt schade, dass du keine Kinder willst, bist du dir wirklich sicher?
2
Die Mutter aller Fragen lautet: Warum haben Sie keine Kinder?[1] Diese vermeintlich harmlose Erkundigung ist intim, denn sie impliziert, dass naturgemäß ein allgemeines Interesse an meinem Sexualleben und meiner Reproduktion existiert, obwohl das niemanden zu interessieren hat. Mein Körper wird zum öffentlichen Raum erklärt. Ich soll Männer reinlassen und Babys rauslassen.[2] Das Land liegt mit im Bett. Da die Mehrheit der Frauen im Laufe ihres Lebens Kinder bekommt, scheint die Frage nach meiner unwilligen Gebärmutter berechtigt. Eine Frau ist eine Frau ist eine Mutter. Weiblichkeit und Mütterlichkeit gehören zusammen wie Kastor und Pollux. Immer noch.
Tatsächlich kapiere ich diese inquisitorische Frage nach meiner Kinderlosigkeit nicht. Denn ich brauche keine Gründe, Mutterschaft zu verweigern. Es ist meine Sache. Vielmehr braucht es Gründe, um Kinder überhaupt in die Welt zu setzen.[3] Dass mir diese Frage im 21. Jahrhundert überhaupt noch so nonchalant gestellt wird, ist erstaunlich. Aber auch ich erwische mich manchmal dabei, normativ zu denken. »Warum hat die eigentlich keine Kinder?«, überlege ich verstohlen, wenn mir eine kinderlose Frau über vierzig begegnet. Reflexhaft stelle ich mir vor, sie könne bekümmert sein oder einsam. Weshalb kommt mir diese Mutmaßung in den Sinn? Vielleicht ist sie weder bekümmert noch einsam unterwegs, sondern umstandslos glücklich. Ich denke solche Gedanken, weil ich es so gelernt habe. Wie die allermeisten kleinen Mädchen, denen Muttersein als Mutterglück versprochen wurde, habe auch ich derartige Vorstellungen verinnerlicht. Obwohl es sich falsch anfühlte, glaubte auch ich, Mutter werden zu wollen. Weil doch alle wollen. Oder nicht? Maternität wird uns schon früh als Lebenssinn eingepflanzt, bis wir sie schließlich als Essenz unserer Weiblichkeit begreifen. Es gilt: »Frauen muttern!«[4] Liebe, Wärme, Mutterglück. All das erwartet uns scheinbar, wenn wir nur unserer wahren Bestimmung folgen. Der Duden definiert Mutterglück als das Glücksgefühl, Mutter zu sein. Aber wer hat uns dieses Mutterglück angelobt? Die eigene Mutter? Die Lehrerin? Die Politik? Der Pastor? Die Wirtschaft? Die Gesellschaft? Wir selbst? Und kann es auch das Nichtmutterglück geben? Das Glücksgefühl, keine Mutter zu sein?
Tante Fine hatte drei Söhne großgezogen, und ihr Körper erzählte unergründliche Geschichten von Vereinigung und Schwangerschaft. In meiner Erinnerung besteht sie hauptsächlich aus Brust, Bauch und Hüfte, ähnlich den Venusfigurinen, die in archäologischen Siedlungen gefunden wurden. Sie roch immer nach Flieder und Heißmangel, und wenn sie lachte, zog sich ein Netz aus Falten über ihr Gesicht. Zu meinem dritten Geburtstag schenkte sie mir eine Babypuppe. Sie drückte mir den Plastiksäugling in den Arm und feixte: »Dat is nu dien Blach.« Ihre Dauerwellenlöckchen wippten zustimmend. Die Babypuppe hatte keine Haare, dafür Speckröllchen aus Vinyl, und sie trug einen rosa Strampler. Sowie man sie auf den Kopf stellte, weinte sie, der Schnuller purzelte ihr aus dem Mund, und sie starrte mich aus ihren großen Glasaugen vorwurfsvoll an. Ich fand sie hässlich, geradezu unverschämt in ihrer Forderung, mich um sie kümmern zu müssen, obwohl ich das nicht wollte. Meine Mutter steckte derweil Trauben auf Käsespieße und bemerkte meine Enttäuschung über das Geschenk genauso wenig wie Tante Fine, die bereits ins Wohnzimmer gestiefelt war.
Ich bin ein Wunschkind. Ich habe die Wangenknochen meiner Mutter und die Lippen meines Vaters. Meine Eltern kannten sich sechs Monate, als sie beschlossen, eine Familie zu gründen. Sie hatten sich in einer Disco kennengelernt, irgendwo in einer niederrheinischen Provinzstadt morgens um halb drei. Meine Mutter verliebte sich in die traurigen Augen meines Vaters, und er mochte ihr blondes Haar.
Vater servierte Asti Spumante, sobald sich Tante Fine auf das Sofa plumpsen ließ. Ich kletterte zu ihr hinauf, presste mich an ihren schweren Busen, um mein schlechtes Gewissen ob meines Unmuts zu beruhigen, und sog ihren Fliederheißmangelgeruch ein. Die Babypuppe blieb auf dem Boden sitzen und schaute anklagend in die Runde. »Isch habbet Reißen inne Glieder, isch glaub, et jibt ander Wetter«, behauptete Tante Fine, trank ihr Sektglas zur Hälfte und zwinkerte mir zu. Vater verstand die versteckte Botschaft und holte unverzüglich den Fernet-Branca aus dem Einbauschrank. Als Tante Fine zwei Stunden, vier Likörchen und sieben Käsespieße später ging, legte ich das Baby in meine Spielzeugkiste und schloss den Deckel.
»Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.« Diesen tausendfach zitierten Satz schrieb die Philosophin Simone de Beauvoir in ihrem berühmten Buch Le Deuxième Sexe. 1949 erschien ihr Manifest, das bis heute den Feminismus maßgeblich beeinflusst. Mit kühler Beobachtung dekonstruiert Beauvoir darin vermeintliche weibliche Eigenschaften und führt sie stattdessen auf soziale und kulturhistorische Prägungen zurück. Die Biologie der Frau werde dazu benutzt, sie auf die vorgeblich natürliche Mutterrolle festzulegen. Beauvoirs Buch löste einen Skandal aus, wurde von Kritikern verrissen und vom Vatikan auf den Index gesetzt. All das ist über siebzig Jahre her. Die Welt hat sich seitdem verändert. Wir klonen Schafe, haben das Internet erfunden, die Desoxyribonukleinsäure entschlüsselt und handeln mit Kohlenstoffdioxid-Zertifikaten, es gibt Eiscreme mit Aalgeschmack und Katzenvideos. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und wir gehören zu jener Generation, die den höchsten Freiheits- und Lebensstandard der Menschheitsgeschichte erleben darf. Viele Türen, die jahrhundertelang verschlossen waren, stehen nun sperrangelweit offen. Doch eben weil sich die Gesellschaft so rasant verändert und klassische Rollenmuster hinterfragt werden, flackert ein fast überwunden geglaubtes Bedürfnis nach eindeutigen Geschlechterverhältnissen wieder auf. Etliche Menschen fühlen sich überfordert von Globalisierung, Digitalisierung, Feminismus und Klimaaktivismus. Manche suchen eine Lösung im Konservatismus. Oder im Nationalismus. Oder im Faschismus. Vielleicht sind das die üblichen Rückzugsgefechte, die mit Wachstumsschmerzen einhergehen. »Die Reizbarkeit des Verlierers nimmt mit jeder Verbesserung zu, die er bei anderen bemerkt«, sagte der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger.[5]
Fürwahr, wir müssen damit leben, dass zu einer offenen Gesellschaft auch Unflätigkeit, Rüpelei und Bösartigkeit gehören.[6] Fest steht aber ebenso: Mit dem Rechtsruck der letzten Jahre gingen altbekannte antifeministische Diskurse und Aktivitäten einher. »Vergesst nicht«, hatte bereits Beauvoir nahezu prophetisch vorausgesagt, »es genügt eine politische, ökonomische oder religiöse Krise – und schon werden die Rechte der Frauen wieder infrage gestellt. Diese Rechte sind niemals gesichert.«
Als die Türkei 2021 aus der Istanbul-Konvention austrat, die Gewalt an Frauen verhindern und bekämpfen soll, gab Staatspräsident Erdoğan als Begründung an: »Die Frau ist vor allem Mutter. Und sie ist für die Kinder da.« In Polen regiert die christlich-fundamentalistische PiS-Partei, die ein striktes Abtreibungsverbot durchgesetzt hat und Personen mit Uterus wie Menschen zweiter Klasse behandelt. In Afghanistan haben die radikal-islamistischen Taliban wieder die Herrschaftsgewalt übernommen, und Frauen dürfen nur noch mit Begleiter zur Arbeit. In Ungarn wurde eine Gebärprämie eingeführt, um der angeblich drohenden Islamisierung zu begegnen. Überall in Europa protestieren Abtreibungsgegner (weibliche wie männliche) mit Plastikföten und Kreuzen vor Arztpraxen und beschimpfen Patientinnen. In den USA steht die konservative Mehrheit des Supreme Court offenbar kurz davor, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu kippen.
In Deutschland macht die AfD antifeministische und rassistische Politik für den weißen Schlichtmichel. Wie die alten Nazis verteidigen auch die neuen Nazis die Heimat an der Gebärfront und verlangen mit völkischer Inbrunst, dass sich die Geburtenrate unter »deutschstämmigen Frauen« erhöhen solle. Vögeln fürs Vaterland! Desgleichen wabert auf den Querdenker-Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen der Antifeminismus durch die Reihen, etwa wenn Menschen aus der Esoterikerszene (darunter viele Heilpraktikerinnen und Schamaninnen, die von »weiblicher Intuition« salbadern) binäre Geschlechterbilder – weiblich oder männlich – vertreten und einer archaischen Fruchtbarkeitsidealisierung von Frauen nachhängen. »Diese Festschreibung auf Mutterschaft ist eine Gemeinsamkeit mit der extremen Rechten«, sagt die Soziologin Rebekka Blum.[7] Antifeministen eint die Forderung nach der traditionellen Kleinfamilie mit der klar definierten Rolle von Frauen als sorgende Mütter. Sexualaufklärung, Abtreibung und Sterilisation werden rigoros abgelehnt, denn sie vertragen sich nicht mit dem »nationalen Interesse« eines deutschen Bevölkerungswachstums. Das Wort »Volkskörper« hatte ich zuletzt im Geschichtsunterricht gehört, jetzt ist es wieder da.
Mir macht das Sorgen. Ja, die Neuen Rechten repräsentieren eine Minderheit in der Bevölkerung. Aber mir ist diese Minderheit zu groß. Zwar verspricht die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2021, mehr Feminismus zu wagen, indem sie die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließen, Paragraf 219a des Strafgesetzbuches (StGB) abschaffen und Beratungsstellen gegen Diskriminierung ausbauen will. Gleichwohl glauben immer noch Teile der Bevölkerung (auch aus der Mitte), dass der Uterus nicht der Frau, sondern der Gesellschaft gehört und dass es mit der Frauenemanzipation langsam mal gut sein müsse. Für diese Überzeugung braucht man nicht rechts sein. Der Leipziger Autoritarismusstudie der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Jahr 2020 zufolge haben jeder vierte Mann und jede zehnte Frau in Deutschland ein geschlossen antifeministisches Weltbild.[8] Und die Ewiggestrigen lassen sich ihre altherkömmlichen Geschlechterrollen nur ungern nehmen. Männer als Ernährer, Frauen als Mütter. Da gelten Reproduktionsrechte schnell als Gefährdung der »natürlichen Ordnung«.
Die Schriftstellerin Sheila Heti schreibt: »Eine nicht mit Kindern beschäftigte Frau hat etwas Bedrohliches. Man hat das Gefühl, sie sei irgendwie unfertig. Was wird sie stattdessen machen? Was für einen Ärger?«[9]
Bin ich unfertig? Nur weil keine neuen Menschlein meinem Schoß entspringen? Lese ich deutsche Medien, könnte ich das zuweilen annehmen. Ein Kind gehört offenbar zum Leben wie die Schwerkraft. So fordert die FAZ im Jahr 2014: »Ruhe, ihr Jammer-Frauen!«[10] Angesprochen sind jene Frauen, die sich aufgrund sozialer oder politischer Motive gegen Kinder entscheiden und diese Entscheidung thematisieren. Der stern erklärt uns 2019, »Warum wir aufs Kinderkriegen nicht verzichten sollten«, denn immerhin lösen Kinder ja »ein unbeschreibliches Glücksgefühl« aus, das niemand verpassen darf.[11] Und jede Frauenzeitschrift titelt gefühlt mindestens einmal die Woche vom »Babyglück«, dem keine Frau entkommen kann (oder soll). Die Presselandschaft ist erfreulicherweise vielfältig, und nicht wenige Artikel zeigen ebenso leidenschaftlich die Gegenseite auf. So schreibt ZEITONLINE 2014: »Dass Kinderlose heute gesellschaftlich mehr geächtet werden als noch vor dreißig Jahren, ist beschämend für eine angeblich offene, tolerante Gesellschaft.«[12]
Höre ich Unionspolitikern zu, lese Kommentarspalten unter Artikeln oder scrolle durch Facebook, fallen mir vor lauter Fremdscham die Augen aus dem Schädel über die zur Schau gestellte Rückständigkeit, die in etlichen Köpfen herumgeistert wie ein uraltes Schlossgespenst. Der Unmut der Kleinbürger richtet sich dabei fast ausnahmslos gegen Frauen. Sie sind es, die angeblich lieber arbeiten und sich selbstverwirklichen wollen. Sie sind es, die zur Reproduktion ermutigt werden müssen. Sie sind es, die die nächste Generation an Beitragszahlern großziehen sollen. Und deshalb sorgt eine willentlich unbekinderte Frau noch heute bei einigen Zeitgenossen für rote Flecken im Gesicht. Irgendetwas in ihr scheint kaputt zu sein. Wenn schon nicht schwanger, dann wenigstens unheilschwanger.
»Kinderkriegen wird als so elementar wahrgenommen, dass an allen Ecken und Enden nach Gründen gesucht werden muss, wenn es nicht stattfindet«, schreibt die Publizistin Sarah Diehl in ihrem lesenswerten Buch Die Uhr, die nicht tickt.[13] Tatsächlich dominiert im Land der Dichter und Denker (gemeint sind die männlichen) immer noch ein seltsam antimodernistisches Mutterbild. Und das, obwohl in Deutschland jede fünfte Frau über 49 kinderlos ist (gewollt oder ungewollt). Im Westen mehr als im Osten, in der Stadt häufiger als auf dem Land. Auf eine Frau kommen im Schnitt bloß eineinhalb Kinder, auch wenn die Geburtenrate nach einem Einbruch in den 1990er-Jahren wieder leicht angestiegen ist. Die Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen ist im internationalen Vergleich besonders hoch. Hier sind 26 Prozent der Mittvierzigerinnen ohne Nachwuchs.[14] Deutschland gehört neben der Schweiz, Italien und Finnland zu den Ländern mit der höchsten Kinderlosigkeit in Europa. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Allein dadurch kommen in der Bundesrepublik – selbst bei steigenden Geburtenraten – absolut betrachtet weniger Kinder zur Welt, da es weniger Frauen im gebärfähigen Alter gibt.[15] Zuletzt wurde 1887 ein Überschuss an Neugeborenen verzeichnet. Dieser Trend ist weltweit zu beobachten. Laut einer Studie des Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington wird im Jahr 2100 die allgemeine Fertilitätsrate auf 1,66 Kinder pro Kopf gepurzelt sein; 1990 betrug der Wert noch 3,12.[16] Ein wichtiger Grund dafür ist der bessere Zugang zu Verhütungsmitteln.
»Die Reproduktion einer Bevölkerung ist gewährleistet, wenn die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, bei 2,1 liegt«, sagt die Bundeszentrale für politische Bildung.[17] Trotz der weitverbreiteten Gebärunwilligkeit gebärdet sich unser Gesetzgeber erstaunlich altväterisch. »Die Paragrafen 218 und 219 des Strafgesetzbuchs machen Deutschland zum Entwicklungsland.«[18] Dazu später mehr.
Gewiss, es könnte uns schlechter gehen. Auch dafür gibt es Beispiele in der Welt. Doch alte Röcke sehen nicht wieder wie neu aus, nur weil man noch ältere danebenlegt. Ich stelle fest: Die Reproduktionsungerechtigkeit bleibt das Kernproblem weiblicher Selbstbestimmung. Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern endet nämlich spätestens beim Thema Kinder. Die individuelle Entscheidung gegen die generative Fortpflanzung ist daher bis heute ein feministisches Thema mit hohem politischen Konfliktpotenzial. Zwar brauchen wir keine Suffragetten mehr, die dafür streiten, dass Frauen an die Wahlurne dürfen, aber wir brauchen jede Menge Mut, um uns von tradierten Erwartungen zu emanzipieren. Mut, uns zu verweigern. Mut, uns herauszuboxen aus Rollenklischees. Mut, unsere eigenen Erzählungen zu erschaffen. Dieses Buch ist deshalb ein Versuch, mein Nichtmuttersein als vollends gleichrangig neben dem Muttersein aufzustellen und das Bewusstsein für diese Form der Selbstermächtigung im sozialen Diskurs zu etablieren. Und ja, meine Methoden sind radikal. Denn Nichtmutterschaft ist politisch.
3
In der Grundschule zeigt uns der Lehrer einen Film, in dem eine Frau ein Baby zur Welt bringt. Sie liegt nackt in einem Krankenhausbett. Ihr Bauch ragt dick und titanisch wie ein Bergmassiv empor. Um sie herum stehen zwei weitere Frauen in Schürzen und Kitteln, die ihre Knie festhalten. Die Nackte verzieht das Gesicht zu einer Grimasse, zwischen ihren Beinen wellt sich schwarzes Haar. Eine männliche Stimme, die aus dem Off ertönt, erklärt, was wir sehen, aber ich höre nicht hin. Ich umfasse meinen Unterleib, bin durchdrungen vom Weh der Schwangeren, die stöhnt und die Zähne aufeinanderbeißt. Mir fällt ein, wie doll ich weinen musste, als ich mir den Kopf an der Tischkante stieß, und ich beginne, an meiner Leidensfähigkeit zu zweifeln. Zu gewaltig erscheint mir der Geburtsvorgang, von dem ich annehme, dass er eines Tages unweigerlich auch mich ereilen wird. Da meine Mutter einen Kaiserschnitt hatte, weiß ich nichts über den Schmerz einer Entbindung. Ich wurde ja aus ihrem Bauch geholt wie aus einem Korb. Dass auch ein Leben ohne Kinder möglich ist, will mir nicht in den Sinn. Alle erwachsenen Frauen, die ich kenne, sind Mütter. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, wie aus meinem zierlichen Mädchenkörper ein zweiter Körper herauskommen soll, ohne dass er mich zerreißt. Die Nackte hechelt wie ein Hund, ich halte den Atem an, nasse Haarsträhnen kleben an ihrer Stirn, dann verkündet die Männerstimme in einer Monotonie, die nicht zur Szene passt, dass es jetzt so weit sei. Die Frauen in den Kitteln und Schürzen feuern Wortfetzen auf die Nackte ab, sie schreit, ihre Wangen glühen, die Männerstimme schleppt sich von Satz zu Satz, sie gibt den Takt vor, die Kamera fährt zwischen die Beine, und plötzlich lugt ein Kopf aus dem schwarzen Haar hervor wie ein Maulwurf aus seinem Hügel. Das Bild zoomt heran, Hände greifen nach dem Kopf, drehen und ziehen, ich will wegsehen, doch es gelingt mir nicht, ich bin durch die Wucht der Aufnahme so erstarrt, als säße ich in einem Gefrierschrank. Endlich schießt der Rest des Säuglingskörpers aus der Frau heraus wie eine Fontäne. Er wird ihr auf die Brust gelegt. Blutig und pulsierend.
Vielleicht hat dieses Erlebnis meines achtjährigen Ichs bereits gereicht, um mich vom »rechten« Pfad abzubringen, um mir jedweden Wunsch nach Reproduktion auszutreiben. Doch so einfach ist es nicht. Ich muss tiefer graben. Jahrtausende tiefer. Muss Schicht für Schicht abtragen wie ein Archäologe.
Wo also anfangen? – Am Anfang, sagt meine Mutter. – Welcher Anfang? – Der Anfang von allem. – Der Anfang von allem ist die Urmutter, denke ich. Eva heißt sie, der Name bedeutet übersetzt »die Belebte«, und sie hat die Menschheit begründet. Tatsächlich sind da zwei Evas. Die biblische Eva und die mitochondriale Eva.
Im 1. Buch Mose formt Gott aus Adams Rippe eine Frau. Sie ist wissbegieriger als ihr Mann, denn sie will leben lernen und isst vom Baum der Erkenntnis. Als Folge der Selbstermächtigung, sich über das göttliche Verbot hinwegzusetzen und damit die absolute Autorität des Himmelsfürsten infrage zu stellen, werden Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben. Eva muss zur Strafe jeden Monat bluten und Kinder unter Schmerzen gebären.
Die mitochondriale Eva hingegen weiß nichts von ihrer Erbsünde. Ihre Bezeichnung stammt aus der Archäogenetik und meint eine Frau, aus deren mitochondrialer DNA die mitochondriale DNA aller heute lebenden Menschen hervorgegangen sein könnte. Die kleinen Zellkraftwerke, genannt Mitochondrien, und den dazugehörigen genetischen Bauplan erhält jedes Kind alleinig von seiner Mutter, die ihn ihrerseits schon von der Mutter geerbt hatte und so weiter und so fort.[19] Die Urmutter war weder die erste Frau noch die einzige Frau zu einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit. Eva hatte viele Mitschwestern; die mitochondrialen Erblinien der anderen Frauen starben aber aus, während die von Eva überlebte.[20] Von allen Menschenfrauen in jener Zeit (es gab nur wenige Tausend) ist es allein ihr gelungen, eine Genkette von Töchtern und Enkeltöchtern zu begründen, die bis heute reicht.[21] Als lucky mother wird sie deshalb in Anthropologenkreisen bezeichnet, sprich eine Mutter, die Glück hatte. Damit ist nicht das Mutterglück gemeint, denn Eva war ja lucky, nicht happy. Ich frage mich dennoch, ob es das Mutterglück, die Happiness über den eigenen Nachwuchs, schon vor 150 000 Jahren gegeben hat, also zu jener Zeit, in der Biologen den Beginn der Erbfolge seit der Urmutter Eva verorten.
Das Wort »Vaterglück« kennt der Duden nicht. Mir wird stattdessen »Gottvater« vorgeschlagen. Googelt man »Mutterglück«, ploppen Begriffe auf wie »spätes Mutterglück«, »Mutterglück ohne Vater« oder »Mutterglück-Lüge«. Die Lüge interessiert mich. Lüge bedeutet, dass der vormütterlichen Frau absichtlich etwas erzählt wurde, was offenbar nicht stimmt. Ist das so? Und wer verbreitet diese Lüge?
Ich klicke mich durchs Internet. Muttersein wird da als Satisfaktion angepriesen – zwar nicht allenthalben, aber wenn, dann volle Lotte. Mutterschaft mache das Leben komplett, heißt es in einigen Blogs. Klar, sie sei anstrengend, sagen die Autorinnen, und strapaziös, manchmal verdrießlich. Gleichwohl schenke sie Heimat. Ich lese Sätze wie: »Die Liebe einer Mutter ist so unvergleichbar, so rein und aufrichtig, so wunderschön.« Oder: »Wenn du Mama wirst, gibst du dem Glück einen Namen.« Oder: »Eine Mutter zu sein, das bedeutet Küsse, Umarmungen und ausgiebiges Kuscheln bis in die Nacht.« Ich erfahre, dass Mutterschaft die Einsamkeit vertreibt und dass die Frau endlich ihre »echte« Weiblichkeit entdeckt, trotz (oder wegen?) aller Opfer. Mutterschaft eröffnet einen Rückblick in die eigene Kinderzeit, sie heilt Verletzungen, ermöglicht eine Korrektur der Erinnerungen. Mutterschaft macht vollständig. Uff. Ob die Autorinnen Muttersein und Mutterideal verwechseln? Und wo in ihrer Glorifizierung tauchen all diejenigen Mütter auf, die ihr Muttertum nicht geplant haben, sondern dazu überredet wurden, oder die sich ihrem Partner und der Familie verpflichtet fühlten? Empfinden diese Mütter ihre Mutterschaft auch als Glück? Und wenn Kinder tatsächlich glücklich machen, warum sind dann so viele Erwachsene auf diesem Planeten unglücklich? Ich lese: »Das Muttersein macht dich stark und gibt dir einen ganz neuen Sinn im Leben. Du entdeckst eine Liebe und Leidenschaft, die du vorher noch nicht kanntest.«
All diese Versprechungen von Liebe und Familie entspringen der Gesellschaft, in der wir leben, dem Zeitgeist, der diese Gesellschaft prägt, dem sozialen Milieu, aus dem wir stammen. Wir schnappen sie im Kindergarten auf und in Schulbüchern, oft nebenbei, bekommen Babypuppen geschenkt und Stubenwagen, wie nett, hören Freundinnen davon erzählen oder Tanten, ganz verzückt, lesen darüber in Artikeln und Blogs, manchmal desinteressiert, sehen sie unentwegt in Serien und im Kino, irgendwie romantisch. So prophezeit auch Jack seiner Rose auf der Kinoleinwand, kurz bevor er in den eisigen Fluten des Atlantiks versinkt, dass sie später »einen Haufen Babys kriegen« wird. Kein Entrinnen. Nicht einmal der Untergang der Titanic vermag diese Gesetzmäßigkeit auszuhebeln.
In nahezu allen populären Fernsehserien und Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin, werden Frauen, die keine Kinder haben, pathologisiert. Sie sind neurotisch wie Dr. Elliot Reid in Scrubs, die sich im Krankenhaus gerne heulend in eine Kammer einsperrt. Sie sind nymphomanisch wie Samantha aus Sex And The City. Oder sie kommen als egoistische Menschen daher wie Elaine aus Seinfeld. Freiwillige Nichtmutterschaft einer freiwillig unbemannten Frau als positiver Lebensstil fand (und findet) auf dem Bildschirm quasi nicht statt. So hat die Netflixserie The Witcher zwar mit der Zauberin Yennefer von Vengerberg eine spannende und emanzipierte Hauptfigur erschaffen, doch in den Machern steckt immer noch der alte Affe Mensch. Als Preis für Macht und Schönheit muss Yennefer ihre Fruchtbarkeit abgeben, was sie in späteren Jahren bereut und sich fortan nach Kindern sehnt. Mutterschaft ist ihr treibendes Motiv. In Big Bang Theory erwartet Penny am Ende der letzten Staffel, die 2019 anlief, ein Baby von Leonard und freut sich unerwartet heftig darüber, obwohl sie sich lange gegen Leonards geäußerten Kinderwunsch gesträubt hat. Und in How I Met Your Mother lebt die »burschikose« Robin überzeugt kinderfrei, bis sie erfährt, dass sie keine Kinder haben kann. Völlig überraschend trauert auch sie um ihre verlorene Fruchtbarkeit und lässt sich am Ende der Serie einhegen, indem sie Stiefmutter von Teds Blagen wird. Das hat mich rettungslos enttäuscht. Ausgerechnet Robin.
»Wir sind nicht nur das, was wir sein wollen. Wir sind auch das, was andere aus uns machen«, schreibt die Publizistin Carolin Emcke.[22] Man kommt nicht als Mutter zur Welt, man wird es. Die weibliche Gebärfähigkeit gilt bis heute als Daseinszweck der Frau und als Berechtigung ihrer Existenz.[23] Das ist seltsam, ist doch Muttersein realiter nicht mehr an ein Geschlecht gebunden. Schwangerwerden können auch trans Männer und nicht binäre Menschen. Gebärmütter lassen sich transplantieren, ebenso Eierstöcke. In China kam 2018 ein Junge zur Welt, dessen Eltern vier Jahre zuvor bei einem Autounfall gestorben waren. Der zu diesem Zeitpunkt bereits eingefrorene Embryo wurde auf Wunsch der Großeltern von einer Leihmutter ausgetragen. In Israel hat man im Jahr 2021 Mäuseembryos in einem künstlichen Uterus wachsen lassen. Sie schwammen in einem Glaszylinder, der sich drehte.[24] Es war das erste Mal überhaupt, dass solch ein Experiment bei Säugetieren gelungen ist, wenn auch nur für elf Tage. Reproduktive Begrenztheiten des Körpers sind also schon jetzt teilweise durch Technologie überwindbar. Außerdem führt Sex dank Empfängnisverhütung nicht mehr zwangsläufig zu Nachwuchs. Man kann sich bewusst entscheiden, schwanger zu werden, und man braucht überdies keine Rechtfertigung, um zu verhüten.[25] Sex kann zur Fortpflanzung führen. Aber Sex dient nicht der Fortpflanzung. Der gebärfähige Mensch muss nicht gebären, wenn er nicht will, zumindest nicht in westlichen Industrienationen. Schwangersein ist nicht länger an Weiblichkeit gebunden. Wir sollten die Begriffe »Mutter« und »Vater« als Beziehungsverhältnis zwischen Menschen betrachten und nicht mehr als Geschlechtsbezeichnung.[26]
Warum werden Frauen immer noch mit Kindern assoziiert, wo doch ein Fünftel von ihnen in Deutschland kinderlos bleibt, viele sogar gewollt? Und weshalb wird eine Frau ohne Kind bis zum heutigen Tag als weniger wertvoll erachtet als ein Mann ohne Kind? Vielleicht weil zwischen Entscheidungsfreiheit und Erwartungshaltung eine Kluft liegt, die der medizinische und zivilisatorische Fortschritt bisher nicht gänzlich zu überbrücken vermochte. Und da in der Bundesrepublik trotz Geburtenrückgang vier von fünf Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens ein Kind bekommen, wirkt die Nichtmutter wie ein Wackelkontakt in der gesellschaftlichen Ordnung. Eine Störung. Denn Nichtmütter konterkarieren die allgemeine Erwartungshaltung. Fortschritt hin oder her. Sie sind der Finger auf der Linse, sie ruinieren das Bild. Eine Frau ohne Kind ist wie ein Mann ohne Penis.
Bin ich trotzdem weiblich? So ganz ohne Baby an der Brust, ohne Mutterliebe, ohne Leben geboren zu haben? Gibt es eine Auslassung für mich, einen Hohlraum, in dem ich eine vollwertige Frau sein kann? Ist Mutterschaft doch das »Eigenste im Weib«, wie es 1902 im Handbuch der Frauenbewegung hieß?[27]
4
»Da man den Frauen nicht die Schönheit des Geschirrspülens preisen kann, preist man ihnen die Schönheit der Mutterschaft«, sagte Simone de Beauvoir in einem Interview zu Alice Schwarzer. Muttertum als »kulthafte Überhöhung«?[28] Sirenengesang?
Mutterschaft scheint nicht optional, sondern obligatorisch. Sie wird uns in den Bauch gelegt. Doch niemand hält uns eine Pistole an die Schläfe und befiehlt, dass wir Mütter werden sollen. Mutterschaft ist keine Vorschrift, sie kleidet sich bloß als moralischer Imperativ. Dessen suggestive Kraft zeigt sich in der unausgesprochenen Anspruchshaltung unseres Umfelds, unterfüttert durch Medien und eine pronatalistische Politik. Mutterschaft kommt als Unausweichlichkeit daher, als Lauf der Dinge. Als Erwartung, die uns einhüllt wie eine Dunstwolke. Wir atmen sie ein und atmen sie aus. Sie ist um uns und in uns. Sie liegt uns auf der Zunge, sie wabert zwischen den Zeilen, zwischen Körpern und Köpfen. Deshalb ist es so beschwerlich, gegen sie aufzubegehren. Man kann ja auch nicht das Wetter bekämpfen. Es ist allzeit da. Jeden Tag.
Die offensive Frage »Haben Sie Kinder?« braucht es dafür gar nicht. Dass ich als Frau automatisch über Kinder definiert werde, zeigt sich nämlich zuweilen recht beiläufig. So fragte mich neulich ein Anwalt, bei dem ich einen juristischen Rat einholen wollte und der nicht älter war als ich, nach meinem Beruf.
»Ich schreibe Bücher«, sagte ich.
»Ah, was denn für welche?«, entgegnete er und setzte sogleich, ohne meine Antwort abzuwarten, hinterher: »Kinderbücher?«
»Nein, über den Nahen Osten.«
»Ach so. Ja, auch schön.« Themawechsel.
Leider habe ich verpasst, ihn zu fragen, ob er einen männlichen Autor auch sofort mit Kinderbüchern assoziiert hätte.
Dabei gibt es sie ja, die lauten Gegenstimmen. Das Internet zeugt davon. Die Vorstellung, dass Mutterschaft ein essenzieller Teil von Weiblichkeit sei, wurde in den letzten Jahrzehnten immer häufiger in Zweifel gezogen. Frausein und Muttersein sollten getrennt voneinander betrachtet werden, fordern Feministinnen nicht erst seit gestern.
Glaubt man der derzeitigen Literatur, so lastet die Mutterrolle allerdings immer noch schwer auf den Frauen. Mehr und mehr Bücher erscheinen zur K-Frage – also Kinder ja, Kinder nein. Es gibt Mama-Kolumnen, die »schonungslos ehrlich« Miseren benennen und die »ohne Insta-Filter« auskommen. Etliche Autorinnen schreiben pointiert über die gräulichen Seiten des Mutterdaseins, über ihren Zwiespalt, über die Langeweile, über das Ende ihres Sexlebens und über die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Sie erzählen von der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, vom schlechten Gewissen, das damit einhergeht, und davon, dass Elternschaft Mühe und Arbeit, Nerven und Geld kostet. »Es tut mir leid, ich schaffe gerade gar nichts, außer überleben«, schreibt Mareice Kaiser in ihrem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter.[29] Um festzustellen, dass sie damit nicht allein ist, reicht ein Blick in die matten Gesichter der Mütter um uns herum. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die eigenen Kinder Eltern mehr bekümmern können als Arbeitslosigkeit, Scheidung oder gar der Tod des Partners.[30] Der Hauptgrund dafür, dass sich viele Eltern gegen ein zweites Kind entscheiden, ist laut der Studie Stress – ausgelöst durch die große Verantwortung, durch Geldsorgen, Zeit- und Schlafmangel, häusliche Isolation und Beziehungsprobleme. Kämen noch mehr Menschen hinzu, würden sich auch die Probleme vermehren, so die Angst. Eine andere Untersuchung von 2019 ergibt, dass es nach der Geburt des ersten Kindes bis zu sechs Jahre dauert, bis Mutter und Vater wieder so schlafen können wie davor.[31] Erst wenn der Nachwuchs ausgezogen ist, sind Eltern glücklicher als Kinderlose, sagen wiederum Wissenschaftler der Universität Heidelberg.[32]
Ende der Leseprobe