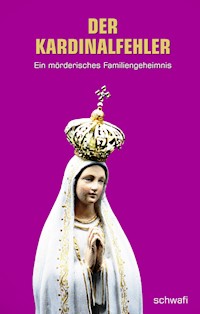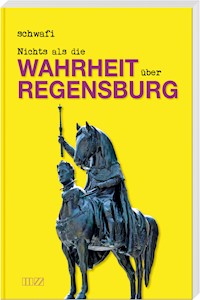
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Leser erhält neue, aufwühlende Einblicke in Regensburgs Geschichte und Gegenwart. Wer zum Teufel baute die Steinerne Brücke wirklich? Warum grüßt der Eingeborene nicht? Wo räkelte sich Kaiserin Sissi in der Sonne? Wie feige war Dollinger, wie lüstern Kaiser Karl V.? Wo gibt es gemischten Braten für Vegetarier? Wer erschoss Mirko Schuppenknecht? Dazu Interviews mit einem Halbschwergewichts-Taxler, einem Rocker a. D., einem leidenschaftlichen Fassaden-Tapezierer und einem High-End-Trinkspezialisten. Mit 20 Dialekt-Redewendungen, die Fremdlingen, Zugezogenen und Ureinwohnern in Alltagssituationen das Leben retten oder kosten können. Anekdoten, Legenden, Stadtspaziergänge, Beschimpfungen, Ansichten, Einsichten, Liebeserklärungen: Amüsanter kann man sich dem Phänomen Regensburg kaum nähern. Die Frage nach dem wahrhaftigen Regensburg von gestern und heute wird mit Witz und Fantasie, mit alternativen Fakten der Geschichtsschreibung und unerschöpflichem Insider-Westentaschenwissen ein für alle Mal geklärt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nichts als die Wahrheit über Regensburg
Impressum
DIE SCHÖNSTE STADT DER WELT
VOM HOFBRÄUHAUS ZUR FOLTERKAMMER, SPAZIERGANG 1
REGENSBURGER FESTKALENDER
TAXI DRIVER – SIND SIE NOCH FREI?
WOHNUNG VERZWEIFELT GESUCHT
DIE STEINERNE BRÜCKE, SPAZIERGANG 2
DIE 10 WICHTIGSTEN REDEWENDUNGEN
EIN SPANIER TAPEZIERT REGENSBURG
ERINNERUNGEN EINES KULTMUSIKERS
KINOWELT ZWISCHEN ELDORADO UND INFERNO
DIE DULT: EINE GEISTERBAHNFAHRT
REGIONALKRIMIBESTSELLERSCHREIBKURS
IM PRINZIP KAM IMMER IRGENDWELCHER ÄRGER HERAUS
KAMERAD SCHLINGENSIEF UND DAS WÜRSTEL-BOMBARDEMENT
KAISERS WOLLUST UND SISSI-EROTIK AM HAIDPLATZ, SPAZIERGANG 3
DAVID WÜRGT GOLIATH
UNTERIRDISCHE TRINK-KULTUR
DIE 10 ALLERWICHTIGSTEN REDEWENDUNGEN
DAS HALBE KALB VOM ÄGIDIENPLATZ
TITELSTORY
Informationsbasis
Der Schreiber
schwafi
Nichts als die Wahrheit über Regensburg
Impressum
Auflage 2020
© E-Book: schwafi, Klaus Schwarzfischer
c/o KONTEXT, Bogenstr. 2 93051 Regensburg
Printversion: 1. Auflage 2020, ISBN 978-3-86646-382-0
© 2020 MZ-Buchverlag in der Battenberg Gietl Verlag GmbH, Regenstauf,
Titelfoto: Hubert Lankes.
Alle Rechte vorbehalten!
DIE SCHÖNSTE STADT DER WELT
Wirf München und Hamburg weg, vergiss Barcelona und New York! Vom Rest ganz zu schweigen. Nur 150.000 Menschen genießen das Privileg, in Regensburg leben zu dürfen. Das heißt umgekehrt, dass es auf der Erde etwa 8 Milliarden bedauernswerte Kreaturen gibt, die dem Himmel auf Erden nie so nah sein werden wie wir, die Auserwählten.
Mit 0,15 Millionen schafft es Regensburg nicht einmal unter die Top 50 Deutschlands, was die Einwohnerzahlen angeht. Aber wie bemerkte schon Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894 –1972) so treffend: „Das sicherste Zeichen der Barbarei und Primitivität ist der Kult der Zahl und der Quantität.“
Welche andere Stadt kann auf eine so lange und bewegte Geschichte zurückblicken? Welche Stadt besitzt einen der besterhaltenen historischen Ortskerne? Wo sonst gibt es so liebenswerte und freundliche Menschen wie hier? Der Einheimische ist weltoffen und gesellig, auch wenn sich dieser Eindruck nicht auf den ersten Blick bzw. bei der ersten Begegnung offenbart. Der Ehrentitel „Einheimischer“ steht ausschließlich Menschen zu, die in Regensburg geboren wurden. Alles andere sind Zugezogene, auch wenn sie, wie ich, seit 40 Jahren hier leben und verzweifelt versuchen, sich als echter Regensburger zu gebärden und als solcher akzeptiert, nein, respektiert zu werden. Andere Zugezogene kann man leicht hinters Licht führen, indem man zum Beispiel statt einem „er kommt“ lässig ein „er kummt“ in die Kommunikation einfließen lässt und sich durch weitere mühsam angelernte Dialekt-Besonderheiten einerseits pauschal vom Preißntum distanziert, aber sich zugleich bewusst vom ländlichen oberpfälzischen und niederbayerischen Prekariat abhebt. Man kann ihnen mühelos vorgaukeln, dass man selbst schon seit Generationen in der Stadt wohne, vielleicht sogar ein direkter Nachfahre der schönen Kaisersgeliebten Barbara Blomberg sei oder ein Urururenkel Johannes Keplers. Die leichtgläubigen Neuregensburger aus den verschatteten, grenznahen Tälern des Bayerischen Waldes, die strafversetzten Professoren aus Berlin, Köln und Freiburg, die von Regensburgs wirtschaftlichen Global Players um die Jahrtausendwende angelockten indischen, bangladeschischen und mecklenburg-vorpommerischen Computerfachkräfte: Sie alle würden nicht den geringsten Zweifel an deiner Regensburger Authentizität und Identität hegen. Der Ureinwohner dagegen erkennt sogar in seiner seltenen Erscheinungsform als Blinder mit Krückstock, dass du keiner der Seinen bist. Er könnte dir mit einem abfälligen Blick den Grad seiner Wertschätzung signalisieren, er könnte dich als drittklassigen Hochstapler entlarven, dich vor den anderen Zugezogenen bloßstellen und der Lächerlichkeit preisgeben. Aber er tut es nicht. Weil es ihn nicht interessiert. Weil du ihn nicht interessierst. Weil es ihm zu viel ist. Ihm ist sehr viel zu viel. Wundere dich deshalb nicht, wenn du in Regensburg nicht gegrüßt wirst. Eine mehrjährige wissenschaftliche Beobachtungsstudie zu diesem Verhalten lieferte eindeutige Resultate:
a) 100 % der Menschen, die in Regensburg als Erstes von sich aus grüßen, sind Tagestouristen aus dem nicht-asiatischen Raum.
b) Leute, die freundlich zurückgrüßen, sind Zugezogene, die seit 20 Jahren oder weniger in Regensburg leben.
c) Wer zwar nicht zurückgrüßt, aber zuckt, weil ihm seine frühere (außer-regensburgerische) Kinderstube und sein Anstand signalisieren, dass er zurückgrüßen müsste, der Drang, einen echten Regensburger zu simulieren aber die Oberhand in seinem gespaltenen Seelenleben behält, lebt im Durchschnitt seit 40 Jahren hier.
d) Der gebürtige Regensburger reagiert weder verbal noch körperlich oder mimisch auf andere Personen.
Man könnte meinen, die Ergebnisse dieser Untersuchung stünden im krassen Gegensatz zu der eingangs erwähnten Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit der Ureinwohner. Dem ist nicht so. Es ist lediglich eine andere Art, dem Gegenüber Sympathie zu bekunden. Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick zurück auf die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, welche die Regensburger Bevölkerung in der Vergangenheit durchlebte. Oder nehmen wir besser nur eine davon exemplarisch heraus: die „Schlacht bei Regensburg“, welche am 23. April 1809 mit der Erstürmung Regensburgs ein blutiges Ende fand. Ausgangspunkt der fünftägigen Kampfhandlungen war nämlich nicht ein geplanter Feldzug oder eine bewusst herbeigeführte Schlacht, sondern vielmehr eine unvermutete Begegnung zweier in verschiedene Richtungen marschierender Heere (Österreicher und Franzosen). Über 2000 Tote (Soldaten und Bürger), eine Feuersbrunst, die Wohnhäuser, Kirchen und die Steinerne Brücke erfasste, marodierende Soldaten und Plünderungen waren die Folge. Unerfreuliche Vorkommnisse wie diese, die aus der zufälligen Begegnung zweier Parteien unter freiem Himmel resultierten, erklären das Verhalten des Regensburgers beim Aufeinandertreffen mit Auswärtigen. Das Gegenüber kann froh sein, dass ihm nicht eine Lanze oder ein Bajonett in den Brustkorb gerammt wird, so wie es spätestens seit den napoleonischen Feldzügen im Erbgut des Regensburgers als Handlungsanweisung verankert ist. Was ist freundlicher: Nicht gegrüßt oder nicht getötet zu werden? Der Akt des Nichtgrüßens kann von daher als Liebeserklärung und Wertschätzung gegenüber allen Menschen, die ihm auf der Straße begegnen, gewertet werden. Mehr noch: Die Kommunikationsgewohnheiten und -regeln des Regensburgers scheinen inzwischen einen weiteren Schritt in die richtige Richtung vollzogen zu haben. Verlässliche Quellen berichten von einer Begebenheit, die sich im Mai letzten Jahres in der Rote-Hahnen-Gasse abgespielt haben soll. Ein aus Duisburg stammendes Pärchen mittleren Alters wandte sich an einen etwa 50-jährigen Regensburger, der ihnen vom Haidplatz her entgegenschlenderte. Die Dame hielt ihm den kosten-, nutz- und wertlosen Einkaufsund Gourmet-Tempel-Stadtplan des Regensburger Marketingvereins vors Gesicht, während der Herr ihn höflich und wortreich ansprach: „Entschuldigen Sie, junger Mann, wir sind auf der Suche nach dem schönen Schloss Emmeram, in dem ja Ihre verrückte Baronin Gloria noch immer ihr Unwesen treiben soll. Haha. Wissen Sie vielleicht, wie wir dort hinfinden?“ Der Befragte soll daraufhin genickt und mit einem „Mhm“ eine wahrheitsgemäße Auskunft erteilt haben, bevor er seinen Weg in Richtung Hinter der Grieb fortsetzte.
Auch innerhalb der eigenen vier Wände bzw. mit Freunden oder in einer Beziehung wird von echten Regensburgern wenig bis nicht gesprochen. Beispielhaft dafür mag folgende Anekdote stehen, deren Erzähler mir versicherte, dass er selbst sie im Rahmen einer Hochzeitsfeier erlebt habe. Nach blumiger Ausschmückung – der Erzähler war kein Regensburger – brachte er die Geschichte endlich zu Ende, nicht ohne auch noch die Pointe zu verhauen. Ich sagte ihm, dass ich dieselbe Geschichte schon mindestens dreimal in unterschiedlichen Varianten gehört hätte. Einmal spielte sie in Südtirol, einmal auf Island und einmal in Raigering weit hinter Cham in der Oberpfalz. Er aber schwor, dass er selbst dabei gewesen sei und es natürlich sein könne, dass an anderen Orten unserer großen weiten Welt sich in den letzten Jahren Ähnliches abgespielt hat oder dass andere sich mit fremden Federn schmücken wollten und sich nicht schämten dieses, sein ureigenstes persönliches Erlebnis, als ihres auszugeben.
Wenn jemand aus freien Stücken einen Eid leistet oder sein Ehrenwort gibt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage wahr ist, weit unter null. Das wissen wir spätestens seit der Barschel-Affäre in den 80ern und seit Bundesinnenminister Zimmermann, der sich den Beinamen „Old Schwurehand“ hart erarbeitet bzw. erlogen hatte, und seit dem „Meineidbauer“, einem Volksstück mit Gesang in drei Akten von Ludwig Anzengruber. Andererseits muss man jemandem so lange glauben, bis er der eidlichen Falschaussage überführt wurde. In unserem Fall ist das noch nicht geschehen.
Nachfolgend werde ich die Begebenheit so erzählen, wie sie mir zugetragen wurde. Nur werde ich alles Beiläufige und Unwichtige weglassen, um nicht den Rahmen dieses Büchleins zu sprengen beziehungsweise dessen Seitenanzahl explodieren zu lassen. Auch behaupte ich weder, selbst anwesend gewesen zu sein, noch dass ich demjenigen, der das von sich behauptet, diesbezüglich Glauben schenkte. Auf die Pointe werde ich gradlinig zuarbeiten und nicht beiläufig den studentischen Werdegang seiner Tochter, auf die der Original-Erzähler sehr stolz zu sein scheint, einfließen lassen. Apropos Pointe. Wem die Anekdote bekannt vorkommt, und das werden nicht wenige sein, der kann gleich mit dem nächsten Kapitel anfangen. Alle anderen eigentlich auch. Jeder kann mit seinem Leben machen, was er will. Aber: Auch falls sie nicht wahr sein oder sich anders und nicht hier abgespielt haben sollte, sagt die Geschichte sehr viel über den Regensburger aus, weil sie, ich schwöre, sich genau so und nicht anders wirklich ereignet haben könnte. Um das Ganze lebendiger zu machen, wähle ich die Ich-Form: Ich sitze also bei der Hochzeit unseres Firmenchefs als Single zwischen zwei befreundeten Paaren. Die beiden rechts von mir, Jette und Jens, stammen aus Düsseldorf und arbeiten beide in der Vertriebsabteilung. Zwei Tische weiter setzt sich ein sonnengegerbter Typ mit langen lockigen Haaren gerade wieder hin, nachdem er einen Toast auf das Brautpaar ausgesprochen hat.
Jette: „Du, Jens, wer issn der Typ?“
Jens: „Was? Den kennst du nicht? Das ist Frank Modetti. Der arbeitete früher bei Zarca-Instruments. Wahnsinnig viel Kohle gemacht. Siebentagewoche, Achtzehnstundentag. Dann Burn-out vom Feinsten. Halbes Jahr Klinik. Anschließend 180-Grad-Turn: Tauchlehrer auf den Malediven. Zwei Jahre lang. Hat bei einem Tauchgang die Nichte der Braut kennengelernt. Die süße Kleine da drüben mit dem fliederfarbenen Kleid und der Goldkette mit dem Muschelanhänger. Siehst du sie?“
„Die da?“
„Nein, die am Tisch daneben.“
„Ach, die.“
„Jedenfalls Batschbumm. Große Liebe und Braten in der Röhre. Zwillinge. Die müssen jetzt auch schon vier oder fünf sein. Ich glaube, zwei Mädchen. Oder zwei Jungen. Weiß nicht mehr genau. Schluss mit der Taucherei. Jetzt wieder voll im Geschäft. Top-Manager bei Berling-Dorklede. Mindestens Zweihunderttausend im Jahr. Soll aber wieder krank sein, hört man. Irgendwas mit dem Herzen oder den Nieren. Kommt gerade vom Urlaub. Sieht man ja. Netter Kerl eigentlich. Ein bisschen verpeilt vielleicht, aber sonst – ah, da kommt ja schon der Nachtisch.“
Links von mir sitzt Karl Schimmchen, unser Neue-Medien-Profi, ein gebürtiger Regensburger in fünfter Generation, der vor 12 Jahren gegen den erbitterten Widerstand seiner Familie eine Auswärtige, die Sinzingerin Franziska Haimerl, jetzt auch Schimmchen, geheiratet hat. Auch ihr ist der attraktive Frank Modetti ins Auge gefallen, also fragt sie ihren Karl: „Wer issn der Typ?“
Karl: „Den kennst du ned.“
VOM HOFBRÄUHAUS ZUR FOLTERKAMMER, SPAZIERGANG 1
Wie und wo könnten wir einen Regensburg-Spaziergang zünftiger beginnen als in einem altehrwürdigen Wirtshaus. Gegenüber dem Alten Rathaus, nur wenige Meter von der Tourist-Info entfernt, steht das Hofbräuhaus. Über dessen Eingang prangt ein liegender Hirsch aus Stein. Bedeutung und Ursprung sind nicht zweifelsfrei geklärt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erinnert er an den Verlauf einer von Johannes von Thurn und Taxis veranstalteten Jagd im Jahre 1987. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, ein hervorragender Schütze, der auch im normalen Leben immer eine scharfe Waffe bei sich trug, nahm daran teil. Ein kapitaler Hirsch lief ihm vor die Flinte. Ladehemmung. Der Hirsch ging mit glühend roten Augen und gesenktem Geweih auf den Jäger los, verfolgte ihn bis in die Stadt. Erschöpft konnte sich Strauß in letzter Sekunde ins Hofbräuhaus flüchten. Die schicksalhafte Begegnung veränderte sein Leben. Von nun an wollte er sich für Tier-, Natur-, Umweltschutz und alternative Energien einsetzen, den Bau der umstrittenen atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf einstellen und Schülern mit „Stoppt Strauß“-Ansteckern das Bayerische Verdienstkreuz für Zivilcourage verleihen. Er nahm sich vor, gleich nächstes Jahr damit anzufangen. 1988 kam er bei einer erneuten Jagd im fürstlichen Forst unter mysteriösen Umständen zu Tode. 1989 wurde der Bau der WAA eingestellt.
Um das Hofbräuhaus rankt sich eine Vielzahl von Legenden, in deren Mittelpunkt meist der Senior-Wirt des Hauses steht, der seit Menschengedenken jeden einzelnen Gast mit einem Händedruck begrüßt. Ihm werden philosophisch angehauchte Zitate wie „Setzen Sie sich schon mal hin, einen Stuhl bringe ich gleich“ oder „soso, jaja, mhm, aha“ zugeschrieben. Menschen, die das HB seit dem Ende des zweiten Weltkrieges regelmäßig besuchen, genießen eine bevorzugte Sonderstellung. Sie werden während des Handschlags mit einem
„Herr“ bzw. „Frau“ angesprochen, worauf im besten Fall der richtige Name des Stammgastes folgt. Die Trefferquote lag vor zwei Jahrzehnten noch bei über 95 Prozent, nimmt aber in letzter Zeit rapide ab, was vor allem dem Umstand geschuldet ist, „dass die jungen Leute alle gleich ausschauen“. Gäste, die mit Namen angesprochen werden, gehören in den geheiligten Hallen des HB zum engsten Kreis der Auserwählten, zur trinkenden Oberschicht, unabhängig davon, ob sie sich im Leben außerhalb als Lumpensammler oder Mathematikprofessor einen entsprechenden Ruf erarbeiten konnten. In einem Menschen mit unterentwickeltem Selbstbewusstsein oder krankhafter Profilneurose kann dieser Umstand schwere seelische Schäden verursachen. Er lässt sich nämlich nicht durch anderswo erfolgverheißende Methoden, wie dem Wirt Honig ums Maul schmieren, hundert Euro Trinkgeld geben oder mehrmals auf die eigene wichtige Funktion als Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens in Regensburg hinweisen, beeinflussen.
Eine innerwirtschaftliche Feldstudie der Universität Regensburg untermauerte die These, dass lediglich eine radikale Veränderung der Lebensweise zum anvisierten Ziel „Handschlag samt korrekter Namensnennung“ führen kann. Diesbezüglich lägen die Mindestanforderungen bei 20 HB-Besuchen von jeweils nicht weniger als drei Stunden monatlich. Auch würden mehr als zwei HB-lose Tage hintereinander die Aufrechterhaltung der zielführenden Präsenz-Kontinuität negativ beeinflussen. Der HB-Wirt soll die Resultate mit einem hintersinnigen „Der Weg ist das Ziel“ kommentiert haben. Die Anfeindungen von Seiten weniger geschäftstüchtiger Mitbewerber, das HB selbst habe die Studie in Auftrag gegeben und die Ergebnisse manipulativ vorformuliert, prallen wirkungslos an den Spitzbogenfenstern der historischen Wirtsstube ab.
Touristen wie Einheimische können sich im HB sicher fühlen. Hier wird nie gerauft, geschlägert, mit Messern aufeinander eingestochen oder geschossen. In den akribischen Aufzeichnungen der Tagesabläufe im HB sticht lediglich ein handgreiflicher Vorfall heraus, in den der Hausherr selbst verwickelt war: Musiker Franz F. (Gitarre) saß bereits seit 15 Uhr mit den anderen beiden Mitmusikanten seiner Kapelle am Tisch, um die Playlist ihres nächsten großen Auftritts beim Tag der offenen Tür der Landmetzgerei Holler in Undorf zu besprechen. Ab 17 Uhr verlor er allmählich seine Sprachfähigkeit und nickte immer öfter ein. Schließlich forderte ihn Karl N. (Quetschn-Spieler), der im Gegensatz zu F. weder beim Kneitinger-Frühschoppen war noch nach dem Mittagessen drei Bärwurz getrunken hatte, auf, heimzugehen, weil das alles keinen Sinn mehr mache. F. widersprach nicht, stand gehorsam auf, torkelte zur Garderobe und wollte in seinen Anorak schlüpfen. Just in diesem Moment drehte der HB-Wirt seine siebte Handschlag-Runde des Tages. F. war ihm namentlich bekannt, da er alle diesbezüglich geforderten zeitlichen und konsumtechnischen Anforderungen des Hauses mehr als erfüllte. Während F. in grobmotorischen Bewegungen versuchte sich anzuziehen, mutmaßte der HB-Wirt, dass F. eben erst gekommen und im Begriff sei, den Anorak auszuziehen. Dabei wollte er ihm behilflich sein. „Warten Sie, ich helfe Ihnen aus der Jacke, Herr F.“ F. hatte seine Sprachfähigkeit noch nicht so weit wiedererlangt, dass er dem Wirt einen komplexen Sachverhalt, wie den Wunsch, seine Jacke anzuziehen, hätte vermitteln können. Daraus entstand ein längeres Hand- und Ärmelgemenge, aus dem der Wirt als Sieger hervorging. Er hängte F.s Anorak zurück an den Ständer und wies die Bedienung an, Herrn F. schnell ein frisches Bier zu bringen, weil dieser ja bestimmt nach der Arbeit einen Riesendurst habe.
Begeben wir uns nun aus diesem Hort des Friedens heraus und tauchen wir ein in die grausame mittelalterliche Historie Regensburgs. Keine 70 Meter müssen wir auf dem Kopfsteinpflaster des Rathausvorplatzes bewältigen, um ans Einlasstor zur Fragstatt, zur Regensburger Folterkammer, zu gelangen. Auf halbem Weg dorthin ragt ein Erker mit gotischen Naturstein-Fialen aus der Fassade des alten Rathauses heraus. Dabei handelt es sich nicht um die Filiale eines Natursteinhändlers, wie der schludrige Leser vielleicht vermuten könnte, sondern um schlanke, verzierte Türmchen, die dem Balkon-Erker mit ihrer Filigranität seine Wucht nehmen und ihn höher aussehen lassen. Hinter den Fenstern des Erkers befindet sich der historische Reichssaal. Vielleicht sollte ich künftig mit dem Wort „historisch“ sparsamer umgehen, weil es in Regensburg kaum einen Quadratzentimeter gibt, der nicht geschichtlich bedeutsam wäre oder nicht schon so uralt, dass er diese Bezeichnung nicht verdient hätte. Der Reichssaal aus dem 14. Jahrhundert war ursprünglich ein städtischer Tanzsaal, in dem Bälle abgehalten wurden. Wie oft und wie lange er als solcher genutzt wurde, ist nicht überliefert. Vielleicht hatte die Nutzungsänderung mit den Tanzverboten zu tun, die ausgesprochen wurden. „Walzend und schutzend Tänz“ galten als unmoralisch, weil es dabei zu „unzüchtigen Betastungen“ kommen könnte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es diesen Verboten geschuldet, dass sich die Geburtenrate Regensburgs im Mittelalter im überschaubaren Rahmen bewegte. Schließlich setzt das Kinderkriegen gewisse Formen unzüchtiger Betastungen voraus. Die Einwohnerzahl soll damals bei etwa 11.000 gelegen haben. Dass es ein halbes Jahrtausend später im Jahre 1818 auch erst 19.000 Regensburger gab, zeigt, wie wenig der damaligen Legislative die ursächlichen Zusammenhänge von körperlicher Nähe und der Zeugung künftiger Steuerzahler geläufig waren. Ab dem 16. Jahrhundert wurde getagt, wo früher getanzt wurde. Von 1663 an fand hier der Immerwährende Reichstag, die Ständevertretung im Heiligen Römischen Reich, statt. Über 300 Fürsten, Grafen, Prälaten und Vertreter von Ritterorden beziehungsweise deren Abgesandte sollen sich zeitweise im Saal gedrängt haben. Einfach ausgedrückt ging es um Führungsansprüche, um Gesetz-Erlasse, Rechteübertragungen, Kriege, Kapitulationen. Noch einfacher gesagt um Politik. Das alles wurde am berühmten Grünen Tisch ausgehandelt, über 300 Jahre, bevor die Fraktion der Grünen Einzug in den Regensburger Stadtrat hielt. „Etwas am Grünen Tisch entscheiden“ wurde zur festen Redewendung für praxis- und realitätsferne Entscheidungen. Offensichtlich fühlten sich einige Stadtpolitiker der Neuzeit diesem zweifelhaften Anspruch aus der Regensburger Vergangenheit verbunden. Wie sonst hätte am Neupfarrplatz ein gewachsenes Stadtviertel mit gotischer und neubarocker Bebauung dem Erdboden gleichgemacht werden können, um dort in den 1970ern ein 13.000-Quadratmeter-Kaufhaus im Betonbunkerstil aus dem Boden zu stampfen?
Wenden wir uns etwas Erbaulicherem als der Regensburger Neubaukultur zu. Wo wollten wir hin? Zur Fragstatt. Genau. Unter dem Alten Rathaus befindet sich die mittelalterliche Folterkammer. Sie beherbergt ein breites Instrumentarium zur intensiven Befragung verdächtiger Personen. Den Spanischen Esel beispielsweise. Der Delinquent wurde gezwungen, sich auf die spitzen, keilförmig nach oben hin zulaufenden Bretter zu setzen. An seine Füße wurden schwere Gewichte gehängt. Oder die Streckleiter, nach deren Einsatz die Befragten nicht selten 10 Zentimeter größer als vorher waren – oder tot. Dabei kamen die Folterwerkzeuge nur sehr selten zum Einsatz, weil allein deren Anblick den unfreiwilligen Betrachter dazu veranlasste, jedes wie auch immer geartete und von wem auch immer begangene Verbrechen zu gestehen. In den 70er und 80er Jahren wurde Lehrern vom Bayerischen Kultusministerium empfohlen, sich als Folterknechte zu verkleiden und die Fragstatt mit renitenten Schülern zu besuchen. Dieses pädagogische Konzept zeigte bis in die 90er Jahre hinein Wirkung. Die Aufmüpfigkeit nahm spürbar ab und wandelte sich zum Teil sogar in eine gewisse Unterwürfigkeit. Wollte ein Schüler, der einmal hinter den verschlossenen Türen der Fragstatt auf sein soziales oder schulisches Fehlverhalten hingewiesen worden war, in alte Verhaltensmuster zurückfallen, brauchte der Lehrer nur mit dem Laserpointer auf die im Werkunterricht nachgebaute Halsgeige zu zeigen, die anstelle des Kreuzes an der Wand des Klassenzimmers hing. Sofort warf der Schüler seine Spickzettel weg, aß den gerade gefalteten Papierflieger auf oder fiel auf die Knie und bat tränenreich um Vergebung. Die Problematiken der Schwererziehbarkeit und Verhaltensauffälligkeit schienen ein für allemal aus dem Schulalltag verbannt zu sein. Dann jedoch wurden die Geburtsjahrgänge nach 1990 eingeschult, die sich schon bald über das Etikett „Generation Porno“ freuen durften. Sie wussten an ihrem 10. Geburtstag bereits mehr über exotische Varianten zum Austausch menschlicher Körpersäfte als ich es mir in meiner begrenzten Restlaufzeit noch aneignen könnte, wenn ich es denn wollte. Auch, falls es mich interessieren würde: Mir fehlte die Zeit dazu. Zudem werde ich immer vergesslicher, was die Einarbeitung in neue Themenbereiche nicht einfacher macht. Angenommen, eine leicht bekleidete, attraktive Frau käme am Mittwochabend an unseren Schnupfer-Stammtisch und würde mich fragen, ob ich sie nach Hause begleiten und mit ihr „etwas“ machen wolle. Sie würde natürlich nicht „etwas“ sagen, sondern einen Fachbegriff verwenden, den ich vor zwei oder drei Tagen auf einer dieser ominösen Internet-Seiten gehört haben könnte, wenn ich sie denn besucht hätte. Mir fiele aber ums Verrecken nicht mehr ein, was dieser Begriff in dem Film, der vielleicht in einem Fitness-Studio gespielt hat, bedeuten sollte. Es wäre mir aufgrund der bereits angesprochenen, altersbedingt verminderten Merkfähigkeit entfallen. Ich könnte die Dame begleiten und mich überraschen lassen, was mit diesem „Etwas“ gemeint ist. Aber was wäre, wenn dieser Begriff gar nicht der gewesen wäre, den der Fitnesstrainer der asthmatisch röchelnden Frau auf der Hantelbank ins Ohr gespeichelt hat? Wenn er sich nur ähnlich angehört hätte? Was, wenn dieses „Etwas“ der slowakische, slowenische oder hochzillertalerische Begriff für „kaputte Birnen auswechseln“ oder „verstopften Siphon reinigen“ wäre? Und warum überhaupt sollte diese rassige Schönheit an einen Tisch mit Männern kommen, denen schwarze Schnupftabaksreste aus der Nase hängen? Sie würde auch andere bekommen, die ihr die Birne rausdrehen oder die neue Waschmaschine in den Keller tragen. Doch das nur nebenbei. Besagte Generation Porno brachte das gesamte schulische Maßregelungssystem ins Wanken. Sie fühlten sich beim Besuch der Folterkammer an Sadomaso-Praktiken erinnert, wie sie sie schon tausendfach auf dem Smartphone gesehen und mit den Mädels aus der 5b diskutiert hatten. Erklärte ihnen der Lehrer, dass auf dem „Beichtstuhl“ die Dornen der Sitzfläche tief ins Fleisch eindrangen, weil der Schoß des Gepeinigten mit Steinen beschwert wurde und dass den Schülern das auch bald blühen könne, quittierten sie das mit einem „langweilig“ oder „Super, darf ich das gleich ausprobieren?“ Von abschreckender Wirkung konnte keine Rede mehr sein. Während 1973 jährlich noch über 800 Schulklassen aus ganz Bayern die Fragstatt besuchten, waren es 2005 nur noch 3. Die Fragstatt erfüllt aktuell keine gesellschaftlich relevante Aufgabe mehr. Im Mittelalter dagegen spielte sie eine tragende Rolle bei der Ausrottung des Hexenwesens. Eine Erfolgsgeschichte, von deren bereinigender Wirkung wir noch im Hier und Heute profitieren. Die letzte verfügbare statistische Jahreserhebung der Stadt weist 118.020 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus. 33.000 davon arbeiten im produzierenden Gewerbe, 21.000 in Handel und Gastronomie, 3.000 im Bauwesen. Ketzerei und Hexerei erreichten keine statistisch relevanten Werte.
REGENSBURGER FESTKALENDER
In Regensburg wird viel gefeiert. Angefangen von freilaufenden Horden weiblicher und männlicher Polterabendgeister, die sich in Sträflingskostümen, Känguruoveralls und rosaroten Tutus (meist adipöse Kreisklassenfußballer aus dem Umland) am Wochenende auf den Weg machen, um unbescholtenen Regensburgern und Regensburg-Besuchern den Abend zu verderben. Bald werden sie keine Junggesellinnen und Junggesellen mehr sein, sondern in den sicheren Hafen der Ehe einfahren, um dort die nächsten Jahrzehnte ein noch trostloseres Tupperware-Kongress-Leben zu führen als vor der Hochzeit. Das muss gefeiert werden. Ein Küsschen für 2 Euro. Oder ein lustiges, über einen Besenstiel gezogenes Himbeergeschmack-Kondom mit Teufelsköpfchen, das wahllos belästigte Passanten abzulecken aufgefordert werden, damit die künftigen Bräutigaminnen und Bräutigame ihre Wetten nicht verlieren. Das Regensburger Fremdenverkehrsamt fordert dazu auf, den Bitten der fröhlichen Leiterwagen-Grüppchen diskussionslos nachzukommen, um Schlimmeres zu verhindern. Man stelle sich vor, wozu Menschen, die sich aus freiem Willen wie entlaufene Irre gebärden, von ihren Artgenossen gezwungen werden können, wenn eine dieser Wetten verloren ginge. Wechseln wir deshalb lieber schnell das Thema und beschäftigen wir uns mit der organisierten Art des Feierns. Darin sind wir Meister. Inzwischen gibt es so viele Feste an so vielen Tagen, dass sie übereinander gestapelt oder parallel stattfinden müssen. Auch mit der Namensfindung ist das so eine Sache. Vor der eigentlichen Bezeichnung sollte immer ein „Regensburger“ stehen, damit jeder weiß, wo er sich befindet, wenn ihm gerade ein Riesenhumptata oder „We will rock you“ die Trommelfelle über die Ohren zieht; wenn ihm der Senf aus der Bratwurstsemmel seines Gegenübers ins frisch operierte Auge spritzt; wenn er halb verdurstet eine Dreiviertelstunde für eine Radlermaß angestanden hat und dann erst nach der letzten Biegung – es stehen nur noch drei Leute vor ihm in der Schlange – das Schild „Pfandrückgabe“ erscheint; wenn den lieben Kindern Klimakiller-Alufolienluftballons in Einhornform für 15 Euro gekauft werden, die beim Tedi-Markt für 50 Cent zu haben sind; wenn diese Luftballons auf Nimmerwiedersehen davonfliegen und die Kinder sich deshalb mit Schreikrämpfen in Currywurst- und Grillhähnchenresten und Zitronenabtupftüchern wälzen; wenn ... und so weiter.
Feste, vor denen „Regensburger“ steht, zeichnen sich dadurch aus, dass man dort keine Regensburger trifft. Denn der Regensburger feiert nicht. Er lässt feiern. Dabei ist es ihm egal, wo und was er nicht feiert. Hinter dem „Regensburger“ können noch so aufregende Bezeichnungen stehen: Bürgerfest, Brückenfest, Craft Beer Fest, Campusfest, Jahninselfest, Popkultur-Festival, Schlossfestspiele, Tage Alter Musik, Jazzweekend, Mundartfest, Theaterfest, Maidult, Herbstdult oder Tag des Bieres. Er bleibt daheim und schließt die Fenster oder fährt weit weg in Urlaub.
Ein ganz besonderes Fest findet alljährlich am Sonntag vor dem Osterwochenende, am Palmsonntag, statt. Sinnigerweise heißt dieses Fest „Palmator“, so wie das Starkbier, das dort ausgeschenkt wird und an Mensch und Umwelt erheblichen Schaden anrichtet. Würde dieses Fest, wie viele andere, in der Innenstadt gefeiert, läge Regensburg längst in Schutt und Asche. So wie die Amerikaner die mutmaßlich gefährlichsten Verbrecher und Terroristen nach Guantanamo ausgelagert haben, spielt sich auch die Palmator-Tragödie außerhalb der Regensburger Stadtgrenzen ab. Am Montagmorgen danach sieht es im eineinhalb-Kilometer-Radius um das Festzelt aus, als hätte ein Orkan gewütet und die Abfallberge aus allen umliegenden Müllhalden hierher verfrachtet.
Die beschauliche Kommune Pettendorf zählt etwa 3.000 Einwohner. Wenn „der Adlersberg ruft“, pilgert die dreifache Menschenmasse hinauf, um sich nach zwei bis fünf Maß wieder marodierend hinunterzubewegen. Die meisten Schäden richten Festbesucher an, die sich beim Heimgehen noch auf zwei Beinen fortbewegen können. Sie reißen Straßenschilder und Begrenzungspfähle aus, zerdeppern ihre Maßkrüge, urinieren an und auf alles, was sich bewegt und nicht bewegt, und sind in vielen Fällen gezwungen, auch andere Körperöffnungen für die Entsorgung von mehr oder weniger flüssigen Exkrementen zu nutzen. Geht man davon aus, dass es Gott gibt und somit auch eine gerechte Gottesstrafe, lässt sich erahnen, welche Ereignisse zu dieser Vorhölle geführt haben könnten. Um 1270 wurde auf dem Adlersberg ein Dominikanerinnenkloster von Ludwig dem Strengen gegründet und gebaut. 300 Jahre später wurde das Kloster profaniert und die armen Nonnen wurden vertrieben. In den Geschichtsbüchern wird dieses gotteslästerliche Vorgehen als erste urkundlich belegte Eigenbedarfskündigung vermerkt. Statt gebetet wurde nur noch gebraut und getrunken. Gott wird sich gedacht haben, dass sich da doch jemand einmischen muss. Und wenn nicht er, wer dann? Also stellt er die Gemeinde vor die Wahl: 7 Jahre Dürre, regional begrenzte Sintflut oder Palmatorfest. Da der Gemeinderat damals ausschließlich aus der siebenköpfigen Wirtsfamilie bestand, die übrigens nicht das Geringste mit den jetzigen, netten und hilfsbereiten Besitzern gemein hatte, fiel die Wahl einstimmig auf das Palmatorfest.
Die Stadt Regensburg weiß, welcher Segen es für sie ist, dass der Palmator weit draußen stattfindet. Sie war deswegen zeitweise so euphorisiert, dass logische Denkprozesse darunter litten und fatale Fehlentscheidungen getroffen wurden. Ein Pendelverkehr vom Hauptbahnhof wurde eingerichtet, der die Trinkwütigen aus der Stadt hinaus und auf den Adlersberg hinauf bringen sollte. Die Vision war, einen Tag lang ein komplett besoffenenfreies Regensburg zu schaffen. Bis ca. 14 Uhr ging die Rechnung auf. Bald wurde den Verantwortlichen klar, dass ein Pendel nicht nur hin, sondern auch her schwingt.
Mein Freund Claudius wohnte in einem kleinen Häuschen der pittoresken Ganghofersiedlung im Stadtsüden. Warum er in den 90er Jahren für 350 D-Mark dort wohnen konnte, die Liliput-Häuser dagegen aktuell für 1,5 Millionen Euro zum Verkauf stehen, könnte einer der Gründe sein, warum so viele Menschen versuchen, auf dem Adlersberg mutwillig ihre Hirnzellen zu vernichten. Sie ertragen es nicht. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt geht es erst mal um den 5. April, den Palmsonntag des Jahres 1998. Claudius hatte einen entspannten Vormittag vorm Fernseher bei der Wiederholung des Aktuellen Sportstudios vom Samstag verbracht. Normalerweise schaute er das aktuelle Sportstudio nur einmal an, entweder samstags oder sonntags. Am 4. April hatten aber die Bayern Werder Bremen auswärts mit 3:0 vom Platz gefegt. Zwei Tore Scholl, eins Jancker. Bayern blieb weiter bis auf zwei Punkte dran am Tabellenführer Kaiserslautern. Dieses Spiel hatte bei Claudius alle Zweifel beseitigt, dass am Ende wieder „Deutscher Meister wird nur der FCB“ gelten werde. Wie würden wir vor dem Ausland, vor Real Madrid, Juventus Turin und Arsenal dastehen, wenn Deutschlands beste Fußballmannschaft aus dem pfälzischen Hunderttausendseelen-Kaff Kaiserslautern käme. Man stelle sich einen britischen Fußballfan vor, der nach dem Pub-Besuch vor laufender Kamera versucht, die Champions League-Paarung seines Lieblingsvereins gegen den FC Kaiserslautern auszusprechen. Aber jetzt Gott sei Dank das 3:0, das sich beim zweiten Ansehen noch triumphaler, noch heroischer, noch seelenbalsamierender anfühlte als am Abend davor. Selten hatte ein Samstag so gut aufgehört und ein Sonntag so herrlich angefangen. Parallel zum Torwandschießen widmete er sich der Lektüre der regionalen Sonntagszeitung. Das Blatt erinnerte ihn ans Palmatorfest und wies auf den praktischen Pendelbusverkehr hin. Ein Wink des Schicksals. Schließlich gab es etwas zu feiern. Er ließ sich ein Bad ein, rasierte sich, duftete sich ein, zog Cordhose, Pulli und das beige Sakko an. Zur Sicherheit packte er eine gefütterte Windjacke in den kleinen Rucksack, falls es später und kälter werden sollte. Am Tag zuvor hatte er sich in der Schusterei in Stadtamhof zugegeben etwas überteuerte, aber sehr elegante Wildlederschuhe gekauft. Der Palmsonntag schien wie geschaffen dafür zu sein, die neuen Halbschuhe einzuweihen.
Inzwischen war es 14:30 Uhr geworden. Zum Bahnhof brauchte er fußläufig 25 Minuten. Er legte die Strecke mit einem breiten Lächeln zurück, weil die Schuhe nicht nur klasse aussahen, sondern auch hervorragend passten. Sie waren bequem genug, mit ihnen vom Adlersberg heimzuwandern, falls er dort Freunde treffen und ihm das Fest so gut gefallen sollte, dass er über die Pendelbuszeiten hinaus dort feiern wollte. Zunächst war er etwas verunsichert, weil sich außer ihm keine Menschenseele an der Haltestelle befand. Nach und nach kamen ein paar Leute, die sich gesittet hinter ihm anstellten. Gut, dachte er, als Erster habe ich einen Sitzplatz sicher. Von Weitem schon war die Leuchtschrift „Sonderfahrt“ auf dem Bus zu lesen, der in die Maximilianstraße eingebogen war und gleich in der Haltestellenharfe am Bahnhof ankommen würde. Mit einem langgezogenen Zischen, das man auch als bedeutungsschwangeres Stöhnen interpretieren hätte können, öffneten sich die hinteren Flügeltüren. Claudius trat etwas zur Seite, damit die zurückkehrenden Fahrgäste ungehindert aussteigen konnten. Ihm schwallte ein Starkbier- und Magensäure-Dunst entgegen, von dem er hoffte, dass er sich auflösen würde, bevor er einstieg. Der Bus leerte sich. Ganz zum Schluss wollten zwei steilwinkelig aneinandergelehnte junge Männer in kurzen Lederhosen und Trachtenjanker aussteigen. Noch im Bus schrie einer dem anderen ins Ohr: „Binagschpanomanzuchhoamnodawischn.“ Der andere antwortete nicht. Auch trat er statt auf die unterste Stufe des Busausstiegs ins Leere, worauf die beiden Claudius vor die Füße fielen und sofort damit anfingen, sich über seine Wildlederschuhe zu erbrechen. Claudius kam es wie eine Ewigkeit vor, bis sie damit fertig waren. Der Eloquentere der beiden schien betroffen zu sein und äußerte ein devotes „Schuliun“. Der andere wischte mit den Händen Claudius’ Schuhe ab und wollte alles ungeschehen machen, indem er versuchte, mit dem Janker-Ärmel nachzupolieren. Dann krochen sie weiter zum Bahnsteig 9, auf dem der Zug nach Straubing zur Abfahrt bereit stand. Claudius nahm zwei Tempos aus der Sakkotasche. Er zog Schuhe und Strümpfe aus, entsorgte sie im Mülleimer an der Fahrplanaushangstange und machte sich barfuß auf den Weg nach Hause. Er wusste nicht genau, warum, aber irgendwie war er in seinem Innersten froh drüber, dass es so gekommen war.
Der Palmator wird nicht nur auf dem Adlersberg ausgeschenkt. Auf der Tremmelhauserhöhe findet am Palmsonntag ebenfalls ein Starkbierfest statt. Doch trennen die beiden Veranstaltungen Welten.
„Kind von fliegendem Maßkrug getroffen“ lautete eine Schlagzeile nach dem Adlersberger Palmatorfest 2019. Beim Höhwirt dagegen lassen Kinder etwas fliegen. Und zwar ihre Drachen. Auf der angrenzenden Wiese herrscht ein buntes Treiben. Kleine Drachenbändiger und Sandkasten-Ritter spielen neben den Biertischen ihrer Eltern, die sich kultiviert über das Tagesgeschehen in und um Regensburg unterhalten. Es wird auf Bäume geklettert, in gemischten Mannschaften mit festgelegter Mädchenquote Fußball gespielt, im Schatten jahrhundertealter Bäume gepicknickt. Die Gäste klappen ihre Biertische und -bänke selbst auf und stellen sie hin, wo es ihnen am besten gefällt. Während am Adlersberg ein zürnender Gott Peitschenhieb um Peitschenhieb auf die Gemeinde niederprasseln lässt, erscheint Tremmelhausen so idyllisch, als hätte man es vorsichtig aus einem Hedwig-Courths-Mahler-Roman herausgeschnitten und behutsam als weit sichtbares Zeichen der Liebe, des Glücks und des Friedens auf einer von weiten Feldern, Wiesen und kleinen Waldungen dekorierten Anhöhe eingepflanzt. Als hätte man es einem Bilderbuch aus unbeschwerten Kindertagen entnommen.
Seit Generationen verkauft die Höhwirt-Familie selbstgemachten Leberkäse und Kuchen aus dem Fenster heraus. An einem anderen Fenster um die Ecke darf man sich für Getränke anstellen. Das alles zu Preisen, die den Gastronomen in der Innenstadt die Schamesröte in ihre profitgierigen Hamsterbacken treiben sollten.
Was macht die generationenübergreifende Anziehungskraft der Tremmelhauserhöhe aus? Ist es, dass man zwei Radler nehmen muss, auch wenn man nur eine haben will, weil sonst am Ende des Tages eine halbe Flasche Limo übrigbleiben könnte? Ist es, dass es keinen Service gibt, sondern du nach etlichen Bieren den immer beschwerlicher und länger werdenden Weg zur Getränkeausgabe selbst auf dich nehmen darfst? Ist es der asphaltierte Vorhof, von dem sich, gehörte er nicht zur Tremmelhauserhöhe, behaupten ließe, dass er den Charme eines Aldi-Parkplatzes versprüht?
Bereits in vierter Generation betreibt die Familie Huf die Wirtschaft sehr erfolgreich. Rückblickend kann man sie als die Erfinder des Guerilla-Marketings bezeichnen. Eine Werbeform, die sich von konventionellen Werbemedien abwendet und trotz geringstem finanziellem Aufwand gute Erfolge generiert. So war der Saal des Höhwirts für eine Hochzeit reserviert worden. Als die Braut fragte, welche Speisen der Höhwirt denn kredenzen wolle, antwortete dieser mit „Schweinebraten“. „Und für unsere vegetarischen Gäste?“, hakte die Braut nach, worauf vom Wirt ein trockenes „Gemischter Braten“ kam. Natürlich wusste der Höhwirt, dass Vegetarier über einen Gemischten Braten nicht besonders amused sein würden. Selbstverständlich hätte er wie aus der Pistole geschossen vier bis fünf vegetarische Gerichte aufzählen können, die er hervorragend zuzubereiten wusste und nach denen sich sogar Veganer die Finger abgeleckt hätten. Er wusste aber, dass die geschwätzige Braut für ihn ein hervorragender Verteiler war. Wieder und wieder würde sie die Anekdote über den einfach gestrickten Hufwirt ihren Freundinnen und Kolleginnen, die mindestens ebenso geschwätzig wie sie waren, erzählen. Diese würden sie ausschmücken und weitererzählen und wieder weiter und noch mal weiter. Der Höhwirt hatte gezieltes Guerillamarketing in Form der sich schneeballsystemartig verbreitenden Mundpropaganda eingesetzt. Bald fragte sich Gott und die Welt, wo denn dieser Höhwirt sei, wie man dorthin komme, wie viele Wochen im Voraus man einen Tisch für zwei Personen bestellen müsse und ob sich ein Hubschrauberlandeplatz in der Nähe dieses sagenumwobenen Gourmet-Tempels befinde. Der Mythos Tremmelhausen war geboren. Von nun an war es für den schlitzohrigen Höhwirt ein Leichtes, die Legendenbildung um sein Wirtshaus zu verstärken. Auf die Frage „Welche Salate bieten Sie an?“ antwortete er mit „Fleischsalat“. „Ob die köstlichen Kuchen selbst gebacken sind?“ „Ja, vom Bäcker.“
Bestätigten Gerüchten zufolge soll im Tresor des Höhwirts ein Büchlein liegen, das von Generation zu Generation vererbt wird und in das noch kein Außenstehender einen Blick werfen durfte. Es soll den Titel „200 sehr gute Antworten auf 200 saublöde Fragen“ tragen.
TAXI DRIVER – SIND SIE NOCH FREI?
Also, warum willst du den Job? – Ich kann nachts nicht schlafen. – Geh in einen Pornoschuppen. Das macht müde. – Das wirkt auch nicht. – Wenn das nicht hilft. Was machstn dann? – Hänge so rum, meistens auf der U-Bahn. Da hab ich mich gefragt: Warum probierst du nicht, in der Zeit Piepen zu verdienen. – Würdest du nachts auch in die Slums fahren, nach Harlem und South-Bronx? – Ich fahr überall hin und wann Sie wollen. – Wie sieht’s aus mit jüdischen Feiertagen? – Überall hin, wann Sie wollen. – Schön, zeig mir mal deinen Führerschein. – Wie viele Verkehrsstrafen hast du? – Keine, Sir. Ich bin sauber, rein wie ein Engel. – Sehr witzig. Versuch nicht mich zu verarschen. Alle Jungs, die sich hier bewerben, denken, sie könnten mich verschaukeln. Wenn du vorhast, mich zu verscheißern, kannst du dich gleich verpfeifen. Ist das klar? – Tschuldigung, Sir, ist mir so rausgerutscht.