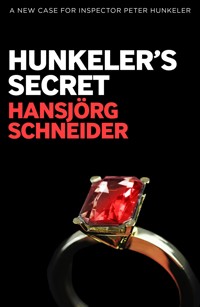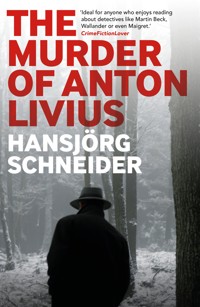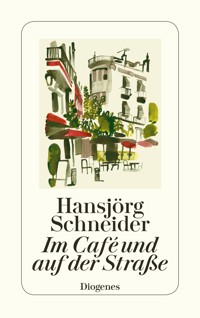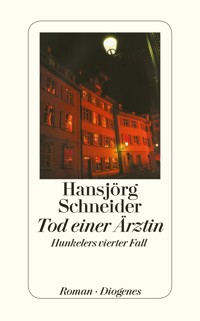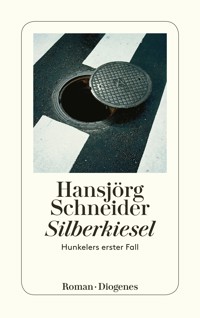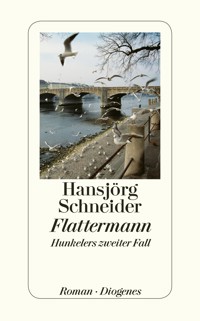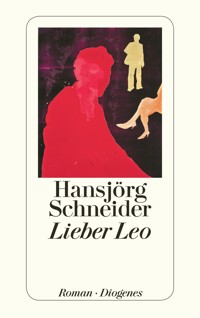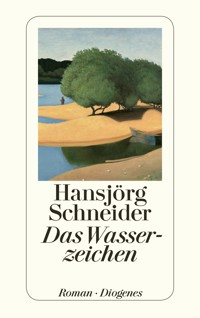7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg hat Hansjörg Schneider Tagebuch geführt. Er notiert Lektüren, Begegnungen, Projekte. Er hält die Glücksmomente fest, die der Tag bringt, und die Alpträume, die ihn in der Nacht heimsuchen. Und immer wieder führt die dichteste Gegenwart zurück in die Vergangenheit, die ihn nicht loslässt. Hansjörg Schneider protokolliert sein Leben – schonungslos gegen sich und die Welt, berührend und mit lakonischem Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hansjörg Schneider
Nilpferdeunter dem Haus
Erinnerungen, Träume
Die Erstausgabe erschien 2012 im Diogenes Verlag Der Text Wasserfrau und Seeforelle (S. 112) ist in einer früheren Fassung erstmals am 16.8.2008 in Annabelle, Zürich, erschienen Der Text Der Kater (S. 118) ist in einer früheren Fassung erstmals am 27.11.2008 in Schweizer Familie, Zürich, erschienen Covermotiv: Gemälde von Heiner Kielholz, ›Katze‹, 1993 (Ausschnitt) Privatbesitz Foto: Copyright © Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich, Lutz Hartmann
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24405 2
ISBN E-Book 978 3 257 60155 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Inhalt
ITagebuch 18. Dezember 2000 – 15. April 2001[5]
IITagebuch 17. Februar 2008 – 28. Mai 2008[76]
IIIWasserfrau und Seeforelle[112]
Der Kater[118]
Meine Mansarden[128]
IVTagebuch 1. Juni 2009 – 13. Juli 2009[139]
VTagebuch
[5] I
Tagebuch 18. Dezember 2000 – 15. April 2001
Todtnauberg, 18. 12. 2000
Gestern vor 44 Jahren hat sich meine Mutter im Kohlenkeller meines Vaters neben den Gasanzünder gelegt, um zu sterben. Ein Datum, das ich immer wieder vergesse. Ich weiß nur, dass sie kurz vor Weihnachten gestorben ist. Dann schaue ich nach und sehe: 17. Dezember 1956.
Vor einem knappen Monat war das Sterbedatum meiner Frau A., 22. November 1997. Dieses Datum vergesse ich nie. Sie ist an Krebs im Kantonsspital Basel gestorben.
Ich sitze an einem Tisch im Hotel Engel, Todtnauberg, Schwarzwald, 1000 Meter über Meer. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe, dass die beiden Frauen, die für mich entscheidend waren, in relativ jungen Jahren gestorben sind.
Es ist zehn Uhr morgens. Ich habe soeben einen Spaziergang über die verschneiten Hügel gemacht. [6] Die unberührte, weiße Fläche, die schwarzen Tannen, am südlichen Horizont die Alpen im Dunst. Eine Schönheit, die mich jedes Mal aufs Neue überrascht. Warum ist die Welt so schön anzuschauen?
Todtnauberg, 19. 12. 2000
Ich habe hier oben ein Appartement mit zwei Zimmern gemietet, zu einem Spezialpreis, da mich die Wirtsleute mögen. Ich darf das Schwimmbad und die Sauna benutzen. Wenn ich Lust habe, setze ich mich abends in die Wirtschaft an den Stammtisch und trinke Bier. Ich habe mich mit dem alten Wirt angefreundet, der im Rollstuhl lebt. Mit einem Dachdecker. Mit einem Steuerberater. Mit einem Spengler im Ruhestand. Mit einem Maschinenschlosser in meinem Alter, der nebenbei noch ein paar Kühe hat. Und mit den Frauen, die bedienen. Ich rede mit diesen Leuten Schweizerdeutsch, sie reden Alemannisch.
Ich bin vor drei Jahren, nach dem Tod meiner Frau, hier heraufgekommen. Seither verbringe ich die Hälfte der Zeit hier oben. Es ist ein von meiner Vergangenheit unbelecktes Gebiet. Anstatt der Basler Zeitung lese ich die Badische Zeitung.
Am Morgen um acht sitze ich im Wirtsraum unten und frühstücke. Dann gehe ich hinauf auf die Hügel. Zwei, drei Stunden wandern, im Winter mit [7] den Skiern. Mittags koche ich eine Suppe. Ich lege mich hin und schlafe eine knappe Stunde. Ich gehe hinunter und trinke Kaffee. Ich überlege, was ich schreiben könnte. Dann setze ich mich in meinem Appartement hin und schreibe. Manchmal kommt eine Katze herein, miaut freundlich und trinkt etwas Milch. Meist setzt sie sich anschließend aufs Kanapee und schaut mir eine Weile zu, wie ich krumm über den Tisch gebeugt dahocke, vor mir das Schreibheft, in der Hand den Kugelschreiber. Wenn ich nicht weiterweiß, stehe ich auf und laufe wie ein Tiger im Käfig herum. Wenn ich ein Stück schreibe, deklamiere ich laut meine Sätze. Worauf die Katze das Weite sucht.
Manchmal übernachtet sie bei mir, sie schläft in meinen Kniekehlen. Da ich nicht mehr durchschlafen kann, miaut sie jeweils empört, wenn ich um halb drei erwache, mich in der Stube an den Tisch setze, um den Traum, der mich geweckt hat, aufzuschreiben. Ich erwache jede Nacht um halb drei. Meist ist es ein schlimmer Traum, von Abschied und Schuld. Ich banne diese Träume, indem ich sie aufschreibe. Und schlafe gleich wieder ein. Für gewöhnlich ist dann die Katze weg, sie mag Nachtruhestörung nicht.
Ein gutes Leben eigentlich, das ich hier oben führe. Ein gutes Schreiben. Schreiben ist für mich zum Leben geworden.
[8] Zu Lebzeiten meiner Frau habe ich leichter, spielerischer geschrieben. Ich habe nur geschrieben, wenn ich Lust dazu hatte. Jetzt kann ich nicht mehr leben, ohne zu schreiben.
Ich habe zwei Theaterprojekte zugesagt, beide für 2003. Eines im Klosterdorf Muri, das andere im luzernischen Entlebuch, über den Bauernkrieg von 1653. Das eine soll Liliana Heimberg inszenieren, das andere Louis Naef. Mit beiden bin ich befreundet. Die zwei Projekte werden mich aus meiner Einsamkeit herausreißen. Ich werde streiten und lachen.
Mit meinem Buchverleger Egon Amman ist ausgemacht, dass ich bis Ende 2001 einen weiteren Hunkeler-Krimi abliefern soll. Den Termin werde ich nicht einhalten können, aber ich freue mich aufs Schreiben.
Am liebsten würde ich einen langen Roman über A. schreiben. Über ihre Herkunft, ihren Werdegang, ihre Begegnung mit mir. Über ihre 35 Jahre dauernde Liebe zu mir. Ich habe nicht den Mut dazu. Die Urne mit ihrer Asche steht immer noch in meiner Basler Wohnung.
Also schreibe ich ein Tagebuch, dafür reicht mein Mut. Dieses Tagebuch handelt von mir. Von einem trauernden Witwer, der immer noch nicht ins Leben zurückgefunden hat und vielleicht nie [9] zurückfinden wird. Der an einer Schuld herumkäut, die vielleicht gar keine ist.
Todtnauberg, 20. 12. 2000
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der seine Liebe durch Krebs verloren hat, keine Schuldgefühle hat. Diese Krankheit ist nicht zu verstehen. Man schaut dem Sterben zu, dieser grausamen, unabwendbaren Veränderung hin zum Tode. Und wenn der geliebte Mensch tot daliegt, will man auch nicht mehr leben.
Krebs ist Vernichtung des Lebens, langsam, präzise, unaufhaltbar. So war es jedenfalls bei meiner Frau. Ich wusste seit der Diagnose, dass nichts zu machen war.
Man sucht nach Gründen. Gewiss war das Zigarettenrauchen ein Hauptgrund. Warum, so frage ich mich, habe ich sie nicht gezwungen, mit der selbstmörderischen Raucherei aufzuhören? Oder war es meine Lieblosigkeit? Woher kam denn diese Lieblosigkeit, da ich A. ja über alles liebte?
Es gab Tage, da bestand ich nur noch aus Hass. Auf mich, auf die Welt. Dieser Hass war eine produktive Kraft für mein Schreiben. Aber an diesen Tagen habe ich auch A. gehasst. Das war gar nicht anders möglich, sie war meine Nabelschnur zur Welt. [10] Ich saß dann stumm da und habe sie voller bösen Gifts angeschaut. Sie hat darunter gelitten, konnte sich meinen Hass nicht erklären. Er hatte ja nichts zu tun mit ihr.
Natürlich hat sie gewusst, dass ich sie liebe. Das hat sie besser gewusst als ich. Aber ich bin einer, der immer wieder versucht, das, was er liebt, zu zerstören. Der Tod soll holen, was ich liebe. Anders gesagt: Ich kann meine Liebe am besten zeigen, indem ich sie zerstören will. Die intensivste Liebe ist die Destruktion.
Ich würde das nicht aufschreiben, wenn ich nicht wüsste, dass dies nicht nur mein persönliches, privates Problem ist. Es ist das Problem unserer Zivilisation, unserer Kultur. Es ist eine christliche Kultur, die ja eine Kultur der Liebe sein sollte. Ist sie aber nicht. Es gibt keinen Gott, in dessen Namen so viel zerstört und getötet worden ist, wie den Christengott. Es gibt keine Religion, in deren Namen die Frau so umfassend zerstört und vernichtet worden ist, wie die christliche Religion. In diesem Sinn trage ich 2000 Jahre christlichen Männerwahn auf dem Buckel.
A. hat mir mehrmals gesagt, ich sei der liebste Mensch auf dieser Erde. Wir haben es meist gut gehabt miteinander, wir haben uns schön geliebt. Woher kommen denn meine Schuldgefühle?
[11] A. und ich sind gerne verreist, wir waren ein ideales Reisepaar. Am liebsten sind wir auf eine ägäische Insel geflogen. Wir haben ein Zimmer gemietet, und wenn uns langweilig wurde, haben wir uns auf einen der alten, schweren Kähne gesetzt. Wir sind von Insel zu Insel gefahren. Wo es uns gefiel, gingen wir an Land und blieben ein paar Tage.
Die Ägäis ist die schönste Landschaft, die ich kenne. Überall freundliches, helles Wasser, aus dem die Inseln aufsteigen, lieblich, beruhigend, ein Augentrost.
Einmal, es muss vor rund sieben Jahren gewesen sein, sind wir von Mykonos nach Paros hinübergefahren. Wir haben vorn auf dem untersten Seitendeck an der Reling gesessen und aufs Meer hinausgeschaut. Wir saßen rechts, ich weiß noch, wie die Bugwelle vom Rumpf wegrollte, hinaus aufs offene Wasser. Ein Sog war da, ein Strudel, dicht am fahrenden Schiff, das die Bugwelle seitlich wegschob, stetig in der schweren, vorwärtsdrängenden Bewegung. Dieser Sog schien mir plötzlich unausweichlich. Es war ein Sog in die Tiefe, ich erschrak. Dieser Sog war eine akute Gefahr, das fühlte ich deutlich. Nicht für mich, sondern für A. Ich verspürte den Drang, sie in diesem Sog untergehen, verschwinden zu sehen. Das kam plötzlich, ausweglos, am helllichten Tag. Ich hielt diesem erschreckend schönen Bild einige [12] Minuten stand, starrte auf das wegrollende Wasser, auf die dunkelblaue Tiefe darunter. Ich erhob mich und zerrte A. ins Innere des Schiffes, hinein an die Bar, wo wir Kaffee bestellten. Ich muss ziemlich verstört gewirkt haben, A. hat mich jedenfalls mit neugierigen, erstaunten Augen angeschaut.
Ich habe ihr nie etwas von diesem Erlebnis erzählt. Es war der Einbruch von etwas Urtümlichem in mein helles Tagesbewusstsein, unkontrollierbar, von atavistischer Notwendigkeit. Der ungeahnte Wunsch, meine Geliebte in der blauen Flut der Ägäis wegtauchen zu sehen.
Ich lese gerade Rüdiger Safranskis Buch über Nietzsche. Ich mag Safranski, schon seine Biografie über Martin Heidegger fand ich hervorragend.
Ich hatte nie etwas von Philosophie gehört, ehe ich mit zwanzig nach Basel an die Universität ging. Dort habe ich die Vorlesungen von Karl Jaspers besucht.
Von sechzehn bis zwanzig bin ich jeden Morgen mit der Eisenbahn nach Aarau ins Gymnasium gefahren und am Abend wieder zurück nach Zofingen. An diesem Gymnasium kam Philosophie nicht vor.
In Aarau ging ich jeden Mittag zu meiner Großmutter, um bei ihr zu essen. Es war das Haus, in [13] dem meine Mutter aufgewachsen war. Mein Großvater, der auf dem Güterbahnhof arbeitete, hatte es bauen lassen. Zweistöckig, mit großem Gemüsegarten, mit einem Bohnapfelbaum und einem mächtigen Nussbaum.
Ich erinnere mich noch genau an den Duft, der in diesem Haus hing. Es duftete nach Äpfeln, nach Suppe, nach gewichstem Linoleum und nach undurchlüftetem Mief.
In diesem Haus wohnte meine Großmutter, eine kleine, evangelisch fromme Frau. Es wohnte auch Onkel Fritz hier, der war debil. Das hatte in seiner Pubertät angefangen. Er hatte keine Lehre machen können und einige Zeit in Anstalten verbracht, bis ihn die Großmutter nach Hause nahm. Er trug stets ein über die Ohren gezogenes Béret und neigte zur Fettleibigkeit. Nach dem Essen versuchte er jeweils, auch noch die Salatsoße auszutrinken.
Er starb, als ich 22 war. Ich habe von ihm 2000 Franken geerbt und bin damit sogleich für einige Monate nach Paris gefahren.
Außerdem wohnte hier Tante Hanna. Sie war wie meine Mutter Lehrerin geworden, war ledig geblieben. Sie hatte eine Zeitlang in Schinznach Dorf unterrichtet, bis es nicht mehr ging. So hat man sich das in der Familie Riniker damals erklärt: Es ist nicht mehr gegangen. Fortan blieb sie zu Hause.
[14] Diese Tante Hanna war eine Leserin. Später, im Altersheim, hat sie Hemingways Sämtliche Werke gekauft und gelesen. Sie hat alle meine Bücher gelesen.
In der Stube stand eine Ofenkunst mit grünen Kacheln. In der Mitte der Tisch, darüber die Zuglampe mit dem Gegengewicht aus Porzellan. An der Wand ein Kanapee.
Nebenan lag das Festzimmer, das nur an Weihnachten benutzt wurde. Es blieb im Winter ungeheizt. Dort gab es ein Büchergestell, und auf diesem Büchergestell standen die Bücher von Hermann Hesse und Ernst Wiechert. Seltsamerweise waren auch Nietzsches Sämtliche Werke da, grüne Bände, ungefähr zwölf an der Zahl. Wie die hierhergekommen waren, habe ich nie erfahren. Tante Hanna hat nicht darüber geredet.
Immer über Mittag, wenn ich gegessen hatte, habe ich mich im Festzimmer hingelegt und gelesen, was da war. Erst Wiechert, dann Hesse. Dann habe ich mich hinter Nietzsche gemacht.
Ich habe nicht viel begriffen. Es hat mir niemand gesagt, wie man so etwas lesen muss, wovon Nietzsche überhaupt redet. Ich wusste nicht einmal, wann er gelebt hatte, gegen was er gekämpft hat, in welcher Tradition er stand. Ich hatte kein Koordinatensystem, in das ich ihn hätte einordnen können. Er [15] ging auf mich los wie ein glühender Meteor. Seine Sprache hat mich süchtig gemacht, seine poetischen, rücksichtslosen, giftigen Sätze. Ich habe Seite um Seite verschlungen. Und etwas habe ich begriffen. Was am Umfallen ist, soll man stürzen. Der Starke muss einsam bleiben. Liebe ist Schwäche. Und mit den Weibern ist nichts Rechtes anzufangen.
Das war die Zeit, in der meine Mutter krank wurde.
Jetzt, bei der Lektüre von Safranskis Buch, komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Wie war es möglich, dass ich diesem Übermann auf den Leim kroch? Diesem eingebildeten, genialen Trottel, der keine Ahnung hatte, was Liebe ist? Ich habe das ja nicht als historische Literatur gelesen, als Sturmböe gegen die Windstille des Biedermeier. Sondern als Botschaft eines heute lebenden Freundes.
Jaspers hat mich dann eines Besseren belehrt. Und bald darauf habe ich Brechts Liebesgedichte gelesen.
Von siebzehn bis neunzehn hatte ich eine Freundin. Wir trafen uns jeden Morgen in der Eisenbahn, setzten uns ins Abteil neben der Toilette und küssten uns. Manchmal legten wir uns auch an die Aare oder stiegen auf den Bornberg bei Aarburg hinauf und umarmten uns auf einer Felskanzel, von der man weit ins Mittelland sah.
[16] Aber auch diese traumhafte Jugendliebe ging zu Ende. Ich habe meine Freundin mehrmals tief verletzt. Ich habe sie nicht nur meine Hitze, sondern auch meine Kälte, die nach dem Tod meiner Mutter in meinem Herzen war, spüren lassen. Ich habe sie beleidigt. Bis sie sich von mir verabschiedet hat.
Danach habe ich ohne Liebe gelebt, abgesehen von kurzen Verliebtheiten, wie das so üblich war. Einmal, mit 22 Jahren, bin ich einer Frau begegnet, der ich vom ersten Augenblick an verfallen war. Sie war verlobt, sie ist bei ihrem Verlobten geblieben und hat ihn geheiratet.
Richtig zu lieben habe ich erst bei A. gelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick, die bis heute andauert.
Todtnauberg, 21. 12. 2000
Heute ist Wintersonnenwende. Ich bin soeben auf dem Stübenwasen gewesen und habe in die Landschaft geschaut. Im Süden die Alpen, dunkel aufragend am Horizont. Ich kenne diese Berge, ich habe einige davon bestiegen, als ich ein junger Mann war.
Den schönsten Berg, auf dem ich war, sieht man von hier oben nicht. Es ist die Bernina.
Ich war damals in Chur in der Rekrutenschule. An einem Samstag nach dem Abtreten bin ich mit einem Kollegen in die Bahn nach Pontresina [17] gestiegen. In der Toilette haben wir die Uniform aus- und die Kletterhosen angezogen. Um sieben Uhr abends haben wir uns zur Tschierva-Hütte aufgemacht. Ich weiß noch, dass es den ganzen Weg geregnet hat. Um Mitternacht waren wir in der Hütte. Da sie überfüllt war, haben wir uns auf den Boden gelegt und ein bisschen geschlafen. Um drei sind wir losgezogen, wir waren die ersten an diesem Morgen. Als die Sonne aufging, waren wir im Sattel, dort, wo man in den Biancograt einsteigt. Wir haben die klassische Route gemacht, über Grat und Gipfel und dann hinunter über den Gletscher zur Morteratsch-Hütte. Wir haben nie länger als zehn Minuten gerastet, damit wir am Abend den letzten Zug noch erreichten. In der Eisenbahntoilette haben wir wieder die Uniform angezogen und waren pünktlich in der Kaserne.
Nach der Rekrutenschule habe ich vor allem in Basel gelebt, in Mansarden, ich hatte fast kein Geld. Die Abende habe ich beim Bier in den einschlägigen Beizen verbracht, mit Leuten, die ich interessant fand. Ich war ausschließlich mit Männern zusammen. Von Frauen habe ich mich meist ferngehalten.
Einmal hat mich eine Dreißigjährige, die manchmal als Hure arbeitete, heimbegleitet, weil ich ihr gefiel. Ich weiß noch, dass sie sich mit meinem Sperma ihre kleinen Brüste eingerieben hat. Sie würden so größer werden, hat sie behauptet.
[18] Ich frage mich, warum ich mich nicht öfter zu einer Frau gelegt habe. Ich denke, dass die Liebe, die Erotik für mich tabuisiert war. Erst durch meine prüde Erziehung. Dann, und vor allem, durch den Tod meiner Mutter. Ihr Leichnam hat in unserer Stube gelegen und zusammen mit den Blumen, die um ihr wächsernes Totengesicht herumstanden, einen Duft verströmt, den ich nicht mehr aus der Nase brachte. Liebe war für mich nach ihrem Hinscheiden für lange Zeit unmöglich.
Bis ich A. begegnet bin. Sie hat mich gestreichelt und geküsst. Sie hat mich zur Liebe verführt.
Dann lag auch sie tot da, nicht bei mir zu Hause, sondern im Spitalbett. Wieder der seltsame Duft, diesmal nicht gemildert von Blumen, die waren erst bei der Abdankung da.
Ich habe mir schon nach dem Sterben meiner Mutter Selbstvorwürfe gemacht. Wieso bin ich nicht lieber zu ihr gewesen, habe ich mich gefragt. Wäre sie am Leben geblieben, wenn ich besser zu ihr geschaut hätte? Ich wusste, dass diese Fragen falsch waren. Dass ein achtzehnjähriger Mann sich von seiner Mutter lösen muss. Dass ich immer sehr lieb zu meiner Mutter gewesen bin, einfach deshalb, weil sie mir immer und überall, wo sie konnte, geholfen hat. Ich wusste auch, dass Suizid ein Menschenrecht ist. Trotzdem waren die Vorwürfe da.
[19] Jetzt, seit etwas mehr als drei Jahren, wiederholt sich diese Schuldgeschichte. Auch jetzt weiß ich, dass sie falsch ist. A. hat es mir deutlich gesagt. Sie hat gesagt: Hör sofort auf mit dem Blödsinn.
Trotzdem frage ich mich, ob sie vielleicht noch leben würde, wenn ich lieber gewesen wäre zu ihr. Ich denke, dass diese Frage für einen alternden Witwer ganz normal ist. Ich werde mich dies fragen, bis ich sterbe.
Ich habe kürzlich den Turmbau von Dürrenmatt gelesen, den zweiten Band seiner Stoffe. Auf den ersten Seiten versucht er zu philosophieren, als würde er eine Seminararbeit schreiben. Später berichtet er über den Tod seines Schäferhundes. Er geht in die Details, schildert, wie er den Kadaver zum Abdecker bringt und so weiter. Was soll das?, habe ich mich gefragt. Wieso verschwendet der alte Mann seine Schreibzeit an den Tod eines Köters?
Gleich anschließend habe ich begriffen, warum. Dürrenmatt schreibt dann über den Tod seiner Frau. Kurz, fast protokollarisch, kühl. Alles, was er über diesen Tod hat sagen wollen, hat er bereits in die Schilderung des Sterbens des Hundes gelegt. Er war offenbar nicht fähig, direkt über den Tod seiner jahrzehntelangen Geliebten zu schreiben. Was ich gut begreife.
[20] Todtnauberg, 22. 12. 2000
Ich habe nie erlebt, dass sich meine Eltern umarmt oder geküsst hätten. Vermutlich haben sie das ab und zu getan, aber nie vor uns Kindern.
Ich habe selten erlebt, dass mein Vater gelacht hat. Offenbar fand er das Leben nicht lustig. Nur manchmal, wenn er ein Glas Wein zu viel getrunken hatte, was pro Jahr vielleicht zweimal vorkam, hat er laut losgewiehert. Dann hat er Wörter gebraucht wie »cheibe Löl«, »dumme Cheib«.
Meine Mutter hat uns Grimms Märchen so lebendig erzählt, dass ich sie heute noch auswendig kann. Sie hat viel gelesen.
Mein Vater hat von meiner Jugendfreundin nichts gewusst. Meiner Mutter habe ich von ihr erzählt. Sie hat sich gefreut, dass ich so ein schönes Mädchen hatte.
Meine Mutter hat es immer wieder fertiggebracht, eine wunderbare Stimmung zu schaffen, ruhig, friedlich, so dass man sich wohl gefühlt hat. Ich habe ihr geholfen beim Bohnenabfädeln und beim Bügeln. Es war von einer zauberhaften Selbstverständlichkeit, wie wir am Tisch saßen und erzählten, was uns in den Sinn kam.
Sie hat keine Macht gehabt. Die gehörte dem Vater. Er ist immer wieder hereingepoltert. Er hat nur gestört.
[21] Er hat dreimal seine Hüftgelenke operieren müssen. Er hat sich dank seines eisernen Willens jeweils sehr schnell von den Operationen erholt. Einmal, wenige Wochen nach einem solchen Eingriff, hat ihn ein Freund besucht. Mein Vater hat ihn draußen im Garten erwartet. Er ist ächzend und stöhnend auf seinen Krücken herumgehumpelt. Dann hat er die Krücken auf einmal weggeworfen und ist schnurgerade auf den Freund zugegangen, so dass der nicht schlecht gestaunt hat. So einer war er.
Er stammte aus dem stockkatholischen Würenlingen im Aargau und ist auch dort aufgewachsen. Mausarm, sein Vater ist früh gestorben. Er hat das Lehrerseminar Wettingen besucht und ist später Gewerbeschullehrer geworden.
Er ist schon früh aus der katholischen Kirche ausgetreten. Er hat erklärt, die Wundergeschichten, etwa des Heilandes Gang über das Wasser, seien nichts anderes als billige Propaganda.
Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hat er erfahren, dass er auf der schwarzen Liste der ›Fröntler‹ stand. Was bedeutet hat, dass er beim Einmarsch der Deutschen Wehrmacht sogleich erschossen worden wäre. Er hat sich für diesen Fall einen Browning gekauft, er hätte versucht, vor seinem Tod noch drei stadtbekannte Nazis zu erschießen. Ich weiß, er hätte das gemacht. So einer war er eben auch.
[22] In unserer Stube in Zofingen stand ein Ausziehtisch aus Nussbaum, den Vater eigens von einem Schreiner hatte zimmern lassen. An diesem Tisch herrschte während der Mahlzeiten für uns Kinder Redeverbot. Den Begriff Redeverbot hat mein Vater selber erfunden. Ich vermute, es war seine einzige Erfindung.
Einmal wurde er aus irgendeinem Grund derart wütend auf die Mutter, dass er mit beiden Händen die noch halbvolle Rösti-Platte ergriff und so auf den Tisch schmetterte, dass sie in Brüche ging. Wir Kinder haben gestaunt. Die Mutter hat die Scherben eingesammelt, wir haben wortlos weitergegessen.
Nach einer Weile hielt es der Vater nicht mehr aus. Er hat Teller und Tischtuch weggeschoben und nachgeschaut. Tatsächlich wies das Tischblatt einen ziemlich tiefen, halbmondförmigen Hick auf. Das haben wir Kinder schadenfroh festgestellt. Aber keines hat gelacht. Diesen Hick hat Vater dann vom Schreinermeister mit einem genau zugeschnittenen Hölzchen ausfüllen lassen.
Der Tisch steht heute noch an derselben Stelle. Der Halbmond ist immer noch zu sehen, was mich freut. Er zeugt davon, dass mein Vater wenigstens einmal in seinem Leben eine Rösti-Platte auf einen Tisch geschmettert hat.
[23] Mit zehn Jahren war ich Mitglied einer Bande, die wir die Schwarze Hand nannten. Wir waren zu dritt, wir haben hinter dem Weiher am Waldrand oben eine Höhle gehabt. Dort hockten wir drin, kratzten mit einem Dolch ein bisschen am weichen Sandstein herum und träumten von einem Feind, der sich anschlich und uns aus der Höhle vertreiben wollte.
Der Anführer der Bande kam aus einer reichen Familie, die am Rebberg oben wohnte. Diesem Anführer hatte ich ewige Treue geschworen. Ich wäre bereit gewesen, für ihn zu sterben. Jeden Mittag nach der Schule begleitete ich ihn bis an den Fuß des Rebbergs. Erst dann machte ich mich auf den Heimweg und kam regelmäßig eine Viertelstunde zu spät. Der Mutter wäre meine Verspätung egal gewesen, die Suppe war ja noch warm. Aber mein Vater wollte meine Extravaganz nicht dulden. Er beschloss, mir den eigenen Willen auszutreiben. Er nahm mich jedes Mal, wenn ich heimkam, in sein Büro, versohlte mir mit dem Lineal den Hintern und schickte mich dann ins Bett, bis ich wieder zur Schule musste. Er hat das mehrere Monate durchgehalten. Aber ich habe auch durchgehalten. Mir waren die Schläge gleichgültig. Und bevor ich zum Nachmittagsunterricht ging, hat mir die Mutter etwas zugesteckt.
Ich weiß noch, wie idiotisch ich diese Prügelei fand und wie sehr ich Vater verachtet habe.
[24]