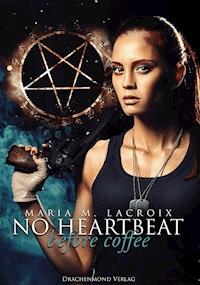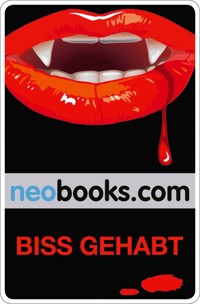Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was geschah während der acht Monate? Diana - Spezialkämpferin des Instituts für "Research and Identification of Paranormal Activities" - wurde während eines Einsatzes verflucht. Hilfe erhält sie von einem paranormalen Wesen. Doch Vertrauen zu dem Werwolf zu fassen, fällt ihr schwer. Schließlich gehört auch er in ihrer Weltsicht zum "Feind". Dass er ausgenommen attraktiv ist und eine starke Anziehungskraft auf sie ausübt, macht es auch nicht gerade leichter. Bei "No heartbeat before coffee - Die Monate dazwischen" handelt es sich um ein Spin-off zum Roman "No heartbeat before coffee". Diese Novelle lässt sich aber auch ganz unabhängig vom Roman lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No heartbeat before coffee
Die Monate dazwischen
Maria M. Lacroix
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Über die Autorin
Über diese Geschichte
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Umschlagdesign: Marie Graßhoff / Maria M. Lacroix
Layout: Michelle N. Weber
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-087-3
Alle Rechte vorbehalten
Für alle Frauen, die wissen, dass ›stark‹ und ›weiblich‹ keine Gegensätze sind.
Und für alle Männer, die solche Frauen lieben.
Kapitel Eins
Der Tag nach dem Fluch (abends)
Als wäre es nicht schlimm genug gewesen, dass mein Tag mit einem Herzstillstand, einer Reanimation und infolgedessen einer gebrochenen Rippe angefangen hatte. Nein, Mac, mein Boss, toppte das, indem er mich am frühen Nachmittag, nach viel zu kurzem Schlaf, zur Einsatznachbesprechung ins Institut beorderte. Abgesehen davon zwang er mich zu einem Gespräch mit unserer institutseigenen Psychotherapeutin. Nach extremen Einsätzen war das üblich – und ›extrem‹ war für den gestrigen Kampf noch eine Untertreibung.
Bevor ich zu Dr. Rosenbloom ging, wusch mir Mac für das Abschalten meines Handys ordentlich den Kopf. Ich konnte ihn verstehen. Die ganze Nacht über war ich nicht erreichbar gewesen und meine Kollegen hatten befürchtet, dass mir etwas zugestoßen wäre. Als ich mein Handy ausgemacht hatte, war ich davon ausgegangen, die Nacht nicht zu überleben.
Inzwischen saß ich in dem gemütlichen Behandlungszimmer, das wie das Wohnzimmer einer alten Dame eingerichtet war. Teelichter brannten und auf dem Tisch lagen hübsch angeordnet bunte Kristalle.
»Ms Cunningham. Wie schön, dass Sie zu mir gefunden haben. Wie geht es Ihnen?«, fragte Dr. Rosenbloom in ihrer Gutenachtgeschichten-Vorlesestimme.
Nervös wippte ich mit dem Fuß.Wie sollte es mir schon gehen? Eine Fülle von Gedanken rauschte durch meinen Kopf.
Du wurdest gestern Nacht verflucht. Mit einem Todesfluch, der zu jedem Sonnenaufgang aktiviert wird. Die verantwortliche Hexe – eine mächtige, gefährliche, sadistische, skrupellose, sehr erfahrene Clan-Anführerin – ist entkommen.
Der einzige Grund, weshalb ich noch lebte, war, weil mich ein Werwolf durch Zufall gefunden und mir gemeinsam mit einem anderen Hexer geholfen hatte. Ob ich den morgigen Sonnenaufgang überlebte? Keine Ahnung. Das hing davon ab, ob der Hexer und der Werwolf bis dahin ein Gegenmittel gefunden hatten.
Ansonsten hieß es: Hasta la Vista, Baby, bye-bye, sayonara, ade, du schnöde Welt! Auf jeden Fall hatte ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Stattdessen war ich auf die Hilfe paranormaler Wesen angewiesen – Wesen, die ich aufgrund meines Jobs bisher als ›Feind‹ betrachtet habe. Zusammengefasst: Mir ging es beschissen!
Statt die Gedanken laut auszusprechen, antwortete ich: »Ich bin gegen meinen Willen hier. Der Boss hat mich dazu gezwungen.«
Dr. Rosenbloom machte eine kleine Notiz und lächelte. »Erstens haben Sie meine Frage nicht beantwortet und zweitens verrät mir Ihr Sarkasmus, hinter dem Sie sich zu verstecken versuchen, mehr, als Sie wahrscheinlich meinen. Also noch mal: Wie geht es Ihnen, Ms Cunningham?«
Unruhig rutschte ich in dem bequemen Ledersessel herum. »Ich lebe.«
Noch, fügte eine kleine fiese Stimme in meinem Kopf hinzu.
Ihr Lächeln verschwand. »Das sollte der Grundzustand sein. Nichts, das man auf eine solche Frage als etwas Besonderes hervorheben sollte, Ms Cunningham. Ist es denn für Sie etwas Besonderes, dass Sie leben?«
Eigentlich wollte ich nicht darüber reden und über das alles nachdenken müssen. Durch ihre Fragerei holte sie die Geschehnisse der letzten Nacht an die Oberfläche zurück. Ich musste hier raus. Dringend.
»Möchten Sie mir nicht doch erzählen, was letzte Nacht geschehen ist, Ms Cunningham?«
Die Wahrheit war, dass ich das starke Bedürfnis verspürte, mich einem von meinen Leuten anzuvertrauen. Vielleicht hätte jemand eine Idee, wie man den Fluch brechen oder die verantwortliche Hexe finden könnte, um sie dazu zu zwingen, ihn von mir zu nehmen. Das R.I.P.A. war nicht umsonst eines der am besten ausgestatteten Institute, die sich mit der Erforschung und Bekämpfung paranormaler Wesen beschäftigten. Wir hätten sowohl die Ressourcen als auch die entsprechend ausgebildeten Leute.
Doch ich bezweifelte es. Letztendlich waren wir am Ende doch nur Menschen und ich machte mir nichts vor. Was die paranormale Welt betraf, hatten wir gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Außerdem würde ich das Risiko eingehen, suspendiert zu werden – wer würde sich schon gerne auf eine Mission mit einer Vampirkämpferin begeben, auf der ein Todesfluch lastete? Also ich nicht!
»Ms Cunningham?«, fragte Dr. Rosenbloom und sah mich auffordernd an.
Fast wäre alles aus mir herausgeplatzt, alles, was mir gestern Nacht passiert war. Aber … nein, ich konnte nicht.
Plötzlich schlug mein Herz schneller, Schauer überzogen meinen Körper, Schweiß brach in meinem Nacken aus und ich sog die Luft mit einem bebenden Atemzug ein. Ich erkannte die Zeichen. Eine beginnende Panikattacke. Ich versuchte sie in den Griff zu bekommen, mich zu beruhigen. Mit geschlossenen Augen zählte ich von zehn rückwärts bis eins. Sobald ich fertig war, öffnete ich die Augen wieder, aber viel hatte sich nicht verbessert. Ich hatte Angst.
Verflucht. Große. Angst.
Dr. Rosenbloom machte wieder eine Notiz und sah mich besorgt an. »Ist alles in Ordnung, Ms Cunningham?«
Ihre Stimme ließ mich zusammenzucken, obwohl sie weiterhin sanft und beruhigend sprach.
Geistesabwesend schüttelte ich den Kopf, weil ich nicht wusste, ob oder was ich antworten sollte. Was wirklich passiert war, konnte ich niemandem erzählen. Erst recht niemandem vom Institut.
»In Ordnung. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Sie wissen, dass Sie jederzeit in meine Sprechstunde kommen können. Ms Cunningham? Ms Cunningham?«
Abrupt sah ich zu ihr auf. Mir war nicht aufgefallen, dass ich den Boden angestarrt hatte. Ich räusperte mich, schüttelte kurz den Kopf und sah dann wieder zu ihr.
»Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe?«, fragte sie.
Ich nickte. »Wenn ich so weit bin, soll ich zurückkommen. Das mache ich, Dr. Rosenbloom.« Ich rang mir ein Lächeln ab. »Danke.«
Auch sie lächelte, doch es wirkte besorgt. Nachdem wir uns knapp voneinander verabschiedet hatten, verließ ich ihr Behandlungszimmer und ging zu Greg und Meta, die auf dem Flur auf mich warteten.
»Alles klar?«, fragte Greg grinsend und schlug mir freundschaftlich auf die Schulter. »Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich denke, der Fachausdruck lautet posttraumatische Belastungsstörung. Hab ich auch schon mal gehabt.«
Ich zuckte zusammen, zog eine schmerzverzerrte Grimasse und hielt mir die Seite. Gregs Schlag gegen die Schulter hatte den ganzen Körper erschüttert und während der Reanimation heute früh hatte mir der Werwolf, Jamie, eine Rippe an- und eine weitere komplett gebrochen.
Greg wirkte bestürzt. »’Tschuldigung. Würde echt gerne wissen, wie du es hinbekommen hast, dir zwei Rippen zu brechen.«
»Eine ist nur angebrochen.«
»Du wirst mich dafür wahrscheinlich killen, aber dieser Job ist einfach nichts für Frauen, Di. Ich frage mich, weshalb Mac das zulässt.«
»Du hast recht. Noch so ein Spruch und ich werde dich killen.«
Greg rollte mit den Augen.
Meta lächelte leicht. »Vielleicht weil Mac im Gegensatz zu dir Höhlenmensch schon im einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen ist?«
»Weiber!« Sein missbilligendes Gemurmel klang mir etwas zu aufrichtig, als würde er es ernst meinen. Bevor ich darauf reagieren konnte, fragte er: »Ich nehme an, dass du heute Abend dann nicht mitkommst?«
»Ins Rocky’s?«
Das Rocky’s war unsere Stammbar, in der wir uns oft nach Feierabend oder erfolgreichen Einsätzen trafen. Wobei ›erfolgreich‹ in dem Fall Ansichtssache war. Schließlich befand sich die Clan-Leaderin, die Hexe, die mir den Todesfluch aufgehalst hatte, noch auf der Flucht.
»Nee, lass mal. Mac hat dafür gesorgt, dass ich für die nächsten sechs Wochen krankgeschrieben bin, nachdem er von meinem Rippenbruch erfahren hat. Ich gehe nach Hause und ruhe mich aus.«
Außerdem hatte ich ein Date mit einem gewissen Werwolf, der mich zu seinem Hexer fahren wollte. Da kam mir die Verletzung als Ausrede mehr als gelegen.
Meta lächelte mitfühlend. »Hab ich mir schon gedacht.« Sie wandte sich Greg zu. »Willst du bei mir mitfahren?«
»Hey, coole Idee. Dann kann ich mich hemmungslos besaufen.« Wie ich Greg kannte, meinte er das leider nicht nur als Scherz.
Als er vorging, umarmte mich Meta vorsichtig. »Pass auf dich auf und lass es etwas langsamer angehen, okay? Du hast gestern allen einen ganz schönen Schrecken eingejagt.«
»Mach ich«, erwiderte ich lächelnd und versuchte wieder die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Während wir uns voneinander lösten, bildete sich ein Kloß in meinem Hals.
Was, wenn das unsere letzte Umarmung war? War es ihr gegenüber fair, so zu tun, als wäre alles okay? Als würden wir uns morgen auf jeden Fall sehen, wie an jedem anderen Tag auch?
Nachdem wir zum Ausgang gegangen und in die klirrend kalte Nachtluft hinausgetreten waren, verabschiedeten wir uns voneinander. Meta und Greg liefen zu ihrem Wagen, während ich mich in die andere Richtung auf den Heimweg begab. Um den beißenden Wind abzuhalten, zog ich mir den dicken Wollschal bis über die Nase und steckte die Hände in die Jackentaschen.
Als mich Jamie heute Morgen vor meiner Wohnung abgesetzt hatte, war ich nicht in der Verfassung gewesen, ihn nach der weiteren Vorgehensweise zu fragen. Ich kannte weder seine Telefonnummer noch seine Adresse. Wie sollte ich ihn kontaktieren? Letzte Nacht war ich zwar mit ihm beim Hexer gewesen, aber ich hatte mich nicht in der Verfassung befunden, mir die Straße oder den Weg dorthin zu merken.
Immerhin erinnerte ich mich an seinen Namen: Marcus Bennet. Vielleicht gab es einen Eintrag im Telefonbuch?
Sobald ich zu Hause angekommen war und mir Schuhe und Jacke ausgezogen hatte, wärmte ich mir die Reste vom Vortag auf und wartete. Ich war mir nicht einmal sicher, worauf ich wartete. Würde sich Jamie oder der Hexer bei mir melden? Was, wenn sie noch immer keine Lösung für mein Problem gefunden hatten? Bei dem Gedanken zog sich wieder mein Herz zusammen. Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Adrenalin prickelte in meinem Nacken, in meinem Mund bildete sich ein bitterer Geschmack. Panik half jetzt am allerwenigsten weiter.
Die Mikrowelle gab mir durch ein Ping Bescheid, dass das Essen fertig war, aber ich hatte keinen Appetit und ließ den Teller einfach drin stehen.
Als ich auf der Couch saß, den Boden anstarrte und fieberhaft nach einer Lösung suchte, läutete es an meiner Wohnungstür. Vor Schreck zuckte ich zusammen, stand dann aber auf und nahm den Hörer der Gegensprechanlage ab.
»Ja?«
»Hier ist Jamie. Kommst du runter?«, schepperte es blechern durch den Hörer. Die Anlage hatte schon mal bessere Tage gesehen, aber sie funktionierte.
»Ja. Augenblick. Ja«, bestätigte ich hastig, legte auf, schnappte mir die Schlüssel, schlüpfte wieder in Schal und Jacke und verließ rasch die Wohnung. Immerhin tat sich etwas – irgendetwas – und das war definitiv besser, als untätig herumzusitzen. In der Wohnung hätte ich es keine Sekunde länger ausgehalten.
Jamie wartete direkt vor der Tür auf mich. Er trug eine viel zu dünne Sommerjacke, wirkte jedoch nicht, als würde er frieren. Nur seine Hände steckten in den Jeanstaschen.
»Guten Abend, Diana«, grüßte er.
»Hey«, murmelte ich nur. Ich fröstelte, doch an der Kälte lag das nicht. Im Gegensatz zu ihm war ich in meinem Wollschal und der Winterjacke dick eingepackt.
Es lag an ihm. Meine Nerven waren ohnehin aufs Äußerste gespannt wie eine reißende Kordel, die nur noch durch einen einzigen Faden zusammengehalten wurde. Er war groß und kräftig und … präsent. In seiner Gegenwart kam ich mir klein und verletzlich vor und das machte mich noch nervöser.
Sein Pick-up stand ein paar Schritte vom Haus entfernt. Wortlos gingen wir hin. Er lief um das Auto herum und öffnete mir die Beifahrertür, bevor er von der anderen Seite selbst einstieg.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass er gleich den Zündschlüssel drehen und losfahren würde, stattdessen saß er mit geschlossenen Augen da und atmete ein paar Mal tief durch.
»Ich wollte dir eigentlich etwas mitteilen«, sagte er schließlich. »Aber ich weiß nicht, ob das in deinem Zustand sinnvoll ist.«
»In meinem Zustand?«
Er sah mich an. Mein Herz raste. Rasch senkte ich den Blick. Nein, er war kein Mensch. Eindeutig. Das, was mich gerade anstarrte, war ein Raubtier. Seine Augen waren zwar dunkelbraun – nicht gelb –, doch der Blick war der eines Jägers. Nachts schien seine Natur deutlicher durchzukommen als tagsüber. Oder es lag an dem uralten Instinkt, dass wir Menschen uns im Dunkeln automatisch unsicherer fühlten und mehr Angst verspürten.
»Du benimmst dich wie Beute«, stellte er fest.
Das trug nicht gerade dazu bei, mich sicherer zu fühlen. Stattdessen drohte mich wieder eine Panikattacke zu übermannen. Verflucht. Bebend atmete ich tief durch, versuchte mich zu beruhigen. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, einem Werwolf zu vertrauen?
»Entschuldige. Das war eine ungeschickte Wortwahl«, sagte er sanft. Seine Hand bewegte sich auf mich zu, als wollte er mich berühren. Als ich zusammenzuckte und mich gegen die Autotür drückte, hielt er inne und zog die Hand zu sich zurück.
»Damit wollte ich lediglich ausdrücken, dass du sehr verängstigt wirkst, schlimmer als gestern. Was ist los, Ripper? Liegt es an mir? Oder an dem Fluch? Oder der Ungewissheit? Oder weil du Zeit gehabt hast, alles zu verarbeiten, und dir bewusst geworden ist, was alles passiert ist?«
»Ja«, antwortete ich. »Alles.«
»Verstehe.« Er lächelte. »Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du es mit einem hungrigen Rookie zu tun hättest, könnte dein Verhalten problematisch werden. Es weckt Jagdinstinkte. Aber ich bin kein Rookie und lasse mich durch so etwas nicht aus der Ruhe bringen.«
Seine Stimme klang warm und angenehm. Tatsächlich schaffte er es durch seinen Tonfall, dass ich mich etwas entspannte und die Panik nicht mehr unter der Oberfläche lauerte wie in einem Dampfkessel, der kurz vor der Explosion stand.