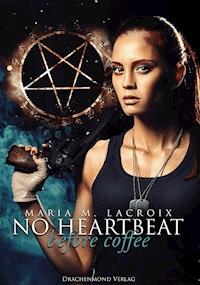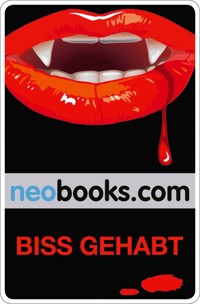Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Geheimnis der Feentochter
- Sprache: Deutsch
Als Nessyas Freundin von einem grausamen Feenprinz in sein Reich entführt wird, kann ihr nur der Heeresführer der Seelenfresser helfen. Doch sein Preis ist hoch. Als Magielose war Nessya im Síd - den Feenhügeln - eine Schande für ihre Mutter und floh deshalb in die Welt der Menschen, nach Dublin. Um Emma zu retten, muss sie Jahre später dorthin zurückkehren, wo ihre Flucht einst begann, und sich auf einen Pakt mit dem gefährlichsten aller Fay einlassen ... Band 1 der magischen Geschichte um die Welt unter dem Feenhügel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Secrets
Das Geheimnis der Feentochter - Band1
Maria M. Lacroix
Copyright © 2017by
Astrid Behrendt
Rheinstraße60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Tanja Selder
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Anja Uhren
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-207-5
Alle Rechte vorbehalten
»Man sitzt vielleicht alleine vor seiner Tastatur,
wenn man ein Buch schreibt,
doch ein Buch schreibt man niemals allein.«
Asta Müller
FürAsta
Inhalt
Prolog
Heutige Zeit
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Glossar
Danksagung
Über die Autorin
Bücher von Maria M. Lacroix
Prolog
Ich tötete siealle.
Alle, die mich gedemütigt und über mich gelacht hatten, doch auch dann war meine Rache noch nicht gestillt.
Dank der Herrschaft meines Gatten – Aymon, Gott des Krieges, König des Síd – hatten die hässlichen und Unheil stiftenden Fay unseren Ruf ruiniert. Wie kurzsichtig er doch war, wie einfach gestrickt. Ihm reichte die Herrschaft über die Feenhügel und er kümmerte sich nicht um den Terror, den die Fay in der Welt der Menschen anrichteten. In seiner grenzenlosen Arroganz vergaß er, dass die meisten Menschen – von den Hexen abgesehen – zwar magielos, deswegen jedoch nicht schwach waren.
Ich wollte mehr. Ich wollte beide Welten beherrschen.
Die Menschen empfanden uns gegenüber Misstrauen und Furcht. Allen Fay gegenüber. Und wer könnte es ihnen verdenken? Auch die Geschöpfe von Licht und Illusion, wie ich eines bin, wurden mit Argwohn betrachtet. Dabei entstamme ich einem Volk, das alles Schöne schätzt und außergewöhnliche Menschen mit reichen Schätzen belohnt.
Aymon war bereits mehrere Tausend Jahre alt, als man mich ihm im zarten Alter von sechzehn Jahren versprach. Sechzehn Jahre. Ich war nur ein Kind und wäre es in Aymons Augen immer geblieben.
Mein Gemahl genoss im Síd hohes Ansehen. Fay achten Stärke und Durchsetzungsvermögen. Fay verstehen die Sprache der Gewalt. Das hätte mir bezüglich seines Charakters einen Anhaltspunkt geben müssen. Doch damals war ich noch naiv und voller Sehnsüchte und Träume.
Die vielen Jahrhunderte der Qual unter seiner Schreckensherrschaft machten mich zu dem, was ich heutebin.
Doch seine Arroganz brachte ihm den Untergang.
Vermutlich hätte er nie gedacht, dass ihn ausgerechnet die zarte Elfenprinzessin, die er Nacht für Nacht zu den abscheulichsten Perversitäten zwang, im Schlaf enthauptete. Mitsamt seinen Mätressen.
Nachdem mein despotischer Gemahl ›verschwunden‹ war, tuschelte und lachte niemand mehr über mich. Auch nicht über die Tatsache, dass die Söhne des Königs nicht die meinen, sondern die seiner Geliebten waren.
Sie fürchteten mich, wie sie Aymon gefürchtet hatten.
Sie ahnten, dass ich ihn umgebracht hatte, doch Sicherheit hatten sie nicht. Sonst hätten sie mich auf der Stelle exekutiert. Um jene, die versuchten, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, in die Irre zu führen, musste ich mir etwas einfallen lassen. Also teilte ich die Rasse der Fay in zwei Gruppen auf – in Seelie und Unseelie –, bezwang in einer Schlacht die Unseelie-Kreaturen und nahm ihnen allen, außer den drei Prinzen, ihre Magie. Anschließend raubte ich ihre Erinnerungen. Den meisten von ihnen. Jene, die sich mir verweigerten, tötete ich. Nur ein Fay behielt sie – und lebte. Einer der Götter. Elendiger. Doch auch ihn zwang ich zum Schweigen.
Dass ich Aymons Söhnen die Magie ließ, war nichts weiter als Berechnung. Ein diplomatisches Entgegenkommen, um das Volk der Unseelie ruhigzustellen und ihnen die Illusion von Sicherheit zu vermitteln.
Ich machte die meinen, die Seelie, zur vorherrschenden Rasse des Síd und verbot den Unseelie, fortan die Feenhügel zu verlassen. Dann sorgte ich dafür, dass die Menschen Argwohn empfanden gegen ihresgleichen, die eine Affinität für Magie besaßen. Hexen. Jahrhundertelang flüsterte ich in die Ohren der Menschen und vergiftete ihre Gedanken, bis sie alle mächtigen Hexenlinien ausgerottet hatten.
Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es bei den Menschen.
Ich hatte unendlich vielZeit.
Doch während ich damit beschäftigt war, meine Pläne in die Tat umzusetzen, wandelte sich die Zeit. Die Menschen kehrten uns den Rücken, dienten nur noch einem einzigen Gott und verschmähten die Magie. Die alten Bräuche und Sitten gerieten in Vergessenheit. Wie auchwir.
Die Zeit der Fay war vorbei. Fürs Erste.
Ich bin jedoch eine geduldige Herrscherin und weiß, dass meine Zeit der Macht über die Menschen kommen wird. Auch sie werde ich bezwingen. Irgendwann.
Ich bin Siobhánn. Ich bin die Königin des Síd. Seit über tausendfünfhundert Jahren.
HeutigeZeit
1
HeutigeZeit
Cathal rollte von der Frau herunter und legte sich in den Sand. Neben sich vernahm er ihre erschöpft klingenden Atemzüge.
»Wow«, hauchte sie und kicherte.
Irgendwann während des Sex war sein Blendzauber in sich zusammengebrochen, da er nicht länger in der Lage gewesen war, sich auf dessen Aufrechterhaltung zu konzentrieren. Doch in der Dunkelheit der Höhle würde sie seine Auswüchse nicht sehen. Deshalb hatte er sie hierher gebracht. Und falls ihr doch etwas auffiel, wäre das auch nicht weiter schlimm. Sie würde die Nacht ohnehin nicht überleben.
Die Frau hatte den Ausflug an den Strand und seine Verführungskünste in der Höhle romantisch gefunden.
Er, ein Romantiker. Der Gedanke amüsierteihn.
Nachdem sie wieder zu Atem gekommen war, legte sie sich auf die Seite und stützte ihren Kopf auf die Hand. »Also, von mir aus können wir das irgendwann einmal gerne wiederholen.« Sie lachte. »Dabei habe ich dich erst für einen arroganten Idioten gehalten. Nichts für ungut.«
»Kein Problem«, murmelte er. Ihm war herzlich egal, was sie über ihn dachte. Er kannte nicht einmal ihren Namen. Ihre Gefühle, ihre Gedanken waren bedeutungslos, denn bald schon würde sie nicht länger fühlen oder denken. Dennoch wartete er geduldig ab. Teil des Spieles war es, die Vorfreude möglichst lange auszukosten.
»Kleiner Tipp für die Zukunft«, fuhr sie fort. »Es heißt, jemandem das Herz rauben, nicht die Seele. Aber am besten lässt du solche Anmachsprüche.«
»Danke für den Rat, doch ich meinte tatsächlich die Seele.«
Sie lachte wieder. Vermutlich dachte sie, er machte einenWitz.
»Wie auch immer. Aber ich muss schon sagen, dass ich seit Langem schon nicht mehr so guten Sex hatte. Wenn ich es mir recht überlege, kann ich mich nicht daran erinnern, je so guten Sex gehabt zu haben.«
»Überrascht mich nicht.«
Abgesehen davon, dass er ein paar Jahrhunderte Erfahrung vorweisen konnte, bezweifelte er, dass sie bereits mit einem Fay geschlafen hatte. Unseelie durften den Síd nicht verlassen und auch wenn sie nicht schlecht aussah, war ihr Aussehen weit entfernt von jener atemberaubenden Schönheit, um einem Seelie aufzufallen.
»Wir haben wohl eine ziemlich hohe Meinung von uns, was?«, erwiderte sie und schnaubte abschätzig.
»Als würdet ihr Frauen nicht darauf stehen, wenn ein Mann ein gesundes Selbstbewusstsein hat«, neckte er sie. Augenrollend schnalzte sie mit der Zunge, erwiderte darauf jedoch nichts.
Anders als Menschen, sah er im Dunkeln hervorragend. Sie wusste sicher genauso gut wie er, dass er recht hatte, schien jedoch zu stolz zu sein, es offen zuzugeben. Obwohl sie ihn ansah, blieb sie entspannt. Offenbar hatten sich ihre Augen, wie erwartet, nicht vollständig an die Dunkelheit gewöhnt, sonst wäre sie bei seinem Anblick längst aufgesprungen und schreiend davongerannt. Nicht, dass sie allzu weit gekommenwäre.
In freudiger Erwartung leckte er sich über die Lippen. Die Ausflüge in die Welt der Menschen dienten dazu, seine Sluaghs von Zeit zu Zeit bei Laune zu halten, doch wenn er schon einmal hier war, weshalb sich nicht selbst auch ein bisschen Spaß gönnen? Schließlich waren das die einzigen Gelegenheiten, bei denen er es sich erlauben konnte, mit einem Menschen Sex zu haben – was seinen sonstigen Optionen deutlich vorzuziehenwar.
Nur wenn er sie ohnehin umbrachte, konnte er es riskieren, dass sie faysüchtig wurden oder einen Blick auf seine wahre Gestalt erhaschten. Er legte es zwar nicht darauf an, jemanden in die Fay-Sucht zu treiben – für einen menschlichen Sexsklaven interessierte er sich nicht –, doch manchmal passierte es aus Versehen, wenn ein Mensch besonders anfällig dafürwar.
Bei dieser Frau war das glücklicherweise nicht der Fall, schließlich hatte er seinen Sluaghs eine intakte Seele versprochen. Dass sie so dunkel war wie Teer, spielte keine Rolle. Im Gegenteil, wenn sie die Wahl hatten, stürzten sich die Sluaghs ohnehin auf die verdorbenen Seelen. Offenbar mundeten sie besser. Er wusste nicht, was genau die Frau angestellt hatte, doch um ein einmaliges Kavaliersdelikt konnte es sich nicht handeln. Dafür strahlte sie zu viel Boshaftigkeit nach außen hinaus.
Manchmal suchte er sich Menschen gezielt nach ihren Vorstrafen aus, manchmal traf er durch Zufall auf eine böse Seele. Wie heute Nacht. Es war der Ausdruck in ihren Augen gewesen, der seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Der Spiegel zu ihrer Seele. Kalt und abgeklärt. Als wäre ihr Gewissen ein glasklarer See, konnte er tief in ihr Herz blicken und die dunklen Schatten erspähen, die es umgaben. Sie flüsterten ihm zu, erzählten, was für ein Mensch siewar.
Als er eine ihrer Haarsträhnen hinter ihr Ohr klemmte, sog sie hörbar den Atem ein. Ihre gespielte Empörung verschwand. Hitze kroch in ihre Wangen. Die Wärme ihres Körpers tanzte über seine Haut und drückte gegen seine Aura. Er badete in dieser Empfindung, atmete tief ein und ließ sie durch seinen Körper strömen.
Die Nacht näherte sich dem Punkt, der ihm die meiste Freude bereitete. Mit einer einzigen Bewegung stemmte er sich hoch, setzte sich rittlings auf sie und drückte ihre Arme in denSand.
Den Moment möglichst lang hinauszögern, ihn genießen …
Ihre Augen weiteten sich. Langsam teilten sich ihre Lippen, die sie mit der Zunge befeuchtete.
»Du hast etwas von ›wiederholen‹ gesagt?«, flüsterte er und beugte sich zu ihr hinab. Er küsste ihre Halsbeuge.
»Jetzt schon?« Sie seufzte und entspannte sich unter seinen Händen. »Ich bin noch zu erschöpft.«
»Keine Sorge, mo anam.« Ein weiterer kleiner Kuss an ihrer Kehle. »Es wird schnell gehen. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht leiden musst.«
»Was?« Sie lachte befangen, schien sich nicht sicher zu sein, ob das noch Teil eines Spieles oder ernst gemeint war. Er spürte den hämmernden Schlag ihres Herzens an seinem Körper. Nach einem letzten kleinen Kuss richtete er sich auf. Inzwischen wand sie sich unter ihm, doch sein Griff hielt sie wie in einer Schraubzwinge.
»Lass mich los.« Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie zur Höhlendecke empor. »Was … was istdas?«
Ob sie trotz der Finsternis einen Blick auf seine körperlichen Auswüchse erhascht hatte? Ihr schockierter Gesichtsausdruck schien darauf hinzudeuten. Die Lust nach Sex schwand unter ihrer Angst dahin. Das Spiel war vorbei.
»Lass mich los!«, wiederholte sie panisch.
Bevor sie schreien konnte, legte er seine Hand auf ihr Brustbein. Die dunkle Magie, die er in sie stieß, trieb ihr die Luft aus den Lungen, erstickte den aufkeimenden Schrei.
Mit der Hand tastete er ihre Aura ab, langte in sie hinein und durchbrach die Schutzschilde ihres Körpers, ohne die Haut zu verletzen. Sobald er fand, wonach er suchte, griff er fest zu. Sie keuchte, bekam kaum Luft. Ihr Puls raste. Seine Magie zog ihr Blut, ihre Essenz wie ein Magnet an sich. Er löste sie Faser für Faser von ihrem Sein. Ihre Augen rollten in die Höhlen zurück, doch er ließ ihr weder Kraft noch Luft, um etwas zu sagen. Dann beugte er sich zu ihr herunter, umschloss ihre Lippen mit seinem Mund und sog ihre abgelöste Essenz an die Oberfläche. Ersticktes Keuchen drang zwischen ihren Lippen hervor. Die Seele löste sich aus ihrem Körper und entschwand in die Luft. Im Gegensatz zu seinen Sluaghs, hatte er für sie keine weitere Verwendung, dafür war er nicht Sluagh genug. Für sein Heer war die Seele jedoch ein Festmahl.
Vor dem Eingang der Höhle vernahm er hohes, schrilles Kreischen. Schwere Flügelschläge verschmolzen zu einem einzigen Laut, mischten sich mit dem Rauschen der Wellen. Der Lärm verriet die Ankunft des Heeres. Geduldig hatten sie gewartet, bis er mit der Frau fertig war, doch nun nahmen sie die Witterung der frischen Seele auf und das machte sie ungestüm.
Während er die leblose Hülle der Frau in seinen Armen hielt, krallten sich die Nachtjäger die über dem Körper schwebende Seele mit ihren Klauen. Sie würden eine Weile von ihr zehren können. Den nackten, erschlafften Körper ließ er zurück in den Sand gleiten.
Sobald das Heer mitsamt den Resten der zerfetzten Seele fortzog, streifte er seine Hose über, schloss den Gürtel und verließ die Höhle.
Draußen tobte ein Sturm. Hohe Wellen brachen sich am Strand und umspülten seine nackten Füße. Schwarze Wolkenungetüme zogen über seinem Kopf hinweg.
Ein Kreischen durchschnitt die Nacht. Dieses Mal handelte es sich um eine Möwe, die versuchte, sich im Tiefflug vor den Elementen zu retten. Das Salz der See und der Duft der Gischt umhüllten seine Sinne, benetzten seine Haut wie ein seidenesTuch.
Da er als Mischling zwischen einer Elfe und einem Sluagh von keinem der Königshäuser anerkannt wurde – etwas, das man ihn sein Leben lang hatte spüren lassen –, besaß er Magie und durfte den Síd verlassen. Dennoch musste auch er sich an die allgemeinen Fay-Regeln halten, die lauteten, in der Welt der Menschen kein Aufsehen zu erregen.
Er ließ den Blick über den Strand schweifen und vergewisserte sich, dass niemand ihn beobachtete, bevor er in die Dunkelheit verschwand.
Dann war er mitsamt seinen Sluaghsfort.
2
In der Nacht hatte es heftig gewittert. Das Meer sah noch immer wütend aus, die Wellen schlugen tosend gegen die Steinklippen.
Für Ende September war es angenehm warm, doch das trübe Wetter schlug Nessya den ganzen Tag schon aufs Gemüt. Sie hatte gehofft, die graue Suppe würde zum Nachmittag hin auflockern und die Sonne durchlassen. Stattdessen krochen Nebelschwaden über den Grund und schluckten alle Geräusche, selbst der Wellenschlag drang nur gedämpft an ihr Ohr. Es war einer dieser Tage, der Freude, Glück und Hoffnung für immer aus der Welt zu schwemmen schien, trübsinnig und grau, aber vielleicht lag das auch an ihrer Stimmung. Sie war betrübt. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, an diesen Ort zurückzukehren?
Trotzdem versuchte sie den Spaziergang am Strand zu genießen. Ihre Sneakers und Socken hielt sie in der Hand, während der nasse Sand zwischen ihren Zehen kitzelte. Das Rauschen der See im Hintergrund beruhigte ihre Nerven. Es wirkte fast meditativ. Die Auszeit hatte sie bitter nötig gehabt und die Einsamkeit Clare Islands war dafür eigentlich perfekt. Allmählich setzte bei ihr wieder eine Art Tiefenentspannung ein, nachdem sie sich in letzter Zeit immer gereizter und aggressiver gefühlt hatte.
Obwohl sie Dublin liebte, empfand sie die Hektik der Großstadt oft als sehr anstrengend. Der Nächste, der sie um extra dies oder extra das in seinem Kaffee gebeten hätte, wäre als Sirup geendet. Der Job bei Starbucks war zwar bei Gott nicht die schlechteste Arbeit, aber manche Leute erweckten in ihr jedes Mal das Bedürfnis, sie alle zu strangulieren. Aber vielleicht lag es auch an ihr. Sie gehörte, im Gegensatz zu Emma, nicht gerade zur geselligsten und offensten Sorte. Ihre Mitbewohnerin trug ihren Spitznamen Little Miss Sunshine nicht nur wegen ihrer leuchtend roten Haare.
Bei dem Gedanken an Emma musste sie lächeln. Ohne ihre liebe und verrückte Freundin würde sie die Wohnung außer zum Arbeiten wohl nie verlassen. Aber Emma wusste ja auch nichts von den ›Anderen‹. Für Emma gab es keinen Grund, immerzu in Alarmbereitschaft zu stehen. Manchmal wünschte sie sich, ebenso unbeschwert durchs Leben tänzeln zu können, ohne von deren Anwesenheit zu wissen. Nur dann wäre sie nicht mehr am Leben.
Träumte nicht jedes Mädchen davon, in Wahrheit Teil eines Disneyfilms zu sein? Eine verlorene Prinzessin, die im Teenageralter nach Jahren der Armut und Entbehrungen an den Königshof kommt, einen tollen Prinzen heiratet und fortan inmitten einer liebevollen Familie in Reichtum lebt? Ein Leben voll mit Magie und wunderschönen, mystischen Geschöpfen?
Dieser Mist wird völlig überbewertet.
Bei ihr war alles andersherum verlaufen. Bis fünfzehn lebte sie in der magischen Welt der Feen. Ihr ›Prinz‹, der sie verführt und entjungfert hatte, entpuppte sich als Mistkerl und ihre Mutter versuchte sie umzubringen. Sie hatte den Fehler begangen, ohne Magie geboren worden zu sein, sodass sich ihre Mutter der Schmach einer menschlichen Tochter hatte entledigen wollen. Nichts Persönliches.
Leider hatten sich bei ihr die menschlichen Gene ihres Vaters durchgesetzt. Nachdem die Magie selbst im Zuge der Pubertät nicht erwacht war, blieb Nessya nichts anderes übrig, als in die Welt der Menschen zu fliehen, wenn sie überleben wollte. Keine Magie zu haben, war im Síd nicht erwünscht.
Sie atmete tief durch und ließ die salzige Luft durch ihre Lungen strömen, als sich plötzlich die Härchen in ihrem Nacken aufstellten. Fröstelnd rieb sie sich über die Oberarme. Wenn man vom Teufel spricht …
Dieses Gefühl war ihr allzu vertraut. Es hatte nichts mit der frischen Brise zu tun. Aufgrund der Sehnsucht nach ihrer Heimat hatte sie sich Clare Island entgegen jeglicher Vernunft als Urlaubsort ausgesucht. Ausgerechnet. Nachdem sie vor ziemlich genau zehn Jahren aus dem Síd hatte fliehen müssen, war sie durch ein Portal hier gelandet. Mit der traurigen Gewissheit, niemals zurückkehren zu dürfen.
Sie vermisste ihr Zuhause. Ihr richtiges Zuhause. Zum ersten Mal in all der Zeit hatte sie der Sehnsucht nachgegeben.
Ob es dieses Portal noch gab? Oder befand sich etwa ein Fay in derNähe?
Mit angehaltenem Atem ließ sie den Blick über den Strand und das Meer wandern, die Arme fest um den Körper geschlungen. Der Strand schien einsam und verlassen zu sein, auf jeden Fall konnte sie niemanden sehen. Zu ihrer Rechten ragten steile Steinklippen in die Höhe, zu ihrer Linken lag das Meer. Ein letztes Mal ließ sie ihren Blick prüfend über die aufgewühlte See und die Schaumkronen schweifen, die sich auf dem Wasser kräuselten.
Nachdem nichts passierte – kein Ungeheuer aus den Fluten sprang – und auch das Knistern in der Luft nicht stärker wurde, entließ sie den angehaltenen Atem aus ihren Lungen. Offenbar spürte sie lediglich Überbleibsel irgendeiner Magie. Einen Moment blieb sie unschlüssig stehen, bis sie etwas weiter vorne den Eingang zu einer Höhle entdeckte. Ihrer Höhle. Das Portal von damals.
Kehr um, dort gibt es nichts für dich, dachte sie, während sie auf die Höhle zuging. Kehr verdammt noch mal um. Die Sehnsucht siegte.
Selbst wenn sie das Portal nicht benutzen würde – das wäre glatter Selbstmord –, könnte sie doch einen Moment dort verweilen. Nur ganz kurz. Und sich wenigstens der Phantasie hingeben, was wärewenn …
Zögerlich betrat sie mit klopfendem Herzen den Eingang. Je tiefer sie hineinging, desto stärker biss die Magie in ihre Haut. Anders als alles, was sie je gespürt hatte.
Sie runzelte die Stirn. So fühlte sich doch keine Magie der Seelie an? Um Elfenmagie handelte es sich sowieso nicht, die hätte sie sofort erkannt. Doch auch die der unbedeutenderen, niederen Seelie fühlte sich für gewöhnlich nicht so … hoffnungslos, schmerzlich und endgültig an, obwohl es auch innerhalb der niederen Seelie-Kasten äußerst fiese und garstige Kreaturengab.
Ihr Mund wurde trocken, das Schlucken bereitete ihr Schwierigkeiten, sie bekam kaum Luft. Dunkle Magie.
Das war unmöglich. Die Unseelie hatten ihre Magie vor langer Zeit verloren, zudem war es ihnen verboten, den Síd zu verlassen. Wozu die dunkle Sippe einmal fähig gewesen war, kannte sie nur von alten Schriften aus längst vergangenen Tagen.
Nur drei Unseelie gab es, die ihre Magie noch besaßen. Die drei Prinzen.
Bei dem Gedanken erstarrte sie. Sie war ihnen nie begegnet und hatte kein Interesse, das zu ändern. Selbst Begegnungen mit Elfen vermied sie, aus Angst, sie könnten sie erkennen und töten oder in den Síd zurückschleppen und dann töten. Nach über zehn Jahren war das zwar unwahrscheinlich, da sie sicher schon längst von ihnen vergessen war oder sie sich nicht weiter um sie scherten, dennoch wollte sie das Schicksal nicht herausfordern. Doch bei den drei Unseelie-Prinzen handelte es sich um ein ganz anderes Kaliber.
Gerade wollte sie auf dem Absatz kehrtmachen, als ihr im Augenwinkel etwas auffiel, das tiefer in der Höhle lag. Unwillkürlich sah sie genauer hin und erkannte den nackten Körper einerFrau.
»Verflucht!«, zischte sie und eilte zuihr.
Neben der Frau kniete sie sich in den Sand. Hier erschien ihr die Luft noch kälter, stickiger und hoffnungsloser als am Eingang. Als würde man Säure einatmen. Sie schaffte es kaum, durch den dunklen Zauber hindurch Luft zu bekommen.
»Mein Gott, welche von diesen Bestien hat dir das nur angetan?«, murmelte sie, während sie das Gesicht der Frau zu sich drehte. Äußerlich schien sie unversehrt zu sein. Immerhin. Die Lippen waren blassblau, wofür jedoch die Kälte verantwortlich sein könnte. Doch ihre trüben Augen waren weit aufgerissen und fixierten einen unsichtbaren Punkt an der Höhlendecke. Der Lebensschimmer war aus ihnen gewichen.
Seufzend schloss Nessya die Lider der Frau, legte dann ihre Hände in den Schoß und wusste nicht so recht, was sie tun sollte. Für die Frau kam jegliche Hilfe zu spät. Etwas – sie weigerte sich, ›jemand‹ zu denken – hatte sie erwischt. Und niemand würde herausfinden, was wirklich geschehenwar.
Selbst wenn die Gardaì ermittelte, würden sie den Mörder niemals finden. Wie auch? Wie sollte man etwas finden, wenn man nicht wusste, wonach man suchen sollte? Die Angehörigen würden nie die Wahrheit erfahren.
Das Licht des schwindenden Tages war Nessya vorher schon trist erschienen, jetzt kam es ihr noch dunkler vor. Als wären alle Farben aus der Welt geschwemmt worden und nichts als Grautöne übrig geblieben.
Während sie wie betäubt neben der Leiche hockte und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, öffneten sich plötzlich deren Lippen.
Lebte sie etwa noch? Doch es handelte sich nur um einen kleinen Krebs, der aus dem Mund der Toten krabbelte. Der subtile Horror dieses Bildes weckte Nessya aus ihrer Lethargie. Schockiert fiel sie nach hinten und rutschte rückwärts von der Leiche weg. Mit zitternden Händen kramte sie ihr Handy aus der Tasche. Kein Empfang.
Rasch verließ sie die Höhle, schlüpfte draußen in ihre Sneakers und lief über den Strand hinauf zur Straße. Auf dem Weg nach oben überschlugen sich ihre Gedanken.
Dunkle, bösartige Magie. Eindeutig. Doch abgesehen von den Prinzen besaßen die Unseelie keine Magie. Weshalb sollten sich die Prinzen ausgerechnet diesen Ort aussuchen, um sich mit einem Menschen zu vergnügen? Würden die nicht eher die Großstädte bevorzugen? Doch wer sonst sollte dafür verantwortlich sein? Abgesehen von den Prinzen, kämen nurnoch …
Abrupt blieb sie stehen. Bei dem Gedanken wurde ihr auf einmal eiskalt.
Es kämen nur noch die Sluaghs infrage, beendete sie ihren eigenen Gedanken. Und, ja, die würden wohl eher eine verlassene Gegend bevorzugen, da sie in der Großstadt viel zu viel Aufsehen erregen würden. Es gab nicht viele Regeln, an die sich ein Fay halten musste. Doch eine – die vermutlich wichtigste – lautete, sich vor den Menschen bedeckt zu halten.
»Wenn du nicht artig bist, setze ich dich nachts vor den Toren des Westens aus«, hatte Mutter immer gesagt. Die Tore des Westens, der Ort, an dem die Seelenfresser hausten.
Sluagh-Territorium.
Ihre Mutter machte die Drohung nie wahr, doch Nessya hätte es ihr zugetraut. Manchmal konnte Mutter ein ganz schönes Miststück sein. Von Kindesbeinen an hatte man ihr die schrecklichsten Geschichten über das Wilde Heer und dessen Heerführer erzählt.
Sogar die ranghohen Seelie fürchteten das Heer, obwohl sich Elfen eigentlich gegen jeden und alles magisch zu verteidigen wussten.
Das Leben im Síd hatte sie gelehrt, ihren Stolz herunterzuschlucken und sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Wer war sie schon, verglichen mit den machtvollen Lichtgeschöpfen? Das Einzige, das sie richtig gemacht hatte, war, die Hügel zu verlassen. Zu sagen, ihr hätte der Tapetenwechsel in die Menschenwelt gutgetan, wäre das Understatement des Jahrhunderts.
Als ihr Handy endlich Empfang bekam, befand sie sich praktisch schon im Pub. Sobald sie eintrat, hörten die Musiker auf zu spielen und ihr war, als würde der Lärm der Menschen, die sich unterhielten, erheblich leiser werden. Was natürlich Unsinn war, die Musiker stimmten gerade einfach ein neues Lied an. Nur weil sie am Strand über dunkle Magie und eine Leiche gestolpert war, hörte die Welt nicht auf, sich zu drehen. Alles ging seinen gewohnten Gang weiter, ob sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand oder nicht.
Was hatte sie sich dabei gedacht, ihre Heimat zu vermissen? Die Begegnung heute zeigte deutlich, dass dazu absolut kein Grund bestand. Vielleicht wäre sie jetzt wenigstens von ihrem dämlichen Heimweh geheilt. Ja, und vielleicht glaubte sie es selbst irgendwann, wenn sie es sich nur lang genug einredete. Es tat verflucht weh. Der Síd war schlecht für sie und doch vermisste sie die Feenhügel.
»… dich setzen?«
Erschreckt sah sie auf und blickte in die kleinen, freundlich blickenden Augen eines älteren Mannes.
»Bitte?«
»Kind, du bist ja kreidebleich«, erwiderte er und führte sie zu einer kleinen Sitznische nahe der Bar. Die untere Hälfte seines wettergegerbten Gesichts versteckte sich unter einem dichten, grau melierten Vollbart und um seine Augen zog sich ein Netz aus strahlenförmigen Lachfältchen. Er erinnerte sie an einen Santa Claus, den ein großes Kaufhaus um die Weihnachtszeit herum für die Kinder buchen würde.
Sollte sie von der toten Frau erzählen? Würde das die Menschen hier in Gefahr bringen? Vermutlich nicht. Die Behörden würden eine unbekannte oder – je nachdem, wie geschickt der Fay beim Verwischen seiner Spuren gewesen war – natürliche Todesursache feststellen.
Santa Claus setzte sich zu ihr an den Tisch. Nachdem sie ihm von ihrem Fund am Strand erzählt hatte, gab er ihr einen Whiskey aus. Sie benetzte ihre Lippen mit der Flüssigkeit und atmete tief durch.
Während der Wirt mit der Gardaì auf dem Festland telefonierte, starrten die anderen Gäste sie verstohlen an. In so einem kleinen Ort verbreitete sich eine solche Neuigkeit bestimmt wie ein Lauffeuer. Sie bekam nur seine Seite des Telefonats mit, doch aus den Worten des Wirts konnte sie sich den Rest zusammenreimen. Nein, aufgrund des Wellengangs könnten sie heute Abend nicht mehr auf die Insel kommen, und ja, die Bergung der Leiche würde bis morgen früh warten müssen. Das hieß, auch sie könnte erst morgen früh die Insel verlassen.
Sie setzte das Glas an und ließ die scharfe Flüssigkeit ihre Kehle hinunterfließen, dann tippte sie eine WhatsApp Nachricht an Emma. Ihre Hände zitterten. Sie musste mehrmals Buchstaben löschen und neu eingeben. Lange starrte sie auf den Text und überlegte, ob Emma die Angst herauslesen könnte, ob sie sie unnötig in Panik versetzen würde. Irgendwann verwarf sie den Gedanken. Was sollte Emma aus ›Hey Emma, ich habe beschlossen, morgen schon zurückzukommen. CU.‹ herauslesen können, außer das, was da stand? Nach einer gefühlten Ewigkeit schickte sie die Messageab.
Unwillkürlich dachte sie daran, dass die Frau eine weitere Nacht in der Höhle am Strand liegen würde, nackt und allein. Das war nicht richtig. Innerlich verfluchte sie sich dafür, so hilflos zu sein und nichts tun zu können, obwohl sie genau wusste, was passiertwar.
Ihr Handy vibrierte kurz auf dem Tisch. Auf dem Display sah sie, dass Emma schon geantwortet hatte. Irgendwie tat es gut zu wissen, dass bei ihr zu Hause alles normal war. Dass es dort jemanden gab, der unbekümmert und fröhlich war und nichts von alledem wusste.
Hey, Nessi, Wette gewonnen. ;-) Ich wusste, dass du dich dort zu Tode langweilen würdest. Bis morgen, Emma.
Dass sie eigentlich Nessya hieß, wussten ihre Freunde nicht. Um Fragen zu vermeiden, hatte sie gleich nach der Flucht in die Menschenwelt angefangen, sich mit Nessa vorzustellen, und behauptet, das sei eine Abkürzung für Vanessa. Ein guter Kompromiss. Mit der Zeit war aus Nessa der Spitzname Nessi geworden. Wie das schottische Monster aus dem Loch. Da es aber ihrem echten Namen sogar etwas näher kam, störte sie das nicht.
Nach einem schnellen Blick auf die Karte war klar, dass der härteste und billigste Alkohol hier der gute Jack war. Sie suchte Blickkontakt zum Wirt, zeigte auf ihr Glas und zeigte mit ihren Fingern das Victory-Zeichen. Gleichzeitig formte sie mit ihren Lippen die Worte ›Jack Daniels‹ und – um den Frevel perfekt zu machen – ›on the rocks‹. Das wäre nicht ihr letzter Doppelter für heute, so viel standfest.
Der Wirt brachte ihr den Whiskey. »Du weißt, dass wir das Zeug normalerweise nur für Touristen benutzen, die es mit Cola mischen wollen, oder?«
Nessya zuckte mit den Schultern. Offenbar verzichtete der Wirt darauf, ihr eine Predigt über Nationalstolz, amerikanischen Whiskey und die größten No-Gos zu halten. Aber leicht schien es ihm nicht zu fallen. Er stellte das Glas vor sie, legte die Hand väterlich auf ihre Schulter und verschwand dann wieder hinter den Tresen. Eiswürfel klirrten gegen den Tumbler, als sie den Whiskey schwenkte.
Nachdem der Wirt mit einigen Männern gesprochen hatte, verließen sie gemeinsam den Pub. Vermutlich begaben sie sich zum Strand, um die Leiche abzudecken. Das fänden die von der Spurensicherung zwar sicher nicht so toll, aber in so kleinen Orten liefen die Dinge sowieso oft etwas anders.
Allmählich zeigte der Alkohol Wirkung, ein leichter Schwindel setzteein.
Rasch exte sie den Drink, schüttelte sich und klopfte sich hustend auf die Brust. In der Tat lagen zwischen diesem Whiskey und dem, den der Wirt ihr ausgegeben hatte, Welten. Dennoch bestellte sie einen weiteren.
»Ein Mord. Hier.« Nessya schreckte hoch, als eine pausbäckige Frau mittleren Alters den Doppelten auf den Tisch stellte. »Wir kennen uns doch alle untereinander. Das kann nur jemand vom außerhalb gewesensein.«
»Danke.« Nessya kippte den Whiskey in einem Zug. Er brannte nicht mehr so stark wie der erste. Wenn die arme Frau doch nur ahnen würde, von wie ›außerhalb‹ der Mörder stammte. »Noch einen.«
Die Frau lächelte sie mitleidig an, bevor sie ihr leeres Glas nahm und ihr kurz darauf den Nachschub und ein Glas Wasser auf den Tisch stellte.
Nessyas erklärtes Ziel für heute: sich gnadenlos die Kante geben. Zumindest, bis die starren Augen des Opfers sie nicht länger verfolgten.
Das war jetzt ihr … dritter? Vierter? Während sie die goldene Flüssigkeit schwenkte, drehte sich der Raum mit. Sie hieß den Schwindel willkommen, er betäubte ihre Erinnerungen, ihre Gefühle.
Seufzend setzte sie das Glas an, als sie durch all den Nebel in ihrem Kopf plötzlich ein Kribbeln auf ihrer Haut spürte. Es zog über ihre Arme, kroch ihre Wirbelsäule hinauf. Wie ein dumpfes Vibrieren, das ihr durch Mark und Bein ging. Sie erkannte das Gefühl sofort.
Fay-Magie.
Unwillkürlich hob sie ihren Blick und sah sofort, wer oder vielmehr was der Ursprungwar.
Ein Mann stand mitten im Raum. Hochgewachsen, selbstbewusst, erhaben. Jede der anwesenden Frauen musterte ihn mit anerkennenden Blicken, während ihn die Männer mürrisch abcheckten, als überlegten sie, ob sie es wohl mit ihm aufnehmen könnten. Wuscheliges blondes Haar stand in einem wilden Wust um seinen Kopf, sein Gesicht war sonnengebräunt und sah aus wie das eines männlichen Models aus einem Modemagazin. Schön und langweilig, von der Sorte Surfer-Typ.
Doch das war nicht sein wahres Aussehen. Trotz der Entfernung und dem Nebel in ihrem Kopf begriff sie, dass das kein Mensch, sondern ein Fay war und es sich bei der Erscheinung lediglich um einen Blendzauber handelte. Demnach musste es sich um einen ranghohen Seelie handeln. Ein Elf vermutlich. Ob er einer der königlichen Krieger war, die für Recht und Ordnung sorgten?
Leider hatte sie schon zu viel intus, um durch den Zauber hindurch zu sehen. Dafür reichte ihre Konzentration nicht mehr aus. Möglicherweise war sie nach all der Zeit aber auch etwas aus der Übung geraten. So sehr sie sich auch bemühte, schaffte sie es nicht, die Illusion zu durchbrechen.
Er erwiderte ihren Blick. Verdammt, sie hatte ihn angestarrt. Angestrengt versuchte sie das Gefühl der Benommenheit zu verdrängen und stellte das Glas auf den Tisch zurück. Wenn sie zum Hauptausgang wollte, müsste sie an ihm vorbei. Ihr Herz schlug ihr bis in den Hals. Nein, so nah wollte sie ihm nicht kommen, manche Fay besaßen mehr als fünf Sinne und könnten misstrauisch werden. Himmel, alle Fay besaßen mehr als fünf Sinne. Manche hatten sechs oder sieben oder noch viel mehr. Der Raum drehte sich weiterhin.
Weshalb war er hier, was wollte er? Wenn sie durch den Blendzauber hindurch einen Blick auf sein wahres Aussehen erhaschen könnte, könnte sie überprüfen, ob er ihr bekannt vorkam oder sie ihn von früher kannte. Das würde ihr immerhin einen Anhaltspunkt geben.
In Dublin verschwand sie problemlos in der Anonymität der Großstadt, doch hier sah die Sache anders aus. Hatte sie sich selbst wieder in den Fokus gerückt, indem sie nach Clare Island gereist war? Wie ein roter Punkt auf einer Zielscheibe?
Hatte Mutter ihn geschickt, um zu beenden, was sie damals begonnen hatte? Doch wozu der Aufwand nach all der Zeit? Oder kannte er ihre Verwandten womöglich gar nicht und hatte lediglich mitbekommen, wer den schrecklichen Fund am Strand gemacht hatte? Möglicherweise wollte er nur überprüfen, was genau sie wusste. Was immer es war, sie wollte nicht im Zentrum seines Interesses stehen.
Lächelnd kam der Fay auf sie zu. Mit rasendem Herzen drehte sie sich um und versuchte die Aufmerksamkeit der Kellnerin zu erregen, doch sie war weiter hinten mit einer Gruppe von Gästen beschäftigt.
»Hi«, sagte er freundlich, zog den Stuhl zurück und setzte sich ihr gegenüber. »Du bist also diejenige, die den Fund am Strand gemacht hat?« Eine Reihe strahlend weißer Zähne blitzte bei seinem charmanten Lächeln auf. Vielleicht versuchte er, harmlos zu wirken. Es gelang ihm nicht. Der Anblick jagte eiskalte Schauer über ihren Rücken.
Rasch sah sie nach unten, betrachtete die Maserung der Tischplatte und überlegte fieberhaft, wie sie aus der Situation herauskommen sollte.
»Ja. Schrecklich, oder?«, flüsterte sie, sah auf und wiederholte nachdrücklich: »Oder?«
Fay können nicht lügen. Sie vermögen einen so lange zu bequatschen, bis man meint, der Himmel bestünde aus rosa Zuckerwatte, aber sie können nicht lügen. Jetzt war sie gespannt, wie er darauf reagieren würde.
Sein Lächeln weitete sich. »Hin und wieder vergesse ich, dass ein solcher Anblick für viele schockierend sein muss. Ich habe in meinem Leben schon so viel zu Gesicht bekommen, dass ich ein wenig abgehärtet bin, fürchteich.«
»Bist du von der Garde?« Da es das sowohl bei den Menschen als auch bei den Fay gab, konnte sie die Frage stellen, ohne Misstrauen zu erregen. Gleichzeitig könnte sie mehr über ihn und seine Absichten erfahren. Falls er nicht von Mutter geschickt worden war, sondern sich um den Regelverstoß eines Unseelie kümmerte, wäre das die bestmögliche Lösung. Auf jeden Fall käme das ihrem Verständnis von Gerechtigkeit am nächsten.
Er beugte sich etwas vor und sah ihr tief in die Augen. »Ist dir am Strand denn irgendetwas Auffälliges aufgefallen?«, fragte er ausweichend.
»Du meinst, abgesehen davon, dass da eine tote Fraulag?«
»Ja, abgesehen davon«, erwiderte er ernst, als hätte er den Sarkasmus in ihrer Frage überhört. Hatte er vermutlich auch. Fay waren für viele Dinge bekannt. Humor und Verständnis für Ironie gehörten nichtdazu.
Sie zuckte die Schultern. »Was zum Beispiel, Herr … Inspektor?«
Lächelnd schüttelte er den Kopf. »Ich bin kein Inspektor.«
»Hauptmann?«
»Das kommt der Sache schon näher.« Was für eine Stimme. Sanft, herb und dunkel. Über ihren Rücken zog eine Gänsehaut. Typisch Seelie. Verdammt.
Konzentier dich, Nessya, ermahnte sie sich. Eine Art Hauptmann also. Dann schien er zur königlichen Garde zu gehören. Die gute Nachricht war, dass er definitiv nicht von ihrer Mutter als Auftragskiller geschickt worden war. So sehr Mutter immer danach strebte, so hatte sie es nie geschafft, Verbindungen zum Hof aufzubauen. Die schlechte Nachricht war, dass sie es jetzt mehr oder weniger mit der Königin zu tun hatte. Schlimmer als normale Fay – was schon schlimm genug ist – sind Fay mit viel Macht.
Und die Königin war die mächtigste Fay des gesamtenSíd.
»Ich muss zugeben, dass ich mich nicht sehr lange dort aufgehalten habe«, erklärte sie. »Nachdem ich festgestellt habe, dass ich ihr nicht mehr helfen kann, bin ich gleich hergekommen, um jemandem Bescheid zu geben.«
»Verstehe«, erwiderte er nachdenklich und sah ihr durchdringend in die Augen, als ahnte er, dass sie mehr wusste, als sie zugab. Aber das konnte nicht sein. Woher auch, wenn er mit ihrer Verwandtschaft nichts zu tun hatte? Oder verfolgte er möglicherweise ganz andere Interessen?
Was sich die noblen Seelie unter Spaß vorstellten, wenn sie in die Welt der Menschen kamen, war Sex. Was den freien Umgang mit Sex betraf, konnte man die Fay von der Einstellung her ein bisschen mit einem Haufen Hippies vergleichen.
Grausame, blutrünstige Hippies.
Als Kind war sie menschlichen Sexsklaven das eine oder andere Mal im Síd begegnet. Im zarten Alter von fünfzehn hatte sie es am eigenen Leib erfahren. Danach war sie geflohen und hatte lange Zeit unter den Nachwirkungen gelitten.
Aber wieso ausgerechnet sie? Nicht dass sie sich wünschte, er würde Jagd auf eine andere Frau machen. Immerhin hatte sie den Vorteil, ihn durchschauen zu können. Sie wusste im Gegensatz zu den anderen, dass hinter dieser attraktiven Fassade etwas Tödliches lauerte. Doch von ihrer hochgewachsenen, blonden, porzellanhäutigen Elfen-Mutter hatte sie lediglich das dunkle Blau der Augen geerbt, ansonsten gab es zwischen Mutters atemberaubendem Liebreiz und ihr keinerlei Ähnlichkeiten und Fay interessierten sich für gewöhnlich nur für die schönsten der Schönen. Sie war kleiner und nicht so damenhaft, wie es sich für eine Elfe des Seelie-Hofes geziemt hätte. Ihre menschlichen Wurzeln sah man ihr deutlich an. Statt sanfter blonder Wellen wie bei ihrer Mutter, kringelten sich dunkelbraune Locken um ihr Gesicht.
Emma versuchte sie regelmäßig dazu zu überreden, sich die Lippen knallrot zu schminken, um den Schneewittchen-Look perfekt zu machen. Einmal hatte sie sich dazu breitschlagen lassen, aber sie fand es ziemlich lästig, regelmäßig aufs Klo zu verschwinden, um sich den Lippenstift nachzuziehen.
»Möglicherweise ist dir ein bestimmter Geruch aufgefallen oder etwas anderes. Bitte, jeder Hinweis ist wertvoll«, bohrte Mr Sex-Hotline-Stimme nach und riss sie aus ihren Gedanken. Überrascht blinzelte sie. Sie war abgedriftet, während ihr ein Fay gegenübersaß. Reiß dich zusammen, Nessya!
»Stickig, glaube ich«, antwortete sie. »Es fiel mir schwer, zu atmen. Könnte aber auch einfach daran gelegen haben, dass die Leiche tief in einer Höhle lag und vielleicht schon Verwesungsgeruch ausgeströmthat.«
Damit hatte sie dem Seelie einen möglichen Hinweis auf den Mörder gegeben, ohne sich selbst zu verraten.
»Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich fühle mich etwas unwohl.« Sie stand auf. »Ich denke, ich sollte in meine Herberge zurückgehen und mich ausruhen.«
Er erhob sich ebenfalls. »Ich werde dich begleiten.« Er klang, als würde er keinen Widerspruch dulden.
»Das ist wirklich nicht nötig«, erwiderte sie schnell und setzte sich wieder.
»Aber ich bestehe darauf. Was hältst du davon, wenn ich dich auf einen weiteren Drink einlade und dich dann sicher in deine Unterkunft begleite?«
Sein Blick fing den ihren ein. Ihre Hand, die um ihr Glas lag, erschlaffte und lag nutzlos auf dem Tisch. Er schwächte sie, drang irgendwie in ihren Verstand. Sie versuchte wegzusehen, doch sie schaffte es nicht, und je länger er sie anstarrte, desto stärker wurde sie in die Unendlichkeit seiner Augen gezerrt. Was auch immer er tat, war nichts, was ein Seelie normalerweise machte. Etwas in ihr ahnte, dass es schlecht war. Doch es ließ sie seltsam unberührt und bald schon verlor es an Bedeutung. Auch die Tatsache, dass er sich in ihrem Geist befand und darin wühlte. Oder was auch immer er da tat. Sie wollte sich nicht länger wehren und ließ sich fallen, gab dem Sog nach. Bilder flackerten vor ihrem inneren Auge auf. Kindheitserinnerungen. Nur Fragmente, zerfetzte Eindrücke.
Das ist keine Seelie-Magie …
Das ist keine Seelie-Magie!
Ein kleiner Funken in ihr kämpfte dagegen an. Sie schob, drängte ihn aus ihrem Kopf. Mit aller Kraft. Sie wollte das nicht, wollte das nicht …
Auf einmal riss die Verbindung ab. Er sagte etwas, oder sie glaubte nur, dass er etwas sagte, weil sich seine Lippen bewegten.
Dann zwinkerte er ihr zu und der Bann war vollends gebrochen. »… damit ich mein Gesicht wahren kann«, beendete er seinenSatz.
Blinzelnd sah sie schnell zur Seite. Verdammt, was war gerade geschehen? Nichts anmerken lassen, er durfte nicht wissen, dass sie alles mitbekommen hatte.
»Entschuldigung«, sagte sie. »Ich war gerade in Gedanken. Was hast du gesagt?«
»Ich habe dir angeboten, dir noch einen Drink auszugeben, bevor wir aufbrechen.«
»Lieber nicht.« Nervös knabberte sie an ihrer Unterlippe und dachte fieberhaft über einen eleganten Abgang nach, ohne ihn zu brüskieren. Fay legten großen Wert auf Etikette, und wenn sie nur dazu diente, den Schein zu wahren.
Sie hob ihr Glas. »Nach diesem hier wollte ich nichts mehr trinken und es ist sogar noch was drin. Ich fürchte, ich hatte sowieso schon zu viel. Aber danke für das Angebot.« Na bitte. Das klang höflich und diplomatisch.
»Du hast dein Glas doch bereits geleert.«
»Nein, hab ich …« Sie stockte, als sie ihr leeres Glas sah. Hatte sie es tatsächlich leer getrunken? Sie konnte sich nicht erinnern. War es während seines kleinen Spielchens geschehen? Hatte er sie dazu gebracht, oder war sie dermaßen beschwipst?
Nein. Als sie sich auf den Kontakt zwischen ihrer Hand und dem Glas konzentrierte, spürte sie ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen. Das kam nicht vom Alkohol. Er hatte einen Blendzauber über das Glas gelegt. Eine ganz kleine, unscheinbare Illusion. Himmel, der Junge wargut.
Die zehn Jahre abseits der Feenhügel hatten sie nachlässig gemacht. Früher konnte sie anhand der Wortwahl genau erkennen, was jemand sagte und was jemand meinte. Da Fay nicht lügen können, kam es oft auf kleinste Detailsan.
Hatte er gesagt, ihr Glas wäre leer oder hatte er seine Formulierung bloß so geschickt gewählt, dass sie meinte, es sei leer? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Wenn es ihr gelang, den Zauber durch einen unerwarteten Zwischenfall zu stören, würde sich die Illusion auflösen.
Sie tat so, als machte sie eine ungeschickte Handbewegung, und stieß das Glas vom Tisch.
Es gibt diesen Augenblick, den Bruchteil einer Sekunde, in dem sich alles Weitere entscheidet. Hätte sie sein Spielchen noch eine Weile mitgespielt, hätte sie eine klitzekleine Chance gehabt, später an diesem Abend unbeschadet in ihrer Pension anzukommen. Er hätte sie vielleicht bis vor die Tür begleitet und wäre gegangen, nachdem sie es geschafft hätte, ihn davon zu überzeugen, dass sie nichts weiter wusste und kein Interesse an unverbindlichen Sex hatte. Falls es das war, worauf er auswar.
Dann hätte sie eine letzte Nacht an diesem verfluchten Ort verbracht, bevor sie nach Dublin zu ihrem durchschnittlichen Leben zurückgekehrtwäre.
›Durchschnittlich‹ ist ein Zustand, den die meisten Leute zu verändern versuchen. Ihr völlig unbegreiflich. Für sie klang es perfekt. Was sie betraf, so wollte sie mit der Feenwelt nie wieder etwas zu tun haben.
Als ihr das bewusst wurde, war es zu spät. Das Glas befand sich bereits im Flug und schwebte wie im Zeitlupentempo dem Boden entgegen.
Sobald es aufschlug und zerbarst, war ihr klar, dass sie nicht zurück in die Pension gehen, unbehelligt auschecken und nach Dublin zurückkehren konnte. Benommen registrierte sie, dass tausend kleine Glasstückchen über den Boden sprangen und schließlich in der goldenen Pfütze kleben blieben, die sich über die Dielen ergoss. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, bevor es dann doppelt so schnell zu rasen begann.
Das Glas war nicht leer gewesen. Sie hatte ihn entlarvt und sich endgültig verraten.
»Ups.« Sie kicherte, versuchte zu retten, was zu retten war. Schwankend stand sie auf und hielt sich an der Kante fest. »Wie ungeschickt von mir. Ich muss doch zu viel getrunken haben.«
»Ich wusste es«, sagte er finster. Seine Ellenbogen stützte er auf dem Tisch ab und sein Kinn auf seine gefalteten Hände, als er sie, die eine Augenbraue hochgezogen, mit einem skeptischen Blick bedachte.
Offenbar kaufte er ihr den Mist nicht ab. Man musste kein Einstein sein, um zu wissen, was er damit meinte.
Sie murmelte etwas von Toiletten und dass sie gleich wieder da wäre. Schnellen Schrittes ging sie zu den Waschräumen, um sich einen Plan B zu überlegen. Sie wollte diese Insel verlassen. Jedoch nicht in einem schwarzen Leichensack.
3
Die Damentoiletten befanden sich im Untergeschoss. Nessya nahm beim Hinabsteigen zwei Stufen auf einmal und stieß eilig die Tür auf. Sie brauchte Zeit zum Nachdenken. Auf keinen Fall durfte sie zulassen mit dem Fay auch nur eine Sekunde lang alleine zu bleiben. Zum Beispiel auf dem Weg vom Pub zur Pension. Nur wenn sie unter Menschen blieb, hatte sie eine Chance zu überleben.
Zu spät bemerkte sie, dass sich jemand im Vorraum bei den Waschbecken befand. Vor Schreck blieb ihr fast das Herz stehen, doch es handelte sich nur um zwei junge Mädchen, die ihr Make-up auffrischten. Ganz normale Teenies, ohne übersinnliche Fähigkeiten. Sie schenkten ihr kaum Aufmerksamkeit, sahen sie kurz an und unterhielten sich dann weiter miteinander.
Schnellen Schrittes durchquerte sie den Raum zu den Kabinen und schloss sich in einer von ihnen ein. Währenddessen schienen die beiden Mädchen fertig zu sein und verließen die Toiletten. Sie war allein.
Die Frage war, für wie lange. Wann würde der Fay einen unauffälligen Moment abpassen, um ihr ins Untergeschoss zu folgen? Lange würde es nicht dauern. Sobald er eine geeignete Gelegenheit erhielt, würde er sie hier unten finden und töten.
Über ihr an der Wand entdeckte sie ein Fenster, das auf die ebenerdige Straße führte. Sie brauchte keine Zeit mehr zum Nachdenken, sie würde durch das Fenster verschwinden. Einer der seltenen Momente in ihrem Leben, in denen sie froh war, nicht allzu groß zu sein. Mit ihren knapp eins sechzig war sie klein und zierlich genug, um durchzupassen, sie musste es nur irgendwie erreichen. Ein dünnes Wasser- oder Heizrohr, an dem sie sich hochziehen konnte, führte unterhalb des Fensters an der Wand entlang. Zum Glück gab es einen kleinen Vorsprung, wie oft bei Souterrain-Fenstern. Von dort aus könnte sie es öffnen und auf die Straße gelangen.
Nachdem sie auf die Klobrille gestiegen war, versuchte sie das Gleichgewicht zu halten, was gar nicht so einfach war. Verdammter Alkohol. Sie sprang, bekam das Rohr aber nicht richtig zu fassen und rutschteab.
»Shit!« Sie landete hart auf dem Boden und knickte mit dem Fuß um. Es tat höllisch weh, aber wichtiger war jetzt, von hier abzuhauen. Sie kletterte erneut auf die Brille und dieses Mal schaffte sie es, das Rohr zu greifen. Einen Augenblick hing sie mit ausgestreckten Armen und Beinen da, dann stemmte sie die Füße gegen die Wand und zog sich langsam hoch. Oben angekommen, kauerte sie sich unterhalb der Decke auf den schmalen Vorsprung.
Das Fenster öffnete sich nach innen und es erforderte einiges an Geschick, aber schließlich gelang es ihr. Sie zwängte sich durch den Rahmen und krabbelte auf die Straße. Inzwischen war die Dämmerung über die Insel hereingebrochen.
Sie zog sich an einem Müllcontainer auf die Beine, stand auf und klopfte sich Dreck von der Kleidung. Die Luft war kühl, ihre Jacke hing noch über der Stuhllehne im Pub. Feiner Sprühregen benetzte ihr Gesicht und klärte den Schwindel in ihrem Kopf. Die frische Luft half gegen die Benommenheit.
Wo war sie eigentlich? In welcher Richtung lag die Pension? Ah, sie befand sich in einer kleinen Seitengasse hinter dem Pub. Dort, wo die Müllsäcke gelagert und Warenpaletten abgestellt wurden. Über dem Hintereingang, der sich neben dem Container befand, spendete eine Notfallleuchte spärliches Licht. Viel erkannte sie nicht. Hinter ihr führte die Gasse tiefer ins Dunkel, vor ihr lagen die Hauptstraße und der Hafen.
Langsam orientierte sie sich. Zu ihrer Pension war es von hier aus nicht weit. Mit etwas Glück würde er sie bis zu ihrer Abreise nicht ausfindig machen und sie könnte wieder untertauchen. Es war ihr einmal gelungen, weshalb sollte es kein zweites Mal klappen?
Sie lief los, knickte um und hielt sich gerade noch rechtzeitig an dem Container fest. Ein stechender Schmerz zuckte durch ihren Knöchel. Auch das noch, aber sie musste in Bewegung bleiben. Das war ihre einzige Chance zu überleben, und die war schon unter den gegebenen Umständen recht gering.
Als sie wieder Richtung Hauptstraße loshumpelte, ertönte über ihr ein Kreischen. Sie erkannte den Laut, sie hatte ihn früher, als Kind, hin und wieder aus weiter Ferne gehört. Doch nie sonah.
Niemals sonah.
Fast wie der Schrei eines Raben, nur heller, schriller und unnatürlicher. Abrupt blieb sie stehen. Das war kein gewöhnliches Tier. Kein Erdentier gab einen solchen Laut von sich. Warme Flüssigkeit lief aus ihren Ohren. Sie wischte sich die Nässe von ihrem Hals und sah auf ihre blutverschmierten Finger.
Sluaghs.
Seelenfresser.
Wenn der Körper zu Staub zerfällt und die Seele gefressen wird, was bleibt dann noch? Kalter Schweiß brach in ihrem Nacken aus. Sie schloss die Augen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht!
Ein weiterer Schrei durchschnitt die Nacht. Sie sah nach oben und suchte die Häuserfassaden und den Nachthimmel ab, konnte jedoch nichts erkennen. Gegen die Wand gedrückt setzte sie sich langsam in Bewegung. Wachsam beobachtete sie ihre Umgebung. Sie konnten nicht hier sein. Sie durften nicht hiersein.
Der dritte Schrei klang noch näher. Er ging ihr durch Mark und Bein. Weitere Rufe folgten, die zu hohen dünnen Tönen anstiegen und nachhallten, als verdoppelten und verdreifachten sich die einzelnen Schreie. Sie durchbohrten ihr Trommelfell und stießen wie Nadeln in ihr Gehirn. Schließlich brach sie unter diesem Ansturm zusammen, presste die Hände auf ihre blutenden Ohren und schrie vor Schmerzen.
Sie rufen einander, dachte sie, bevor der Lärm plötzlich abbrach. Ihre Ohren rauschten, die restlichen Geräusche um sie herum klangen wie durch Watte. Beim Aufstehen verlor sie das Gleichgewicht.
Sie sah hinauf und machte weiter vorne an der Wand zu ihrer Linken eine Bewegung aus. Ein schwarzer Schatten, der sich, ähnlich einer riesigen Fledermaus, mit muskulösen Armen an das Gemäuer krallte und auf sie herunterschaute. Augen erkannte sie keine, der Schädel war wie eine Sichel geformt. Lang und schmal. Die Stirn und das, was das Kinn sein sollte, bogen sich nach hinten.
Mit einem Blick erfasste sie die Fassade und entdeckte weitere Schattengestalten. Die Umrisse ihrer Körper mischten sich mit der Finsternis. Langsam begann sie rückwärts zu gehen, nur weg. Weg von den Monstern.
Steinchen rieselten aus dem Gemäuer, als die Kreaturen daran entlangkrochen. Plötzlich stieß sich eine von ihnen ab und landete in einiger Entfernung vor ihr auf dem Boden. Das Wesen fauchte sie an und entblößte eine Reihe dicht nebeneinanderstehender, messerscharfer Zähne. Von vorne hatte der Schädel die Breite einer Handkante. Als es seinen Schlund öffnete, sah es so aus, als würde sich in der Dunkelheit ein Loch aus Fangzähnen öffnen.
Ihr Herz raste, doch ihre Muskeln waren wie erstarrt. Eine Stimme in ihr schrie, sie solle wegrennen. Eine andere flüsterte, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Vielleicht … vielleicht flogen die Kreaturen davon, wenn sie ruhig blieb?
Das Wesen stemmte sich mit den Armen vom Boden ab und stand mit seinem muskulösen, drachenartigen Körper aufrecht. Mit einem lauten Schlag entfaltete es seine Flügel.
Sie machte einen Satz zurück und fiel zu Boden. Die Spannweite der Schwingen reichte von der einen bis zur anderen Wand. Der Sluagh schüttelte sie aus. Es klang, als würden schwere lederne Laken im Wind flattern. Eine Drohgebärde.
Der Weg zur Straße wurde ihr versperrt.
Das Wesen tat nichts. Legte nur den Kopf schief und beobachtete sie. Worauf wartete es? Auf den Alpha? Das Wilde Heer stand unter der Kontrolle eines Heerführers – die schrecklichste Kreatur, die der Síd je hervorgebracht hatte. Auf einmal hob der Sluagh vor ihr den Kopf und entließ erneut jenen schmerzenden Schrei. Entlang der Wände krochen die anderen drachenartigen Geschöpfe auf siezu.
Hastig rappelte sie sich auf, drehte sich um und rannte los. Es waren viele. Zu viele. Selbst eine einzige dieser Kreaturen könnte sie auslöschen. Nicht einfach nur töten, sondern komplett ausradieren. Wenn man stirbt, hat man die Hoffnung, dass danach noch etwas kommen könnte. Wenn die Sluaghs einen erwischen, gab es nichts.
Die Biester flogen schneller, als sie rennen konnte, trotzdem rannte sie weiter. Am Ende der Gasse bog sie in die Seitenstraße.
Es hieß, dass es kein Entkommen gab, wenn das Heer einmal die Jagd auf sein Opfer eröffnet hatte. Sie gaben so lange nicht auf, bis sie es erwischten, und wenn es bis in alle Ewigkeit dauerte. Hatten ihr die Seelie das Heer auf den Hals gehetzt, weil sie das Opfer eines Fay entdeckt hatte? Das war doch unmöglich. Das wäre der absolute Overkill. Sie hatte nichts verbrochen.
Ein schrecklicher Gedanke schlich sich in ihr Hirn. Vielleicht empfand der Síd ihre Flucht als Verrat. In dem Fall würde es Sinn ergeben, dass das Heer sie jagte. Verrat gehörte im Síd zu den schlimmsten aller Verbrechen.
Hinter sich hörte sie die hohen Rufe und wie ihre Flügelschläge die Sluaghs näher brachten. Der Lärm der Herde war ohrenbetäubend, doch Menschen würden lediglich stürmenden Wind hören. Falls sich eine Menschenseele in der Nähe befand. Über dem gesamten Gebiet musste ein Illusionszauber liegen. Ein Unbehaglichkeitsbann vielleicht, der Menschen vertrieb. Und sie hatte keine Ahnung, wie sie ihn durchbrechen könnte.
Vor ihr versperrte ihr ein Zaun aus Maschendraht den Weg, doch sie hatte es fast geschafft. Dahinter, am Ende des Weges, lag eine Straße. Derart exponiert würden die Sluaghs sie nicht jagen. Sie setzte zum Sprung an. Doch ein Windstoß traf sie im Rücken und riss sie zu Boden. Sie rollte um ihre Achse und erhaschte einen Blick auf circa ein halbes Dutzend Nachtjäger, die sich wie eine tobende Gewitterwolke direkt über ihr tummelten.
Automatisch hob sie ihre Arme schützend vor das Gesicht und entdeckte gleichzeitig aus dem Augenwinkel einen Spalt zwischen dem Maschendraht und der Wand. Mit letzter Kraft drehte sie sich auf den Bauch, robbte auf das Loch zu und kroch hindurch. Sie musste von hier verschwinden, aus dem Bannkreis brechen, Menschen treffen.
Auf der anderen Seite des Zauns stand sie auf und rannte weiter, inzwischen vor Schmerzen mehr hüpfend als laufend. Nicht mehr weit und sie wäre aus den engen Gassen heraus. Vor sich konnte sie den Strand, Boote und eine Straße sehen. Hinter ihr blieb es merkwürdig ruhig.
Weshalb griffen sie nicht an? Die Sluaghs ließen ihre Beute nicht entkommen. Niemals.
Kaum hatte sie den Gedanken zu Ende gebracht, kam sie strauchelnd zum Stehen. Sie hatten sie nicht gejagt, sie hatten sie hierhergetrieben, in eine einsamere Gegend. Wie Vieh. Weg vom Pub, den Straßen und anderen Menschen.
Ihre Befürchtung bestätigte sich, als eine hochgewachsene Gestalt in die Gasse bog. Seine Schritte streckten sich, einzelne Bilder wurden vor ihrem Auge zu einer zeitlupenartigen Momentaufnahme.
Im ersten Augenblick sah sie nur die riesigen Dämonenschwingen, die hinter ihm emporragten. Dann seinen muskulösen Oberkörper und die langen Beine, mit denen er auf sie zuschritt. Gerades, hüftlanges Haar wurde von einem Windstoß aufgewirbelt. Die Hose saß so tief auf den Hüften, dass sie das schmaler werdende Dreieck seiner Bauchmuskeln sehen konnte und wie es unter dem Bund seiner Hose verschwand.
Obwohl er jetzt seinen Blendzauber fallen gelassen hatte, wusste sie, dass er der Fay aus dem Pub war. Mit dem harmlosen jungen Mann, den er zu mimen versucht hatte, hatte er nichts mehr gemein. Abgesehen von seiner stattlichen Größe – sicher über eins neunzig –, hatte er die wenigen Details, die ihn mehr oder weniger menschlich hatten wirken lassen, abgestreift.
Seine Haut wirkte heller, die Haare schimmerten im Licht des Mondes silbern und die Augen … Gott, diese Augen. Selbst auf die Entfernung und trotz der Dunkelheit konnte sie den metallischen Glanz darin erkennen. Augen wie Quecksilberteiche.
Undurchdringlich. Tödlich.
Sein langes Haar ergoss sich über breite Schultern. Einige Strähnen klemmten hinter den Ohren und gaben den Blick auf spitze Ohrmuschelnfrei.
Unseelie.
Kein Zweifel.