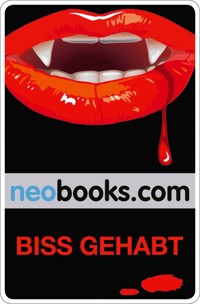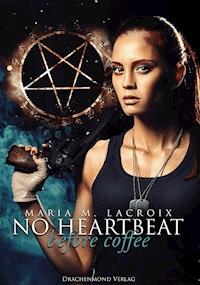
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Während eines Einsatzes gegen einen dunklen Hexenclan wird Diana, kampferprobte Spezialistin des Instituts für "Research and Identification of Paranormal Activities", mit einem tödlichen Fluch belegt. Rettung aus ihrer aussichtslosen Lage erhält sie ausgerechnet von einem Werwolf. Obwohl auch er in ihrer Weltsicht zum Feind zählt, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Jamie zu vertrauen. Und als wäre ihr Leben nicht verzwickt genug, zieht er sie stärker an, als sie sich selbst eingestehen will. Gleichzeitig wird Seattle von einer brutalen Mordserie erschüttert, sodass Diana ihre persönlichen Probleme in den Hintergrund stellt, um sich voll und ganz der Aufklärung des Falles widmen zu können. Doch ihre Kollegen dürfen weder von ihren Gefühlen für Jamie erfahren noch, welchen Preis sie für ihr Überleben gezahlt hat...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria M. Lacroix
No heartbeatbefore coffee
Astrid Behrendt Rheinstraße 60, 51371 Leverkusenwww.drachenmond.de, [email protected]
KorrektoratMichaela Retetzki
Satz, Layout Martin Behrendt
IllustrationenJanett Krützfeldt
Umschlaggestaltung Marie Graßhoff
ISBN: 978-3-95991-249-5 ISBN der Druckausgabe: 978-3-95991-251-8
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Danksagung
For Hny
My best friend, my knight in shining armor, and my sweetheart
Eins
Qualm kratzte in meinen Lungen. Durch die dichten Rauchschwaden hindurch konnte ich kaum etwas erkennen. Hinter einer Ecke ging ich in Deckung und wechselte so leise wie möglich das Magazin meiner Browning Hi-Power. Ich unterdrückte den Hustenreiz, um den Hexen nicht meine Position zu verraten. Wie viele von ihnen lebten überhaupt noch?
Diese verfluchte Operation war mächtig schiefgegangen. Wir hatten nur ihren Versammlungsort stürmen und sie verhaften wollen. Sie hatten als Erste das Feuer eröffnet. Buchstäblich. Zwei der Jungs vom CPU verbrannten innerhalb weniger Sekunden bei lebendigem Leib – per Verwünschungen aus einigen Metern Entfernung. Danach war das restliche Team in Panik geraten und hatte angefangen, auf die Hexen zu schießen. Ein paar von ihnen waren weg-, ein paar auf uns zugerannt. Im Kugelhagel fielen sie wie die Fliegen. Keine Ahnung, ob sie sich in einer Art Trance befunden oder den Weg ›Suicide by Cop‹ gewählt hatten. Auf jeden Fall entgingen sie dadurch einem langen Gerichtsprozess mit fast sicherem Todesurteil. Jap, bei Hexen, die Todeszauber betreiben, kennen unsere Gesetze keinen Spaß.
Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Tief durchatmen war bei dem Qualm nicht drin. Das Feuer hatte sich innerhalb kürzester Zeit ausgebreitet, inzwischen stand das ganze Haus in Flammen. Ich trug eine Feinstaubmaske, gehörte bei uns – warum auch immer – zur Standardausrüstung, doch die hielt keine giftigen Gase, sondern nur leichte Rauchpartikel ab. Niemand hatte mit so einem Brand gerechnet. Lange durfte ich mich hier drin nicht mehr aufhalten, wenn ich nicht an einer Rauchgasvergiftung sterben wollte. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich die Anführerin des Clans in die Ecke gedrängt hatte. Die würde mir nicht entkommen, bei Gott!
»Diana!«
Das klang nach Greg, meinem Teamkollegen.
»Wo zum Teufel steckst du?«
Er war auch Vampirjäger, wie ich. Ja, genau, Vampirjäger. Mit Hexen hatten wir normalerweise nichts am Hut. Falls ich die Scheiße hier überlebte, würde ich dem Anzug tragenden Sackgesicht, der auf die grandiose Idee gekommen war, Stellen zu kürzen und Departements zusammenzulegen, meine Meinung geigen. Falls ich diese Scheiße überleben sollte.
»Cunningham!«, rief einer der CPU-Jungs. Greg und er fingen an zu diskutieren, dass es nicht mehr lang dauerte, bis die ganze Bude über unseren Köpfen zusammenbrach. Greg brüllte ihn an, dass er nicht ohne mich gehen würde. Fuck!
Mit einem frustrierten Grummeln schob ich mich an der Wand hoch. Ich hasste es, die Bösen entkommen zu lassen. Aber die Jungs hatten recht. Nicht mehr lange und das Dach stürzte ein, abgesehen davon, dass ich mittlerweile ernsthafte Probleme hatte, Luft zu bekommen. Das verdammte Miststück war wahrscheinlich sowieso längst weg.
Es war dieser Gedanke, der mich leichtsinnig und unaufmerksam werden ließ. Und dazu das Bedürfnis, so schnell wie möglich aus dem brennenden Haus zu gelangen. Ich sah sie nicht kommen. Plötzlich stand sie neben mir und verpasste mir eine Rechte, die sich gewaschen hatte. Ich stürzte zu Boden, behielt meine Waffe aber in der Hand. Jahrelanges Training. Den Lauf richtete ich rasch nach oben, doch die Hexe war wieder in den Rauchschwaden verschwunden. Vielleicht hatte sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt und war abgehauen.
»Diana«, rief Greg wieder aus einem anderen Teil des Hauses. Es klang von weiter weg als eben.
Bring dich selbst in Sicherheit, du Idiot! Aber ich hätte ihn auch nicht zurückgelassen und er wäre sicher sauer, wenn ich ihm einfach so unter der Nase wegsterben würde, ohne vorher ein Lebenszeichen von mir gegeben zu haben. Ich an seiner Stelle wäre jedenfalls ziemlich angepisst.
Aus Reflex holte ich tief Luft, um zu antworten, und wurde von einem heftigen Hustenanfall durchgeschüttelt. Ein weiterer Schlag traf mich und schleuderte meinen Kopf zur Seite. Von wegen die Gelegenheit beim Schopf gepackt und abgehauen. Die verdammte Hexe setzte sich auf mich und packte mich am Schopf.
»Au! Bitch!«, rief ich, als sie ihre Finger in meine Haare krallte und daran zerrte. Ich warf sie von mir, wobei sie mir ein ganzes Büschel ausriss. Doch Schmerzen spürte ich im Moment nicht, die kämen später. Miststück. Ich rechnete mit einem weiteren Angriff, stattdessen trat sie einen schnellen Rückzug an.
»Diana Cunningham«, rief die Hexe und hielt meine ausgerissenen Haare in die Höhe.
Verflucht, woher kannte sie meinen vollen Namen? Ach ja, den hatten ja Greg und der CPU-Typ eben durch das Haus gebrüllt. Klasse gemacht, Jungs!
»Ich verfluche dich. Ich verfluche dich zum Tode!« Zwischen ihren Fingern begannen meine Haare zu dampfen und zu versengen, als würde sie ein Feuerzeug darunter halten, was sie aber nicht tat. Fuck. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich brachte meine Pistole in Position und schoss, verfehlte sie jedoch. Wegen ihrer Schläge war mir schwindelig und aufgrund des Rauches verschwamm meine Sicht. Mit Tränen in den Augen lässt sich nicht gut zielen.
»Ich wünsche dir den gleichen Tod an den Hals, wie deinem ärgsten Feind«, hörte ich sie kreischen. Zu sehen war sie in dem Qualm nicht mehr. »Möge dein Herz bei Sonnenaufgang zu schlagen aufhören!«
Ich schoss wieder in die Richtung, aus der ich die Stimme vermutete. Doch genau über mir krachte ein Stück der Decke herunter. In letzter Sekunde rollte ich mich weit genug weg, sprang auf und rannte aus dem Zimmer. Die Hexe zu erwischen, war aussichtslos. Es war ihr Haus, sie kannte sich hier viel besser aus und war jetzt wahrscheinlich wirklich geflohen.
Irgendwie schaffte ich es nach draußen. Ich glaube, ich konnte mich nur deshalb retten, weil eine Wand bereits halb eingestürzt war und ich so ins Freie kam. Beschwören könnte ich es im Nachhinein aber nicht mehr. Im Garten hinter dem Haus fiel ich ins Gras, riss die Maske von meinem Gesicht und hustete mir die Seele aus dem Leib.
Sobald es mir besser ging, bemerkte ich, dass ich unter dem Sternenhimmel völlig alleine war. Keine Sanitäter, keine Feuerwehr, keine Kollegen, die zu mir geeilt kamen und halfen. Die befanden sich alle vor dem Haus. In der Ferne hörte ich Sirenen, aufgeregtes Rufen, Befehle wurden gebrüllt. Mein Name fiel ein paar Mal. Das brennende Haus befand sich wie eine Barriere aus Flammen zwischen uns.
Ich rappelte mich auf, damit ich ums Haus herum nach vorne gehen und medizinisch versorgt werden konnte, als mir in dem Moment die Worte der Hexe erst richtig bewusst wurden.
Sie hatte mich mit einem Todesfluch belegt. Nach einjähriger Vorbereitungsarbeit hatten wir heute deren Hauptsitz gestürmt, weil der Clan immer auffälliger und ihre Taten von Mal zu Mal grausamer geworden waren. Daher war ich mir sicher, dass die Hexe keine leeren Verwünschungen ausgestoßen hatte, zumal sie uns eine Kostprobe ihrer Fähigkeiten gegeben hatte. Bei ihren Flüchen handelte es sich nicht um im Zorn ausgesprochene, inhaltslose Drohungen. Der Fluch war echt.
Wie mein ärgster Feind sollte ich sterben. Aber noch lebte ich.
Vampire waren meine schlimmsten Feinde.
Zu Sonnenaufgang.
Ich schaute auf meine Hände und sah, dass sie heftig zitterten. Ich zitterte so stark, dass die Waffe, die ich umklammerte, vor meinen Augen als verschwommener Schemen erschien. Vor meinem Blick breitete sich Dunkelheit aus.
Das Nächste, woran ich mich erinnerte, war, wie ich mutterseelenallein nachts durch den Wald lief. Ich hatte einen Filmriss. Inzwischen nahm ich meine Umgebung wieder bewusst wahr, fühlte mich aber taub. Nur zwei Gedanken kreisten unaufhörlich in meinem Kopf.
Du wurdest verflucht.
Du wirst sterben.
Es war nur eine Frage der Zeit, eine Sache von wenigen Stunden …
Durch die Baumkronen hindurch erkannte ich in dieser Novembernacht einen sternenklaren Himmel. Mein Atem bildete Kondenswölkchen. Es musste klirrend kalt sein, doch auch das spürte ich nicht. Wie weit war ich schon gelaufen? Wie spät war es? Das Haus hatten wir gegen neun Uhr abends gestürmt. Wie viel Zeit blieb mir noch?
Bei dem Gedanken setzte wieder die Panik ein. Da war mir das Gefühl der Taubheit lieber, doch innerhalb der letzten … keine Ahnung – Stunden? – wechselten sich Panik und Stumpfheit fröhlich miteinander ab. Und zu allem Überfluss war mein Zeitgefühl vollkommen im Eimer. Ich hatte keine Ahnung, wann die Sonne aufgehen würde, wie lang ich noch zu leben hatte.
Resigniert ließ ich mich auf einen umgekippten Baumstamm sinken. So konnte es nicht weitergehen. Ich konnte doch nicht darauf warten, dass mich der Sonnenaufgang dahinraffte. Wie einen Vampir.
»Wirklich zum Schreien komisch, du verdammtes Scheiß-Hexen-Miststück … Fuck!«
Jetzt erinnerte ich mich. Statt nach vorne zu meinen Kollegen zu gehen, war ich in den Wald gelaufen, der an den verwilderten Garten hinter dem Haus grenzte. Die Jungs hätten mir nicht helfen können. Sollten sie lieber denken, ich wäre in den Flammen umgekommen, statt den Rest der Nacht zu versuchen, mich zu retten, nur um mir am Ende dann doch beim Sterben zuzusehen.
Nein, verdammt! Das war eine beschissene Art, abzutreten.
In dem Moment fiel mir wieder die Waffe auf, die ich zwischen meinen verkrampften Fingern hielt. Und plötzlich zeigte sie mir eine ganz neue Möglichkeit auf.
Ich musste ja nicht wie so ein verfluchtes Hinrichtungsopfer auf meinen Tod warten.
Rennen. Weicher Erdboden unter seinen Pfoten. Düfte. Erde, tote Blätter, Moos, Baumrinde. Wind strich durch sein Fell.
Ruhe.
Weitab von der lauten Stadt. Nur die Geräusche des Waldes. Der Mond schien hoch über seinem Kopf, die Nacht sang.
Er roch … Beute. Nahm Witterung auf und rannte. Der Geruch brachte ihn zu einem kleinen Geschöpf. Dort hockte es, so nah. Es hatte ihn bemerkt, floh, schlug einen Haken. Doch er sprang und erwischte es. Ein Biss durch die Kehle und es war tot. Er schmeckte Blut, Fleisch. Er legte den Kopf in den Nacken und heulte sein Vergnügen in die Welt.
Freiheit.
Nach der kleinen Zwischenmahlzeit streifte er weiter durch den Wald. Er roch einen Menschen. Doch der war so weit von ihm entfernt, dass er nie etwas von seiner Anwesenheit erfahren würde. Wenn er jetzt umkehrte.
Menschen mied er.
Er kehrte nicht um.
Roch seltsam. Nach Ruß, nach Angst. Aber darunter verbarg sich ein zarter Duft. Kaum wahrnehmbar und doch …
Langsam trottete er in Richtung des Geruchs. Vorsichtig. Man kann ihnen nicht trauen. Sie sind gefährlich. Ein Windstoß streifte ihn und trug den Duft mit sich. Wie eine Nebelwolke umhüllte er ihn. Er blieb stehen, witterte. In seinem Kopf entstand eine Karte des Waldes. Er wusste genau, wo sich dieser Mensch befand.
Als er ihn erreichte, blieb er im Unterholz und beobachtete ihn. Weiblich. Roch gut. Sehr gut sogar, wenn man an dem Geruch von Verbranntem vorbei schnupperte. Nach Leben und Energie. Seife und Shampoo mischten sich mit ihrem natürlichen Duft.
Sie saß auf einem umgefallenen Stamm und starrte auf etwas in ihren Händen. Ihre Schultern waren vornüber gekippt. Sie wirkte verunsichert, besorgt. Neben dem Ruß und ihrer eigenen Note, roch er außerdem Metall und einen scharfen, chemischen Pulvergeruch. Eine Waffe.
Er sollte umkehren.
Sie hob die Arme. Zähne kratzten gegen Metall.
Er verließ sein Versteck und rannte mit langen Schritten auf sie zu. Sie sprang auf, ihr zarter Duft mischte sich mit dem von frisch ausgestoßenem Angstschweiß. Bevor er sie erreichte, feuerte sie einen Schuss ab.
Laut, zu laut. Der Knall schmerzte, machte ihn taub. Etwas zischte nur Millimeter an seinem Körper vorbei und versengte ihm die Haare seines Fells. Kurz blieb er wie angewurzelt vor ihr stehen, bevor er wütend wurde.
Sie hatte auf ihn geschossen.
Adrenalin rauschte durch seinen Körper. Unwillkürlich sträubte sich sein Fell. Zornig knurrte er, legte die Ohren an und sprang. Gemeinsam schlugen sie auf dem Waldboden auf, die Waffe flog aus ihrer Hand und landete Meter entfernt im Laub.
Ihre Hände krallten sich in sein Fell, als sie versuchte, ihn abzuwehren. Vergeblich. Sie war kräftiger als sie aussah, doch nicht kräftig genug. Mit den Pfoten drückte er sie in die Erde, hob die Lefzen und knurrte laut. Der scharfe Geruch von Stressschweiß stieg ihm in die Nase, reizte ihn.
Statt sich weiter zu wehren, ließ sie von ihm ab, bot ihm die Kehle dar und schloss die Augen. Seltsam.
Doch ihr unterwürfiges Verhalten beruhigte ihn. Zur Warnung knurrte er weiter, ließ es aber ausklingen und beschnupperte ihren Hals. Als seine feuchte Nase über ihre Haut streifte, zuckte sie zusammen. Hartes Narbengewebe zog sich von der linken Seite ihres Halses über das Schlüsselbein hinunter zur Schulter.
Seinen Blick vermied sie. Sie hatte Angst. Zu Recht. Man schießt nicht auf einen Werwolf. Dummer Mensch.
Nachdem er von ihr heruntergestiegen war, trottete er zur Waffe und fing an, ein Loch zu buddeln. Es dauerte einen Moment, bis sie sich aufsetzte und beobachtete, wie er die Waffe vorsichtig zwischen die Zähne nahm, in das Loch warf und es wieder zuscharrte. Er drehte sich um und sah sie an. Sie hatte ihre Knie an den Körper gezogen, umschlang die Beine mit den Armen und sah zurück, einen fragenden Ausdruck in ihren Zügen. Ihr helles Gesicht erschien in der Dunkelheit und umgeben von dichten dunklen Locken nahezu weiß.
Aufgrund der hockenden Position, war ihr Kopf niedriger als seiner. Er stand aufrecht, den Schwanz und die Ohren als Zeichen seiner Dominanz nach oben gerichtet. Mit einem leisen Knurren und Schnaufen macht er seinen Unmut deutlich, doch ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte sie keine Ahnung, was er ihr mitzuteilen versuchte.
Zeit, sich in einen Menschen zurückzuverwandeln.
Manchmal, wenn alles zu viel wird, wenn der Verstand mit dem Begreifen der Ereignisse nicht hinterher kommt, schaltet man ab. In diesen Momenten hört man auf zu empfinden. Die Sinne funktionieren einwandfrei, zum Teil sogar schärfer, als wenn das Hirn sie erst einmal interpretieren müsste. Man sieht, hört und riecht nur noch. Um den Verstand nicht zu verlieren, ist man darauf angewiesen, das Hirn auszustellen und auf Durchzug zu schalten.
In diesem Zustand befand ich mich, während ich einen riesigen Wolf dabei beobachtete, wie er sich nach und nach in einen Menschen wandelte. Im ersten Moment hatte ich nicht begriffen, was vor sich ging. Nachdem sich das massige Vieh hingelegt hatte, fingen zunächst seine Gliedmaßen unter lautem Knacken und Krachen an, sich unnatürlich zu verformen. Als würde jemand alle Gelenke in seinem Körper aus- und wieder einrenken lassen. Es hörte sich furchtbar an und sah schmerzhaft aus, doch mein Verstand war wie leer gefegt. Ich beobachtete ihn, ohne etwas dabei zu fühlen. Weder Angst noch Mitleid noch sonst irgendetwas. Ich sah nur zu und wunderte mich.
Ich zählte keine Minuten – hatte also keine Ahnung, wie lang die ganze Prozedur dauerte –, doch dort, wo sich ein Wolf auf den Waldboden gelegt hatte, lag nun ein Mann. Er stand auf, streckte stöhnend seine Glieder und humpelte die paar Schritte zu mir herüber. Er sah aus wie jemand, der Schmerzen hatte, dessen ganzer Körper wund war. Seine Bewegungen erinnerten mich an mich selbst, wenn ich unter einem mordsmäßigen Muskelkater litt. Dennoch war er eine wahre Augenweide.
Unter anderen Umständen hätte ich den Anblick genossen. Ich wusste, wie viel Arbeit hinter einem gestählten Körper steckte und rechnete es jedem hoch an, der sich die Mühe machte, fit zu bleiben. Für meinen Job verbrachte ich selbst täglich mindestens vier Stunden beim Sport. Zwei Stunden Muskeltraining und zwei für Cardio.
Er musste zwischen eins achtzig und eins fünfundachtzig sein – da ich noch auf dem Boden saß und zu ihm hochblickte, konnte ich das nur grob abschätzen. Lange, athletische Beine gingen in schmale Hüften über. Abgesehen von dem dünnen Streifen Haare, der über den Unterleib bis zu seinem Bauchnabel reichte, waren sein flacher, durchtrainierter Bauch und die muskulöse Brust unbehaart. Seltsam, in Anbetracht der Tatsache, dass er eben noch ein voll behaarter Wolf gewesen war.
Dass er nackt war, nahm ich nur am Rande wahr und kümmerte mich nicht weiter darum. Die Muskeln seiner breiten Schultern und kräftigen Arme waren perfekt definiert und passten zum Rest seines Körpers. Weder zu massig noch zu schmächtig. Jap, der Kerl war fit. Dass mir diese ganzen Banalitäten in meiner derzeitigen Lage durch den Kopf gingen, zeigte, wie sehr mein Verstand auf ›Stand-by‹ stand.
Bei mir angekommen, quälte er sich wieder auf den Boden, setzte sich – wie ich – mit dem Rücken gegen den Baumstamm gelehnt hin und stellte seine Beine auf.
»Was immer es ist …«, sagte er. »Es gibt für alles eine Lösung. Das Leben ist zu kostbar, um es einfach so wegzuwerfen. Wir finden schon einen Weg, okay?«
Keine Ahnung, womit ich gerechnet hatte, damit jedenfalls nicht. Fassungslos sah ich ihn an, blickte in diese dunklen, warmen Augen und fragte mich, welcher Film hier gerade lief. Strähnen seines dunklen Haares hingen ihm in die Stirn und streiften seinen Nacken. Ich musterte sein Gesicht – männlich, markant, jugendlich – und schätzte ihn auf Anfang dreißig, also ein paar Jährchen älter als ich. Sein Blick war warm und freundlich, aber gleichzeitig auch aufmerksam und forschend.
»Verstehst du, was ich sage?«, fragte er geduldig, ohne mir das Gefühl zu geben, mich für minderbemittelt zu halten.
Mir wurde bewusst, dass mein Mund offen stand. Ich klappte ihn zu. »Ähm, ja. Ich kann dich gut verstehen.«
»Ich denke, du stehst unter Schock, wofür ich mitverantwortlich sein dürfte. Aber keine Sorge, das vergeht wieder.«
»Das brauchst du mir nicht zu erklären. Ich weiß, dass ich unter Schock stehe und der irgendwann wieder vergeht. Das werde ich aber nicht mehr erleben«, erwiderte ich gereizt. »Und um dein Gewissen zu beruhigen: Du kannst nichts dafür, ich stand schon unter Schock, bevor du aufgetaucht bist. Zu dem ganzen restlichen Mist sorgst du nur gerade für einen mordsmäßigen What-the-fuck-Moment.«
Kaum war ich fertig, bereute ich es, ihn so angeschnauzt zu haben. Er konnte nichts dafür, dass ich verflucht worden war. Es war nicht seine Schuld. Doch statt zurückzuschnauzen oder mich meinem Schicksal zu überlassen, lächelte er verständnisvoll. Um seine Augen herum bildete sich ein Netz aus kleinen Lachfältchen. Es war eines von diesen Lächeln, die ansteckend wirkten und die Stimmung des Gegenübers automatisch mit anhoben. Ich könnte wetten, dass dieser Kerl allein mit diesem Lächeln massenweise Frauenherzen zum Schmelzen brachte. Der bräuchte sicher nur einen Raum zu betreten und alle lägen ihm zu Füßen. Ich bewunderte solche Leute, denn ich war nicht so. Ich hatte nicht diese entspannende, lockernde Wirkung auf Menschen. Im Gegenteil. In meiner Gegenwart fühlten sich viele Leute unbehaglich. Die Wahl zur Miss Sympathie würde ich nie gewinnen. Himmel, ich würde ja nicht einmal nominiert werden. Nicht dass ich auf so etwas besonders viel Wert legte. Wichtiger als Nettigkeit war mir Effizienz. Ich sah von diesem unverschämt attraktiven Gesicht weg und schaute auf meine Hände.
»Entschuldige«, sagte ich. »Meine Nacht war bisher echt beschissen und als ich dachte, es könne nicht schlimmer werden, bist du aufgetaucht. Vor meinem inneren Auge sah ich schon die Zeitungsartikel, in denen darüber berichtet wird, wie ein älteres Ehepaar mit Mops bei einem Waldspaziergang meinen halb verwesten Kopf und ein paar Knochen gefunden hat. Mein Hirn hat das Memo noch nicht bekommen, dass du jetzt ein Mensch bist.«
Der Mann neben mir lachte. Ein angenehm dunkler, durchdringender Laut, tief aus seiner Brust. »Ein älteres Ehepaar mit Mops?«
Ich sah ihn wieder an. »Na, es sind immer die Rentner, die solche gruseligen Funde machen. Oder noch schlimmer, spielende Kinder. Nie hört man, dass ein Mitglied der Hells Angels oder so aus Versehen über ein Opfer gestolpert ist und das der Polizei meldet.«
»Verstehe«, sagte er breit lächelnd. Das Netz seiner Lachfältchen weitete sich noch mehr aus. »Dann sag mal deinem Hirn, dass ich kein Mensch, sondern ein Werwolf bin, es aber trotzdem wieder hervorkommen darf. Ich beiße nicht.«
»Werwolf …«, murmelte ich tonlos.
»Normalerweise sage ich das vor Menschen nicht so offen heraus. Aber ich schätze, vor dir wäre es witzlos, das zu leugnen. Sobald du den Schock überwunden hast, hättest du dir das selbst zusammengereimt. Dich deswegen umzubringen, nachdem ich dich davon abgehalten habe, dir das Hirn wegzupusten, wäre noch witzloser.« Mit einem Schulterzucken schien er das so für sich stehen zu lassen. »Also, was könnte so furchtbar sein, dass du den Tod als letzten Ausweg siehst? Eigentlich wirkst du auf mich nicht so, als wärst du deines Lebens überdrüssig.«
»Bevor du aufgetaucht bist, habe ich fünf Mal angesetzt und mich fünf Mal dagegen entschieden, zu schießen. Abdrücken ist nicht so einfach, wie es aussieht.« Während ich sprach, fühlte ich nichts. Der Zustand der Taubheit hielt an und ich hoffte, er würde bis Sonnenaufgang bleiben. »Kurz bevor du mich angesprungen hast, hatte ich die bescheuerte Idee, mich selbst abzuknallen, endgültig verworfen. Sterben werde ich so oder so. Da kann ich die Zeit, die mir noch bleibt, genauso gut auch absitzen.«
»Bist du krank?«, fragte er sanft.
Ich stieß ein bitteres Lachen aus. »Nicht ganz. Ich wurde verflucht.«
Auf seinen fragenden Ausdruck hin, umriss ich grob, was passiert war. Machte schließlich keinen Unterschied mehr, ob er davon erfuhr oder nicht. Morgen stünde es sowieso in den Zeitungen. Ich erzählte von dem Einsatz, den Hexen, dem Fluch und dass ich daraufhin planlos in den Wald gelaufen war.
»Du bist ein Ripper!«, stieß er aus, sprang auf und sah abfällig auf mich herab.
Ich gehörte zu einer Spezialeinheit des R.I.P.A. – Seattle. Die Abkürzung stand eigentlich für Research and Investigation of Paranormal Activities. Die Bevölkerung hatte uns jedoch den wenig schmeichelhaften Spitznamen ›Ripper‹ verpasst.
Niemand wusste so genau, weshalb Hexen, Vampire, Werwölfe und die restlichen Viecher vor ungefähr zehn Jahren aus der Welt des Aberglaubens zu uns zurückgekrochen waren. Inzwischen nahm man an, dass es sie schon immer gegeben hatte. Im Zuge der Aufklärung und des Vormarsches der Wissenschaft waren sie aber schlicht verdrängt und als dummer Aberglauben abgetan worden. Dazu brauchte man nur die Berichte aus dem Mittelalter bis hin zur frühen Neuzeit zu lesen. Aber an Hexen und Vampire zu glauben, kam irgendwann im Laufe des 18. Jahrhunderts aus der Mode. Es war nicht länger In. Überfälle waren die letzten zweihundert Jahre auf Unfälle, Tiere oder geisteskranke Menschen geschoben worden. Doch die verbesserte Technologie hatte uns gezeigt, dass die Menschen von damals so doof nicht waren und es sich mitnichten um Aberglauben handelte. Spätestens nachdem eine Londoner Überwachungskamera einen Werwolf beim Verspeisen eines Menschen gefilmt hatte – Werwolfgate –, war die Zeit gekommen, unsere arrogante Haltung zu überdenken. Irgendwie ironisch, dass uns ausgerechnet der technische Fortschritt ›Back to the roots‹ gebracht hatte.
Nach dem unfreiwilligen Snuff-Filmchen hatten die Behörden erstaunlich schnell reagiert und innerhalb kürzester Zeit Institutionen aus dem Boden gestampft, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigten. Wie das RIPA. Obwohl wir dafür sorgten, dass die Zivilbevölkerung nicht allzu oft mit dem Kram konfrontiert wurde, hatten die Menschen uns gegenüber Vorbehalte. Könnte natürlich daran liegen, dass die meisten nicht wussten, was genau wir trieben und vieles vertraulich behandelt wurde. Wir, den Leuten suspekt? Nicht doch!
Wer könnte es einem Werwolf dann verdenken, genauso zu reagieren, vor allem, da sie zu jenen gehörten, die wir jagten.
»Na?«, fragte ich und stieß ein bitteres Lachen aus. »Bereust du es jetzt, mir nicht die Kehle herausgerissen zu haben?«
»War das ein Werwolf?«, fragte er und fasste sich mit den Fingern an sein Schlüsselbein.
Unwillkürlich fuhr ich mit der Hand über das vernarbte Gewebe, das sich von meinem Hals über das Schlüsselbein bis hin zur Schulter zog. Unter meinen Fingern spürte ich den unnatürlichen Knick im Knochen. Nachdem sich ein Vampir darin verbissen und ihn zertrümmert hatte, war er etwas schief wieder zusammengewachsen. Man konnte sehen, dass etwas mit dem Knochen nicht stimmte, dass er nicht seiner natürlichen Form entsprach, aber es behinderte mich nicht in meinen Bewegungen.
»Nein. Das war ein Vampir und es ist auch schon sehr lange her. Du bist, um ehrlich zu sein, der erste Werwolf, den ich treffe.«
»Oh.« Sein Ausdruck wurde etwas milder und er setzte sich wieder. »Dann kann ich davon ausgehen, dass du noch nie einen von uns umgebracht hast.«
»So einen wie dich würden wir niemals jagen. Paranormal zu sein, ist nicht illegal. Es gibt schließlich auch einen Haufen Hexen und Hexer, die unbehelligt unter uns leben. Wir rücken erst dann aus, wenn ein Verbrechen verübt wurde.«
»Dann erinnere dich bitte mal daran, wie du vorhin reagiert hast, als ich aus dem Unterholz hervorgekommen bin.«
Überrascht blinzelte ich. Mist, ich hatte ohne zu zögern auf ihn geschossen. Allerdings hatte ich bislang nicht gewusst, dass es auch solche Werwölfe wie das neben mir sitzende Exemplar gab. Ich war – wie alle anderen – davon ausgegangen, dass sie wilde Bestien waren, unfähig, sich in einen Menschen zurückzuverwandeln und jenseits menschlichen Denkens und humaner Gefühle handelten. Wie in dem Werwolf-Film von John Landis aus den Achtzigern. »Guter Punkt«, lenkte ich ein. »Weshalb …«
»Die Leute wissen nichts von uns und das soll auch so bleiben«, beantwortete er die Fragen, die mir bereits auf der Zunge lagen. »Sie sind nicht bereit für dieses Wissen. Wir haben keine Lust, uns wie die Hexen amtlich melden zu müssen, unter ständiger Beobachtung zu stehen und am Ende noch wissenschaftliche Experimente über uns ergehen lassen zu müssen.«
Ich schüttelte den Kopf. »So etwas wäre illegal und …« Im selben Moment bemerkte ich, wie naiv ich klang. »Vergiss es, ich denke, ich weiß, was du meinst.« Vermutlich sogar besser als jeder andere. Schließlich arbeitete ich an der Quelle. Nicht alles, was die Wissenschaftler am RIPA trieben, hieß ich gut. Auf der anderen Seite war vieles nützlich und sinnvoll. Es war, wie alles im Leben, ein zweischneidiges Schwert.
»Gibst du mir dein Wort, dass du dicht hältst?«, fragte er. Ohne ihn anzusehen, spürte ich seinen stechenden Blick förmlich auf mir. Wenn ich ihn anlog, würde er das merken, davon war ich überzeugt. Nicht, dass ich es vorhatte.
»Ich denke, was das betrifft, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Sonnenaufgang wird schon dafür sorgen, dass ich dicht halte.«
Er sah mich lange an, den Ausdruck auf seinen Zügen konnte ich im Dunkeln nicht deuten. »Nicht unbedingt«, sagte er schließlich, stand auf und hielt mir seine Hand entgegen. »Ich kenne jemanden, der dir möglicherweise helfen könnte, Ripper.«
»Ernsthaft?« Neue Hoffnung durchflutete mich und spülte die Taubheit fort. Ein gefährliches Gefühl, falls sich herausstellte, dass mir derjenige doch nicht würde helfen können. Ich hatte die fünf Phasen des Sterbens bereits durch und war bei der Akzeptanz angelangt. Seine Worte schleuderten mich unwillkürlich zur ersten Phase zurück. Unter Vorbehalt allerdings. Ich gehörte nicht gerade zur vertrauensseligen Sorte – aber erzählt das mal einem hoffenden Herzen. Nicht einmal mein rationaler Verstand konnte es völlig zum Verstummen bringen. Es war, als würde mein Herz bereits Konfetti werfend herumspringen, während mein Verstand vergeblich versuchte, es zu zügeln.
Fuck!
Ich rappelte mich auf und ergriff seine Hand. Trotz der Schutzkleidung war ich völlig durchgefroren. Die Kälte steckte mir tief in den Knochen und machte meine Bewegungen steif und unbeholfen. Während er mir auf die Füße half, lächelte er breit. Im ersten Moment wusste ich diesen Ausdruck nicht richtig einzuordnen. Dann sah ich, dass er auf meine Hand starrte und ich begriff. Statt sie ladylike in seine zu legen, hatte ich ihn wie ein Kerl am Unterarm gepackt und mich so von ihm hochziehen lassen. Es gab zwei Sorten Männer: Die, die sich über mein kumpelhaftes Verhalten amüsierten und letztlich daran gewöhnten, und die, die damit überhaupt nicht klar kamen und auf getrennte Geschlechterrollen beharrten. Ratet, wer sich früher oder später die Zähne an mir ausbiss.
»Frierst du nicht?«, fragte ich, als ich vor ihm stand. Mit einem Blick nahm ich noch einmal seine Statur auf und schätzte ihn doch eher auf eins fünfundachtzig, wenn nicht etwas größer. Für eine Frau war ich durchschnittlich groß und musste dennoch zu ihm aufschauen.
Er zwinkerte mir zu. »Nein, wir Werwölfe sind extrem heiß.«
»Und bescheiden offenbar auch«, erwiderte ich Augen rollend.
Er lachte leise und wir liefen gemeinsam los. Seine Nacktheit behandelte er so selbstverständlich, dass sie mich seltsamerweise nicht in Verlegenheit brachte. Aber – mal ehrlich – wo sollten die Klamotten auch herkommen? Und wäre er als Wolf in T-Shirt und Jeans herumgerannt, hätte das wohl ziemlich lächerlich ausgesehen. Auch solche Sprüche machten mir nichts aus. Zum einen brachte es der Job mit sich, dass man die meiste Zeit mit sich selbst geil findenden Egomanen abhing und zum anderen waren mir selbstbewusste Männer lieber, als die mit Komplexen. Letztere konnten sehr anstrengend werden, vor allem, wenn sie sich von mir in ihrer Männlichkeit herausgefordert fühlten.
Wir liefen ein Stück, bevor wir auf einer kleinen Lichtung einen alten Pick-up erreichten. Während der Werwolf eine Sporttasche von der Ladefläche herunternahm, aus der er dann ein Shirt und eine Sporthose herauszog, sah ich in den Sternenhimmel hinauf.
»Hast du eine Ahnung, wie spät es ist?«
Die Hose trug er bereits und zog sich nun das T-Shirt über den Kopf. Dann sah er ebenfalls hinauf. »Dem Stand des Mondes nach zu urteilen, würde ich schätzen, gegen vier Uhr morgens.«
Es war der 27. November, das hieß, Sonnenaufgang wäre in schätzungsweise drei bis vier Stunden. Hatte ich ein Glück, dass Winter war. Abgesehen davon fiel mir auf, dass kein Vollmond, sondern ein Halbmond am Himmel stand.
Nachdem wir eingestiegen und angeschnallt waren, fuhr er los.
»Ich lass den Motor erst ein bisschen warm laufen«, sagte er. »Aber es dauert sicher nicht lang, bis die Heizung anspringt.«
»Ich dachte, dir wäre nicht kalt.«
»Ist mir auch nicht. Aber du wirkst, als könntest du etwas Wärme vertragen. Deine Hand war vorhin eiskalt und auch sonst siehst du ziemlich durchgefroren aus.«
»Oh«, murmelte ich. So viel Rücksichtnahme war ich nicht gewohnt. Die Jungs in der Einheit behandelten mich immer wie einen von ihnen. Das hatte ich mir über Jahre hinweg erkämpft. Aber jetzt war ich dankbar, mit jemandem zu tun zu haben, der mich noch nicht so gut kannte. »Danke.«
Normalerweise stieg ich nicht zu Fremden ins Auto, schon gar nicht, wenn ich nicht wusste, wohin die Reise ging und ich keine Waffe am Körper trug. Die einzige Pistole, die ich bei mir gehabt hatte, lag verbuddelt im Wald. Doch aufgrund der besonderen Umstände konnte ich wohl eine Ausnahme machen. Ich hatte sowieso keine Wahl.
Nachdem wir aus dem Wald herausgefahren waren, gähnten uns menschenleere Straßen durch die Scheiben des Pick-ups entgegen. Mir war früher schon aufgefallen, dass die Zeit zwischen drei und vier Uhr morgens am ruhigsten zu sein schien. Bis circa zwei rennen noch Partygänger herum und ab fünf befinden sich die ersten wieder auf dem Weg zur Arbeit. Aber zwischen drei und vier Uhr schläft die Welt.
»Ich dachte, Werwölfe verwandeln sich nur zu Vollmond?«, fragte ich in die Stille hinein. Es war eine angenehme, friedliche Stille. Irgendwie hatte dieser Typ etwas an sich, das mir innere Ruhe gab.
»Das trifft hauptsächlich auf die jüngeren zu. Wir älteren Werwölfe können uns jederzeit verwandeln.« Er zuckte mit den Schultern. »Es erfordert ein bisschen Übung und wie du vorhin gesehen hast, ist jede Transformation mit Schmerzen verbunden. Wenn man jünger ist, sind sie stärker, daher vermeiden neu verwandelte Werwölfe es, solange der Vollmond sie nicht dazu zwingt.«
Ich löste meinen Blick von den Straßen und betrachtete sein Profil mit der geraden Nase und den schön geformten Lippen. Vor dem Seitenfenster zeichnete es sich wie eine dunkle Silhouette ab.
»Ältere Werwölfe«, wiederholte ich. »Wie alt bist du denn?«
Er lächelte und um seine Augen entstand wieder dieses Netz aus Fältchen. »Was glaubst du denn, wie alt ich bin?«
»Hm, so um die dreißig?«
»Gut geschätzt.« Er lachte. »Wenn du noch hundertsiebzig Jahre dazu rechnest, kommst du der Sache etwas näher.«
Jetzt war es an mir, zu lachen. Noch vor wenigen Stunden hätte ich nie gedacht, dass mir heute Nacht trotz allem noch mal danach zumute wäre. Doch der Werwolf neben mir blieb stockernst. »Das … das war doch ein Scherz, oder?«, fragte ich, um sicherzugehen.
Er schüttelte den Kopf. »Ich hatte dieses Jahr einen runden Geburtstag. Glatte zweihundert.«
Indem er auf den Parkplatz eines Krankenhauses einbog, lenkte er mich von weiteren Fragen ab. Der Kerl nahm mich hoch, eindeutig.
Hier war natürlich mehr los. Hinter vielen Fenstern – vor allem dort, wo sich die Gänge, Rezeptionen und Personalzimmer befinden mussten – brannte Licht. Vor dem Eingang standen zwei Frauen in weißen Kitteln und rauchten. Ich mochte keine Krankenhäuser. Zu viele schlechte Erinnerungen.
Der Werwolf fuhr um das Gebäude herum zu einem Hintereingang, wo weniger los war. Dort blieb er stehen und stellte den Motor ab.
»Bleib im Wagen, bin gleich zurück.« Er stieg aus und verschwand im Gebäude.
Ich stieß ein frustriertes Seufzen aus und schaute aus dem Fenster. Er hatte den Befehl mit solch einer Selbstverständlichkeit ausgesprochen, dass es mich glatt im Hintern juckte, aus Prinzip auszusteigen und neben dem Auto auf ihn zu warten. Aber erstens wäre das kindisch und zweitens tauten in der Wärme des Autos allmählich meine durchgefrorenen Gliedmaßen wieder auf, also blieb ich im Wagen.
Du wurdest verflucht.
Stille und Einsamkeit gaben mir Zeit zu grübeln und dieser Gedanke schlich sich zurück in meinen Kopf. Du wurdest verflucht. Du wirst sterben. Seltsam. Mir war klar, was diese Worte besagten, und doch begriff ich nicht, was sie für mich bedeuteten. Oder vielmehr wollte ich es nicht begreifen. Mein Hirn weigerte sich noch, sich damit auseinanderzusetzen. Verdrängung ist etwas Wunderbares.
Es dauerte nicht lang, bis er mit einer großen schwarzen Tasche herauskam, sie vorsichtig auf der Ladefläche verstaute und wieder einstieg.
»Was ist in der Tasche?«, fragte ich, sobald er losfuhr.
»Ein portabler Defibrillator mit EKG-Funktion. Nur für den Fall der Fälle. Ich hoffe, dass wir ihn nicht brauchen werden.«
»Ein was?«
»Ein Defibrillator. Das sind Geräte, die man bei Patienten mit Herzstillstand benutzt.« Nachdem ich ihn einen Moment lang überrascht von der Seite anstarrte, erklärte er, dass er in dem Krankenhaus als Notfallassistent arbeitete. »Das Gerät wurde ausrangiert, weil sich bei einem der Kabel die Ummantelung etwas gelöst hat, aber ansonsten funktioniert es einwandfrei. Niemand wird es vermissen. Im Handschuhfach liegt mein Handy. Gibst du es mir bitte heraus?«
Perplex öffnete ich das Handschuhfach und reichte ihm sein Handy, stellte aber keine weiteren Fragen. Wozu ihn unnötig kränken? Ein Werwolf, der als Notfallassistent arbeitet! Wie abstrus war das denn bitte? Das musste ich erst einmal verdauen. Ja, ich gebe es zu, ich hatte möglicherweise das eine oder andere Vorurteil. Verklagt mich!
Wen auch immer er versuchte zu erreichen, derjenige ging nicht dran. Erst nach dem circa zwanzigsten Klingeln schien jemand abzunehmen.
»Hey, Marcus. Ich bin’s. Entschuldige, dass ich dich geweckt habe.« Eine kurze Pause, in der vermutlich dieser Marcus sprach. »Ja, genau …«, fuhr der Rettungssanitäter-Werwolf fort. »Hör mal, ich habe hier einen kleinen Notfall und bin gerade auf dem Weg zu dir. Wir müssten in …«, er sah auf die Uhranzeige des Armaturenbretts, »… ungefähr zehn Minuten da sein. Machst du uns dann auf? Klasse, danke. Bis gleich.«
Nachdem er aufgelegt hatte, erklärte er mir knapp, dass Marcus sein hauseigener Hexer war, der den Fluch vielleicht entkräften könnte. Ich erfuhr, dass offenbar jedes seriöse Rudel einen der – politisch korrekt ausgedrückt – Magiebegabten beschäftigte. Um nach Vollmond hinter ihnen aufzuräumen, wenn sie über die Stränge schlugen. Kam wohl hin und wieder vor.
»Weshalb tust du das eigentlich?«, fragte ich. »Weshalb hilfst du mir?«
Er warf mir einen kurzen Seitenblick zu, bevor er sich wieder auf die Straße konzentrierte. »Ich habe dich gefunden und dadurch fällst du jetzt in meinen Verantwortungsbereich«, antwortete er. »Ich kann dich doch nicht einfach so sterben lassen.«
Damit schien für ihn alles erklärt.
Ein Werwolf mit Helferkomplex. Jetzt hatte ich alles gesehen.
Zwei
Ich saß in einem gemütlichen, ziemlich biederen Wohnzimmer auf einem mit dunkelgrünem, ausgefranstem Samt bezogenen Dreiersofa und wartete darauf, dass der Hexer und der Werwolf aus dem anderen Zimmer zurückkamen.
Die hölzernen Armlehnen waren nicht gepolstert, dafür befanden sich links und rechts längliche Kissen, auf die man die Arme abstützen konnte. Über der Rückenlehne lag eine weiße Spitzendecke ausgebreitet. Der Rest der Einrichtung bestand aus Holzmöbeln im Chippendale-Stil. Alt, filigran und mit vielen Verzierungen, wie Füße in der Form von Löwentatzen.
In einer Vitrine standen allerhand kitschige Figürchen. Staubfänger aus Kristall, Glas und Keramik. Ein großes Eckbücherregal voller alter Klassiker erstreckte sich über zwei Wände. Ich wusste das, weil ich mir die Buchrücken schon angesehen hatte. Neugierde – manche nannten es auch Herumschnüffeln – gehörte zu den Berufskrankheiten meines Jobs. Dort, wo die Wände nicht zugestellt waren, hingen zahlreiche Bilder. Stillleben in gedeckten, erdigen Tönen. Zur Einrichtung hätte gut ein muffeliger Geruch gepasst, eine Mischung aus Staub und Mottenkugeln etwa, stattdessen roch es hier sehr angenehm nach getrockneten Blumen und Patchouli-Räucherstäbchen.
Vor mir stand ein kleiner hölzerner Couchtisch, auf dem ebenfalls ein weißes Spitzendeckchen und akkurat angeordnete Zeitschriften ausgebreitet lagen, und gegenüber von mir befanden sich passend zum Sofa zwei Ohrensessel. Sogar eine antike Standuhr gab es.
Viel hatte ich von unserem Gastgeber bisher nicht mitbekommen. Ein Blick auf meine kugelsichere Weste, auf der fett das RIPA Emblem prangte, hatte genügt, um die Begrüßungs- und Vorstellungsphase deutlich abzukürzen. Im feinsten British English hatte er sich, kaum dass wir die Wohnung betreten hatten, entschuldigt und war mit dem Werwolf in ein anderes Zimmer gegangen. Dort diskutierten sie seitdem miteinander. Der Hexer hatte die Tür geschlossen, dennoch konnte ich durch die dünne Wand jedes Wort hören. Es ging hauptsächlich darum, was sich der Werwolf nur dabei gedacht hätte, mich hierherzuschleppen. Nachdem die magischen Überfälle durch den dunklen Clan losgegangen waren, hätten die Behörden den Hexer wegen seines Esoterik-Shops sowieso schon ins Visier genommen.
Ich hatte am Rande mitbekommen, dass derzeit verstärkt Kontrollen durchgeführt wurden, dabei handelte es sich aber eher um administrative Formalitäten, um die Menschen zu beruhigen und den Politikern das Gefühl zu geben, dass etwas gemacht wurde. Da wir den Clan jetzt ausgeräuchert hatten, würden die Kontrollen sicher wieder abnehmen.
Wie es der Hexer geschafft hatte, durch das Netz der großen DNA-Razzia vor zehn Jahren zu fallen, war mir allerdings ein Rätsel. Auf der anderen Seite interessierte es mich nicht wirklich. Ich war mit vierzehn schon gegen eine Meldepflicht von Magiebegabten, aber leider zu jung zum Wählen gewesen. Hätte vermutlich sowieso nichts gebracht. Das Gesetz wurde mit einer fünfundachtzigprozentigen Mehrheit beschlossen. Nach Werwolfgate herrschte eine verängstigte Grundstimmung unter den Menschen.
Die Standuhr schlug halb fünf morgens. Sie klang wie der Big Ben in London. Ob da jemand Heimweh hatte?
Seufzend fuhr ich mir mit den Fingern durch die Locken. Nicht mehr lang bis Sonnenaufgang …
Kurz überlegte ich, ob ich jemanden anrufen sollte, als mir bewusst wurde, dass es niemanden zum Anrufen gab. Ich war Single – das brachte der Job mit sich, zumindest kannte ich keinen Kämpfer, der in einer längerfristigen Beziehung steckte –, zu meinen Eltern hatte ich keinen Kontakt und Freunde, außer den einen oder anderen Kollegen, hatte ich auch nicht. Bis auf die Wohnung und ein paar Fische gab es eigentlich überhaupt nichts, das ich zurücklassen würde. Doch auch das war das typische Los von uns Kämpfern. Wir lebten für den Moment. Gezwungenermaßen.
Eigentlich ein ziemlich deprimierender Gedanke.
»Ich denke nicht, dass sie dich melden wird, Marcus«, hörte ich den Werwolf durch die Tür hindurch sagen.
»Sie ist eine RIPA-Agentin«, erwiderte der Hexer. Er sagte RIPA-Agentin statt ›Ripper‹. Interessant. »Und anhand von dem, was du mir erzählt hast, hat sie gerade fast einen kompletten Clan ausgelöscht und jetzt erwartest du von mir, dass ich ihr helfe? Was geht es mich an, ob sie verflucht wurde? Berufsrisiko, würde ich sagen. Das hat sie sich selbst zuzuschreiben.«
»So verbittert kenne ich dich gar nicht.«
»Wie würdest du dich denn fühlen, wenn sie gerade ein komplettes Rudel ausgelöscht hätte?«
»Wenn es sich um ein Rudel von Rogues gehandelt hätte, würde ich mich freuen, denn das hieße weniger Arbeit für uns. Dir war dieser Clan doch selbst ein Dorn im Auge. Erst vor wenigen Wochen hast du mir erzählt, wie sehr du dir gewünscht hast, dass irgendjemand etwas gegen ihn unternimmt. Er würde ein schlechtes Licht auf euch alle werfen und vor allem würden die, die sich zu ihrer Magiebegabung öffentlich bekannt haben, sehr unter der aktuellen Lage leiden.«
»Ja, schon, aber …«
»Die Ripper haben ihr Leben eingesetzt, so muss man das auch mal sehen. Das Mädchen hat ihren Hals riskiert, in gewisser Weise auch für dich, Marcus!«
Der Hexer seufzte lautstark. »Ja, James, ich weiß.«
Der Werwolf hieß also James.
»Trotzdem«, beharrte der Hexer. »Ich weiß ja noch nicht einmal genau, um was für einen Fluch es sich handelt. Wie soll ich bitte innerhalb der kurzen Zeit ein Gegenmittel finden?«
»Versuch’s doch wenigstens.«