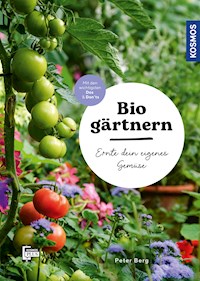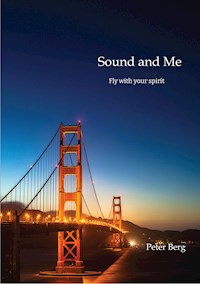9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lesen ist das neue Reisen
- Sprache: Deutsch
Kurz nach den erschreckenden Selbstmordattentaten in Jerusalem im März 1996 reist der Student Joachim nach Israel. Er will sich ein eigenes Bild von der Lage machen, aber er hat noch einen anderen Grund: seine Freundin hat ihn vor zwei Tagen verlassen. Im Flugzeug begegnet er der Palästinenserin Leila, die er gleich anziehend findet. Sie wollen sich wieder treffen, aber Leila wird seit der gemeinsamen Taxifahrt von niemandem mehr gesehen. Ihre Familie bittet Joachim um Hilfe, und er gerät in eine undurchsichtige Geschichte, die ihn tief in die israelisch-palästinensischen Konflikte hineinzieht. Gleichzeitig verliebt er sich in Naomi, die gerade ihren israelischen Wehrdienst absolviert. Sie führt ihn durch die Landschaften und historischen Ort Israels und zu ihrer Familie. Ihr Vater, ein einflussreicher Politiker, zieht hinter ihrem Rücken die Fäden, um sie auseinander zu bringen. Davon ist auch Leila betroffen. Joachims Reise ist eine Auseinandersetzung mit der Last der eigenen, deutschen Geschichte, mit Fragen zu seiner zerbrochenen Liebe und der Liebe überhaupt, Fragen nach der Möglichkeit von Verständigung und friedvollem Zusammenleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nur zwei Tage ist es her, seit Eva ihre Sachen abholte. Knall auf Fall hat sie mir eröffnet, dass sie Abstand braucht, mich unerträglich Mindet, ihr alles "zu eng" geworden ist. Ist es wirklich wahr? Kann eine Beziehung, die drei Jahre unseres Lebens prägte, so einfach vorbei sein? In letzter Zeit
hatten wir fast nur noch gestritten, doch es gab ebenso die Versöhnun- gen, die uns wieder nahe brachten.
Vor meinem inneren Auge die Bilder der Zerstörung: Zerfetzte Leiber auf der Straße, herumirrende Menschen, weinende Mütter, deren Kinder nie wiederkommen werden, hilKlose Hel- fer, sprachlose Polizisten, ein unglaub- liches Chaos. Die Reaktionen aufge- brachter Passanten, Buhrufe und PKif- fe beim Eintreffen des Premiers. In- nerhalb einer Stunde zwei Bomben- anschläge mit 27 Toten und 80 Ver- letzten.
Mein unruhiger Geist, eh schon auf- gewühlt, traf einen schnellen Ent- schluss. Seit Eva sich im vorigen Sommer über meinen Herzenswunsch hinwegsetzte, nach Israel zu reisen, war mir der Plan nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Die Anfrage beim Reisebüro war positiv, der Flug schnell gebucht.
Natürlich ist es eine Flucht, ein we- nig auch Trotz, aber ist Flucht nicht manchmal die bessere Realität?
Ich ertappe mich dabei, Konfuzius bis Seite zehn gelesen zu haben, ohne einen einzigen Gedanken wirklich wahrzunehmen. So sehr beschäftigen mich die Ereignisse der vergangenen Tage.
Inzwischen redet sich der jüngere der beiden Herren in Fahrt, regt sich über den Vorstand auf, der ältere stimmt ihm stets zu: "Ich glaube ich spinne, wir gehen mal wieder auf Kurs vorauseilender all durch. Es ist et- was "in Vergessenheit geraten", Be- richte und Kommentare spielen eine Rolle. Man wird "sich zusammenset- zen" und "am Montag sehen, wo die Fehler liegen". Dann spricht der Eiferer von "getürkten Zahlen". Die Statis- tik stimmt nicht, weil Zahlen einfach fortgeschrieben werden. Fehlerhafte Berechnungen und "Gemauschel im
Haus". Man geht deshalb von falschen Voraussetzungen aus. Der Jasager meint, genau das sei das Problem.
Die Schuldfrage wird eine Rolle spie- len. Sie spielt immer eine Rolle, vor allem wenn man nach Israel reist. Wir alle tragen unsere Schuldscheine in der Tasche, wollen es aber nicht wahrhaben.
"Das Gemauschel in den Konzernen wird von allen gedeckt, die Verluste vertuscht, beschönigt."
Alle haben Anteil an mieser Praxis.
Der Jasager stellt fest, nun müsse man los. Der Eiferer Mindet das schade. Marburg.
Was bringt einen deutschen Studen- ten dazu, ausgerechnet in Zeiten ver- schärften Bombenterrors nach Israel zu reisen? Was suche ich dort? Was hoffe ich zu Minden? Der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Neue Besatzung, Mitreisende sind uns gegeben, wir su- chen sie nicht aus, sie sind unser Schicksal. Ein älteres Paar nimmt die
Plätze der Konzernangestellten ein. Sie behält ihre Pelzkappe auf, ordnet i h m l i e b evo l l d e n S c h a l . E i n Taschenträger setzt sich vis-a-vis, zückt die Lesebrille, schlägt einen Rei- seprospekt auf: Träume. Alle drei ver- lassen mich so schnell, wie sie kamen, Gießen. Zwei junge Frauen ersetzen sie. Ich habe rechtzeitig das linke Bein großzügig über das rechte gelegt, ei- nem Speer gleich, der sich jedem ent- gegenstellt, der es wagen sollte, meine räumlichen Spielzonen einzuschrän- ken. Beide Frauen lesen: Träume von Liebesromanzen. Nasen werden ge- putzt, der Zug muss warten. Leicht schweben SchneeMlocken auf den Bahnsteig, bleiben dort liegen.
Ein eigenes Bild von den Ereignissen zu gewinnen, heißt für mich hinzufah- ren und Gespräche mit Betroffenen zu führen. Weil Eva das weiß, verspürt sie keinen Drang, wieder einmal einen Urlaub mit Recherchen zu füllen. Ein Jahr zuvor schon hatte ich ihr zugemutet, im ehemaligen Jugoslawien zerschossene Häuser aufzusuchen
und Zeitzeugen zu befragen, statt des versprochenen Strandurlaubs. Zuerst war sie widerstrebend mitgekommen, um dann nach acht Tagen wieder ab- zureisen. Resigniert hatte sie mich meinem "irren Hobby" allein überlas- sen. Mein unbändiger Drang nach dem Faktischen und der wirklichen Begegnung ist nicht so leicht mit den bodenständigen Idealen der ange- henden Lehrerin in Einklang zu brin- gen. Auch die Strapazen der bevorste- henden Staatsprüfung lagen Eva auf der Seele, aber kann das allein Grund sein, eine Liebe fortzuwerfen?
Der Zug fährt wieder. Meine Gedan- ken schweifen weit. Der Schaffner sor- tiert Zugestiegene von den schon län- ger Mitreisenden. Hätte ich die Kra- watten daheim lassen sollen? Es ist ein Tick: Ich Minde es schick, bei pas- sender Gelegenheit die passenden Hemden mit Jackett und Krawatte zu kombinieren. Eva fand das angenehm. "Ein perfekt gekleideter Mann ist sexy", höre ich sie lachen. Ich muss unwillkürlich an meine fast dreihundert Krawatten denken. Wohl fünfzig davon hat sie in den letzten Jahren bei den verschiedensten Anlässen hinzu- gefügt. Oft kam sie von einem Einkauf zurück und präsentierte stolz ein neues Stück.
Ein neuer Mensch kommt ins Abteil, schaut mich nicht an. Er stellt seine Tasche mir gegenüber ab und setzt sich daneben. Das erhält meine ge- wünschte Beinfreiheit. Eine der jun- gen Frauen beginnt zu husten und hört nicht wieder auf. Die andere greift verständnisvoll in die Tasche und reicht ihr ein Hustenbonbon. Mein Gegenüber liest das Boulevard- blatt: "Die toten Urlauber - wer hat sie auf dem Gewissen?" Wenige Tage zu- vor stürzte ein Flugzeug mit deut- schen Urlaubern in die Karibik. Jetzt geht es um die Schuldfrage. Manche befassen sich gern mit ihr, wenn sie nicht zu direkt gestellt wird, sozusa- gen nur hypothetisch. Dann ist sie erträglich, hat sogar einen Unterhal- tungswert. Viel ist nicht zu lesen dar- in, schnell ist er darüber hinweg. Nun
betrachtet er schon eine ganze Weile das Pin-up-girl, das nicht so recht in die Winterlandschaft passt. Wir nä- hern uns Frankfurt. Ich steige um.
Der Schnee schmilzt auf den Bahn- steigen außerhalb der Halle, noch be- vor er sie erreicht. Die Stadt strahlt eine unangenehm feuchte Wärme aus, die nach schlechter Luft riecht. Jedes Mal hier packt mich Beklemmung, die Hektik, die raschen Wechsel, die plötzliche Nähe der vielen Menschen. Eine junge Frau mit Kopftuch, viel- leicht Zigeunerin oder Eritreerin, Bosnierin, beschleunigt auf dem Querbahnsteig neben mir ihren Schritt, während ich mich mit dem Koffer abmühe, hält mir einen hand- schriftlichen Zettel vor, Mleht mehr- fach: "Bitte!" - Ich bin in Eile, mein Zug fährt in zwei Minuten, schaue nicht sie und nicht den Zettel an, sage gereizt: "Nein danke!" - Im Augenwinkel sehe ich ihre dunkle Haut am schlanken Handgelenk. Sie dreht ab, um ihren Zettel einem anderen Reisenden hinzuhalten, der mehr Entgegenkommen zeigt.
Im Weitergehen trifft mich ein Zwei- fel: Bin ich ganz entgegen meiner UVberzeugung doch Rassist? Hätte ich bei aller Zeitknappheit eine hellhäuti- ge Blonde angehört? Kurz darauf tatsächlich Augenkontakt mit einer jun- gen Reisenden, wohlgekleidet, ein klares "Entschuldigung" meinerseits, da meine Tasche im Vorübergehen die ihre streifte, ein ebenso deutliches "Bitte", verbunden mit einem Lächeln zurück.
Szenenwechsel. Jetzt im bequemen Intercity: "In wenigen Minuten errei- chen Sie Frankfurt-Airport." Der Bord- Service geht um und teilt Angebots- zettel aus: Bockwurst 4,20 DM, Sand- wich 5,20 DM, Baguette 5,40 DM, Kaf- fee, Tee, Limo. Ich sitze im Raucherab- teil, bemerke meinen Irrtum und wechsele einige Reihen nach vorn.
Zwei Reihen weiter, schräg gegen- über, sitzt eine schöne Frau mit leicht
orientalischen Gesichtszügen in mei- ner Blickrichtung. Sie hat ungefähr mein Alter, Ende zwanzig, ist schlank, ganz in Schwarz gekleidet, das schul- terlange Haar exakt gewellt. Sie liest in einem Journal, die Beine lässig auf der Sitzbank nebenan. Eben noch hat sie sich zur Gepäckablage emporge- reckt, um Aktenkoffer, Tasche, Mantel und Hut hinaufzulegen. Dabei hat sie meine Aufmerksamkeit erregt: Das aparte Gesicht mit leichtem Rouge, die weiblichen Konturen unter dem Woll- pulli. Als sie sich setzt, treffen sich unsere Augen kurz, sie lächelt - fast un- merklich, aber doch. Erste Augenkon- takte entscheiden die Sympathiefrage, kurze Blicke sind besonders gefähr- lich, sortieren, machen zum Jemand oder zum Niemand.
Es gibt in unserer satten Gesellschaft Tausende, die gar nicht wahrgenom- men werden. Für viele Menschen ist es Gewohnheit, ein Niemand zu sein. Der Zugkellner kommt, die Frau be- stellt einen Kaffee. Was wäre, wenn sie jetzt feststellte, ihre Geldbörse verloren zu haben? Gern würde ich ihr aushelfen, großzügig, generös, spen- dabel, multikulturell! Dabei ist sie ge- nauso fremd wie die Bettlerin vor wenigen Minuten auf dem Bahnsteig! Sie zahlt, wechselt mit dem Kellner ein paar Worte. Dann lächelt sie mir noch einmal zu, jetzt deutlich, ich lächle zurück. Die Fluggäste rüsten sich zum Ausstieg.
Zwei
Sie ist ungewöhnlich klein, fast wie ein Kind. Ich bemerke es, als sie nach zwei Stunden den schmalen Gang zwischen den Sitzreihen des Airbus entlang zur Toilette geht. Erst jetzt sehe ich, dass ihr Körper eine bucklige Last trägt. Zielstrebig hatte die Alte den Gangplatz neben mir belegt, eine VielMliegerin, die keine Mühe mit der Orientierung kennt. Spontan war ich aufgestanden und hatte ihren Bordca- se ins Mantelfach gehoben. Man weiß, was sich gehört. Sie dankte höMlich und generös, so als habe sie es erwar- tet. Ein kleines Lächeln, welches die Augen noch nicht trifft.
Die Sicherheitsabfertigung zuvor war extrem sorgfältig. Flüge nach Is- rael stehen unter besonderem Au- genmerk. Fast immer muss das Ge- päck geöffnet, der Inhalt herausge- nommen werden. Heute wollten sie es
besonders genau wissen: Meine Ka- mera, in der sich glücklicherweise noch kein Film befand, musste geöff- net, mein Haarföhn aus der Verpa- ckung genommen werden. Sicherheit hat ihren Preis, und wenn man es nicht persönlich nimmt, kann eine solche Untersuchung, bei allen Flug- gästen in gleicher Weise durchgeführt, ungeheuer beruhigend wirken. Es folgte die Leibesvisitation, ein vor- sichtiges Abtasten der Kleidung durch eine darauf spezialisierte Sicherheits- kraft, und dann endlich die Abgabe des Koffers und die Ausgabe der Platzkarte.
Da noch etwas Zeit blieb, bat ich eine ältere Frau, kurz auf mein Hand- gepäck zu achten, und ging noch ein- mal durch die Sperren zurück, um ei- nige Filme zu kaufen. Das geMiel den Sicherheitsbeamten überhaupt nicht. Als Strafe musste ich erneut anstehen und auch den Bodycheck ein zweites Mal über mich ergehen lassen. So kam ich gerade noch rechtzeitig zur 'Last Boarding Time'.
Sarah. So soll sie heißen. Ohne Um- schweife beginnt sie einen Monolog. Sie teilt mir mit, sie sei nun zehn Stunden unterwegs seit New York, sei hier nur umgestiegen und habe seit gestern früh keinen Schlaf gehabt. Sie spricht ein Mließendes Amerikanisch, ich bin erstaunt, sie so mühelos zu verstehen. Auf ihre Mitteilungen reagiere ich mit nicht zu aufmerksamem Nicken, derweil wird der obligate Film über Sicherheitsmaßnahmen abge- spult: Benutzung der Sauerstoffmas- ken und der UVberlebenswesten.
Beim Einsteigen habe ich mir von einer freundlichen Stewardess Lese- stoff geben lassen. Dem möchte ich mich nun widmen. Die Maschine rollt in Startposition. Ein kurzer Halt nur, dann das AuMheulen der Antriebe, ein schneller Sprint, und der Airbus hebt ab. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
"It's over" prangt auf dem Cover des neuesten
TIME-Magazins. Dazu ein Porträtfoto der gekrönten Diana. Daneben die
NEWSWEEK mit einer Variation zum selben Thema: Diesmal eine unge- krönte aber sichtlich angerührte Di. Und die Schlagzeile "Royal Split". Das eine Heft trägt den Untertitel "Diana and Charles are history, but a battle royal looms over her future", das an- dere nicht weniger geistreich "Diana Mights for her kids, her title and her future".
Kann Trennung, wenn sie denn voll- zogen ist, nicht auch eine Chance be- deuten?
Trennungen von Regentenpaaren werden stellvertretend vollzogen. Auch die deutschsprachige Presse greift gern danach. Der STERN, den ich, maßlos wie oft, noch zusätzlich ergriff, bietet das Pendant. Auf dem Titel ein zwischen den Personen zer- rissenes Foto des Niedersächsischen Regentenpaares aus besseren Zeiten. Darauf prangen Lettern: "Die Tren- nung - Das bittere Ende eines Traum- paares". Ich beginne meine Lektüre natürlich mit Hillu und Gerhard.
Doch ich komme nicht weit, denn ich gleite sogleich in jenen Bereich der Gedanken, der meiner eigenen Ge- mütslage entspricht. Ist wirklich die Trennung vollzogen, wenn Fakten ge- schaffen wurden? Was ist mit den un- sichtbaren Banden, die über Jahre gewachsen sind? Ein geräuschvoller Auszug, eine Flugreise, was mögen sie bewirken, wenn unsere Seele zurück- bliebe?
"Where are you from?" Ich höre sie wie durch eine Wand. Sie muss es schon einmal gefragt haben, denn sie zieht ihre dünnen, nachgezeichneten Augenbrauen über den Rand ihrer goldgefassten Brille. Und während die Flugbegleiter ein warmes Mittags- mahl in Alufolie austeilen, bin ich schon ihr Gefangener.
Aus New York stammt sie. Jetzt ist sie mit ihrer Nichte und deren Ehe- mann erstmals in ihrem Leben auf dem Weg nach Israel. Die dezent ge- kleidete alte Dame teilt sich in wohl- gesetzten Worten mit. Doch sie
spricht etwas zu leise. Das hat zur Folge, dass ich wegen der übertönen- den Fluggeräusche immer wieder nachfragen muss. Sie hingegen inter- pretiert das als gesteigertes Interesse meinerseits: Ihr Mann ist vor vielen Jahren aus Dänemark kommend in Amerika eingewandert. Nur einen Tag haben sie sich gekannt und dann gewusst, dass sie heiraten werden! Ihre Familie ist jüdisch, die Eltern waren streng gläubig. “Wir Juden haben feste Lebensregeln“, erklärt sie mir, „es sind Gebote, die uns von Gott gegeben wurden.“
Schlagartig ist mein Interesse ge- weckt: Bahnt sich hier die erste be- deutsame Begegnung dieser Reise an, Seite an Seite mit dem Weltjudentum?
Hillu und Gerhard können warten.
Einen Früchtegroßhandel haben sie in Florida gegründet. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Filialen dar- aus. Sie haben gutes Geld damit ver- dient. Die großvolumigen Goldringe
an ihren Fingern, das diamantbesetzte Pillendöschen, aus dem sie ihre "vit- amines" nach dem nur halb probier- ten SchellMisch auf Rosinenreis ent- nimmt, bezeugen das. Nun ist der Gat- te seit acht Jahren tot. Doch meine Nachbarin, ich nenne sie Sarah, ist überzeugt: Er weilt noch bei ihr, ist auch hier im Flugzeug! Und über- haupt glaubt sie an Reinkarnation und darüber hinaus an "Synchronicity". Diesen Begriff erklärt sie mir am Bei- spiel ihrer Ehe: Wenn der Richtige kommt, ist es klar, dass man die UVbereinstimmung wahrnimmt und sie ak- zeptiert. Keinen einzigen Gedanken an einen anderen Mann hat sie in ihrem ganzen Leben verschwendet. Zur Ver- tiefung empMiehlt mir Sarah den Autor Deepak Chopra, dessen Namen sie mir zur Mitschrift buchstabiert. Deepak Chopra hat ihr auch zu dem Weltverständnis verholfen, welches sie ohne jegliche Angst vor Bomben- terror nach Israel reisen lässt, sogar in dieser verschärften Lage, in der täglich wieder mit neuen Attentaten zu rechnen ist. Meine Frage, ob die
jüngsten palästinensischen Selbst- mordanschläge sie denn nicht beun- ruhigen, belustigt sie sichtbar.
Als Sarah erfährt, dass ich Student bin, möchte sie wissen, was ich denn in Israel zu studieren gedächte. Mit meiner Antwort "politics" kann sie überhaupt nichts anfangen. Durch ge- zieltes Nachfragen nötigt sie mich, in das Gespräch mit ihr einzusteigen. Die alte Frau weiß sehr wohl, dass es für junge Deutsche der nachwachsenden Generationen auch um die Bearbei- tung des Holocaust gehen muss. Von dem millionenfachen Judenmord in der Zeit des Nationalsozialismus will sie von mir selbst hören, will mir ge- rade dabei nichts schenken, nichts er- sparen.
Zuerst spreche ich von der "actual political situation" heute in Israel. Das interessiert sie jedoch nicht sonder- lich. Da gibt es für sie nichts zu deu- teln: Dass man sich für die Palästinen- ser interessieren könnte, ist für die amerikanische Jüdin völlig abwegig.
Allerdings: "Die Araber sind auch se- mitischen Ursprungs", meint sie, "in- sofern sind sie eigentlich unsere Brü- der".
Unumwunden erklärt Sarah, dass man viel Geld an diesen Staat Israel von Seiten der amerikanischen Juden zahle. Man müsse ihn am Leben erhal- ten, koste es, was es wolle. Man wisse aber auch, dass ein Jude in etwaiger Verfolgung dort immer einen gesi- cherten Unterschlupf Minden würde. Niemals dürfe sich wiederholen, was während der Zeit des Naziregimes passierte, dass Juden ausweglos in die Vernichtung gingen. Dann äußert sie als Gipfel der Versuchung: "Vielleicht musste es geschehen, damit der Staat Israel gegründet wird?"
Mit sichtlichem Wohlwollen reagiert sie auf mein ehrliches Bekenntnis, dass der Mord an Millionen Juden in Deutschland ein ungeheures Verbre- chen ist, welches eine nicht gutzuma- chende Schuld auf die Deutschen ge- laden hat. Es veranlasst sie ihrerseits zu betonen, dass mich als viel Jüngeren, der die damalige Zeit nicht miter- lebt hat, natürlich keine persönliche Schuld treffe: "You're a baby!" Wie schmeichelhaft!
Offen fragt sie mich, welche Gründe Adolf Hitler wohl gehabt habe für sei- ne rassistische Politik. Und zur Veran- schaulichung des Widersinns fügt sie hinzu, dass die deutschen Juden sich immer zuerst als Deutsche gefühlt haben: "Die deutschen Juden haben wertvolle philosophische Beiträge zur abendländischen Kultur erbracht. Sie waren wegen ihres Wohlstandes und EinMlusses auch ein enormer wirt- schaftlicher Faktor."
Meine Antwort, ein totalitärer Staat habe sich schon immer Sündenböcke als sichtbare Feinde suchen müssen, will Sarah als psychologisch gefärbte Begründung wohl gelten lassen, aber sie reicht ihr nicht aus. Meine weiterführende UVberlegung jedoch, eine im Christentum verankerte Wur- zel für die Denkweise, die zur Kata- strophe führte, könne eine Rolle gespielt haben, weist sie entschieden zurück: "Nein, die Juden waren nicht die Mörder von Jesus Christus! Jesus war selbst Jude, er war ein Rebell!" Ich kann dem nichts entgegnen.
Als ich nach zwei Stunden zum Waschraum gehe, treffe ich voller Verwunderung eine Bekannte: Die Orientalin aus dem Intercity lächelt mich an und nickt mir freundlich zu. Sie sitzt zwei Reihen schräg hinter mir. Mit der gleichen Offenheit erwi- dere ich ihren Blick. Wie kommt sie hierher, und warum habe ich sie nicht im Warteraum oder beim Einsteigen gesehen?
Ich bin verwirrt und erfreut zu- gleich.
Auf meinem Platz zurück erwartet mich Sarah mit einem weiteren The- ma. Auch das Problem der Einwande- rung soll zur ersten Lektion dieser Reise gehören. Aber ich bin jetzt abge- lenkt. Mein Interesse gilt der jungen
Frau hinter mir, deren Blicke ich nun spüre.
"First of all immigration is a pro- blem of language", belehrt mich meine erfahrene Reisebegleiterin. Sie plap- pert weiter munter drauMlos, ist nicht mehr abzustellen. Amerika sei schon immer ein "melting pot" der verschie- densten Rassen und Nationen gewe- sen. Doch komme es nicht darauf, sondern in erster Linie auf die Sprache an. Heute kämen viele Mexikaner über die amerikanische Grenze, viel- fach illegal. Dagegen habe sie nichts einzuwenden, nein, überhaupt nicht. Amerika sei ein großes Land mit vie- len Möglichkeiten, wenn die Einwan- derer bereit wären, die englische Sprache zu lernen, sei dies "o.k." Viele verweigerten dieses jedoch aus Be- quemlichkeit, würden mehr und mehr unter Ghettobedingungen leben wol- len. Ihre eigene Putzfrau sei auch von dieser Sorte. Die Vorteile wolle man in Anspruch nehmen, sich aber nicht richtig in die Gesellschaft integrieren. Sprache sei, so wiederholt sie sich
nachdrücklich, nun mal das zentrale Verbindungselement.
Die wohl schon an die achtzig Jahre zählende Geschäftsfrau entwickelt bei diesem Thema erstaunliche Energien. Sie selbst habe jüngst erst Unter- schriften gesammelt für ein Gesetz, das in Amerika längst überfällig sei: "Wir brauchen eine nationale Vorgabe, die verbindlich regelt, dass Eng- lisch die Landessprache in Amerika ist." Leider sei das aber bis heute nicht durchzusetzen, da Abgeordnete im- mer zuerst an die Wählerstimmen dächten, und auch die Zuwanderer schließlich das Wahlrecht hätten. In Israel sei dieses Problem gelöst. Hebräisch sei verbindliche Landes- sprache für alle Immigranten, eine Sprache, die nationale Identität schaf- fe.
Beim LandeanMlug auf Tel Aviv be- merke ich, dass die Zeit mit Sarah im Gespräch wie im Flug verging. Ich fra- ge sie, ob sie schon einmal in Deutsch- land war. Sie schaut mich entgeistert
an und verstummt einen Moment. Dann erklärt sie, nie im Leben würde sie in dieses Land reisen! Sie selbst hätte vielleicht schon ein Interesse, nein, so sei das ja nicht, aber wegen ihrer amerikanischen Freunde könne sie unmöglich je nach Deutschland Mliegen. Diesen Gruppenzwang gesteht sie stolz ein: In dieses Land reist man nicht!
Für mich ist das eine völlig neue Sichtweise und Erfahrung. Nach unse- rem Holocaustgespräch frage ich nicht nach einer Begründung.
Zum Abschied sage ich der Alten, dass sie eine bemerkenswerte Frau sei, und bedanke mich für das gute und lehrreiche Gespräch. Ersteres weist sie zurück, zu Letzterem be- merkt sie, dass ein Gespräch immer zweiseitig sei und auch sie daraus ge- lernt habe. Was sie damit meinte, er- fahre ich nicht. Nach der freundlichen Verabschiedung im Flugzeug blickt sie mich später im Flughafen und in der Warteschlange beim Zoll nicht mehr an, - mag sein wegen ihrer Müdigkeit,
vielleicht auch wegen der Kurzsich- tigkeit, oder aber auch nur gedanken- verloren. Ich nehme mir vor, Deepak Chopra zu lesen.
Drei
"The fact is, that mistakes happen!"
Lacht sie mich an oder aus, oder beides? Vor mir steht die Fee aus Tau- sendundeine Nacht, freut sich offen- sichtlich, mich noch immer in der Bannmeile des Flughafens anzutreffen und gibt mir kopfschüttelnd zu ver- stehen, dass ich an der falschen Bushaltestelle warte, während an der richtigen gerade der Bus nach Jerusa- lem abgefahren sei.
"Komm, wir nehmen ein Sammelta- xi", schlägt meine schöne Zugbe- kanntschaft in bestem Deutsch vor. Es ist mir so, als würden wir uns schon lange kennen. Ohne eine Antwort ab- zuwarten, winkt sie mit routinierter Geste einen der Großraumwagen her- an. Der Fahrer, ein alter Mann, ver- staut unser Gepäck, klemmt sich hin- ter das Lenkrad und beginnt um- ständlich am Taxameter zu hantieren.
Die junge Frau nennt ihm Jerusalem als Fahrziel und fügt schnell den Fahrpreis, den sie zu zahlen bereit ist, hinzu, worauf er die Vorstellung auf- gibt, ein Extrageld zu verdienen, das Gerät wieder abstellt und leise mur- rend losfährt.
"Was führt dich her in dieser Zeit?", ergreift sie erneut die Initiative, "für Tourismus gibt es angenehmere Ziele." Die Anspielung gilt den terro- ristischen Selbstmordanschlägen, die an zwei Sonntagen in Folge die Auf- merksamkeit der Welt auf Israel rich- teten. Ihre Augen blicken fragend, während sie sich mit der Linken leicht durchs Haar fährt.
"Gewiss", entgegne ich, "um uns kennenzulernen, hätten wir uns den Flug ersparen können."
"Das ist doch ein kleiner Unter- schied", widerspricht sie, und ihre Augen funkeln. "Du kommst in ein Land, das sich im Krieg beMindet, ich kehre zurück in meine Heimat."
"Wieso sprichst du so gut Deutsch, und wie bist du vorhin in die Maschi- ne gekommen?"
"Du bist ja gar nicht neugierig! Stellst du immer zwei Fragen auf ein- mal?" kontert sie und gibt so keine Antwort.
"Entschuldige, ich sollte mich erst- mal vorstellen", beginne ich erneut: "Joachim, Student aus Göttingen."
"Du studierst bestimmt Geisteswis- senschaften", lächelt sie in mir nun schon vertrauter Weise.
"Politik und etwas Psychologie. Wie kommst du darauf?"
"Auf mich wirkst du wie ein freund- licher Frühlingstag. Du sprichst mit den Augen und beschäftigst die Men- schen mit schlauen Fragen.“
Aha, sie hatte wohl im Flugzeug von ihrem Platz aus mein Gespräch mit Sarah belauscht, vielleicht sogar Ein- zelheiten mitbekommen.
"Mein Name ist Leila", fährt sie fort, da ich sie nur erstaunt anschaue. "Auch ich studiere in Deutschland. Ich bereite mich auf die Promotion vor.
Zuerst war ich an der Uni in Bir Zeit, dann in Hamburg."
"Danach zu beurteilen, wie genau du beobachtest, tippe ich bei dir auf ein naturwissenschaftliches Fach."
"Oh, du erstaunst mich", ihre Augen weiten sich einen Moment, während sie nachdenklich mit dem rechten ZeigeMinger an der Nase entlang streicht. Dann fasst sie sich schnell wieder, richtet ihren Oberkörper im Sitz auf, so als wolle sie ein unange- nehmes Thema verlassen und fügt hinzu: "Ich bin Biologin. Du hast Recht, alles Natürliche ist mir nicht fremd. Im UVbrigen hat man mich in Frankfurt sehr ausführlich, … wie sagt man, …geMilzt. Erst im letzten Moment konnte ich die Maschine besteigen."
"Werden Israelis denn gründlicher geMilzt als Deutsche?" wundere ich mich, schaue dabei wohl etwas naiv drein.
"Ach, du hältst mich für eine Israe- lin? Wie schön, dann wirst du gleich erschrecken, wenn du erfährst, dass du seit heute Vormittag einer Palästi- nenserin schöne Augen machst. Aber
ich muss dich enttäuschen, ich beiße trotzdem nicht!"
In der Tat bin ich überrascht. Ich fühle mich zugleich durchschaut. Die jahrzehntelange, israeltreue Informa- tionspolitik der deutschen Medien hinterlässt Spuren in Form von Vorur- teilen in unseren Köpfen. Leila schaut mich ein wenig trotzig, ein wenig fra- gend von der Seite an. In Deutschland lebend gehört diese Erfahrung zu ih- rem Alltag. Man gibt sich daher lieber als AVgypterin, Jordanierin und so wei- ter aus. Deutsche stellen sich unter dem Stichwort Palästinenser in der Regel kaum eine europäisch gekleide- te junge Frau mit Charme und Geist vor.
"Es wird wohl noch eine Weile dau- ern, bis sich die Verhältnisse auch für uns Palästinenser bei der Einreise normalisieren. Jedes Mal nehmen sie mein Gepäck bis in alle Einzelteile auseinander. Sie haben Angst vor Sprengstoff. Deshalb befühlen sie so- gar die Schmutzwäsche. Heute habe
ich die Frau bei der Einreise gefragt, ob sie wirklich überzeugt ist von dem, was sie da macht. Sie hat mich ange- sehen und gesagt: Don't force me to do something against you! Ich bin froh, jetzt endlich einen eigenen pa- lästinensischen Pass zu haben. Vor dem Oslo-Abkommen war die Proze- dur noch schwieriger."
Während sie spricht, benutzt sie beide Hände zur Untermalung des Ge- sagten. Eine Haarlocke, die ihr über die Wange rutscht, wischt sie leicht fort. Dann stockt ihr RedeMluss plötz- lich, und ihr Blick verliert sich für ei- nen Augenblick in der Ferne, so als suche sie etwas am Horizont. Auf ih- rer Seele lastet wohl mehr, als sie zu berichten bereit ist.
"Arme Leila", sage ich sanft und be- rühre sie leicht am Arm, "kann ich dir helfen?" Einen Moment scheint es mir, als wolle sie ihren Kopf an meine Schulter legen, aber sie fängt sich schnell wieder und sagt:
"Wir sind jetzt in einer neuen Zeit und alles wird besser werden. Doch helfen können wir uns nur selbst."
"Wohin fährst du jetzt, können wir uns in den nächsten Tagen sehen?"
Ich bin nicht bereit, sie so schnell verschwinden zu lassen, wie sie in mein Leben trat.
"Ich werde meine Familie besuchen, in der Nähe von Ramallah. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder, aber mach dir keine falschen Hoffnungen. Mein Leben ist komplizierter, als du dir vorstellen kannst. Es ist besser, du fragst nicht zu viel."
Der Taxifahrer schaut kaum merk- lich in den Rückspiegel, wohl nur, weil ein großer Wagen amerikanischen Fabrikats zum UVberholen ansetzt. Den Ben Gurion Airport haben wir längst hinter uns gelassen, der zähe Groß- stadtverkehr löst sich allmählich auf. Die Autobahn windet sich nun in die judäischen Berge, unser Chauffeur tritt aufs Gaspedal. Ich möchte mehr erfahren über die Situation im West-
jordanland, der Heimat der Palästi- nenser, und frage daher direkter:
"Wie stehst du zu den schrecklichen Selbstmordattentaten auf unschuldige Menschen? Du kannst sie doch un- möglich gut Minden?"
Ein seltsames Lächeln spielt um ih- ren schönen Mund. Sie zieht die Lip- pen zusammen, und es scheint für ei- nen Moment, als forme sie eine Kuss- Schnute, dann antwortet sie überlegt:
"Terror ist nicht neu in dieser Welt- gegend. Wir leben seit Jahren damit. Doch das, was jetzt Terror genannt wird, drückt etwas aus. Unsere Jugend steht heute mehr denn je unter Druck. Sie haben gekämpft und fragen sich nun, wofür."
"Aber Gewalt ist kein legitimes Mittel der Politik", wende ich sofort ein.
"Gewalt ist eine tägliche Realität in unserem Land. Hier geht es auch nicht um Politik. Hier Mindet Krieg statt."
"Diejenigen, die sich selbst in die Luft sprengen, tun alles, um den Frie- den zu verhindern!" gebe ich zurück.
"Was ist das für ein Frieden, der den einen alles gibt und den anderen alles nimmt?"
Ich spüre, dass ich noch zu wenig weiß, um mir ein Urteil erlauben zu können, daher schweige ich.
Aber Leila fährt fort:
"In Palästina werden nach wie vor junge Menschen abgeholt und gefol- tert. Die Brutalität der Besatzer geht weiter! Dabei haben wir so gehofft, der Frieden würde unsere Lage ver- bessern. Aber es gibt überall Sperren. Wenn ich nachher zu meinen Eltern fahre, muss ich mindestens fünf Kon- trollen passieren. Das Land ist wie ein Schweizer Käse, in A-, B- und C-Gebie- te eingeteilt. Es gibt die A-Gebiete, Großstädte, die schon eine Teilauto- nomie haben, die B-Gebiete, ländliche Bereiche, in denen die Zivilverwaltung bei uns liegt, die Kontrolle aber bei den Israelis, und die C-Gebiete, die noch ganz von den Israelis beherrscht werden. Nach wie vor ist das ganze Land israelisch dominiert, und sie
können jederzeit die Zugänge abrie- geln."
"Kannst du denn nicht verstehen, dass ein Staat sich gegen Terroratta- cken, die in nur vier Wochen sechzig arglose Zivilisten töteten und viele andere verletzten, schützen muss?" greife ich noch einmal meine Frage auf.
"Natürlich haben wir Terroristen, Radikale. Die haben die Israelis aber auch! Wie du sicher weißt, war der Mörder von Rabin ein Israeli. Es wird immer Radikale geben, die mit dem Frieden nicht einverstanden sind, weil sie alles haben wollen und nicht kompromissbereit sind. Wenn aber zwei, drei Attentate genügen, um die Ver- träge ungeschehen zu machen, dann ist es mit der Friedensfähigkeit nicht so weit her. Sie strafen unser Volk kollektiv. Ich klage deshalb die Unfähig- keit zu differenzieren an."
Leila spricht mit Leidenschaft in der Stimme und wird beständig lauter.
Der Taxifahrer schaut wieder in den Spiegel.
"Die Mehrheit meines Volkes be- grüßt den Friedensprozess. Aber es ist schwer für die jungen Leute, so schnell umzuschalten. Wir sind in der Intifada, dem Aufstand gegen die Besatzungsmacht, aufgewachsen. Die Jugendlichen und die jungen Erwach- senen haben den Hass gegen die Is- raelis mit der Muttermilch eingesaugt. Wenn es nicht möglich sein wird, die Dinge gerade jetzt, wo es um einen wirklichen Frieden gehen soll, mit kühlem Kopf zu sehen, wird es noch lange kein Leben in Frieden geben."
Während dieser Mlammenden Rede blitzen Leilas Augen wie Feuer, ihre Wangen erröten. In ihrem letzten Satz jedoch schwingt Schwermut mit, und sie fügt nach einer Weile hinzu: "Die Ereignisse der letzten Wochen habe ich als lähmend empfunden. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht und was mich zuhause erwartet."
Eine ganze Weile sitzen wir stumm nebeneinander.
Draußen beginnt es zu dämmern. Die meisten Wagen haben schon die Scheinwerfer eingeschaltet. Mir scheint, Leila hat sich mit ihren Wor- ten weiter vorgewagt, als es einem Fremden gegenüber eigentlich ange- messen ist. Sie hat mich ins Vertrauen gezogen, obwohl, ich spüre es deut- lich, ein Geheimnis in ihren Augen liegt, das zu lüften mir heute nicht ge- lingt, wenn es überhaupt je möglich sein wird, darüber zu sprechen.
Wir nähern uns Jerusalem. Linker- hand tauchen bereits die zahlreichen Wohnburgen auf, tausende von neuen Heimstätten für jüdische Immigran- ten, Lebensraum im Westjordanland. Hier werden Fakten geschaffen, un- umkehrbar, eine künftige, friedliche Lösung der Siedlungsfrage erschwe- rend.
"Wo wirst du wohnen?" fragt Leila nun in die Stille hinein.
"Im OVsterreichischen Hospiz."
"Das liegt in der Altstadt, unweit vom Löwentor", erklärt sie, "ich wer- de den Fahrer anweisen, am Tor zu halten."
"Werden wir uns wiedersehen?" versuche ich es erneut.
"Das wird sich zeigen, lieber Freund", entgegnet sie mit pessimisti- schem Unterton, "ich habe zuerst et- was zu regeln. Dann weiß ich auch noch nicht, wie die Lage sein wird, ob ich aus dem autonomen Gebiet wieder herauskomme. Aber wenn alles so läuft, wie ich es möchte, komme ich dich in spätestens drei Tagen besuchen. Dann zeige ich dir ein paar ara- bische Lokale in der Altstadt. Abge- macht?" Sie lächelt und versucht da- bei, optimistisch zu klingen. Ich kann nicht widersprechen, doch fürchte ich, dass alles ganz anders kommen wird.
Am Stephanstor, auch Löwentor ge- nannt, im Ostteil der Jerusalemer Alt- stadt, hält unser Wagen an. Leila ver- weigert beharrlich, meinen Anteil an den pauschalen Fahrkosten anzunehmen. Sie weist mir den Weg: "Immer geradeaus bis zur nächsten Quer- straße, dann kannst du deine Herber- ge rechts an der Ecke nicht verfehlen."
Wir drücken zum Abschied wie gute Bekannte Wange an Wange. Ich fasse dabei ihre Hand, die einen Moment lang warm in der meinen liegt, strei- che ihr die Haarlocke aus der Stirn, schaue noch einmal tief in die schwarzen Augen, sehe die Sterne und steige schnell aus, bevor es zu schwer wird. Der Fahrer reicht mir meinen Koffer, ich winke kurz hinter dem Wa- gen her, bevor er in die Straße ein- biegt und meinem Blick entschwindet. Einen Moment stehe ich noch gedan- kenverloren auf dem Platz vor dem Tor, bis mich ein kleiner arabischer Junge wegen eines Almosens antippt, beachte ihn nicht, nehme vielmehr meinen Koffer auf und gehe den Weg, den sie mir beschrieb. Der Betteljunge folgt mir.
Vier
Vorsichtig ins Helle blinzelnd muss ich mich zuerst erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Eine Weile schon höre ich im Halbschlaf die Ge- sänge eines muslimischen Morgenge- bets in unmittelbarer Nähe. Als ich endlich die Augen öffne, Mlutet die Sonne ins Zimmer und fast in mein Bett.
Das OVsterreichische Hospiz "Zur Heiligen Familie" im moslemischen Viertel der Altstadt Jerusalems ist ein Geheimtipp, eine erste Adresse für Kenner der Szene. Gewöhnlich für Monate im Voraus ausgebucht, hatte ich das Glück, über meinen Freund Fredi einen Unterschlupf in dieser Oase zu Minden.
Fredi war Stammgast der Göttinger Studentenkneipe, die ich hin und wieder gern besuche, wenn Eva ihre Bas- ketballabende hat, zuletzt aber auch öfter. Eines Abends teilte er seinen Kumpels mit, dass er sich für ein hal- bes Jahr "nach Israel absetzen" werde. Als Student der Theologie müsse er "ein ganz privates Semester in Jerusa- lem verbringen", das sei er seiner See- le schuldig. Um seinen Lebensunter- halt zu Minanzieren, war er auf die ge- niale Möglichkeit gestoßen, ein Volon- tariat im OVsterreichischen Hospiz an- zutreten. Dafür hatte er Kost und Lo- gis frei, konnte seine Freizeit in un- mittelbarer Nähe der heiligen Stätten mit dem Studium der bunten Religi- onsvielfalt verbringen und bekam sogar noch ein Taschengeld für die von ihm zu leistende Arbeit.
Mit Fredi hatte ich seinerzeit immer wieder über meine Vorstellung von einer Israelreise gesprochen. Als er dann vor einem Vierteljahr abreiste, reichte er mir augenzwinkernd seine Adresse mit der Bemerkung: "Lass dich mal sehen, altes Haus." Die Knallauf-Fall-Trennung ließ mich zunächst
den Flug buchen, um dann sofort bei Fredi wegen einer Bleibe nachzufra- gen. "Komm auf jeden Fall, ich bringe dich schon unter", waren seine Worte.
Nun muss ich mich zuerst orientie- ren, bin ich doch gestern Abend fest eingeschlafen, als ich mich nach der Ankunft nur kurz aufs Bett legte. Die Erschöpfung nach den Strapazen der letzten Tage, dazu die Erlebnisse der Reise forderten einen gesunden Ausgleich. Fredi, so kommt mir in Erinne- rung, hatte mich mit den Worten "Willkommen in Jerusalem" empfan- gen und mir den Zimmerschlüssel ge- reicht, denn er selbst versah den Re- zeptions- dienst. "Morgen Abend bin ich frei, dann werde ich dir die nöti- gen Weihen verabreichen", hatte er gescherzt, und man sah ihm die Freu- de an, einen alten Bekannten aus der Heimat zu empfangen.
Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass ich fast zwölf Stunden geschlafen habe. Ich trete ans Fenster, recke mich und ziehe den Vorhang zur Seite. Das
einfach eingerichtete Zimmer liegt im obersten Stock des herrschaftlichen Hauses zum Hinterhof, eine Bediens- teten-Unterkunft. In der anderen Zimmerecke steht ein zweites, unge- nutztes Bett. Ein Blick aus dem Fens- ter gewährt mir Einsicht in diverse Höfe und auf Dachterrassen der um- liegenden, meist niedrigeren Bauwer- ke. Unmittelbar gegenüber beMindet sich eine Wohnung, in der ein junger Mann lautstark mit einer älteren Frau diskutiert. Darunter ein Balkon, auf dem eine junge Frau mit Kopftuch üp- pige KastenpMlanzen begießt. Eine Katze sonnt sich, Tauben gurren, Mlie- gen auf. Ein Blick in die Gasse schräg unten zeigt hinter dem hospizeigenen Parkplatz und einer hohen Mauer be- reits lebhaften Fußgängerverkehr.
Nichts hält mich mehr hier. Schnel- len Schrittes steige ich die Stufen zur nahen Dachterrasse empor, wo sich ein faszinierender Blick auf das atem- beraubende Panorama der heiligen Stadt, Al- Quds, bietet. Linkerhand, ganz nah, der OVlberg mit den glitzern-
den Kuppeln der russisch-orthodoxen Maria-Magdalena-Kirche, nicht weit davon muss der Garten Gethsemane liegen, wo Jesus unter Olivenbäumen die letzten Augenblicke vor seiner Festnahme verbrachte und das öster- liche Geschehen seinen Lauf nahm.
Ganz dicht dabei im Zentrum des Panoramas der Tempelberg mit dem alles dominierenden islamischen Fel- sendom, der im Sonnenlicht glänzen- den goldenen Kuppel. Rechts dahinter die dunkel kontrastierende kleinere Haube der Al-Aqsa-Moschee.
Mein Blick von diesem privilegierten Aussichtspunkt schweift weiter über das Meer der Gassen und Häuser bis hinauf zur Kuppel der christlichen Grabes- und Auferstehungskirche. Dieser Gegenpol zum Felsendom ist derzeit eingerüstet. Zwei Arbeiter sind gerade dabei, einem neuen, wohl über vier Meter hohen Kreuz, in des- sen Gold und Kristallen sich die Sonne spiegelt, den letzten Schliff zu geben. Tief unter mir in den Gassen herrscht reges Treiben, erste Pilger, die bereits den Weg der Schmerzen gehen, die
Via Dolorosa, um die Leiden des Herrn in vierzehn Stationen bis zur Kreuzigung nachzuempMinden. Chris- ten aus aller Welt ziehen im Gedenken an die Passion Jesu von der nahen Festung Antonia, dem vermuteten Ge- richtssaal des Pontius Pilatus, bis nach Golgatha, dem heute von der Grabeskirche umhüllten Schädelhügel. Auf diesem symbolischen Weg tragen sie das Kreuz mit Christus.
Das Frühstück nehme ich im ,Wiener Caféhaus’ des Hospizes ein, in Gesell- schaft meines teuren Freundes, der mich inzwischen aufgespürt hat. Wir verabreden uns für den Abend, den Fredi nutzen will, um mir zu zeigen, wie man hier in Jerusalem "die Sau rauslässt".
Ich gehe durch den gepMlegten Gar- ten, nehme mir vor, unter Palmen in schattigen Winkeln zu ruhen, steige die hellen Sandsteinstufen hinab durch die Gänge und Korridore, die ich gestern noch unter dem Eindruck einer orientalischen Fee erklomm,
drücke den elektrischen Sicherungs- schalter, der ein massives Eisengitter nur von innen öffnet, gelange darauf kurz in einen nach beiden Seiten gesi- cherten Zwischenkorridor, öffne nun die Eichentür zur Straße und beMinde mich, nach dem sanften aber endgül- tigen Zugleiten der Pforte, unge- schützt mitten in Jerusalem, im Her- zen des muslimischen Viertels. Voll ungebändigter Neugier lenke ich mei- nen Schritt zu den Pilgern, ihrem schweren Holzkreuz, das sie die Via Dolorosa entlang von Station zu Stati- on tragen, dabei frühchristliche Ge- sänge anstimmend. Sie bleiben ste- hen, auch ich verweile kurz. Ein junger Priester verliest seinen Text mit pathetischer Stimme:
"Jesus fällt das erste Mal.
Die, die gesehen haben, wie er Kranke und Gelähmte heilte, wunderten sich:
Sollte er alle Macht verloren haben? Doch Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt: Niemand nimmt mir das Le- ben,
ich bin es, der es gibt."
Ich dränge mich an den Brüdern und Schwestern vorbei. Es zieht mich zum Tempelberg. Sogleich tauche ich ein in die Düfte von Kardamom, Nelken, Kumin, Kiefernharz, Moschus und Amber. Vorbei an Pyramiden aus Orangen, jemand preist Säfte aus Karottenextrakt an, Kunsthandwerkli- ches aus Olivenbaumholz und Leder, hier Minden Pilger alles, was an Mit- bringseln benötigt wird, um den Da- heimgebliebenen die Wallfahrt zu be- legen: Die Jungfrau Maria in allen Va- riationen, das Abendmahl in Leder oder Holz, die Flucht aus AVgypten in Elfenbein. Auch für Juden wie für Moslems sind die entsprechenden Re- liquien auf T-Shirts als Menora oder als Felsendom, auf Tassen, Decken oder Postkarten tausendfach präsent, der Bibel- oder Koran-Einband in al- len Farben oder Materialien, dazwi- schen getrocknete Früchte, frisches Gemüse und Kräuter. Handwerker ar- beiten in tiefen, kellerartigen Gruften, eingegraben in ihren Utensilien und
Produkten: Schlosser, Schuster, Schnitzer. UVber allem der Duft süßen Gebäcks, Stapel von Sesambroten, Honig, Mandeln, Oliven, Pistazien, - alles, was das Pilger-Herz begehren könnte, wird hier mit frömmelnder Inbrunst dem Vorbeieilenden feilge- boten.
Ich halte mich daran nicht auf, lenke meinen Schritt geradewegs in einen Minsteren, überdachten Gang, der von hier aus rechtwinklig auf den Tem- pelberg abzweigt. In der Luft liegt ein beißender Rauch, der von einem offe- nen Feuer ausgeht, das in einem alten OVlfass mit Abfallholz entzündet wur- de. Drei Muslime hocken auf dem Bo- den und saugen an einer Wasserpfeife. Nach dem hellen Sonnenlicht in den Gassen bin ich zunächst halb blind in der geräucherten Dunkelheit, gehe mutig weiter, und allmählich gewöhnen sich die Augen, nehmen Verkaufsstände wahr, wartende Frau- en mit Kopftüchern, Händler, die in Fett gebackene Falafel anbieten, dazu eine mit Kardamom gewürzte dunkle
Brühe, die sie als Kaffee anpreisen, Minztee, nicht minder zweifelhaft in der Zusammensetzung.
Hier betrete ich einen weiteren Sei- tengang, von dem ich annehme, er führe zum Tempel. Muslime stehen wartend an Schaltern. Ich frage einen der Männer auf Englisch nach der Bedeutung und erfahre, dass man sich hier für Pilgerfahrten nach Mekka und Medina einschreiben könne. Wieder zurück im Hauptgang strebe ich auf jenes helle Rechteck zu, das am Ende einer Treppe den Zugang zum Felsen- dom verheißt, will hinaustreten und werde barsch zurechtgewiesen: "It's closed now!"
Ein Araber verwehrt mir den Zutritt, nur betende Moslems seien jetzt zuge- lassen. Dahinter an einem Tisch ein israelischer Soldat mit Gewehr im An- schlag, die Sicherheit des Bezirks wahrend.
Ratlos schaue ich mich um. Ihm zu widersprechen oder auf sonstige Art zu widersetzen, mich an der Wache
vorbei zu mogeln, erscheint zwecklos und gefährlich. So kehre ich um. Ha- ram Al-Sharif, das erhabene Heilig- tum, ist jetzt für mich nicht zu errei- chen.
Ich durchquere die dunklen Basar- gassen erneut, inzwischen an das Dämmerlicht gewöhnt, überlege ich kurz, ob ich etwas zu mir nehmen sollte, lasse es mit Rücksicht auf mei- nen Magen lieber sein und trete wie- der ans Tageslicht.
Kurz darauf ein anderer Tunnel, der Zugang zum jüdischen Viertel. Hier komme ich erstmals zu einem der Kontrollpunkte, die von den israeli- schen Sicherheitskräften in der geteil- ten Altstadt errichtet sind. Ich kann ungehindert passieren. Hinter dem Durchgang in gleißendem Sonnenlicht der Platz mit dem höchsten Heiligtum der jüdischen Welt, der Kotel Ha Ma'arivi, der Westmauer. Seit dem Mittelalter wird diese Wand aus geschichteten, zyklopischen Steinen in der christlichen Welt Klagemauer ge-
nannt. Ich trete näher, passiere eine Absperrung, an der mir die Kippah als Papphut verabreicht wird. Ohne KopMbedeckung ist der Zutritt verbo- ten. Und dann erlebe ich eindringlich die Inbrunst der Gebete gläubiger Ju- den. Völlig in sich gekehrt und den- noch demonstrativ, der Gegenwart Gottes nirgends so gegenwärtig wie hier, beten Männer und Frauen nach Sektionen getrennt, laut und mit hef- tigen Körperrhythmen der Mauer zu- gewandt. Als letzter UVberrest des Jahwe-Tempels, der von Salomo einst errichtet, durch Nebukadnezar zer- stört, unter Herodes wieder neu er- baut und durch Titus unter römischer Besatzung endgültig vernichtet wurde, ist diese Mauer nun staatstragen- des Symbol.
Als Nichtjude kann ich die Kraft der Stätte nur erahnen. Auf dem Platz in- nerhalb der Absperrung haben sich etwa zehn Männer mittleren Alters, bärtige Väter mit ihren etwa achtjäh- rigen Söhnen eingefunden. Alle tragen ihre Kippah. Sie halten sich an den
Händen, laufen singend in einem gro- ßen Kreis, es wird gelacht, gescherzt, eine mir fremde Atmosphäre der Freude und des Zusammenhalts. Ich spüre intuitiv, dass hier die Religion Gemeinde stiftet, eine Form der ech- ten Initiation, der Weitergabe von Werten an die nächste Generation, die uns im Christentum vielfach abhandengekommen ist.
Nachdenklich gehe ich durch die Gassen zurück.
Auf dem Tisch in meinem Zimmer im Hospiz Minde ich eine handschriftli- che Nachricht auf Deutsch:
TREFFE DICH UM 15 UHR IM HIN- NOM-TAL!
Fredi kann mir nicht sagen, wie die Nachricht dort hinkam. Während sei- nes Dienstes hat er keinen Boten ge- sehen. Das Zimmer hatte ich wohl nicht abgeschlossen, bin mir aber nicht sicher. Der Zettel enthält keinen Hinweis auf den Absender. Natürlich denke ich an Leila, und mein Herz
schlägt unwillkürlich höher. Ich sehe auf dem Stadtplan nach. Warum sollte ich sie in dem stillen Tal südlich des Berges Zion treffen? Für ein solch ver- schwiegenes Rendezvous kennen wir uns doch wohl noch nicht gut genug! Und warum hat sie nicht mit ihrem Namen unterzeichnet? Welchen Grund gibt es für diese Geheimnis- krämerei?
Um 14 Uhr schon breche ich auf, um der ungewöhnlichen Einladung zu folgen. Ich brenne vor Neugier und halte es nicht mehr in meinem Zim- mer aus, obwohl ich kaum länger als eine Viertelstunde für den Weg benö- tige. Ich durchquere wieder die Gas- sen, folge nun dem Hauptstrom und komme zum Jaffa-Tor, wo ich die Alt- stadt verlasse. Da noch etwas Zeit ist, gönne ich mir einen kleinen Umweg, überquere die Hativat Yerushalayim, eine der Hauptverkehrsadern, gehe durch Yemin Moshe, das Künstlervier- tel. Danach erkunde ich einen ruhigen Park mit dem klangvollen Namen ,The Liberty Bell Garden‘, in dessen Mitte
eine Nachbildung der amerikanischen Freiheitsglocke auf einem Gestell thront.
Ringsum das Tosen des Mittagsver- kehrs, und hier nun, welch ein Kon- trast, eine Oase des Müßigganges. Spatzen zanken vor lauter Langewei- le, Kinder turnen an Klettergerüsten, ein Hund bellt, zwei Jungen rennen mit ihrem Fußball vorbei, dann ein kleines Freilichttheater, in dem eine junge Frau ihr Mittagsbrot verzehrt, ein friedliches Bild.
UVberall moderne Kunstplastiken in Nischen aufgebaut. Angrenzend eine Schule mit mehreren Plätzen für Bas- ketballspiele. Ich muss an Evas Lei- denschaft für dieses Spiel denken. Hat sie ihren Schritt inzwischen bereut? Zwei junge Frauen kommen schwat- zend und lachend den Weg entlang. Einen Moment erliege ich der Täu- schung, glaube fest, die mit dem lan- gen, blonden Haar sei Eva. Unmöglich, das kann nicht sein! Sie gehen vorbei,
hebräische Töne, ich drehe mich um, blicke ihnen lange nach.
Dann ein Rastplatz unter schattigen Arkaden. Eine jüdische Großfamilie hat ihn erobert. Ich zähle sechs Män- ner, drei Frauen, eine Horde Kinder. Viele Plastiktüten mit Nahrungsmit- teln, Tomaten, Brot, Getränke in Fla- schen. Zwei der jungen Männer sind lautstark in heftigem Streit. Es geht um Organisatorisches. Sie tragen ihre Kippah am Hinterkopf. Die Frauen räumen und hantieren.
Inmitten des Familiengetöses wird ein kleiner Junge, vielleicht zwei Jahre alt, aufwendig und mit rituellem Eifer geschoren. Er sitzt auf dem Schoß sei- ner Mutter. Ein junger Mann schnei- det mit einer Schere eine der langen Haarsträhnen nach der anderen ab. Der Junge gibt lautstarkes Wehge- schrei von sich, so als gehöre es dazu. Doch niemanden scheint es zu stören.
Man bereitet Fleisch auf einem dampfenden Grill, trägt Getränkebo-
xen, richtet das bevorstehende Mahl. Auch hier wieder der enge familiäre Zusammenhalt, ähnlich wie bei der zuvor beobachteten Beziehung der Väter zu ihren Söhnen an der Klage- mauer. Ob es sich um ein religiös ge- färbtes Ritual handelt? Ich wüsste es gern, doch ich mag nicht die Kreise der Familie stören, um danach zu fragen.
So verlasse ich den Park zur Seite, überquere die sehr belebte David Hamelech und wende mich meinem Ziel, dem Hinnom-Tal, zu, das hier sei- nen Eingang hat.
Einen Moment noch muss ich ver- weilen, um den eindrucksvollen Blick vom Süden her auf die Altstadt wirken zu lassen: drüben der rechteckige Kasten des legendären King-David- Hotels und der markante YMCA-Turm. Davor die Windmühle des Sir Monte- Miore, dann die weiß strahlende Mauer der Altstadt vom Jaffa-Tor über den Zionsberg mit der Dormitio-Abtei, da- vor das Institute of Holy Land Studies
und rechterhand, steil abfallend, das Hinnom-Tal.
Obwohl die Nächte Anfang März im über 800 Meter hoch gelegenen Jeru- salem noch empMindlich kalt sind, blühen hier überall schon Bäume, sind Blumenkästen mit Geranien aufge- stellt, Lilien in weiß und violett im Beet, gelb lachende Gerbera. Der Eingang zum Tal stellt sich als Teil des
,National Park Jerusalem Gardens‘ vor. Eine Inschrift weist darauf hin, dass die Anlage von einer Londoner Stif- tung geschenkt wurde.
Kaum ein Mensch ist zu sehen in diesem Garten Eden. Wäre nicht das Getöse des nahen Verkehrs, man könnte nicht begreifen, inmitten der Großstadt zu sein, zu ländlich und zu friedlich scheint die Gegend. Ein sat- ter Rasen breitet sich aus, leicht abschüssig talwärts. Darauf einige kahle Bäume, die sich zum Austrieb rüsten, durch erste Spitzen das Blattgrün angedeutet. UVber die Wiese sind weiße Felsbrocken verstreut,
Quader wie von Riesenhand hierher gelegt.
An einen der Felsen gelehnt hockt ein halbwüchsiger Junge in kariertem Hemd. Als er mich kommen sieht, schaut er auf, neben ihm sitzt ein gleichaltriges Mädchen. Die beiden sind in angeregter Unterhaltung ver- tieft. Beim Näherkommen erkenne ich die Zugehörigkeit des Jungen an sei- ner Kippah. Die beiden haben nichts mit meiner Verabredung zu tun. Sie bieten ein trauliches Bild.
Mein Blick schweift über die sich langsam talwärts verengende Land- schaft auf der Suche nach einem An- haltspunkt für die Bestellung. Aber Leila ist nirgends zu erblicken, so sehr ich dies auch wünsche, auch sonst keine Seele. Soll ich weitergehen? Der Weg wird ungewiss. Abseits der Tou- ristenströme und jenseits des Alltags- getriebes am Rande der zivilisierten Welt wird mir der Ort langsam unge- heuer. Wäre nicht jenes Gemisch aus freudiger Erwartung und ungewisser
Abenteuerlust in mir, ich würde kaum diesen Weg weitergehen. Doch es treibt mich an.
Aus dem Park am Eingang des Tales wird, je weiter ich gehe, eine urwüch- sige Landschaft. Die Wiesen sind un- gepMlegt, naturbelassen. Uralte OVl- bäume haben die Jahrhunderte überdauert. Ein Wasser Mließt leicht dahin, sammelt sich und versickert im Un- tergrund. Terrassen aus Steinmauern, von Menschenhand geschichtet, zeu- gen von früherer Nutzung. Je tiefer ich steige, desto steiler ragen die Fels- wände empor, die das Tal rechterhand begrenzen.
Zwei halbwüchsige Jungen haben ein Tau von den Felsen herabgelassen. Sie üben sich im Erklimmen der etwa zwanzig Meter hohen Steilwand. Mich nehmen sie nicht wahr. Da taucht plötzlich, ich weiß nicht woher, wie im Sturm ein Maultier vor mir auf. Auf seinem Rücken sitzen zwei arabische Jungen, treiben es eifrig an. Im Nu sind sie auch schon den Berg herauf gekommen. Den Galopp eines Mulis
habe ich nie zuvor gesehen. Sie reiten zum Zberg ion, halten nur kurz inne und rufen den beiden Bergsteigern am anderen Ende des Tales etwas zu.
Jetzt erblicke ich eine schwarz ver- hüllte Araberin, die einen schmalen Weg vom jenseitigen Dorf herabsteigt. Langsam setzt sie Fuß vor Fuß. In ei- niger Entfernung bleibt sie stehen. Wohl kaum meinetwegen, wohl aber wegen der zwei Männer, die sie nun erblickt. Auch ich sehe jetzt die Minste- ren Gestalten, Müßiggänger in schäbi- ger Kleidung, dem westlichen Auge bedrohlich im Anblick. Sie lehnen an einer der geschichteten Steinmauern unter OVlbäumen. Die Frau hält inne, blickt herüber und kehrt dann um. Jetzt haben die Männer mich bemerkt, bleiben aber unbewegt an ihrem Ort. Ich gehe weiter talwärts, denn noch immer hoffe ich auf meine Begegnung.
Je tiefer ich steige, desto deutlicher wandelt sich jetzt die Landschaft zur Müll- und Schuttdeponie. Es ist un- glaublich, dass ein historischer Platz,
so nahe bei den heiligen Stätten und fast im Herzen der Großstadt, so elend verkommen kann. Zwischen ehrwürdigen OVlbäumen stapeln sich haufenweise Steine, Pappkartons, Plastikmüll, eine wilde Deponie. Wer wird den Unrat je beseitigen?
Tief unterhalb der Westmauer wan- dere ich nun wie mit einem Ziel dahin. Nur nicht stehen bleiben! Hinter mir taucht ein Auto auf, ich trete zur Seite, es fährt vorbei. Der Unrat nimmt an Dichte noch zu. Alte Kühlschränke lie- gen am Weg. Irgendwo hinter Mauern quiekt ein Tier in Todesangst. Blaue und rote Plastikkanister, verrostete Blechdosen. Vor mir am gegenüber- liegenden Hang hunderte arabischer Wohnungen, sehr einfach, aus Platz- mangel kühn ineinander verschach- telt. Ein Hahn kräht.
Später lese ich, dass dieses Tal einst Stätte eines Kultes war, bei dem man Kinder durchs Feuer gehen ließ. Der Ort wurde zum Inbegriff des Bösen. Der Name des Tales 'Hinnom' soll sich
deshalb von dem arabischen Wort 'gehenna' für 'Hölle' herleiten. Hier soll der Hohepriester Kaiphas die im Johannesevangelium (11, 42-53) be- schriebene Versammlung abgehalten haben, bei der die Tötung Jesu be- schlossen wurde. Schließlich, so er- fahre ich, liegt hier der Blutacker, der nach Matthäus (27, 6-8) von den dreißig Silbergroschen gekauft wurde, die von dem reuigen Verräter Judas Ischariot in den Tempel geworfen wurden.
Ich bin froh, im Talgrund angekom- men zu sein und hier endlich vom Abweg und Müllplatz, auf den ich un- gewollt geriet, wieder auf eine belebte Straße zu gelangen. Das Treffen fand nicht statt. Enttäuscht wende ich mich wieder der Zivilisation zu, gehe an der Straße entlang bergauf. Da kommt mir auf dem schmalen Seitenstreifen er- neut ein Junge auf dem Rücken eines Esels entgegen, treibt ihn just vor mir unverschämt an, ich muss zur Seite springen, um nicht umgerannt zu werden. Lachend dreht er sich um.
Vor mir nun eine Gruppe von Touris- ten. Im Stadtplan erkenne ich, es han- delt sich um den Siloah-Teich, an dem Jesus den Blindgeborenen heilte (Jo- hannes 9, 7). Durch arabische Wohn- viertel steige ich weiter den Berg hin- auf. Unterwegs kaufe ich für einen Schekel, den ich zufällig in der Hosen- tasche Minde, zwei Bananen bei einem Straßenhändler und komme gleich darauf zu wartenden Bussen, deren Fahrgäste für ein paar Minuten ihres Programmes von hier aus zur Klage- mauer eilten: Die Hinterhöfe des Tourismus.
Die Fahrer stehen schwatzend bei- sammen, sie kennen sich alle von ih- ren Holy-Land-Tours, sehen sich wö- chentlich an denselben Stellen wieder. Ich gehe an der vielbefahrenen Straße entlang, dann zur Stadtmauer empor. Durch eine kleine Pforte gelange ich auf einen arabischen Friedhof, steige zum Goldenen Tor auf, das kein Tor mehr ist, seit man es zumauerte. Der Messias sollte nach Ansicht der Juden
an dieser Stelle die Stadt betreten. Deshalb, so wird erzählt, mauerten die Araber den Zugang zu und plat- zierten hier zusätzlich einen Friedhof. Auch hier treffe ich keine Menschenseele, nun hoch über dem angrenzen- den Kidrontal.
Gegenüber liegt der OVlberg jetzt in seiner ganzen Ausdehnung und Pracht. An seinem Fuße die Kirche der Nationen mit bunter Fassadenbema- lung. UVber den Hang, südlich davon, tausende steinerner Gräber der Juden. Sie alle wollen am Tag der Ankunft des Messias das Ereignis nicht ver- säumen. Eindrucksvoll im Talgrund die aus dem Felsen gehauenen Grab- male des Absalom und des Zacharias. Ich fotograMiere, bin von den immer neuen Ausblicken angetan.
Am Löwentor, unweit meiner Her- berge, endet der abenteuerliche Auf- stieg. Nun, da ich wieder das Licht der Welt erblicke, kommt es mir vor, als habe ich einen ersten symbolischen AusMlug in die Urgründe Zions unter-
nommen. Was alles mag verborgen liegen im Urgestein dies Berges, den eine Jahrtausende lange Geschichte mit unserer Zeit verbindet? Welch verschlungene Pfade weist dieses Land in seinen abgelegenen Winkeln noch auf?
Fünf
Neonfarben zuckende Blitze erhellen den Raum im Staccato des ohrenbe- täubenden Gedröhnes. Bewegte Lei- ber, wehende Mähnen, lachende Ge- sichter, Mlackernd wie zu StummMilmzeiten. Zwei junge Frauen stehen plötzlich auf den Tischen, werfen die Arme hoch, verdrehen die Augen wie in Trance. Die Umstehenden klatschen im Rhythmus der Musik.
Das "Underground" in Jerusalem gilt in Kennerkreisen als Gipfel der Kult- szene. Natürlich muss der Abend mit Fredi hier enden. Zuerst speisten wir gemütlich bei Eldas Vcsehov in der Yaffaroad, französische Küche, um dann einen Streifzug durch die angrenzenden Straßen und deren Knei- penkultur zu starten. Viel Volk ist hier abends unterwegs. Eine gewisse AVhn- lichkeit mit unserer heimischen Stu- dentenszene ist nicht zu leugnen,
wenn auch das Bier internationaler ist.
Die Stunden Mlogen dahin. Fredi er- zählte von seiner aufregenden Zeit im Schnittpunkt der Kulturen, dem Auf- einander- prallen der westlichen mit der arabischen Welt. Ich berichtete ihm von den jüngsten Ereignissen, die mich so unverhofft auf diese Reise führten bis hin zu meinem AusMlug ins Hinnom-Tal am Nachmittag. Als Krö- nung unserer Tour will Fredi mir nun gegen Mitternacht diesen kultigen Schuppen zeigen.
Noch stehen wir unentschlossen am Rande der TanzMläche, doch ich spüre schon, wie es mich gleich packen wird; das rhythmische Getose fordert alle, die sich noch etwas Lebensfreude in den Knochen bewahrt haben, un- barmherzig zum Mittanzen auf.
Und schon sehe ich, wie Fredi über die Fläche wirbelt, und ich folge ihm. Ringsum junge, fröhliche Gesichter. Hier zählt weder Rasse noch Nationa-
lität; die Jugend der Nationen ist sich in der Welt der Musik längst über alle Grenzen hinweg einig. Im Tanz ver- schmelzen die zuckenden Körper zu einem gemeinsamen Lebensgefühl, öffnen sich die Augen und die Seelen und man ist verbunden, ohne Worte wechseln zu müssen. Jeder tanzt mit jedem.
Unwillkürlich schießt es mir durch den Kopf: Was wäre, wenn jetzt ein verrückter Selbstmordattentäter sei- nen teuMlischen Auftrag erfüllte? Un- weit von hier in der Yaffa Road, wir sahen vorhin die Stelle, wurde vor zwei Wochen ein Linienbus zur Todesfalle. Ich verwerfe den Gedanken schnell wieder, denn eine Weile schon schaut sie mich nach jeder Drehung wieder lachend an, die attraktive dunkelhaarige Tänzerin mit dem strahlenden Gesicht und der langen Mähne.
Kaum zwanzig ist sie wohl. Gilt ihr Lachen mir, oder ist es nur Ausdruck ihrer Lebenslust? Nein, ich merke
deutlich, das gilt mir, tanzen wir doch nun schon eine ganze Weile in fast symmetrischen Figuren. Unsere Kör- per ergänzen sich. Sie entwickelt eine spürbare Freude dabei, mich zu im- mer neuen Bewegungen zu animieren, die sie mir mit Phantasie vorgibt. Ich lasse mich auf das Spiel ein, mal springend, mal hüpfend, mal langsam, mal schnell: Kreisen der Hüften, Schütteln des Pos, phantastische Be- wegungen des Rumpfes und der Arme. Im Augenwinkel fange ich die wissenden und vielsagenden Blicke Fredis auf.
Als die Musik wechselt, fasst sie mich leicht an der Schulter, beugt sich vor und fragt in mein Ohr: "You like a drink?"
"Yes, I do", brülle ich zurück, denn eine Unterhaltung ist hier unmöglich.
Mit zwei Cola-Whiskys treten wir auf die Straße vor dem Lokal, die sehr bevölkert ist. Lauter fröhliche, junge Menschen, die in Gruppen zusam- menstehen und sich unterhalten. Ich
spüre warme Sympathie, als sie mich beim Hinausgehen unterhakt, dabei zwei Freunden zuwinkt. In deutli- chem Kontrast dazu steht ihre erste Reaktion, als sie merkt, dass ich Deut- scher bin.
"Du kommst aus Deutschland?" dehnt sie und wechselt wie selbstver- ständlich die Sprache. "Es spricht für dich, da ss du in diese Zeit herkommst."
"Du kannst die Deutschen nicht lei- den?" frage ich direkt.
"Wir wurden von jenen erzogen, die Nummern am Arm trugen", spielt sie direkt auf den Holocaust an, fährt dann aber fort: "Niemand ist hier feindlich mit die Deutschen, und du kannst nichts für die Geschichte. Aber zuerst zuckt man zusammen."
"Beim Tanz eben haben wir uns wunderbar verstanden, fand ich."
"Du hast Recht, ich Minde, du warst eine gute Tanzschüler." Sie reicht mir versöhnlich die Hand und sagt: "Ich bin Noami, wir sollten Freunde sein." Ich nenne meinen Namen, und wir
tauschen uns nur ganz kurz über un- sere BiograMien aus. Dabei erfahre ich, dass sie zurzeit ihren Wehrdienst ab- leistet, jedoch für eine Woche Urlaub hat.
Schon kommt Fredi, der alte Neid- hammel, und stupst mich von hinten an: "Sag mal, behandelt man so einen Freund? Lässt mich beim Tanzen al- lein! Ist das der Dank für die gelunge- ne Sause?"
Ich stelle die beiden einander vor, - im selben Moment kommen zwei wei- tere junge Frauen, grüßen Noami überschwänglich auf Hebräisch, Küss- chen hier, Küsschen da, ziehen sie mit sich zu einem Pulk von Freunden ne- benan, wildes Palaver, Gelächter, lautstarke Wortwechsel.
"Du hast ein besonderes Talent, ge- rade im richtigen Augenblick zu er- scheinen", werfe ich Fredi vor.