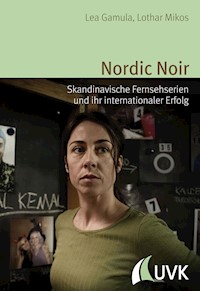
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alltag, Medien und Kultur
- Sprache: Deutsch
Mit Stig Larssons »Millenium«-Trilogie haben skandinavische Krimis und ihre Adaptionen in Film und Fernsehen nicht nur Europa, sondern den Weltmarkt und international die Herzen der Zuschauer erobert. Auch in der deutschen Fernsehlandschaft haben sich die Serien aus dem skandinavischen Raum einen festen Platz gesichert. Lea Gamula und Lothar Mikos zeigen die Gründe für den internationalen Erfolg skandinavischer Fernsehserien auf. Vor dem Hintergrund der internationalen Serienproduktion und ihrer Entwicklung stellen sie den skandinavischen Sonderweg vor, der trotz internationaler Orientierung seine ganz eigene nationale Identität bewahrt hat: Die Autoren geben Einblick in die spezifischen Formen der Ästhetik und der Narration sowie in die Besonderheiten des skandinavischen Marktes und die dortigen Produktionsweisen. Denn trotz internationaler Orientierung zeichnen sich skandinavische Fernsehserien durch einen besonderen, eben skandinavischen Look aus, der oft auch als »Nordic Noir« bezeichnet wird. Außerdem stellen sie die qualitativ hochwertigen und vielprämierten Serien wie »Protectors«, »Kommissarin Lund« (Forbrydelsen), »Die Brücke« (Broen) und »Gefährliche Seilschaften« (Borgen) vor, welche bereits großen Zuspruch eines internationalen Publikums fanden. Amerikanische Produzenten wurden aufmerksam und stellten Adaptionen der Serien für den amerikanischen Markt her: »The Killing« (eine Adaption von »Kommissarin Lund«) wurde in mehreren Staffeln produziert, »The Bridge« mit Diane Kruger in der Hauptrolle neu gedreht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alltag, Medien und Kultur
Herausgegeben von Joachim von Gottberg, Lothar Mikos, Elizabeth Prommer, Claudia Wegener
Band 15
In dieser Reihe werden in erster Linie empirische, aber auch theoretische Arbeiten veröffentlicht, die den Zusammenhang von Alltag, Medien und Kultur aus der Perspektive der gesellschaftlichen Akteure, der Mediennutzer thematisieren. Mit ihrer mediensoziologischen Orientierung und interdisziplinären Ausrichtung trägt die Reihe zum Dialog zwischen Medienpraxis, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Medienpädagogik und Jugendschutz sowie zur Diskussion um die gesellschaftliche Bedeutung der Medien im 21. Jahrhundert bei.
Inhalt
Danksagung
Einleitung
Eine kurze Seriengeschichte
Fernsehserien als Quality-TV
Der Begriff »Quality-TV«
Skandinavien und das Quality-TV
Die Produktion von Fernsehserien im Kontext des globalen Fernsehmarktes
Die amerikanische Produktionsweise
Vorüberlegungen zum Erfolg skandinavischer Serien
Innovation und Effizienz - der skandinavische Weg der Serienproduktion
Das Fernsehdrama in Skandinavien
Skandinaviens Medienproduktion
Internationalisierung des Contents
Dänemark: Annäherung, Adaption und Innovation
Das Prinzip der Double Stories/Double Narration
Nachwuchsförderung und Autorenausbildung
Das Produktionssystem in Schweden und Norwegen
Erfolgreiche skandinavische Fernsehserien – von »Kommissarin Lund« über »Lilyhammer« bis »Borgen«
Die skandinavischen Serien
Der Anfang: die Polizei-Trilogie
Der Erfolg: Scandinavian Crime
»Forbrydelsen«
»Bron«/»Broen«
»Borgen«
»Lilyhammer«
Die Besonderheiten der skandinavischen Serien
Mehrdimensionalität und multithematischer Ansatz
Dramaturgie und Narration
Formatwahl: Miniserie
Exkurs: Frauencharaktere im Fokus
Realismus und Authentizität
Ästhetik und Gestaltung
Der internationale Erfolg
Auswertung in anderen Ländern
Internationale Adaptionen skandinavischer Serien
Scandinavian Crime und Nordic Noir
Quellen
Filmografie
Serien
Weitere Serien (Auswahl)
Filme (Auswahl)
Danksagung
Zwei Forschungsaufenthalte in Göteborg haben das Interesse der Autorin und des Autors für die skandinavische Medienlandschaft im Allgemeinen und für Fernsehserien aus dem nördlichen Teil Europas im Besonderen geweckt. Zahlreiche Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen in Dänemark und Schweden waren sehr hilfreich, um sich dem Thema wissenschaftlich zu nähern. Besonderer Dank für die Unterstützung bei der Recherche und die Diskussion von Thesen gilt: Gunhild Agger (Aalborg), Stina Bengtsson (Stockholm), Göran Bolin (Stockholm), Katharina Brummer (Uppsala), Hanne Bruun (Aarhus), Monika Djerf-Pierre (Göteborg), Maria Edström (Göteborg), Pia Majbritt Jensen Azzolini (Aarhus), Anne Jerslev (Kopenhagen), Jakob Isak Nielsen (Aarhus), Eva Novrup Redvall (Kopenhagen), Ingrid Thornell (Göteborg), Patrick Vonderau (Stockholm), Anne Marit Waade (Aarhus) und Ingela Wadbring (Sundsvall). Ingolf Gabold, dem ehemaligen Head of Drama des dänischen öffentlich-rechtlichen Senders Danmarks Radio (DR), gebührt Dank für die ausführliche Erläuterung der Prinzipien der dänischen Serienproduktion. Ein besonderer Dank geht an die skandinavischen Experten des »European TV Drama Series Lab«, das jährlich vom Potsdamer Erich Pommer Institut veranstaltet wird, für ausgesprochen interessante Einblicke in die skandinavische Serienproduktion: Piv Bernth (Head of Drama DR), Anne Bjørnstad (Erfinderin und Koautorin von »Lilyhammer«), Sven Clausen (Produzent von »Kommissarin Lund«), Thomas Gammeltoft (Kopenhagen Film Fund), Nadia Kløvedal Reich (Head of Fiction DR) und Klaus Zimmermann (Produzent der Serie »Borgia«). Großer Dank geht auch an Cia Edström (Chefin des Nordic Film Market beim Internationalen Filmfestival Göteborg), die die Teilnahme an der jährlichen Veranstaltung »TV Drama Vision« ermöglichte. Ein Dankeschön geht auch an die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir die Serienproduktion in Europa und den USA diskutieren konnten: John Thornton Caldwell, Matilde Delgado Reina, Susanne Eichner, Andrea Esser, Iliana Ferrer, Timo Gössler, Ben Harris, Christian Junklewitz, Richard Kilborn, Edward Larkey, Denise Mann, Robin Nelson, Hugh O’Donnell, Marta Perrotta, Anna Tous Rovirosa und Elke Weissmann. Bedanken möchten wir uns auch bei allen Freunden und Verwandten, die uns während der Arbeit an diesem Buch unterstützt haben. Karin Dirks hat wie immer zuverlässig Lektorat und Layout besorgt – danke.
Berlin und Köln im Frühjahr 2014
Einleitung
»Amerikanerne fortæller gode historier, der er moderne fortaltog har gode karakterer. Hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det?«1 (Rumle Hammerich in Nordstrøm 2004, S. 21)
Gemeinhin sind es die US-amerikanischen Fernsehserien, die große Beachtung erfahren – sowohl im internationalen Programmhandel als auch bei Publikum und Kritik. Sie sind neu, sie sind gut, und sie sind nach Auffassung mancher Zuschauer und der Fernsehkritik besser als viele der europäischen Serien, die es häufig nicht über die Landesgrenzen hinaus schaffen; sie sind, so heißt es: Quality-TV. Auf der ganzen Welt? Nein, ein kleiner Teil Europas wehrt sich gegen diese vermeintliche Allmacht des Fiktional-Seriellen aus amerikanischer Hand: Skandinavien gelang es in den letzten Jahren, erstaunlich erfolgreiche, bei Publikum, Kritik und auf dem Programmmarkt beliebte Serien zu konzipieren und zu produzieren.
Skandinavien ist vornehmlich bekannt für seine Kriminalliteratur und, besonders in Deutschland, für deren Fernsehadaptionen: »Wallander«, »Kommissar Beck« und viele andere bezeugen neben Kinofilmen wie der »Millennium«-Trilogie die Bandbreite der kriminalistischen Literatur und ihren großen Erfolg. In den letzten Jahren hat das auch die Aufmerksamkeit von Journalisten und Wissenschaftlern erregt, die einige Bücher über skandinavische Krimis verfasst haben (vgl. Agger/Waade 2010, Forshaw 2012, Nestingen 2008, Nestingen/Arvas 2011, Peacock 2013). Der britische Kritiker Barry Forshaw nutzte ob der oft dunklen Atmosphäre den Begriff »Nordic Noir« als Sammelbegriff für skandinavische Kriminalliteratur und deren Verfilmungen sowie für Krimiserien im Fernsehen (vgl. Forshaw 2013). Der Begriff hat sich inzwischen als Genrebezeichnung durchgesetzt. So betitelt selbst der schwedische Fernsehsender SVT eine Dokumentation über das Phänomen mit »Nordic Noir«.
Die neuen Serien basieren jedoch auf keiner literarischen Vorlage. Sie ähneln zudem visuell und dramaturgisch eher den zuvor erwähnten High-Quality-Primetime-Serien US-amerikanischer Machart. Längst sind es aber keine reinen Kriminalserien mehr: Zahlreiche Genres, breit gefächerte Themen- und Personenspektren, globale Diskurse und multiperspektivische Ansichten brechen das gewohnt Düstere auf. Werden die Literaturadaptionen noch dem Scandinavian Crime oder sogenannten Nordic Noir zugerechnet, bildet sich über den aktuelleren Serien eine neue Dachmarke: Scandinavian Fiction. Warum und wie gelingt es gerade Skandinavien, diese erfolgreichen Serien herzustellen? Wie erklärt sich deren Beliebtheit?
Der Erfolg korreliert mit zahlreichen Veränderungen in der skandinavischen Fernsehproduktion: Es scheint, als sei sowohl eine technische Orientierung an dem US-amerikanischen Produktionssystem als auch eine ästhetisch-dramaturgische Annäherung an das Quality-TV ausschlaggebend. Doch vieles spricht dafür, dass auch der Aspekt des Nordic Noir, die Nische des Krimigenres, das den ersten Erfolg Skandinaviens begründet, Grundlage des Alleinstellungsmerkmals der Scandinavian Fiction ist. Außerdem scheint sich der Erfolg aus dem Zusammenspiel vom Image Skandinaviens und der Universalität und Aktualität der behandelten Themen zu generieren. Doch was genau sind die Ursachen des Erfolgs? Inwiefern lässt sich die Entwicklung in Skandinavien mit der des Quality-TV in den USA vergleichen? Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede lassen sich finden?
Gegenstand der vorliegenden Studie sind die zeitgenössischen skandinavischen Fernsehserien, die auf keiner Literaturvorlage basieren und international ausgewertet werden. Es werden mögliche Gründe und Voraussetzungen für den internationalen Erfolg skandinavischer (vorwiegend dänischer) Serien dargelegt. Zum einen geht es also darum, produktionstechnische Gegebenheiten wie beispielsweise Stoffentwicklung und Formen der Produktion oder die veränderte Wahrnehmung der Rolle des Autors etc. zu untersuchen. Zum anderen sollen die daraus resultierenden ästhetischen, dramaturgischen sowie narrativen Alleinstellungsmerkmale der Serien analysiert werden, um diese dann in Beziehung zum US-amerikanischen Quality-TV und der möglichen Generierung eines skandinavischen Metagenres oder einer Marke zu setzen. Wichtig hierfür sind natürlich weiterhin die Rezeption und der Bedarf in den entsprechenden Auswertungsländern. So sind skandinavische Literaturverfilmungen beispielsweise in Deutschland sehr beliebt, Großbritannien dagegen hat eine lange Tradition des Fernsehdramas. Ziel ist es, einen Überblick über die skandinavischen Serien und ihren Erfolg darzulegen sowie verschiedene mögliche Erfolgsfaktoren bezüglich der Produktionsweise und -umgebung in ihrer Korrelation zu ästhetischen, inhaltlichen sowie formattechnischen Eigenheiten zu überprüfen.
Der internationale Erfolg fiktionaler und nonfiktionaler Fernsehformate ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Besonders die scheinbare Überlegenheit der USA, ihre Vormachtstellung in der kulturellen Medienproduktion und die Befürchtung einer damit einhergehenden Amerikanisierung entfachen zahlreiche Diskussionen, die ihrerseits in den Globalisierungsdiskurs eingebettet sind. Doch verändert sich die Sicht zusehends, andere Globalisierungskonzepte werden entworfen: Kritik an der These der amerikanischen Dominanz wird lauter (vgl. Miller et al. 2005). Vergessen wird hierbei häufig, sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in der Wissenschaft, dass anderen Ländern und Kulturregionen ganz eigene Momente attestiert werden können, der Blickwinkel der westlichen Welt mitunter etwas einseitig bleibt. Michael Curtin versucht in seiner Studie zur chinesischen Medienwelt die Globalisierung von Fernsehen und Film im asiatischen Raum darzulegen und aufzuzeigen, dass das chinesische bzw. asiatische Publikum quantitativ das westliche übersteigt, daher nicht mehr unbedingt zwingend von »cultural homogenization or Western hegemony« gesprochen werden kann (Curtin 2007, S. 9 ff.). Im asiatischen Sprachraum dominiert Japan in vielen Bereichen; ein Beispiel ist die Mangakultur, die längst in andere asiatische (und westliche) Regionen expandiert ist und dort adaptiert wird (vgl. Iwabuchi 2002). Doch auch andere Regionen bzw. Kulturkreise verfügen über dominante Medienmärkte, etwa Indien mit seinen Bollywoodfilmen oder Nigeria als »Nollywood«, kleines Hollywood. Auch der Frage, warum es gelingt, in manchen Regionen funktionierende Produktionszentren aufzubauen, in anderen wiederum nicht, wird von den genannten Autoren nachgegangen. Inzwischen geht man zwar immer noch vom dominanten Flow amerikanischer Filme und Fernsehserien aus, man konstatiert aber auch sogenannte Contraflows, indem audiovisuelle Produkte wie Telenovelas, Bollywoodfilme und japanische Animes eine weltweite Verbreitung finden (Thussu 2007, S. 15 ff.). Nicht mehr Dominanz allein ist das Thema, sondern es wird von wechselseitigen Beziehungen ausgegangen, wie Elke Weissmann (2012) an den britischUS-amerikanischen Beziehungen in der Produktion von fiktionalen Fernsehsendungen gezeigt hat.
Im europäischen Kontext wird der Globalisierungsdiskurs ähnlich verhandelt: Mette Hjort spricht von einer »counter-globalisation« in kleineren Staaten, u.a. in Dänemark. Der Fall Dänemarks zeige, dass nicht unbedingt staatliche Eingriffe oder ökonomische Voraussetzungen ausschlaggebend sind, sondern »certain highly effective forms of counter-globalisation may instead depend on the presence of supremely talented directors« (Hjort 2006, S. 128). Während sich zahlreiche internationale Untersuchungen mit dem Export und Erfolg von Fernsehformaten beschäftigen, sind es wenige, die den internationalen Erfolg europäischer Medienprodukte konkret analysieren. Den aktuellen Serien, die im Folgenden Gegenstand der Analyse sind, wird bisher meist nur im jeweiligen Genrekontext Beachtung geschenkt, weniger im global-transnationalen Umfeld. Vielfach wird allein das Kriminalgenre als konstituierend für den Erfolg angesehen, als skandinavische Nische (vgl. Forshaw 2012).
Es gibt im skandinavischen Raum und in Deutschland umfangreiche Untersuchungen zu skandinavischer Kriminalliteratur und zu Literaturverfilmungen. Daniel Brodén (2008) beschäftigt sich in seiner Dissertation mit dem Kriminalgenre in Fernsehen und Kino und dessen Genreevolution, Gunhild Agger (2005, 2010a, 2010b) in mehreren Veröffentlichungen mit dem dänischen Fernsehdrama und dessen Erfolg. Skandinavien ist überdies in anderen Gebieten erfolgreich: Im Verhältnis zur Größe der Länder wurden und werden in Skandinavien, besonders in Schweden, überdurchschnittlich viele erfolgreiche Fernsehformate entwickelt. Den Erfolg skandinavischer Fernsehformate diskutiert Yngvar Kjus (2008) in seiner Dissertation, und auch Pia Jensen geht in ihrer australisch-dänischen Fallstudie ausführlich darauf ein (Jensen 2007). Ähnlich inflationär wie die Publikationen zu nationalen Adaptionen internationaler Fernsehformate sind die Auseinandersetzungen mit amerikanischen Fernsehserien. Die zeitgenössische Fernsehserie ist prominentes Thema in der aktuellen Fernsehforschung, zahlreiche Publikationen und Sammelbände beschäftigen sich mit dem internationalen Erfolg von Fernsehserien (vgl. Blanchet et al. 2011; Eichner et al. 2013; Hammond/Mazdon 2011; Meteling et al. 2010; Rothemund 2013). Schwerpunkt sind meistens amerikanische Primetime-Serien wie »Dexter«, »Lost«, »Mad Men«, »The Sopranos«, »The Wire« und andere. Studien und Untersuchungen, Definitionen und Analysen zum amerikanischen Quality-TV gibt es sowohl im amerikanischen als auch im deutschen Sprachraum (Jahn-Sudmann/Kelleter 2012; Jahn-Sudmann/Starre 2013; McCabe/Akass 2007; Thompson 1996). Bedauerlicherweise wird selten Rekurs auf europäische Serien genommen, noch seltener werden diese, abgesehen von wenigen britischen Produktionen, in die Nähe des Quality-TV gerückt.
In Dänemark hat sich allerdings, ausgehend von den Universitäten in Aalborg, Aarhus und Kopenhagen, ein neuer Schwerpunkt gebildet, in dem fiktionale Medienprodukte im Kontext ihrer Produktion analysiert werden. So forscht beispielsweise Eva Novrup Redvall (2010) zum Wandel im dänischen Mediensystem durch die veränderte Ausbildung im Bereich der Dramaturgie und des Drehbuchschreibens. Das »Second Golden Age of Danish TV-Drama« (Dam 2012) wird in Dänemark momentan viel beachtet und diskutiert, eine internationale Perspektive – aus den Rezeptionsländern – fehlt indes noch. Für Pernille Nordstrøm (2004) zieht sich das erste goldene Zeitalter der dänischen Fernsehserie von 1994, dem Start von Lars von Triers »Riget« (»[Hospital der]Geister«), bis zu den aktuellen Fernsehserien, dem zweiten goldenen Zeitalter. In Stockholm gibt es unter der Leitung von Patrick Vonderau Ansätze einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Auf einer Konferenz mit dem Titel »Lights! Tystnad! Azione! Practices, Sites and Careers in European Film Production« wurde 2011 erstmals die Richtung der Production-Studies im europäischen Kontext vertieft und diskutiert. John Thornton Caldwells Buch »Production Culture« (2008) diente hierbei als Ausgangspunkt. Eine ausführliche Studie zur dänischen Serienproduktion, die auf teilnehmender Beobachtung und Interviews basiert, hat kürzlich Eva Novrup Redvall (2013) vorgelegt.
In Deutschland finden sich dagegen kaum Veröffentlichungen, die die Produktionsumgebungen von Medienprodukten im Fokus haben, noch viel seltener werden die Produktionsumstände und die Produktionen als solche mitsamt ihren visuellen, thematischen und dramaturgischen Interdependenzen berücksichtigt. Entweder gibt es die Produktion oder das Produkt, geflissentlich werden Wechselwirkungen ignoriert. Der Ansatz der Production-Studies, wie ihn beispielsweise Caldwell vertritt, findet bisher selten Beachtung, soll aber im Folgenden Berücksichtigung erfahren. Caldwell (2008) untersucht zum einen die während einer Produktion entstehenden Texte, die durch Partizipierende und Arbeitende der Medienbranche produziert werden und in denen diese sich selbst und die Produktionen reflektieren und analysieren. Zum anderen forscht er zum Zusammenhang und den Wechselwirkungen veränderter Produktionsweisen und der Ästhetik des Produkts, wie er ihn der Entwicklung des US-amerikanischen Fernsehens in den 1980er Jahren attestiert (vgl. Caldwell 1995). Dies dient u.a. in vorliegender Untersuchung als Anregung für eine neue Herangehensweise bei der Beobachtung der skandinavischen Entwicklungen.
Der Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Produktionssystem und dem Erfolg einer Medienproduktion darf nicht isoliert von anderen möglichen Erfolgsfaktoren betrachtet werden. Welche anderen Faktoren den Erfolg der skandinavischen Fernsehserien ausmachen, soll hier Beachtung finden. So wird auch eine kulturwissenschaftliche Perspektive mit einfließen, die die Wahrnehmung Skandinaviens in den Auswertungsländern umfasst.
Diese Untersuchung versucht, die skandinavischen Serien multiperspektivisch und in einer interdisziplinären Herangehensweise zu analysieren und zu verorten. Sowohl die Fernsehserien als künstlerische Produkte sollen bezüglich ihres Erfolgspotenzials, ihrer Alleinstellungsmerkmale und ihrer Nähe zum Quality-TV untersucht werden als auch die Voraussetzung, die eine solche Entwicklung erst ermöglicht: das Produktionssystem.
Im Folgenden werden wir zunächst kurz die Geschichte der Fernsehserien darstellen, bevor wir uns mit Fernsehserien als Quality-TV auseinandersetzen. Wie bereits erwähnt, wurde bisher der Produktionskontext von Fernsehserien, insbesondere die Autorenschaft, wenig beachtet. Daher schließt sich ein Kapitel zur Produktion von Fernsehserien im Kontext des globalen Fernsehmarktes an. Danach schildern wir ausführlich den skandinavischen Weg der Serienproduktion. Erfolgreiche skandinavische Fernsehserien werden beschrieben und ihre Besonderheiten analysiert. Die letzten Kapitel befassen sich mit dem internationalen Erfolg und mit der Adaption skandinavischer Fernsehserien vor allem in den USA. Das abschließende Kapitel behandelt die Etablierung von Scandinavian Crime und Nordic Noir als international erfolgreiche Marken. Die Geschichte des Erfolgs skandinavischer Fernsehserien ist damit jedoch längst nicht zu Ende. Die Fortsetzung folgt – im Fernsehen.
1 »Die Amerikaner erzählen gute Geschichten, modern erzählt und mit guten Charakteren. Warum sollten wir das nicht können?«
Eine kurze Seriengeschichte2
Fernsehserien kommen zwar nur im Fernsehen vor – auch wenn sie mittlerweile über sogenannte Video-on-Demand-Plattformen auf den heimischen Bildschirm gelangen, der nicht mehr notwendigerweise ein Fernsehgerät sein muss, sondern auch der Screen eines Laptops sein kann. Die Erzählweisen, die den Serien zugrunde liegen, haben allerdings Tradition (vgl. Mielke 2006). Serielle Erzählungen sind zunächst in oralen Kulturen nachweisbar, bevor sie nach der Erfindung des Buchdrucks auch in gedruckten Medien auftauchen. Bereits zu dieser Zeit wurden die Erzählungen teilweise mit Bildern verknüpft. Es entstanden Bilderserien, die zunächst in Zeitungen gedruckt wurden, bevor sie später als Comics eine eigenständige Mediengattung bildeten, von »Asterix« zu »Micky Maus«, von Cartoons bis hin zu japanischen Mangas. Die elektronischen Medien und der Film griffen die Erzählform auf. Während bereits in den 1910er Jahren Filmserials populär waren, wanderten die seriellen Erzählungen in den 1920er Jahren ins Radio, die sogenannte Radio-Soap war entstanden. Das Fernsehen griff auf diese tradierten Formen zurück, die Daily Soap und die Familien-, Krimi-, und Westernserien wurden geboren. Kaum hatte sich das Internet massenhaft durchgesetzt, wurden die sogenannten Webserien geboren, die in vielen kurzen Episoden ihre Geschichten erzählen. Gemeinsam ist den Serien in allen verschiedenen Medien die Art der Erzählung: das serielle Erzählen oder, wie es Christine Mielke (2006, S. 2) genannt hat, die zyklische-serielle Erzählform bzw. Narration.
»Hauptkennzeichen der zyklisch-seriellen Erzählformen im weitesten Sinne ist die Zusammengehörigkeit mehrerer Erzählungen oder Erzähleinheiten in einem real oder fiktional erkennbar gerahmten Modus, sei es durch eine Programmstruktur oder durch die Kommunikationsakte eines fiktionalen bis (massen-)medial vereinten Publikums. Ihre Hauptmotive sind der Tod und die Gemeinschaft, die als polare Gegensätze inszeniert werden, zwischen denen sich die literarische Darstellung eines lebensweltlichen Phänomens und seine vitale sprachliche Diskursivierung entspannt. Sowohl die Rahmenzyklen wie die Endlosserien erzählen von der Irreversibilität des Todes und den Gegenstrategien, die die poetische Sprache bietet. Ihre Funktion ist die Demonstration des Erzählens als Vorgang eines fiktionalen Weltentwurfs, als Ablenkung und krisenhafter Zeitvertreib in einer motivischen Verbindung mit einer Erzählgemeinschaft als Instanz und Garant der sozialen Weltkonstruktion« (ebd.).
Bereits Scheherazade hatte die Wirkung von Fortsetzungsgeschichten erkannt und zog damit den Sultan in ihren Bann, um ihren Tod aufzuschieben. Die Geschichten aus »Tausendundeine Nacht« gelten allgemein als Urform des seriellen Erzählens (ebd., S. 49 ff.; Mikos 1994a, S. 130). Sie enthalten die wesentlichen Merkmale: Es geht um Leben und Tod, den Urstoff dramatischer Geschichten, und es geht darum, das Publikum (den Sultan) an die Geschichte und seine Erzählerin zu binden. Heute »sind serielle Erzählverfahren Teil eines wechselseitigen Bedingungsgefüges von industriellen Produktions- und technischen Reproduktionsprozessen sowie nicht zuletzt Ergebnis eines Geschäftskalküls, das auf die langfristige Bindung breiter Rezipientengruppen an ein Produkt zielt« (Wedel 2012, S. 22). Zwar reicht die Geschichte der Fernsehserien bis in die Anfänge des Mediums zurück, doch bekommen sie im 21. Jahrhundert unter den Bedingungen der Digitalisierung und der dadurch ausgelösten Ausdifferenzierung von Sendern und Fernsehprogrammen bei gleichzeitiger Fragmentierung des Publikums eine noch wichtigere Rolle. Geht es doch für die Produzenten und Sender darum, in der Vielzahl der Fernsehkanäle Aufmerksamkeit zu generieren und das Publikum zu binden. Die Zuschauer, die von einer Serie fasziniert sind, schauen immer wieder zu – und das nicht nur im klassischen linearen Fernsehen, sondern auch auf DVD und BluRays sowie auf den Video-on-Demand-Plattformen und in Mediatheken. Für den ökonomischen Gewinn ist wichtig, dass die Zuschauer dabeibleiben, auf welchem Vertriebsweg auch immer.
Dieses Prinzip war bereits für die Zeitungen wichtig. Der sogenannte Feuilletonroman gilt als moderne Inkarnation seriellen Erzählens, auch wenn es zuvor schon Fortsetzungsgeschichten in der Kolportageliteratur des 17. Jahrhunderts gab, aus denen die heutigen Heftromanserien hervorgegangen sind. Doch erst im 19. Jahrhundert wurde die Serie zu einer dominanten Form der narrativen Präsentation (vgl. Hagedorn 1988, S. 5). Die Fortsetzungsgeschichten standen in den französischen Zeitungen im unteren Drittel der Seite, quasi im Erdgeschoss (Neuschäfer et al. 1986, S. 2). Honoré de Balzac war der Verfasser des ersten Feuilletonromans mit dem Titel »La Vieille Fille« (»Die alte Jungfer«), der im Oktober und November 1836 in der Tageszeitung La PRESSE erschien (vgl. Hagedorn 1988, S. 6; Schwendemann 1976, S. 262 ff.). Doch erst ein paar Jahre später erlebten die Fortsetzungsgeschichten eine wahre Blütezeit. Die wohl bekanntesten Feuilletonromane dieser Zeit sind »Les Mystères de Paris« (»Die Geheimnisse von Paris«) von Eugène Sue, »Le Comte de Monte-Cristo« (»Der Graf von Monte Christo«) von Alexandre Dumas und »Les Mystères de Londres« (»Die Geheimnisse von London«) von Paul Feval. Diese Romane dienten vor allem dem Zweck, die Auflage der Zeitungen zu steigern und mehr Abonnenten zu bekommen. Wie sehr diese Strategie zum Erfolg führte, lässt sich am Beispiel der Zeitung LE CONSTITUTIONNEL zeigen. Das Blatt kaufte nach dem großen Erfolg der »Geheimnisse von Paris« den Nachfolgeroman von Eugène Sue mit dem Titel »Le Juif errant« (»Der ewige Jude«). Damit konnte im Jahr 1844 die Auflage binnen kurzer Zeit von 3600 auf 22 130 Exemplare gesteigert werden (vgl. Thiesse 1984, S. 16). Das Phänomen beschränkte sich jedoch nicht nur auf Frankreich, sondern fasste auch in Deutschland und England Fuß. Denn schnell wurde erkannt, dass die Fortsetzungsgeschichten nicht nur für die in ihnen erzählte Geschichte warben, sondern auch für die Zeitung, die sie veröffentlichte.
Interessanterweise spielen serielle Erzählungen immer dann eine große Rolle, wenn neue Medien den alten Konkurrenz machen. Darauf hat Roger Hagedorn (1988, S. 5) hingewiesen, der mit der Rolle der Eigenwerbung erklärt, »why serials appear in a particular medium precisely at that period when the real rival is not so much another serial in the same medium, but another medium«. Damit ließe sich erklären, warum der US-Kabelsender HBO um die Jahrtausendwende mit seinen hochwertigen Serien Marktanteile gewann. Damit ließe sich auch erklären, warum gegenwärtig vor allem Fernsehserien produziert werden: Das Fernsehen muss sich gegen die Konkurrenz des Internets wehren und kann eben mit den Fortsetzungsgeschichten Zuschauer binden. Im Internet wiederum wird versucht, mit Webserien eine Nutzerbindung herzustellen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten die Filmproduzenten mit ersten Serials das Publikum in die Kinos zu locken. Dabei standen drei Genres im Mittelpunkt. Vor allem in Frankreich und den USA gab es Filmserials mit populären Komikern, z.B. die »Boireau«- und die »Bébé«-Serien in Frankreich oder die Serials mit Charlie Chaplin und Buster Keaton in den USA (vgl. Wedel 2012, S. 23). Daneben waren es vor allem Krimi- und Detektivserials wie die »Nick-Carter«-Serie in Frankreich. Auch in Deutschland gab es Detektivserien um die Figuren Joe Deebs und Harry Higgs (ebd., S. 24). In den USA erblickten Westernserials die Leinwände. Von »Broncho Billy« wurden zwischen 1907 und 1916 insgesamt 376 Episoden gedreht. Außerdem versuchte man gerade in den USA, mit einer »Mischung von Erotik, Verbrechen und Gewalt« (ebd.) – die Filmserials »What Happened to Mary« und »The Hazards of Helen« seien hier beispielhaft genannt – das Publikum zu locken. Die dramatische Erzählung wurde am Ende jeder Episode mit einem sogenannten Cliffhanger beendet, d. h., die Handlung wird in einem besonders spannenden Moment unterbrochen und erst in der darauffolgenden Episode fortgesetzt. Damit sollen die Zuschauer wieder ins Kino gelockt werden. Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre hatten sich die langen Featurefilme als Hauptattraktion in den Kinos durchgesetzt, die Serials gerieten zwar nicht in Vergessenheit, wurden aber in den Hintergrund gedrängt. Diese Entwicklung fiel in eine Zeit, als es einerseits mit der Einführung des Tonfilms einen Umbruch in der gesamten Filmindustrie gab und andererseits sich mit dem Radio ein neues Medium anschickte, zum Massenmedium zu werden. Die erste Radioserie »Amos ’n’ Andy« ging 1929 in den USA auf Sendung. Die Werbeindustrie hatte da bereits das ökonomische Potenzial der Serien erkannt. So ist es kein Wunder, das »Amos ’n’ Andy« zunächst von Pepsodent Zahnpasta (bis 1937) und danach von Campbell Suppen gesponsort wurde. Vor allem Hausfrauen wurden als Zielgruppe der Radioserials gesehen, sodass vor allem Firmen aus dem weiten Bereich der Haushaltsartikel als Sponsoren in Erscheinung traten. Eine der erfolgreichsten Serien im Radio war »Ma Perkins«, deren Geschichte von 1933 bis 1960 in 7 065 Episoden erzählt wurde. Gesponsort wurde sie vom Waschmittel- und Seifenhersteller Procter & Gamble (vgl. Mielke 2006, S. 494). Auch die Konkurrenz Colgate-Palmolive sponsorte Radioserials. Das führte u. a. dazu, dass dieses neue Genre auch als »Soap-Opera« bezeichnet wurde (vgl. Cantor/Pingree 1983, S. 37). Die 1930er und 1940er Jahre waren die Blütezeit der Radioserials. In den 1950er Jahren ging deren Ära langsam zu Ende, die großen Networks hatten Anfang der 1960er Jahre kaum noch Radio-Soaps im Programm.
Diese Entwicklung wurde vor allem durch die Konkurrenz eines neuen Mediums hervorgerufen. Das Fernsehen stand in seinen Startlöchern. Da die Filmindustrie in Hollywood dem Fernsehen zunächst skeptisch gegenüberstand, ergaben sich große Chancen für neue Produzenten. So gründete Procter & Gamble zu Beginn der 1950er Jahre eine eigene Produktionsfirma, die Fernsehserien produzierte (ebd.). Einige der von dem Konzern unterstützten Radioserien wie »Guiding Light« wurden nun von der eigenen Produktionsfirma für das Fernsehen adaptiert. Die Serie war bereits 1937 im Radio gestartet und lief von 1952 bis 2009 mit über 15 000 Episoden. Die erste Fernsehserie kam ohne Sponsoring aus. »A Woman to Remember« wurde von Februar bis Juli 1949 auf DuMont Television ausgestrahlt und war ebenfalls eine Adaption aus dem Radio. Derartige Soaps werden noch heute für das Tages- und Vorabendprogramm produziert, wie man auch in Deutschland am Beispiel von »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« und »Verbotene Liebe« sehen kann. Für diese Programmschiene wurden neben den Soaps auch Tierserien wie »Flipper«, »Fury« oder »Lassie« produziert.
Das Abendprogramm in den USA sah etwas anders aus. Hier wurden Westernserien wie »Bonanza«, »Gunsmoke« (»Rauchende Colts«) oder »High Chaparral« ausgestrahlt. Auch »Star Trek« (»Raumschiff Enterprise«) lief drei Jahre lang auf NBC am Abend. Die Serie erlebte später noch weitere Neuauflagen und wird aktuell noch immer als Kinoserial vermarktet. Daneben bevölkerten vor allem Krimiund Detektivserien die abendlichen Bildschirme: »Perry Mason«, »77 Sunset Strip«, »The Fugitive« (»Auf der Flucht«), »I Spy« (»Tennisschläger und Kanonen«), »The Persuaders« (»Die Zwei«), »The Streets of San Francisco« (»Die Straßen von San Francisco«) und »Kojak« (»Kojak – Einsatz in Manhattan«). Viele dieser Serien waren auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Dort lief »Der Kommissar« ab 1969 erfolgreich als eigenproduzierte Abendserie. Auch in Großbritannien liefen viele der US-Serien, doch hatten die Briten z.B. mit »The Avengers« (»Mit Schirm, Charme und Melone«) ebenfalls eigenproduzierte Serien im Programm.
Krimi- und Detektivserien sind nach wie vor im Abendprogramm präsent. Doch in den späten 1970er und in den 1980er Jahren veränderte sich die Serienlandschaft am Abend (vgl. Mikos 1994a, S. 133 f.). Einerseits wurden literarische Adaptionen als Miniserien realisiert, die an aufeinanderfolgenden Abenden gesendet wurden, z.B. »Roots« (1977) und »Holocaust« (1978), andererseits wurden nun auch am Abend Familienserien gezeigt, die allerdings Elemente aus anderen Genres wie Krimi oder Western integrierten. Dominierten im Nachmittagsprogramm die positiven Elemente des Familienlebens, so zogen mit den neuen PrimetimeSerien dysfunktionale Familien in die Fernsehunterhaltung ein. Für diese Familien diente die Ideologie der heilen Familie nur noch als moralische Folie, um die Bedeutung der Intrigen und Streitereien besonders hervorzuheben. »Dallas« und »Dynasty« (»Denver-Clan«, vgl. ebd., S. 214 ff.) waren nicht nur in den USA, sondern weltweit sehr erfolgreich. Diese beiden Serien bilden eine Zäsur im Verständnis von Serien auf mehreren Ebenen:
»Ihre episch mäandernden, tendenziell ins Unendliche gerichteten Erzählungen erreichten eine zuvor nicht für möglich gehaltene Komplexität. Das Muster der Familiensoap revolutionierten sie nachhaltig, indem sie ihre – moralisch teils fragwürdigen – Figuren in psychologische und soziale Grenzsituationen trieben, auf Spannungseffekte und Actionszenen setzten, bei denen nicht wenige Protagonisten überraschend auf der Strecke blieben. Genreelemente wurden miteinander vermischt, die bis dahin strikt voneinander getrennt waren. Als spiegelbildliche Konkurrenzprodukte prägten beide Serien mit ihren Stars, ihrem Ambiente und ihrem distinkten Look das Image ihrer Sender und lenkten so die Aufmerksamkeit auf das hohe Identifikationspotenzial einer Premiumserie mit dem sie umgebenden Programm« (Wedel 2012, S. 26).
Während in den USA das Network CBS mit »Dallas« den ersten Erfolg landete, zog ABC später mit »Dynasty« nach. In Deutschland konkurrierten diese beiden Serien in der ARD und im ZDF miteinander, auch wenn sie nicht direkt gegeneinander programmiert waren. Wie Rezeptionsstudien zeigen, tendierten die Zuschauer dazu, entweder die eine oder die andere Serie zu verfolgen (vgl. Mikos 1994a, S. 309 ff.). Wer »Dallas«-Fan war, konnte nicht auch »Dynasty«-Fan sein. Die 1980er Jahre gelten in den USA als das zweite goldene Zeitalter des Fernsehens, während das erste im Wesentlichen in den 1950er Jahren die Fernsehwelt veränderte (Thompson 1996; vgl. auch Eichner 2013). Innovative Serien erblick ten das Licht der Bildschirme. In der NBC-Serie »Hill Street Blues« (»Polizeirevier Hill Street«) wurden mehrere Handlungsstränge verknüpft, die auch nicht innerhalb einer Episode aufgelöst wurden, sondern sich über mehrere Folgen erstrecken konnten. Das Privatleben der Polizisten wurde ebenso wichtig wie ihre Arbeit als Ermittler. Die Serie faszinierte vor allem wegen ihrer realistischen Darstellung des Polizeialltags. Das Privatleben der Ermittler spielte auch in »Miami Vice« eine Rolle, die Serie bestach jedoch vor allem durch ihren visuellen Stil, der sich sehr am Kino orientierte. In »Moonlighting« (»Das Model und der Schnüffler«) war Selbstreflexivität ein Thema. Immer wieder wurde in den Dialogen über die eigene Handlung gesprochen. Mehr und mehr starke Frauenrollen tauchten in den Fernsehserien der 1980er Jahre auf. Waren in Serien wie »Dallas« Frauen noch eher als schönes, attraktives Beiwerk der agierenden Männer inszeniert, änderte sich dies in Serien wie »Cagney & Lacey« und »Moonlighting«. Die beiden Polizistinnen in »Cagney & Lacey« standen im Zentrum der Handlung und agierten sehr selbstbewusst. Zudem waren direkte Adressierungen der Zuschauer an der Tagesordnung. Die Neuerungen des zweiten goldenen Zeitalters setzten sich bis Mitte der 1990er Jahre fort. In »Emergency Room«, kurz »ER« genannt, wurde der Realismus des Krankenhausalltags thematisiert. In dieser Zeit starteten in den Serien auch die Karrieren einiger Hollywood-Schauspieler wie George Clooney und Bruce Willis. Die filmische Erzählweise wurde vor allem von David Lynch in seiner Serie »Twin Peaks« auf die Spitze getrieben. Hier deutete sich auch bereits ein Trend zum Mystischen an, der in den 1990er Jahren mit Serien wie »X-Files« (»Akte X«) und »Buffy – the Vampire Slayer« (»Buffy – Im Bann der Dämonen«) einen Höhepunkt erreichte. All diese Serien setzten neue Qualitätsmaßstäbe im Hinblick auf filmische Ästhetik, realistische Erzählweisen und die Verknüpfung von Handlungssträngen, die über mehrere Episoden hinweg erzählt wurden. Für diese Art von Serien wurde der Begriff »Quality-TV« geprägt (vgl. Thompson 1996, S. 13 ff.). Realismus, filmische Ästhetik, ein Genremix und ein Ensemble von Haupt- und Nebenfiguren machen diese Qualitätsserien aus.3
Seit der Jahrtausendwende kann man sicherlich vom dritten goldenen Zeitalter des Fernsehens in den USA sprechen. Es ist vor allem der Kabelsender HBO, der für den neuen Schub in der Serienlandschaft verantwortlich ist. Der Sender wollte seinen zahlenden Abonnenten mehr als nur Filme bieten und begann Ende der 1990er Jahre mit der Produktion eigener hochwertiger Serien (Edgerton 2008, S. 10 ff.). Vor allem mit drei Serien sorgte HBO für Aufsehen: das Gefängnisdrama »Oz«, die Mafiaserie »The Sopranos« und die Comedyserie »Sex and the City«. Die Themen der Serien wurden ungewöhnlicher, die Erzählweisen komplexer, der Realismus der Darstellung spielte wie in »The Wire« eine große Rolle. Daneben wurden zahlreiche Genres bedient, z.B. der Western (»Deadwood«), das Vampirgenre (»True Blood«), die Fantasy (»Game of Thrones«) und erneut die Mafiaserie mit »Boardwalk Empire«, in der es vor allem um die Verquickung von Politik und organisiertem Verbrechen geht. Andere Kabelsender wie Showtime und AMC zogen mit eigenen Produktionen nach. Auf diese Weise entstanden einige Serien, die sehr erfolgreich waren bzw. sind: »Californication«, »Dexter«, »The Tudors«, »Weeds« und »Homeland« bei Showtime, »Breaking Bad«, »Mad Men« und »The Walking Dead« bei AMC. Doch auch die großen Networks produzierten Serien, die dem neuen Quality-TV zugerechnet werden können. ABC war zuallererst mit »Lost«, aber auch mit »Desperate Housewives« und »Grey’s Anatomy« erfolgreich. NBC setzte lange auf »Law & Order: Special Victims Unit«, bevor dann im Jahr 2013 mit »Hannibal« und »Crossing Lines« zwei ambitionierte Serien gesendet wurden. CBS setzte vor allem auf die verschiedenen »CSI«-Versionen und »Navy CIS«, die abgesehen von der Inszenierung forensischer Details eher konventionell erzählt sind. Mit der Serie »24« konnte der Sender Fox eine neuartige Erzählweise etablieren, indem die Handlung gewissermaßen in Echtzeit erzählt wird und alle nur erdenklichen filmischen Mittel der Spannungserzeugung eingesetzt werden (vgl. Mikos 2008, S. 339 ff.). Auch wenn die Erzählweisen komplexer geworden sind, die Ästhetik sehr viel filmischer ist als noch in den 1970er Jahren, zeigt sich doch eine gewisse Kontinuität »der Milieus, Stoffkreise und Figurenkonzepte« (Wedel 2012, S. 27), die seit den frühen Tagen des Feuilletonromans und der frühen Filmserials existieren. Das serielle Erzählen ist mit den neueren US-amerikanischen, aber auch mit einigen skandinavischen, vor allem dänischen Serien – wie noch zu zeigen sein wird – auf eine neue Qualitätsstufe gehoben worden.
Diese Entwicklungen haben sich in Deutschland nur marginal auf die Produktion von Fernsehserien ausgewirkt. Während der Erfolg der US-Serien aus dem zweiten goldenen Zeitalter auch auf deutschen Bildschirmen noch dazu führte, dass ab Mitte der 1980er Jahre vermehrt eigenproduzierte Serien gesendet wurden, gingen sowohl die komplexeren Erzählweisen als auch die filmische Ästhetik und der Realismus der Darstellung weitgehend am deutschen Fernsehen vorbei. Lediglich wenige Serien wie »Abschnitt 40«, »KDD – Kriminaldauerdienst« und »Allein gegen die Zeit« (eine Adaption von »24« für ein jugendliches Publikum, die auf KiKA gezeigt wurde) konnten den erzählerischen und ästhetischen Ansprüchen genügen, die durch die neueren US-Serien als Qualitätsmaßstab für serielles Erzählen etabliert worden waren.
Nach dem Erfolg von »Dallas« und »Denver-Clan« in der ARD und im ZDF begann eine verstärkte Eigenproduktion von Serien für die Primetime, das Hauptabendprogramm. Mit der Krankenhausserie »Die Schwarzwaldklinik« konnte das ZDF zahlreiche Zuschauer gewinnen. Die Serie hatte gegenüber einer anderen erfolgreichen ZDF-Serie, »Diese Drombuschs«, den Vorteil, dass sie regelmäßig wöchentlich zu festen Zeiten gesendet wurde. Mit »Das Erbe der Guldenburgs« wurde versucht, die intriganten Machenschaften von Familienclans, wie sie aus den US-amerikanischen Serien bekannt waren, auf Deutschland zu übertragen, indem eine zerstrittene Brauerei-Dynastie ins Zentrum der Erzählung gestellt wurde. Die ARD hatte wenig Erfolg beim Versuch, mit »Rivalen der Rennbahn« diesen Trend aufzugreifen. Stattdessen setzte man eher auf konventionelle Genres wie die Anwaltsserie (»Liebling Kreuzberg«) und reicherte Ermittlerserien mit Action an (»Peter Strohm«). Im ZDF hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits der Krimifreitag etabliert, der mit eher altbackener Krimiware wie »Derrick« und »Der Alte« sowie einer Kombination aus Anwalts- und Detektivserie (»Ein Fall für zwei«) die Zuschauer lockte. Bei der Entwicklung neuer Serien ging der Blick jedoch nicht nur in die USA, sondern auch nach Großbritannien. In der britischen Serie »Coronation Street«, die seit 1960 läuft, wird das alltägliche Leben der Bewohner einer Straße in einem fiktiven Ort gezeigt. Die Serie lebt vom großen Ensemble der Bewohner und ihrer verschiedenen Lebensentwürfe. Bereits 1970 hatte das dänische Fernsehen mit »Huset på Christianshavn« eine Serie entwickelt, die sich an dem britischen Vorbild orientierte (Redvall 2013, S. 44). In Deutschland nutzte man dies erst Mitte der 1980er Jahre, als die »Lindenstraße« im Dezember 1985 auf Sendung ging. Auch hier wird das Alltagsleben eines großen Ensembles von Bewohnern einer Straße geschildert. Aufgrund des umfangreichen Arsenals an Figuren können zahlreiche Handlungsstränge miteinander verwoben werden, die sich dann über viele Episoden erstrecken (vgl. Mikos 1994a, S. 235 ff.). Am Ende jeder Episode gibt es einen bereits aus der US-amerikanischen Soap-Produktion bekannten Cliffhanger, um die Spannung bis zur Ausstrahlung der nächsten Folge aufzubauen.
Bis in die 1980er Jahre hinein war die Serienproduktion in Deutschland sehr an den Konventionen und Themen orientiert, die aus den amerikanischen Produktionen für das Tagesprogramm bekannt waren: Familien und Tiere. »Unsere Nachbarn heute Abend – Familie Schölermann« lief immerhin von 1954 an sieben Jahre in unregelmäßigen Abständen im Ersten Programm (vgl. ebd., S. 129 f.). Die »Familie Hesselbach« war die Adaption eines erfolgreichen Radioserials. Auch in der Tierserie »Alle meine Tiere« stand eine Familie im Mittelpunkt der Erzählung. Diese Serien und andere erfolgreiche Familienserien wie »Salto Mortale«, die im Zirkusmilieu angesiedelt war, und »Die Unverbesserlichen« zeichnete aus, dass es für sie noch keinen regelmäßigen wöchentlichen Sendeplatz gab. Die einzelnen Episoden dieser Serien wurden einmal im Monat oder gar vollkommen unregelmäßig gesendet. In Zeiten eines öffentlich-rechtlichen Monopols, in dem es nur zwei Sender gab, schalteten die Zuschauer auch ein, ohne dass man sie extra an den Sender binden musste. Das änderte sich erst in den 1980er Jahren, als die Deregulierung des Rundfunkwesens zur Einführung privat-kommerzieller Fernsehsender führte und damit die Konkurrenz um die Gunst des Publikums größer wurde.
Die 1960er und 1970er Jahre hielten bereits zwei Beispiele bereit, die die transnationale Adaption von Fernsehserien vorwegnahmen. Inzwischen haben sie einen großen Stellenwert, wie die zahlreichen US-Adaptionen von dänischen, schwedischen und israelischen Serien zeigen (vgl. Weissmann 2012, S. 190 f.). Im Allgemeinen wurden damals lediglich in anderen Ländern produzierte Serien im deutschen oder britischen Fernsehen gezeigt. Bereits Ende der 1950er Jahre gab es in Deutschland mit »Stahlnetz« die Adaption einer US-Serie, »Dragnet« lief in den USA ab 1951 im Fernsehen und war eine Adaption aus dem Radio. In den 1970er Jahren war »Ein Herz und eine Seele« sehr erfolgreich. Die von Wolfgang Menge geschriebene Comedyserie mit Alfred Tetzlaff als Hauptfigur war eine Adaption der englischen Serie »Till Death Us Do Part« mit Alf Garnett als zentralem Charakter. Neben der deutschen gab es auch eine amerikanische Adaption (»All in the Family«, ebd., S. 22). Ein Jahr nach dem Beginn von »Ein Herz und eine Seele« wurde dann die amerikanische Version in den Dritten Programmen der ARD gezeigt. Hier zeigt sich, dass es bereits in der Zeit des öffentlich-rechtlichen Monopols im deutschen Fernsehen zu Adaptionen erfolgreicher Serien aus Großbritannien und den USA kam – wenn auch nur vereinzelt.





























