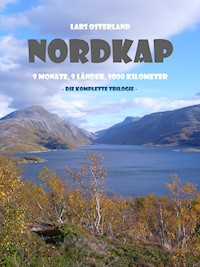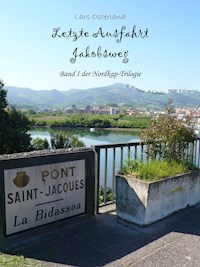Nordkap - Band III der Nordkap-Trilogie - 9 Monate, 9 Länder, 9000 Kilometer E-Book
Lars Osterland
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Nordkap
- Sprache: Deutsch
Lars, der vor einem knappen halben Jahr in Barcelona aufgebrochen ist, hat mittlerweile Deutschland erreicht und ist noch immer nicht gewillt, seinen Traum, den europäischen Kontinent zu Fuß zu durchqueren, aufzugeben. Wird er sein Ziel, das Nordkap, erreichen? Dies ist der abschließende Band nach "Letzte Ausfahrt Jakobsweg" und "Lied vom stillen Sommernachtstraum". Band III: Lars kommt durch Skandinavien, wandert dabei über verschiedene dänische Inseln, durch schwedische Wälder und auf dem Olavsweg von Oslo nach Trondheim. Von da an geht es entlang der Fjorde, über die Polargrenze und immer weiter hinauf in den arktischen Norden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1209
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lars Osterland
Nordkap - Band III der Nordkap-Trilogie - 9 Monate, 9 Länder, 9000 Kilometer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Hamburg – Kopenhagen
2. Kopenhagen – Göteborg
3. Göteborg – Oslo
4. Oslo – Hamar
5. Hamar - Trondheim
6. Trondheim – Brønnøysund
7. Brønnøysund - Lofoten
8. Lofoten – Tromsø
9. Tromsø – Nordkap
Danksagung
Hinweis
Impressum neobooks
1. Hamburg – Kopenhagen
Viertel sieben stehe ich auf. Wie in Amsterdam fahren hinter dem Park die Züge zum nahegelegenen Hauptbahnhof. Wie in Amsterdam hoppeln die kleinen Häschen durch den Park. Ich packe zusammen und stehe hundert Meter weiter bereits auf der Lombardsbrücke zwischen Binnenalster und Außenalster. Ich entscheide mich für das Ufer des viel kleineren Sees, der Binnenalster, um meinem Tagebuch von meinem Fehltritt zu beichten. Aber auch meinem Tagebuch gegenüber verschweige ich die Details, ganz ohne Scham geht es dann doch nicht. Es ist ein grauer Morgen, offensichtlich dürfte im Laufe des Tages noch Regen fallen. Es ist auch recht frisch und zu guter Letzt ist da noch der große Verkehr. Weg ist die Gemütlichkeit von den beiden Abenden und Nächten zuvor. Ich bin etwas niedergeschlagen. Auch weil ich begreife, dass ich bald die Quittung dafür bekommen werde, dass ich mit meinen ohnehin geringen Geldreserven nicht besser haushalte … im Gegenteil, weil ich es offenbar für nötig erachte, diesen Weg nur als einen selbstzerstörerischen Weg zu beschreiten. Und deswegen das Geld in alle Richtungen zerstreue, in Bier, in Zigaretten, in Kaffee, in Prostituierte, in Kinos, in Zeitungen … all diese Dinge, die man nicht braucht … die einem nur im Weg stehen und die doch notwendig sind, um sich wieder aufrichten zu können, nachdem man gefallen ist. Denn keine Weisheit auf dieser Welt ist nicht aus Schmutz geboren. Tauche ab und komme wieder zurück, atme ein und atme aus. Ich bilde mir ein, dass ich kein Geld brauche um den rechten Pfad zu beschreiten, ich bilde mir allerhand ein, doch an Geld klebt auch immer etwas Schmutz und erst wenn ich es losgeworden bin, kann ich etwas finden, wo ich noch nicht einmal weiß was das überhaupt sein soll.
Da es mir anscheinend nicht mehr genügt, einfach nur am Wasser zu sitzen, bin ich wenig später schon wieder in einem Café-Freisitz, auf dem nahen Ida-Ehre-Platz … keine Ahnung, der fünfte oder sechste Cafébesuch in Hamburg bereits. Ich denke nicht darüber nach, was das alles zusammen kostet beziehungsweise gekostet hat, ich lass mich einfach nur treiben, zu den angenehmen, wohligen Dingen des Lebens … wie ein kleiner, verschüchterter Junge am Rocksaum seiner Mutter. Sitze hier, ohne ein Gefühl von Buße, zwischen den beiden Hauptkirchen Sankt Petri und St. Jacobi. Hier kam ich zuvor noch nicht lang, es gibt immer wieder Neues in Städten zu entdecken, nicht wirklich Erbauliches, aber immerhin neu und unbefleckt. Ich sehe fleißige Männer die Mülleimer absuchen, nach Flaschen- und Dosenpfand. In Hamburg gibt es viel Flaschenpfand, vor allem im Zentrum, zumal wenn gerade noch ein Fest wie das Duckstein-Festival stattfindet. Flaschenpfandsammeln ist ein harter Beruf, ein schlechtbezahlter, ein Beruf bei dem man schmutzig wird und dem Frauen noch etwas skeptisch gegenüberstehen. Ich sehe nie Frauen die Mülleimer abklappern. Vielleicht ist es Würde, vielleicht Stolz, vielleicht beides. Sie machen andere Jobs. Von den Männern mit ihren bunten Tüten voller Pfandflaschen abgesehen, ist es ein grauer, trostloser Morgen. Vorhin bin ich bei Scientology vorbei, sie schlafen noch, ich vermute vor zwölf steht da keiner in der Zentrale. Auch bei Occupy war es noch ganz ruhig, die Zelte wild durcheinander auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz und vor Sonnenaufgang geschieht hier wohl nie etwas, ähnlich wie in Den Haag. Am Thalia Theater wird später in diesem Jahr noch Platonov gespielt, eine gute Wahl. Ein Glockenspiel erklingt von dem Haus, wo das Café untergebracht ist … offensichtlich für mich, für mich allein, denn ich bin hier ganz allein. Es wird Zeit, dass ich nach Nordosten blicke, denn in diese Richtung muss ich die Stadt verlassen, denn mein nächstes größeres Ziel ist Lübeck. Ja, es reicht jetzt in Hamburg. Ich war über 30 Kilometer zu Fuß in der Stadt unterwegs, ich brauch endlich wieder etwas mehr Luft, mehr Platz, mehr Weiden, mehr Asphalt (statt Pflaster). Doch Hamburg ist groß und meine Moral ist unten, wenn ich daran denke, stundenlang durch Hamburger Außenbezirke und Vororte zu laufen. Ich mache es mir leicht, gehe zum nahen Hauptbahnhof und tausche die Bonuskilometer, die ich in Hamburg gesammelt habe, gegen ein Zugticket zum ersten etwas größeren Ort außerhalb der Stadt ein, nach Bad Oldesloe. Drei Gleise weiter steht ein Zug nach Leipzig. Mir wird bewusst, dass ich hier, an diesem Meilenstein, der Heimat so nah wie noch nirgendwo anders bin, von hier ist es wirklich nur ein kleiner Impuls … ein kleiner Schritt Richtung Heimat … und anders als am Anfang dieser Reise hätte ich auch diesmal das Geld, um mir das Rückticket zu besorgen, hier und jetzt … zurück in mein altes Leben … ein Bad, eine Rasur, meine Familie, meine Tochter … ja, Heimat … ist sie denn wirklich dort an diesem Ort, der mir genauso fremd ist wie alle anderen Orte und Plätze dieser Welt? Ich blicke am Gleis mit dem ICE nach Leipzig vorbei, zu einem Bildschirm, der die Abfahrtzeiten der nächsten Busse anzeigt … einer nach Alicante, ein anderer nach Barcelona … die Anfänge dieser Reise … und das hier ist noch nicht das Ende.
Ich trudle zehn Uhr in Bad Oldesloe ein. Es sind etwa 25 Kilometer nach Lübeck, mein heutiges Tagesziel. Ich möchte den Abend und die Nacht in der Buddenbrooks-Stadt verbringen, auch deshalb diese kleine Schummelei … und auch, um nicht einen weiteren Tag zu verlieren. Von hier aus muss ich einfach nur immer der Trave folgen, die durch beide Städte fließt. Fürs Erste möchte ich mir aber den Ort anschauen, gehe rüber zum Kurpark, wo alles von der Nacht her recht feucht ist und ich weit und breit der einzige Mensch bin. Ich kaufe etwas Proviant im Penny und gehe rüber zum Ehrenfriedhof, mit einem alten Kriegsgräberdenkmal. Ich möchte eine rauchen und muss dabei feststellen, dass ich die neue Packung Pall Mall kurz nach dem Kauf irgendwo auf dem Weg hierher verloren haben muss. Ich gehe den Weg zurück zum Penny, etwas panisch den Boden absuchend, doch die Schachtel ist weg und ich ärgere mich maßlos. Ja vielleicht ist es ein Zeichen von oben, dass ich lieber aufhören sollte. Mit dem Rauchen, mit der Faulheit, mit der Verschwendung, mit dem Überfluss. Doch nein, ich akzeptiere meinen Verlust nicht und ich akzeptiere auch keine Zeichen. Laufe die Strecke ein zweites Mal ab, wieder nichts. Ein drittes Mal, bis ich wieder in dem kleinen Park am Kriegsgräberdenkmal stehe … und ja, im nassen Rasen liegt die Schachtel … mein bis dahin rasender Puls verschafft sich Luft … Erleichterung, durchatmen … und diese Aufregung wegen einer Schachtel Kippen … Außerhalb des Zentrums sieht man so gut wie keine Leute, ich gehe rüber in die kleine Altstadt, wo man Menschen findet, doch die Jüngsten unter ihnen sind doppelt so alt wie ich. Um das kleine Zentrum der Stadt fließt die Trave, einmal ringsherum, ganz nett und trotzdem irgendwie nicht besonders aufregend. Auf dem Markt haben ein paar Stände geöffnet, von einem Hügel aus grüßt die Peter-Paul-Kirche. Ich steuere einen Italiener an. Es ist merkwürdig, in Deutschland will es mir nicht so recht gelingen, einen Markt zu betreten, ohne gleichzeitig den Drang zu verspüren, mich in irgendeinen Café-Freisitz zu setzen. Es ist wie ein Automatismus: Markt ist gleich Kaffeetrinken. Völlig bescheuert, aber wie schnell man selbst auf Reisen in Routine verfällt. Dabei ist es weiterhin völlig ungemütlich, die Sonne weiter verborgen, sogar ein paar Tropfen fallen zwischendurch. Die Rechnung geht nicht auf, unbewusst denke ich mir, dass vielleicht ein Café-Besuch meine schwermütigen Gedanken verdrängt, doch an einem Tisch zu sitzen hat noch nie gegen Schwermut geholfen. Ein Café-Besuch funktioniert nur dann, wenn man euphorisch ist, wenn man bereits mit Euphorie im Gepäck den kleinen Tisch unter dem großen Schirm ansteuert. Der Milchkaffee schmeckt wie immer und doch schmeckt er heute wie die Zahnpasta am Morgen, nach Nichts, nach nichts was Geschmacks- und Geruchssinn inspiriert. Es schmeckt nach Gewohnheit, lauwarm und fad. Zweieurofünfzig nicht gegen die innere Trägheit, sondern im Namen dessen. Sich Gutes tun funktioniert nicht ohne Mühen. Und ich bemühe mich zurzeit nicht sonderlich. Ich habe das Gefühl in den letzten beiden Wochen extrem gealtert zu sein, den Wohlstand und das Leben genießend. Ich bin der Jüngste und Faulste weit und breit, ich weiß es und es stört mich, dass es mir nicht besonders schwerfällt, dies zu akzeptieren.
Ich bezahle endlich, schnappe mein Zeug, breche auf. Zum Abschied fragt mich eine Frau, wo denn meine Begleitung sei. Ich hätte keine, sage ich. „Aber so allein reisen, da haben sie doch nichts zu erzählen.“ Ich glaube sie liegt falsch, aber wer weiß das schon so genau. In einem Punkt hat sie jedoch recht, es wird niemals in Zukunft jemanden geben, der an meiner Seite sagt: „weißt du noch, als WIR …“ Ja, das wird es nicht geben. Ich verlasse Bad Oldesloe auf dem Fahrradweg neben der B75. Am Wegesrand stehen ein paar Himbeersträucher, die ersten reifen Früchte, rot und süß. Ein paar Meter weiter probiere ich auch von den Heidelbeeren, blau und sauer. Es bringt mir eine gewisse Freude, nach den Beeren zu schauen, ein paar reife Früchte zu pflücken und diese direkt zu verspeisen. Der Radweg endet schließlich und so muss ich erstmals in Deutschland auf der Straße weiter. Unangenehm, denn die Bundesstraße ist recht schmal, ähnlich wie in Frankreich, und viele Laster sind unterwegs. Doch ich habe Glück, der Radweg taucht nach nur ein paar hundert Metern wieder auf, was gut ist, denn hier auf der Hauptverkehrsstraße zwischen den Orten ist es vielleicht dann doch etwas zu gefährlich, nicht für mich, eher für die Trucker. Ich erreiche Reinfeld, es fallen einige wenige Tropfen. Die Kleinstadt zieht sich entlang der B75 weiter als gedacht, ich beschließe den Straßenlärm für einen Moment hinter mir zu lassen und spaziere rüber zum Herrenteich, einem langgezogenen See, der dabei entstand, als Mönche im Mittelalter die Heilsau stauten. Es ist ganz nett hier, trotz Nieseln lädt der See zu einer Pause auf einer Bank ein.
Auf einer kaum befahrenen Dorfstraße verlasse ich Reinfeld und werde dabei wenig später von einem Schauer überrascht, doch kleine Dorfstraßen haben in der Regel den Vorzug, dass neben ihnen Bäume stehen, bei denen man Schutz findet. Ich bin gut drauf, auf einmal. Ich denke der Grund dafür ist recht einfach zu erklären, denn ich bin in diesen Nachmittagsstunden fast so etwas wie wieder zurück in der Spur. Passend zeigt sich auch hinter der grauen Wolke bereits so etwas wie blauer Himmel … doch, ich freue mich … ich freue mich auf meinen ersten Besuch in Lübeck. Im Dorf Ratzbek werde ich von der Sonne begrüßt … und wenig später wieder ein Schauer … ein nettes Wechselspiel, langweilig wird es so nicht … diesmal schützt mich auf altbewährte Weise ein Bushaltestellenhäuschen. Es ist bereits 17 Uhr und auf der Suche nach dem richtigen Weg gehe ich etwas in die Irre, das ist zwar recht schwierig, denn es gibt nur eine einzige Straße in Ratzbek, aber ja, es ist möglich und ich gehe in die falsche Richtung. Vielleicht habe ich auch gehofft, der B75 aus dem Weg gehen zu können, aber sie ist am Ende dann doch die einzige Option. Immerhin bringt der Radweg Sicherheit und auch die Sonne zeigt sich wieder. Ich bin mittlerweile auch im vierten Bundesland meiner Deutschland-Tournee angekommen, in Schleswig-Holstein.
Lübeck empfängt mich gnädig. Ich stehe am Stadtgraben und blicke auf das Wahrzeichen der Stadt, auf das Holstentor, flankiert von den Kirchtürmen der Marienkirche und Petrikirche. Diese Postkartenansicht auf die Stadt würde schon völlig reichen, um wenigstens einmal im Leben die Stadt zu besuchen. Der Gang in die Altstadt, über die Puppenbrücke und den grünen Wiesen auf dem Holstentorplatz und schließlich durch das Holstentor hindurch, bringt irgendwie gute Laune. Hinter dem Tor geht es über die Holstentorbrücke, unter der die Trave fließt, und das einmal komplett um die gesamte Altstadt, die hier als eine Insel mit besonders viel Charme daherkommt. Schon kurz vorher konnte ich mir am Holstentorplatz in der Touristeninformation eine Stadtkarte besorgen, wo sich das, was sich vor meinen Augen abspielt, noch mal bunt auf bunt widerspiegelt. Es ist auch nicht verwunderlich, dass nun die Sonne scheint und fürs Erste gehe ich in dieser angenehmen Abendstimmung am Ufer der Trave entlang. Es haben viele Freisitze geöffnet, ich rauche auf einer Bank und habe dieses altbekannte Gefühl, dass ich heute, an diesem Abend, praktisch unbesiegbar bin. Es passt einfach alles zusammen. Ich gehe weiter nach Süden, wo mich der Dom empfängt oder vielmehr war er es, der mich zu sich gezogen hat. So wie hier anscheinend alle Kirchen ist auch dieser im roten Gewand, in einem von der Sonne glänzenden Backstein gut in Szene gesetzt. Ja, auch wenn der Dom zwei Türme hat, wie ja auch die Marienkirche, so wären für mein unwissendes Auge die Kirchen der Stadt kaum zu unterscheiden, die Türme sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Doch noch nirgendwo anders hat mir dieser Backsteinkirchenbau so gut gefallen wie hier. Auf der Broschüre wird Lübeck als die „Stadt der sieben Türme“ bezeichnet und ich verstehe wieso. Die vier Türme von Marienkirche und Dom, dazu die einzelnen Türme von Jakobikirche, Petrikirche und Aegidienkirche … diese Türme sah ich bereits von außerhalb der Altstadt klar und deutlich und mir hatte es sofort gefallen und sieben ist sowieso eine ganz anständige Zahl, was man ja schon seit Schneewittchen weiß. Auf meinem Altstadtrundgang und mit breitem Dauergrinsen ziehe ich weiter, komme ins ehemalige Judenviertel, wo Bronze-Platten auf dem Gehsteig an die Ermordeten erinnern sollen. Auf dem Aegidienhof neben der gleichnamigen Kirche ist es besonders gemütlich, schmucke Ziegelhäuser unterschiedlicher Größe, die sich um den großen Innenhof aufreihen, vermitteln dem Besucher ein Gefühl, dass man sich hier in der Siedlung einander gut leiden kann. Ein paar Ateliers scheint es hier auch zu geben, dazu Balkone und auffällig viel Wildwuchs, ja doch, auch wenn ich nie viel Wert auf gute Nachbarschaft gelegt habe, aber hier könnte man sich vielleicht sogar ganz wohlfühlen. Wahrscheinlich eine Illusion, denn dauerhaft wohlgefühlt habe ich mich noch nie unter Menschen, aber definitiv lebenswerter als eine stinknormale Wohnung im anonymen Durcheinander des Großstadtdschungels. Vom idyllischen Miteinander gehe ich weiter, Richtung Günter-Grass-Haus. In die Glockengießerstraße eingebogen, sitzen an einer Kreuzung an ein paar kleinen Tischen drei gut gelaunte Gäste vom Restaurant Blechtrommel. Ich, wie immer etwas schüchtern, blicke in meine Stadtkarte, um zu erfahren in welche Richtung ich weitermüsste, um zum Grass-Haus zu gelangen (warum ich da hinmöchte, weiß ich selbst nicht so genau, denn ich habe Grass nur einmal oder vielleicht auch zweimal gelesen). Fast gleichzeitig fragen mich die gutgelaunten Menschen an der Ecke, welchen Ort ich denn suche. „Nichts Bestimmtes“, was im Grunde genommen auch stimmt, denn das Grass-Haus ist ja nur ein Anhaltspunkt auf meinem Stadtrundgang. Sie trinken Bier und in dem Moment, wo ich unschlüssig bin, ob ich mich nicht vielleicht auch setzen sollte, auf ein Bier und auch auf etwas Gesellschaft, bietet einer der beiden Männer, der Marek heißt, mir einen Platz neben sich an. Das große Schnattern beginnt und es ist ein besonders angenehmer Mittwochabend. Nur wenige Leute kommen vorbei, Autos zeigen sich auch kaum, der Himmel blau. Neben Marek (etwa 35 Jahre alt) sitzen hier auch Johannes (etwa 60) und Eva (Mitte 20). Wir schwatzen über Allesmögliche und es erinnert ein wenig an die geselligsten Abende auf dem Jakobsweg. Nur Eva kommt aus Lübeck, Marek ist aus Polen und Johannes aus Leeuwarden, wo ich ja erst vor ein paar Wochen durchgekommen bin. Natürlich rücke ich wieder etwas in den Mittelpunkt, sie haben Fragen, die man wohl zwangsläufig hat, wenn man einen so unrasierten, langhaarigen und jungen Menschen mit einem großen Rucksack auf dem Rücken sieht. Besonders Marek zeigt sich begeistert und das kalte Bier stachelt die Euphorie noch zusätzlich an. Marek hat sich Fingerfood bestellt und bietet mir an, mich von seinem Teller zu bedienen … was ich freilich gern annehme. Marek, der zwei kleine Töchter hat, ist beruflich viel unterwegs und sieht seine Mädels oft wochenlang nicht, was schwer für ihn ist. Ich verstehe das. Marek ist dabei selbst ein interessanter Typ, der durchaus weiß Geschichten aus seinem eigenen Leben gut und spannend zu erzählen. So saß er zum Beispiel mit 17 Jahren in Marseille für 36 Stunden im Gefängnis, nachdem er im Hafen tauchte und Benzin aus Booten stahl. Er erzählt es mit solcher Hingabe, dass ich mich selbst im Hafen von Marseille tauchen sehen kann. Doch er findet auch Interesse an meiner Geschichte, lädt mich auf zwei Bier ein, wenn ich ihm im Gegenzug das Buch über meine Reise zusende. Eva und Johannes würden es auch lesen. Sie wohnen alle drei auf dem Bäcker-Gang, einen der typischen Lübecker Gänge, die man von der Straße aus über ein offenes Tor erreicht und etwa 50 Meter durch einen schmalen Gang nach hinten gehen kann, wo an der Seite kleine Häuser und Buden stehen, die bewohnt werden und oft auch gleich von mehreren Generationen einer Familie (jede mit ihrem eigenen kleinen Haus). Familie scheint hier auch groß geschrieben zu werden, denn von den wenigen Frauen die hier vorbeikommen, ist jede Zweite schwanger. Ich bilde mir zumindest ein, den Unterschied zwischen „schwanger“ und „dick“ noch zu erkennen. Eine hochschwangere Frau kommt auf ihrem Fahrrad an der Blechtrommel vorbei, zu uns an den Tisch und wird offensichtlich von unserer allgemeinen Euphorie angesteckt und teilt ihre Freude über die bevorstehende Geburt, die vom Arzt auf heute prognostiziert wurde. Es stellt sich heraus, dass sie im selben Gang wohnt. Ich muss zugeben, dass ich sie hier etwas beneide. Wie gut sie einander verstehen, wie gut es ihnen gelungen ist füreinander da zu sein, um nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander zu wohnen. Sie sind total verschieden und doch alle auf Augenhöhe, sie sind nicht nur flüchtig Bekannte, sie sind Freunde. Ich habe in meinem Leben in so vielen Wohnungen gelebt, doch noch nie habe ich nur ein einziges, vertrautes Detail mit den Menschen hinter der Wand geteilt. Nie. Kein einziges Mal. Nicht mal damals als die Großeltern neben uns wohnten. All die Menschen, Familien, Pärchen, Junggesellen … ich habe mit keinem von ihnen ein vertrautes Verhältnis aufbauen können. Das lag zwar in erster Linie an mir selbst, aber nicht nur. Und hier in der Lübecker Altstadt sehe ich wirklich zum ersten Mal, dass es auch anders geht. Das imponiert mir, ja doch ich beneide sie darum. Sie sind nicht vom gleichen Blut, sie kommen aus vielen verschiedenen Ländern und sind füreinander da. Chapeau Ideal. „Bist du ein Weltenbummler?“, fragt mich die schwangere Frau mit ihren strahlenden, orientalischen Augen. Ich nicke und starre ihr dabei ständig auf ihre unglaublich große und gleichzeitig schöne wie auch inspirierende Kuller. „Wie schön“, lächelt sie. Es gibt Frauen, die dir vom ersten Moment an sympathisch sind. Nicht viele, aber es gibt sie. Ihre Familie kommt ihr entgegen, sie ziehen gemeinsam weiter, weiter in eine neue Zukunft, mit viel Geschrei und doch auch neuem Leben. Auch Johannes verlässt uns, es ist mittlerweile spät geworden. Marek und Eva zerbrechen sich den Kopf, wo ich denn schlafen könnte. Ich lächle nur und sage, dass man in Städten immer schnell etwas findet … und muss dann lachen, als ich an Leeuwarden denke, wo es mir nicht so gut geglückt war. Sie empfehlen mir an der Trave zu schlafen und von allen Brücken, die die Altstadt mit der Neustadt verbinden, sei die Rehderbrücke wohl die beste, da ruhigste Wahl. Ich werde es dann dort versuchen. Eva, die mit zunehmender Dauer immer mehr auftaut, hat nun ihrerseits einige spannende Geschichten auf Lager. Zu Tabak und Bier berichtet sie, Soziologin von Beruf, wie sie mit 17 Jahren für ein ganzes Jahr nach Bolivien ging, später dann noch ein Jahr nach Mexiko, dabei an Typhus erkrankte und sich schließlich für längere Zeit in einer Höhlenwohnung in Granada wiederfand. Interessante Frau, sehr natürlich, ohne irgendwelchen Hokuspokus wie Make-up. Nachdem Marek die Rechnung bezahlt, möchte Eva mir noch ein Bild davon geben, wie sie miteinander leben, wie so ein typischer Lübecker Gang nun ausschaut. Ich gehe mit den beiden, durch das Tor in den Gang und sofort gefällt es mir hier. Ihr Gang präsentiert sich gemütlicher wie es kaum in einer Stadt sein kann. Grün, wild, chaotisch, bunt. Viele Fahrräder, es wirkt irgendwie südeuropäisch, genauer noch italienisch, wie eine Ode an das Leben. Mir gefällt das. Wieder könnte ich mir vorstellen, hier zu leben. Wieder täusche ich mich ein wenig selbst über meinen unsozialen Charakter hinweg, aber das macht nichts. Marek und Eva wohnen in ihren kleinen Behausungen direkt gegenüber. Vor jedem Häuschen stehen außer Pflanzen auch noch Tische und Stühle, wo hin und wieder gemeinsam gefrühstückt oder sich einfach nur abends in den Gang gesetzt wird, um über den Tag, die Vergangenheit, die Zukunft zu schwatzen. Dass man hier auf dem Gang kein Auto sieht, macht es nur noch gemütlicher. Obwohl ich begeistert bin, fühle ich auch, dass es ein Privileg sein muss, hier leben zu dürfen … ein Privileg, welches ich niemals genießen werde. Eva zeigt mir ihr Häuschen, 60 Quadratmeter groß, verteilt auf zwei Etagen. Sie wohnt hier mit ihrem Freund zusammen, ein Herumtreiber wie ich, wie sie sagt, der aber anders als ich auch etwas Vernünftiges macht und sich zurzeit in Lübeck zum Koch ausbilden lässt. Vor ihren Fenstern steht ein Baum, der für frischen Sauerstoff sorgt. Eva reicht mir ein kaltes Bier und wir setzen uns draußen in den Gang. Ja wirklich, es gefällt mir so gut hier, dass ich mir gerade eher vorstellen könnte, ein geregeltes Leben mit Arbeit und Familie zu führen, anstatt weiter als Vagabund mein Unwesen zu treiben. Während wir trinken und rauchen, verstreichen die nächsten knapp zwei Stunden wie im Fluge. Ich glaube, ich spreche zum ersten Mal mit jemandem über meine gescheiterte Beziehung. Solch ein Gang wäre sicherlich ein guter Ort für einen Psychiater, um Patienten zu empfangen, da es den Patienten hier leichter fallen dürfte sich zu öffnen. Und Eva ist eine gute Zuhörerin, wie ja viele Frauen. Sie merkt an, dass ich noch sehr an ihr hänge und dass sich das wohl auch nicht ändern wird, wenn ich nicht bereit bin, mit ihr zu reden. Solch ein klärendes, abschließendes Gespräch könnte reinigend sein, meint Eva. Ich weiß, dass sie recht hat, aber ich merke auch, dass mich der Schmutz anzieht, der Schmerz, das Dahinsiechen, das Elend und der Verlust. Es wird kein Gespräch geben. Eva arbeitet in einem Zuwandererheim, sie mag ihre Arbeit. Ich beneide sie, dass sie etwas gefunden hat, was ihr einerseits die Möglichkeit gibt, sich selbst zu versorgen und andererseits, ihre Leidenschaft in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Trotz des vertrauten Gesprächs bleibt aber eine Sache wie immer: meinen wahren Liebling erwähne ich nicht. Das zeigt mir, dass diese Wunde tausendfach tiefer ist als die andere. Doch es fehlt nicht viel, dass ich mich an diesem Abend komplett öffne, vor allem, als kurz nach 23 Uhr Mareks beiden Töchter vorbeikommen und ihrem Vater in die Arme fallen, der sie liebevoll an sich drückt, nachdem er sie drei Wochen lang nicht gesehen hatte. Es berührt mich, dieses Bild des liebenden Vaters und seiner Töchter. Kurz darauf verabschiede ich mich, denn Eva muss früh raus. Sie drückt mir noch zwei Bananen in die Hand und nach einer kurzen Umarmung verlasse ich den Gang und spaziere rüber zum Hafen und weiter bis zur ruhigsten Brücke von Lübeck, der Rehderbrücke, im Osten der Altstadt. Mein Nachtquartier ist schnell aufgeschlagen, neben dem Brückenpfeiler und direkt an der Kanaltrave (Teil des Elbe-Lübeck-Kanals), durch die Brückenmauer gut abgeschirmt vom schmalen Grünstreifen und dem Parkweg, der zwischen Kanal und Krähenteich verläuft. Über die Brücke selbst fährt um Mitternacht kein Auto mehr. Von Menschen auch nichts zu hören oder zu sehen. Für eine Innenstadt ein wirklich ruhiges Nachtquartier. Ich sitze in meinem Schlafsack, nasche noch ein paar Kekse, höre etwas Radio (Buchtipps von Hörern). Ich bin zufrieden, wenn ich an die vergangenen Stunden denke. Doch so gut es auch tat, mit einer Frau zu reden, so sehr bin ich dann doch aber auch überrascht, dass da weiterhin keine Sehnsucht nach körperlicher Nähe ist. Ich brauche keine Streicheleinheit, nicht von solcher Art. Ich glaube hier unterscheide ich mich von vielen Menschen, die das eine von dem anderen nicht trennen können und auch gar nicht wollen, vor allem wenn sie Singles sind. Es mag sein, dass die Nacht im Bett einer Frau zu verbringen, die angenehmere Art wäre, als hier allein unter der Brücke, doch ich ziehe Letzteres vor, denn ich bin kein Freund von unnötigen Komplikationen.
Die Nacht ist recht frisch, doch wenigstens ist es selbst am Morgen um mich herum und auf der Brücke über mir ruhig. Ich stehe erst halb acht auf und eine Viertelstunde später spaziere ich durch die Altstadt und bewundere die vielen alten historischen Häuser, die mir vor allem aufgrund ihrer markanten Giebel gefallen. Vom Grass-Haus bei der Katharinenkirche ziehe ich weiter am Filmhaus vorbei zur Stadtbibliothek und schließlich zum Buddenbrookhaus gegenüber der Marienkirche. Es ist ein grauer, kalter Morgen, es nieselt. Ich sitze unter einem Baum neben der Kirche, rauche und blicke auf die weiße Fassade des wohl berühmtesten Hauses der Stadt. Buddenbrooks habe ich in den Leipziger Parkanlagen rund um das Elsterflutbecken gelesen, nachdem ich von ihr eine wohlverdiente Backpfeife bekommen habe. Schon vor der Geburt unserer Tochter war nicht alles goldig, vermutlich war es das nur an unserem allerersten gemeinsamen Abend. Ich denke jedenfalls gern an das Buch zurück, da ich erst nach Hause zurückkehrte, als ich damit durch war. Es scheint, ich hätte damals mehr Ausdauer gehabt und definitiv war ich auch anspruchsloser. Heute, sobald es kalt ist und etwas nieselt, suche ich das nächste Café auf. Faul und träge stolpere ich bei Mr. Baker rein, wo man sich selbst bedient, was sicherlich auch die niedrigeren Preise erklärt. Ich verbringe auf einem Hocker am Fenster eine gemütliche Stunde, zum Kicker gibt es gleich zwei Kaffees, dazu zwei Brötchen mit Wurst und geschmolzenem Edamer, als Nachtisch eine Apfeltasche. Ich bleibe für mich und bleibe still, eine Seltenheit hier in Norddeutschland, wo ich ja sonst von einem Gespräch ins nächste stürze. Nach dem Frühstück geht es wieder raus und fünf Minuten später sitze ich bereits wieder. Ich trage Pulli und friere, während ich auf einer Bank auf dem großen zentralen Platz der Altstadt rauche. Auf den anderen Bänken sitzt auch jeweils eine Person, beschallt von dem monotonen Geräusch eines Wasserspiels. Dass es so stark bewölkt ist, scheint sie weniger als mich zu stören. Anscheinend stört sie auch nicht mein Anblick und offensichtlich auch nicht mein Geruch, den ich wahrscheinlich selbst gar nicht wahrnehme, wenn man schon wieder seit ein paar Tagen nicht duschen war. Wie der letzte Penner durch eine Altstadt zu spazieren, viele Blicke dabei zu ernten, fühlt sich in der Regel gar nicht so übel an … nein, ich genieße es sogar, denn ich weiß wer ich bin, was ich hier treibe und was ich zuletzt getrieben habe. Ich setze mich ins Café Niederegger auf dem Marktplatz, dreißig Meter vom Rathaus entfernt, während dahinter das siebenstimmige Glockengeläut der Marienkirche elfmal schlägt. Die beiden Türme der Kirche ragen in einen ganz düsteren Himmel, ein schönes Bild.Das Café wirkt etwas zu renommiert für mein poröses Äußeres und in der Tat werde ich auch ignoriert, obwohl ich so anständig war nicht hinein zu gehen, wo sich, außer einem Pärchen und mir, die Gäste tummeln. Vor mir stehen ein paar Marktbuden. Weitere Gäste setzen sich draußen hin, die Kellnerin begrüßt sie und nimmt die Bestellung entgegen. Sie hat mich vorhin gesehen, meinte sie komme gleich … doch sie kommt nicht. Ich gehe. Rüber zur Obertrave, in eine Bar, bestelle ein Radeberger, fröne dem womöglich letzten Luxus dieser Reise. Nach einem ausführlicheren Tagebuchbericht geht es endlich weiter (es ist bereits nach zwölf), denn schließlich habe ich heute noch ein Ziel: die Ostsee. Und so soll es auch nicht weiter hinderlich sein, dass es weiterhin nieselt. Schlussendlich kann ich eins sagen, ja doch sogar mit voller Überzeugung: auf meiner Reiseroute durch den Norden Deutschlands war Lübeck meine Lieblingsstadt.
Die Altstadt liegt hinter mir, auf dem Radweg sind es 14 Kilometer bis nach Travemünde. Bei der Herreninsel (eigentlich eine Halbinsel) an der Untertrave fährt ein kostenloser Shuttlebus durch den Herrentunnel unter dem Fluss auf die andere Seite. Den Tunnel gibt es erst ein paar Jahre, er verhindert, dass man die Trave weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu Gesicht bekommt. Gefällt mir zwar nicht, aber das ist der Weg. In Kücknitz, wie die Herreninsel noch immer zum Stadtgebiet Lübecks gehörend, fallen ein paar Tropfen und ich überbrücke die Zeit mit einem Landstreichermittag (fünf Brötchen mit Käse und Wurst) unter einer Brücke. Anderthalbstunden später bin ich in Travemünde und auch hier bin ich nach Stunden des Unterwegsseins noch offiziell in Lübeck. Ich bin bereits ganz nah am Meer, manchmal fallen ein paar Tropfen, manchmal scheint die Sonne und die ganze Zeit weht ein starker Wind. Ich bin von unten bis oben vollgepackt mit Proviant und Luxusartikeln (Bier, Kippen, Zeitung). Doch ich bin auch von unten bis oben zugeknöpft, trage Pulli, bin müde und friere. Ich müsste mich wohlfühlen, doch irgendetwas klemmt. Auf der Travepromenade sind sehr viele Familien, um nicht zu sagen: zu viele. Auch zu viele Kinder. Sonst konnten es nie genug sein, heute schon. Jedes einzelne Kinderlachen mehr verstärkt in mir die Melancholie und Einsamkeit. Ihre Eltern lachen mit ihnen … so wie es sich gehört. Ich fühle meinen Verlust, ja ich fühle auch ihren Verlust, dass sie keiner dieser kleinen Engel ist, die lachend in die Arme ihres Vaters stürzen. Sie schaut vielleicht um sich, sucht mich und stolpert. Manchmal hilft es in solchen Momenten, schöne junge Frauen um sich herum zu wissen, sie anzuschauen und alles ist gut. Selten wird daraus ein Problem, jetzt gerade ist es eins. Sie sind jung, sie sind schön … und die meisten von ihnen gehen an der Seite eines Mannes. Ich beneide sie, vor allem ihn. Die nächste graue Wolke. Von einer Bank und meinen ziellosen Betrachtungen, mitsamt Bier-, Tabak- und Gänsehautgenuss, an der Anlegestelle Prinzenbrücke gehe ich lustlos weiter und stoppe in einen der vielen Cafés entlang der Promenade. Ich setze mich unter einem Sonnenschirm, bestelle einen Pott des schwarzen Aufputschmittels und denke mir im nächsten Moment, dass ich gar keinen Appetit darauf verspüre. Obwohl ich mich einsam fühle, möchte ich lieber allein sein … keine Gespräche, keine Stimmen, keine Motoren, keine Belanglosigkeiten …
Vom Café ist es vielleicht noch ein Kilometer neben der Travemündung, bis ich endlich wieder das Meer vor mir sehe, doch diesmal vielleicht noch etwas besonderer als sonst, denn ich stehe erstmals auf dieser Reise und erstmals seit Jahren an der Ostsee. Wir Ostdeutschen haben eine recht intakte Beziehung zu ihr, ich auch, denke ich. Auch wenn ich es viel zu wenig zu schätzen weiß, dass mein erster Blick auf sie durch gleich zwei Regenbögen über ihr abgerundet wird. Zurück am Meer, zurück an der Ostsee, zwei Regenbögen … und ich mache zwei Fotos und gehe weiter. Sie empfängt mich herzlich, wie einen Jungen der nach Hause kommt und von einem Chor lauter Stimmen mit „Überraschung“ begrüßt wird. Und ich rümpfe die Nase und geh rauf in mein Zimmer. Ich bin ein Arsch. Die Partydekoration und allen voran der untere der beiden Regenbögen, mit einer kunterbunten Lichterkette versehen, hätten für gute Laune sorgen sollen, doch inmitten eines dünnen Nieselregens und einem starken Sonnenschein ist mir viel eher zum Heulen zumute. Das Meer, die Wolken, die Sonne, der Himmel … sie meinten es gut mit ihrer „Welcome-Back-Party“ … vielleicht hätte ich es mehr zu schätzen gewusst, wenn ich schon einmal selbst mir die Mühe gemacht hätte, für jemanden eine Rückkehrparty zu organisieren, doch das habe ich nicht. Ich feiere keine Rückkehr, ich feiere überhaupt nichts, nicht mal mehr mich selbst. Der Himmel zeigt sich enttäuscht und weint sich über mir aus, heftig, vielleicht etwas zu heftig. Doch ich finde Schutz bei der Bühne am Meer, unter einer großen Plane, wo sonst die Zuschauer stehen. Ich stehe nicht, ziehe Schuhe aus und mach mich lang, rauche, lese Kicker, warte auf den nächsten Sonnenschein. Dieser zeigt sich schon bald, der nächste Regenbogen entsteht. Ich verlasse Travemünde auf dem Fahrrad- und Spazierweg Hermannshöhe entlang der nach Nordwesten gebogenen Küste Richtung Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand, dem bei Touristen beliebten Seebad. Der Weg führt dabei durch kleine Wälder, ohne Autos, dafür sind umso mehr Vögel zu hören. Ich merke, dass ich mich an der Ostsee wohler fühle als an der Nordsee, die Küste bringt mehr Abwechslung, sie ist auch sanfter, weniger stürmisch. Das entspricht eher meinem eigenen Naturell, so sehr ich mich auch häufig vom Gegenteil zu überzeugen versuche. Vermutlich sind es die kleinen Wälder direkt neben der Küste, durch die hindurch man von einer kleinen Anhöhe aus auf das Meer blickt. Das ist geheimnisvoller und auch interessanter zum Fotografieren. Die Perspektiven verschieben sich mit jedem Schritt, ja doch, diese Art von Überraschung mag ich sehr gern, viel lieber als ein Begrüßungskomitee, das mir schreiend zwei Regenbögen an den Wirsing donnert. Das ist dann zu viel, weniger ist besser, manchmal, na vermutlich eher seltener, aber es kommt vor.
Für einen kurzen Moment kommt wieder Leben in die Bude, als ich am etwas pompös wirkenden Hermannshöhe Erlebniscafe vorbeikomme, großes Gelände, mit Spielplatz, Strandkörben auf der Wiese, Biergarten dahinter … viele Stimmen … mir zu viel Trubel, ich gehe schnurstracks wieder zurück in den Wald. Nur einhundert Meter vom Café entfernt steht ein Haus, etwas versteckt zwischen den Bäumen, zwar direkt am Weg, doch angenehm für sich. Der Zaun ist etwas hinfällig, das Eingangsholztor klapprig und vermodert, der Garten klein und völlig verwildert. Es ist praktisch mein Ebenbild und deswegen trete ich ein. Ich gehe um das kleine Haus und blicke von hier oben runter auf die Ostsee. Neben mir ist die Tür zu einem kleinen Anbau des Hauses … Foyer, geschlossene Außenterrasse, Wintergarten (ohne Pflanzen) … wie auch immer man das nennt. Ich teste die Türklinke ohne darüber nachzudenken, so völlig sicher, dass sie natürlich verschlossen ist … und ohne zu wissen, warum ich sie überhaupt betätige. Aber ja, sie ist tatsächlich offen. In dem Moment, wo ich die Klinke nach unten drücke und die Tür nach innen aufgeht, bin ich ein wenig fassungslos, denn sollte ich wirklich hier gerade mein Nachtquartier gefunden haben? Unmittelbar am etwa fünfzehn Meter tiefen Abgrund der Brodtener Steilküste mit dem weiten Blick aufs Meer? Dieser 12 m² kleine Vorraum, abgesehen von einer Bank ohne weitere Ausstattung, ist klinisch sauber, bietet Parkettboden und Plexiglasdach, was dementsprechend für kuschlige Temperaturen sorgt (bis zu zehn Grad wärmer als draußen). Die Eingangstür zum Haupthaus ist verschlossen und ich hoffe, dass ich mich in meiner Annahme nicht täusche, dass in diesem Haus zurzeit niemand wohnt. Überhaupt ist nicht wirklich eindeutig bestimmbar, ob dieses Haus noch von Zeit zu Zeit bewohnt wird, vielleicht ja als Sommerhäuschen. Es wirkt fast eher so, als wären die letzten Stimmen hier schon vor Jahren davongesegelt. Wäre die Haupteingangstür offen gewesen, hätte ich schnell kehrtgemacht, so viel Achtung vor Privatbesitz und Privatsphäre hätte ich dann doch noch. Aber auch die Fensterflügel sind allesamt verschlossen. Die Tür zu meiner kleinen Residenz kann sogar von innen verriegelt werden und der Raum ist vom nur zehn Meter entfernten Weg auch nicht zu sehen. Doch nachts ist hier auch keine Störung zu erwarten, denn das Haus liegt etwa zwei Kilometer vom ersten Ort im Süden (Travemünde) und drei Kilometer vom ersten im Norden (Niendorf, Timmendorfer Strand) entfernt. Zwei Seiten des Raumes sind vom Boden bis zur Decke mit Glaswänden versehen, an der dritten Seite befindet sich die Tür in den Garten, neben einem kleinen Fenster, während die vierte Seite an die weiße Haupthausfassade grenzt. Es gibt eine kleine Eckbank, von der man eine unglaublich aufregende Aussicht auf die Lübecker Bucht hat. Unter einem Regenbogen, dem bereits Vierten innerhalb der letzten Stunde, verkehrt gerade ein großes Fährschiff, wohin auch immer, vielleicht ja in eine bessere Welt. Nein, doch nicht, sie steuert Travemünde an, ein Schiff von der Finnlines Reederei, kommt also entweder aus Malmö oder Helsinki. Nach Helsinki würde ich auch mal gern, gern nach Finnland und gern überallhin, nur nicht zurück. Und jetzt gerade möchte ich auch gar nicht nach Helsinki, denn hier ist es ja perfekt, fast zu perfekt, damit es wahr sein könnte … dass es mir wirklich möglich sein sollte, hier in diesem geschützten, warmen Raum mit Blick aufs Meer die Nacht verbringen zu können. Das Ganze ist schon ziemlich romantisch, auf eine gute Art, auf eine Art wo es keinen Partner bedarf. Dank der großen Glaswände ist es schön hell und ich nutze die schöne Stimmung, um zu schreiben, um zu berichten, um mein Glück mit ein paar Seiten Papier zu teilen. Untermalt wird die Stimmung von Wagner, der seiner Art entsprechend wieder ziemlich derb auf den Putz haut. Gar nicht so unpassend, denn solch ein Häuschen an der Küste sein Eigen zu nennen, wird mir niemals vergönnt sein. Über die Strenge, auf den Putz, für nur eine Nacht. Und so gut wie in der ersten Nacht wird es auch nie wieder werden, von daher ist es gut nur diese eine Nacht zu haben und den Moment zu genießen. Gelegentlich rufen ein paar Kinder oder Erwachsene dazwischen, die auf der anderen Seite des Hauses auf dem Spazierweg entlangschlendern. Es ist kurz nach 20 Uhr, in ein paar Stunden sollten die Stimmen weg sein. Und bereits jetzt (und endlich!) ist auch mal wieder die Brandung zu hören. Die Wellen sind niedrig und doch hört man sie sich brechen … oh wie ich diesen Klang vermisst habe! Es ist für mich das schönste Lied dieser Welt. Wagner kann einpacken. Die Dämmerung steht bevor und die Dämmerung am Abend ist so viel größer als die der Götter und der Marsch der Wellen so viel bewegender als Siegfrieds Trauer. Doch im nächsten Moment sind die Wellen stumm und auch Wagner wird zum Schweigen gebracht, denn ich höre Menschen näher kommen. Mist. Sie stehen direkt neben der geschlossenen Tür. Ein älteres Pärchen, sie reden miteinander, locker und ungezwungen, typisch für einen Donnerstagabend. Meine Eckbank steht günstig, man müsste schon ganz nah ans Fenster kommen, um mich in der Ecke sehen zu können. Ich möchte nicht gesehen werden, denn ich habe es weder auf Störung noch auf Ärger abgesehen. Die beiden gehen wieder, das ist gut. Ja, dieses Grundstück macht neugierig. Ich war selbst ja schon zehn Meter weitergelaufen, ehe ich umkehrte um mehr zu erfahren. Mein Instinkt könnte sich wieder einmal als mein bester Ratgeber herausstellen. Ich möchte hier heute nicht mehr weg, ich brauch nur noch die letzten sechzig Minuten Tageslicht überstehen, dann sollte ich sicher sein. Es wäre ganz eindeutig einer meine exquisitesten Schlafplätze dieser Reise - und nach diesen halte ich ja schon von Tag 1 an Ausschau. Der letzte wirklich überragende Schlafplatz liegt schon eine gefühlte Ewigkeit zurück, ich weiß schon nicht mal mehr wo. Der Regenbogen ist noch immer da, spannt sich über die Bucht … ich muss raus, der Himmel ist zu schön, in vier bis fünf verschiedenen Farbtönen gehalten, zwischen kleinen und großen Wolken. Ich knipse Fotos, gehe wieder rein, will kein Risiko eingehen, will nicht, dass man mich entdeckt. Ich ziehe meine nassen, schweißtriefenden Schuhe aus, ein schwerwiegender Fehler, wie sich kurz darauf zeigt. Ein anderes Pärchen (um die 40 beide) steht mittlerweile im Garten und ich denke, es ist dieser üble Geruch, der da von drinnen nach außen strömt, der sie neugierig macht. Eine verwesende Leiche? Die Frau schaut durchs Fenster zu mir hinein, ich weiß nicht ob sie mich sieht, doch im nächsten Moment wackelt die Türklinke. Anders als vorhin hatte ich sie diesmal verriegelt. Ich stehe auf und öffne ihr die Tür, eine Höflichkeit die meine Chance erhöhen soll, dass sie mich nicht verraten. „Brechen sie nicht ab“, sagt der sehr vornehm gekleidete Mann und deutet auf den steilen Abgrund, der praktisch schon unter meinem Nachtquartier beginnt. „Das wäre dann Schicksal“, erwidere ich lächelnd. Der Mann geht schnell weiter, ich vermute ich bin ihm suspekt. Die Frau lächelt nach meiner Antwort: „Sind sie der Hausbesitzer?“, fragt sie mich, mit mehr Sympathie als Spott in der Stimme, wie mir scheint. Ich muss nochmals lächeln, schön wär’s ja, aber nein, der Hausbesitzer bin ich nicht. „Dann wünschen wir ihnen noch eine schöne Hausbesetzung“, sagt sie, nicht ohne Freundlichkeit, weshalb ich guten Mutes bin, dass sie einfach ignorieren, dass sie mich hier gesehen haben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die in solch einem Moment die Polizei rufen würden, da sie es einem Penner nicht gönnen, dass er eine kostenfreie Herberge mit erstklassiger Aussicht bezieht. Ich will es drauf anlegen und bleibe hier. Wenig später sind die nächsten Stimmen nahe am Haus zu hören. Das ist schon etwas unheimlich. Dabei habe ich keine Angst vor den Leuten, sondern Angst, meinen traumhaft schönen Schlafplatz im letzten Moment noch zu verlieren. Draußen in der Bucht zeigen sich die ersten Vorboten der Dämmerung. Eine Fähre steuert auf den Horizont zu, die letzten Segelboote fahren heim. Es wird dunkler. Ich blicke nach Osten, die Sonne geht hinter mir unbemerkt unter. Zum Abendessen gibt es Vollkornbrötchen mit Heringssalat, garniert mit Käse und Bier. Die vermutlich letzte Finnlines Fähre des Tages tuckert vorbei, die Erste die hellbeleuchtet ist oder es zumindest durch die Dunkelheit so wirkt. Letztes Tageslicht, das Ende der Dämmerung, der Anfang der Nacht, es ist schön diesen Moment mal wieder bewusst wahrzunehmen.
Ein zweites Mal Freitag der 13., ein weiteres Mal wird es nicht geben. Doch von Grauen, Unglück und Jason keine Spur … seit 5 Uhr scheint von Osten die Sonne in mein Appartement. Zum Sonnenaufgang war ich kurz draußen vor der Tür … Glücksgefühl … Dankbarkeit … denn nicht nur Abend und Morgen sind wunderschön, auch die Nacht war geruhsam und niemand kam bei mir vorbei … oder zumindest ohne dass ich es bemerkt habe. Es ist warm, es ist ruhig, es ist so kuschlig, dass ich auch jetzt noch, drei Stunden nach Sonnenaufgang, in meinem Schlafgemach liege und raus zum Meer blicke. Zwei Käsebrötchen zum Frühstück. Das Radio läuft, was etwas Urlaubsatmosphäre erzeugt. Ich war eingeschlafen, ohne es auszuschalten. Einen Schlafplatz wie diesen zu verlassen, fällt immer etwas schwerer, denn ob man es sich nun eingestehen möchte oder nicht, man fühlt sich wohl an einem sicheren Ort. An einem Ort, der einen beschützt, eine Oase in einer Welt, in der man schon vor langer Zeit verlorengegangen ist. Die ersten unsichtbaren Menschen kommen auf dem Spazierweg hinterm Haus vorbei, ich vernehme ein Husten. Ein Zeichen, dass ich packen sollte um aufzubrechen, bevor mir ein jemand noch die schöne, viele Jahre überdauernde Erinnerung ruiniert. Udo singt Hinterm Horizont geht's weiter … genau, weiter geht’s, auf den Horizont zu, mehr oder weniger, zumindest symbolisch gesprochen, denn wo denn sonst befindet sich das Nordkap als am Horizont?
9 Uhr breche ich auf, mit Dank in der Stimme und in den Augen. Es ist jetzt „mein“ Häuschen, wie alles „mein“ ist, was schön war und noch sein wird, was mir auf dieser Reise begegnet. Es ist dennoch erstaunlich, dass ich die längste Zeit des Tages nicht sonderlich zufrieden bin. Ich verwöhne mich von morgens bis abends … und weiß so gut wie ich sonst nur wenig weiß, dass da das Problem liegt. Zu wenig Strecke, zu viele Pausen, zu viele Leckerlis, zu viel auf Bestätigung aus … ich denke an die schwereren Tage in Nantes oder Amsterdam zurück und möchte fast behaupten, dass es mir da besserging. Ja, für einen kurzen Augenblick kann ich noch Dankbarkeit fühlen, aber nicht mehr dieses große Glück wie einst am Mittelmeer. Es ist grotesk, jetzt wo ich so faul bin, fühlt es sich mehr wie „Arbeit“ an und das passt mir so gar nicht. „Mach deinen Job, geh rauf zum Nordkap. Danach kannst du von mir aus auch mal zwei Wochen Urlaub machen.“ Dagegen bildet sich Widerstand in mir, Widerstand gegen mich selbst, woraus eine Stimme erwacht und mir immer lauter zuschreit: „Wo ist das Glück, wo die Glückseligkeit?“ Ich weiß es nicht. Ich probiere zum Aufbruch ein paar Liegestütze, die ersten dieser Reise und kapituliere nach 25 Stück. Ein Mann, der nach 25 Liegestützen kapituliert, ist satt … am Ende, am Boden, hat sich von sich selbst entfernt. Es ist schwer sich über seine eigenen Gedanken und Gefühle klarzuwerden, wenn man sich selbst nicht mehr versteht. So geht es mir zurzeit … auch am ersten Tag nach dem Wiedersehen mit dem Meer, mit vier Regenbögen inklusive und einer kostenlosen Luxusherberge.
Es geht oberhalb der Lübecker Bucht die paar Kilometer bis zum nächsten Ort, dem Ostseeheilbad Niendorf. Sobald ich auf Menschen stoße, denke ich unwillkürlich daran, ein Café aufzusuchen. An der Strandpromenade führt der Weg durch den langgezogenen Ort bis zum Hafen. Ein paar fleißige Menschen sind hier, außer mir keine weiteren Müßiggänger, insgesamt wenig Betrieb, wenn überhaupt sind meistens nur Kinder zu sehen, die sich auf Spielplätzen oder am Strand vergnügen. In neun der sechzehn Bundesländer sind zurzeit Sommerferien, deswegen dürfte es hier und in Timmendorfer Strand im Laufe des Tages etwas voller werden. Ein Wegweiser beziffert die Entfernung nach Oslo auf 721 Kilometer, was ziemlich nah klingt … und ich mir sicher bin, dass ich ein paar Kilometer mehr brauchen werde, denn bekanntlich verschließt sich der direkte Weg hier und dort … und das ist auch gut so! Bis nach Oslo habe ich noch einiges vor, ich weiß zwar nicht so genau was, aber da muss es einiges geben … Fehmarn, Dänemark, Kopenhagen, Schweden, Göteborg, Norwegen … plus hier und da kleine Leckerbissen … das ist doch allerhand. Freu mich auf meinen Ritt durch Skandinavien, die Vorfreude hatte ich heimlich schon in Barcelona verspürt … bloß dass da noch etwas der Glauben fehlte, dass ich es realisieren könnte. Nun gibt es keine Zweifel mehr.
Ich sitze in einem der Freisitze, die bereits geöffnet haben. Fischfrikadelle als zweites Frühstück, dazu eine Tasse Kaffee, die es mittlerweile ja jeden Morgen gibt. Ein Spatz lauert an meiner Seite, schielt zwischen Kaffeetasse und Brötchen … ich weiß nicht ob er es auf das Koffein oder auf die Kohlenhydrate abgesehen hat. Seine Freunde gesellen sich dazu, sitzen auf dem Tisch vor und auf dem Stuhl neben mir. Der Spatz, der zuerst hier war, schien zuversichtlich gewesen zu sein und rief die anderen hinzu. Er hatte damit nicht unrecht. Ich teile zwar weniger als ich könnte, doch auch mehr als ich wollte. Die Sonne hat sich mittlerweile verzogen, der Morgen ist frisch, perfektes Wanderwetter … nun ja. Keine halbe Stunde später sitze ich einem kleinen Park in Timmendorfer Strand und verzweifle an mir selbst: Ich bin faul, träge, ein Arbeitsverweigerer!Aus der Nähe erschallt eine Stimme von einem Festmoderator, zwischendurch wird auch mal gesungen. Ordentlich Betrieb hier im Seebad, von mir selbst mal abgesehen. Es ist Punkt 12 und ich bin heute sieben Kilometer vorangekommen, viel mehr als 30 Kilometer sind da am Tag nicht drin. Zu dieser Jahreszeit könnte und sollte man schon bis um 12 die ersten 30 Kilometer des Tages gelaufen sein, vor allem am Morgen, wo man ideale äußere Voraussetzungen vorfindet. Doch Deutschland und ich, das wird nichts mehr. Ich baue auf Dänemark und Dänemark ist nah, Gott sei Dank. Ich muss diese Blockade lösen, diese Stimmen in meinem Kopf, die mir zuflüstern, wie nahe ich doch der Heimat bin. Hier und jetzt könnte ich in den Zug steigen und nach Hause fahren, ich hätte es überstanden, habe überlebt und könnte weitermachen. Mit jedem Schritt weiter und vor allem wenn es dann soweit sein wird, dass ich mit der Fähre Deutschland Richtung Dänemark verlassen werde, dann wäre das wohl gleichbedeutend mit der Entscheidung gegen Sicherheit und vielleicht auch gegen das Leben an sich. Denn indem ich hier in Deutschland so trödle, wird es immer unwahrscheinlicher, dass ich noch rechtzeitig oben in der Arktis ankomme. Und indem ich hier so verschwenderisch lebe, steht auch fest, dass ich da oben keinen Cent mehr in der Tasche haben werde. Und doch bin ich froh, dass mich niemand in der Heimat erwartet, dass sie mit meiner Tochter und einem anderen Mann glücklich zusammenlebt. Denn die Heimat, das sind die anderen.
Ein Mann holt mich zum Glück aus meinen Gedanken heraus und fragt mich von wo nach wo ich wandere. Meine Antwort genügt ihm, er geht weiter. Kurz drauf steuert ein über 70jähriger mit seinem vollgepackten Fahrrad auf mich zu und möchte mehr über mich erfahren. Ich vermute, ich sehe spannender aus als ich bin, zumindest zurzeit. Der ältere Herr berichtet mit strahlenden Augen, wie er selbst schon auf zwei Rädern in mehreren Touren 30.000 Kilometer in Australien zurückgelegt habe. Das gefällt mir. Nach der kurzen Schwatzerei begebe ich mich zurück auf die Strandpromenade, um streckentechnisch von dem Tag noch zu retten was zu retten ist. Eine etwas eigenwillige Skulptur von Udo Lindenberg und seinem Lied Horizont steht hier seit ein paar Monaten. So macht das Lied im Radio am Abend zuvor noch etwas mehr Sinn. Lindenberg soll an dieser Stelle in den Dünen damals das Lied geschrieben haben. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen, das ist gut. Bei allen Nörgeleien zurzeit, vor allem an mir selbst, muss ich auch den gebührenfreien Komfort hier an der Ostsee loben. Ich müsste nicht in Cafés, um mich mal frisch zu machen oder meine Wasserflaschen aufzufüllen, denn es gibt hier viele öffentliche und blitzsaubere Toilettenhäuschen entlang der Promenaden. Das ist Luxus und wenn ich selbst weniger im Luxus schwimmen täte, würde ich das auch noch mehr zu schätzen wissen. Denn für die, die nichts besitzen, ist Wasser das wichtigste Gut. Nicht so für all die unsrigen, die sich hier im Urlaubsort aufhalten. Ein paar Leute aus der Heimat cruisen mit ihren Fahrzeugen und dem Lausitzer Kennzeichen an mir vorbei. Wahrscheinlich werden sie einen der Strandkörbe für acht oder neun Euro Tagesgebühr buchen, die es hier zu Hunderten entlang des kilometerlangen Strandes gibt. Vorher müssen sie aber auch schon eine Gebühr bezahlen, um an den Strand selbst zu gelangen. Das ist nicht ganz so meins, muss es aber auch nicht. Ein paar Urlauber planschen im seichten Wasser herum, so ganz hinein zum Schwimmen traut sich jedoch niemand. Es ist wahrscheinlich noch zu frisch. Ich selbst hege auch keine Ambitionen zum Baden. Ich war auch kein einziges Mal in der Nordsee … ja, ich war an vier Meeren und war anderthalb Mal baden gewesen, in fünfeinhalb Monaten, wow … Für eine Viertelstunde Internet besuche ich ein Casino … sie schreibt mir nicht mehr, sie denkt nicht mehr an mich … und ich? Ja, ich denke von morgens bis abends an sie. Und das obwohl ich unterwegs bin, Abenteuer erlebe, während sie nur das Einmaleins des sozialen Austauschs lebt, nichts Besonderes, das Übliche, Liebe und Sex, Familie und Freunde, der ganze Spuk … doch die Geister sind nicht bei ihr, sondern schwirren in meinem Kopf … ich muss raus aus dem Casino, Casinos werden mir zurzeit für den Rest meines Lebens verübelt, was gut ist, wenigstens was. Es tropft, leicht, aber ausreichend, um mich unter einem Sonnenschirm in einen Strandimbiss zu setzen. Bier und Bratwurst, nichts Aufregendes, die nächsten sechs Euro futsch. Bei allen Pausen schlage ich zurzeit den Kicker auf, was etwas zu häufig ist und bald wieder Geschichte sein soll.
Hier an der Küste reihen sich die Orte aneinander, jede halbe Stunde in einem neuen Ort und überall verweile ich für eine kurze Zigarettenpause. Es ist selten geworden, dass ich eine Stunde am Stück gehe. Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und schließlich Neustadt in Holstein. Und überall dieselbe Frage: „Was ist nur los?“ In Endlosschleife. Und ein endloses Schweigen folgt, keine Antworten, keine Taten. Ich bilde mir ein, dass es jetzt als Familie hier - zumal ich gerade am Hansa-Park vorbeikam - schöner wäre als allein. Aber das ist natürlich nicht wahr, denn wäre ich mit ihnen hier, würde ich auf die Bucht rausschauen und mit diesem sehnsüchtigen Blick in die Ferne unglücklich sein, da ich mein einsames Vagabundenleben aufgegeben habe. Ich wäre nicht so leer wie jetzt, denn ich wäre von oben bis unten voll mit Stumpfsinn. Nicht wegen ihnen, sondern wegen mir … mir allein … und deswegen ist es auch gut, dass ich es jetzt mit mir allein ausmachen muss. Da Nachdenken hungrig macht, kaufe ich mir im Supermarkt eine Packung Hörncheneis, sechs Stück, das Übliche also. Da kein schöner Pausenplatz zu finden ist, muss ich das Eis beim Gehen schlecken. Dämlich. Zumindest die letzten beiden Eis kann ich noch in einem Park verdrücken, drei alte Bäume um mich herum. Mechanisch öffnen und schließen sich meine Augen, mein Mund, in gewisser Weise auch meine Ohren, denn ich bekomme nur Bruchstücke von dem, was um mich geschieht, mit … blind, stumm, taub … ein Vagabund ohne Welt … dabei kann der Vagabund nur existieren, wenn es eine Welt gibt die ihn füllt … mit Leben, mit Neuem, mit Unvergesslichem … Eis aus dem Supermarkt zählt nicht darunter. Ein grauer Himmel schon eher … ich verlasse uninspiriert Neustadt, nach einem kurzen Ausflug zum Hafen, es ist kurz vor fünf am Nachmittag. Die Schuhe sind weiterhin pausenlos nass, eine Blase unterm rechten Fuß erschwert das Vorwärtskommen … na nicht wirklich … nur auf der Suche nach Ausreden. Ich pfeife auf den Banter See, auf allen Selbstbetrug. Die Geister in deinem Kopf kannst du nicht ertränken. Nicht mit Wasser, vielleicht mit Alkohol, vielleicht nicht mal das.
In Rettin findet am Meer ein kleines Fest statt. Am ersten Getränkestand genehmige ich mir ein Bier, sympathisch günstig für nur einen Euro. Das gefällt auch den Gästen, die um mich herumstehen und einander viel zu erzählen haben. Dazu schon fast so etwas wie ein Sonnenschein. Für mich geht es weiter, an diversen Campingplätzen entlang der Küste vorbei, weshalb es auch nichts mit einem Schlafplatz am Meer wird. Ich komme seit langem mal wieder ins Schwitzen, wusste schon gar nicht mehr ob die Drüsen noch funktionieren. An der Küste bei Bliesdorf steht ein kleiner Wald … wo Menschen bestattet werden … ohne Grabsteine oder sonstigem Schnickschnack … ich durchquere den RuheForst … der Wald reicht bis nah ans Meer, wo es mal keine Strandkörbe gibt. Ein Pilgerweg führt vorbei. Die Steilküste ist ziemlich flach. Ob ich doch am Strand schlafen könnte? So recht passt es mir nicht, zum einen weil man hier im Sand regelrecht untergeht, zum anderen weil Leute unterwegs sind und der Strand hier ziemlich schmal ist, weshalb sie zwangsläufig nahe an meinem Nachtquartier vorbeikommen würden. Das hier ist eben nicht Spanien oder Portugal im Frühjahr. Ich frage einen jungen Kerl, wo man sich hier am besten aufs Ohr hauen kann. Er schaut mich nur ungläubig an und weiß auch keinen Rat. Das größte Problem ist das unberechenbare Wetter, da es praktisch jederzeit regnen kann, weshalb ich mir schon etwas Überdachtes suchen sollte. Ich setze mich auf einen großen Stein, schalte das Radio ein, warte auf den Wetterbericht, rauche nebenbei. Gute Prognosen, doch ich traue dem Braten nicht … und so gern ich mal wieder direkt am Strand schlafen täte, so sehr fürchte ich die Launen der Natur. Ich gehe wieder rauf in den Wald, höre ein paar Stimmen, die vom angrenzenden Campingplatz hier rüber schallen. Und schlagartig möchte ich nicht mehr raus aus dem Wald, mit all den Toten in der Erde unter mir. Von einer Bank aus blickt man zwischen den Bäumen runter zum Meer, es ist schön friedlich hier, tatsächlich ein guter Ort um bestattet zu werden. Am gerade noch blauen Himmel ziehen neue Wolken auf, dabei ist kaum Wind. Freitag der 13. und ich denke mir: ich bleibe! Auf dem schmalen Waldweg spazieren ein paar wenige Leute vorbei. Wenig später ein Mann mit zwei kleinen Mädchen auf ihren Rädern. Sie binden die Fahrräder an einem Baum vor mir an und gehen runter zum Strand. Ich verliere sie aus den Augen, doch offensichtlich haben sie Spaß, denn ihr Lachen ist nicht zu überhören. Die nächsten Tropfen fallen und erschweren meine Pläne. Denn mittlerweile habe ich auf der Bank Wurzeln geschlagen und würde am liebsten direkt hier schlafen. Der spezielle Ort und die Aussicht geben den Ausschlag. Doch schließlich bleibt mir nichts anderes übrig als zu kapitulieren. Der Regen wird zu stark, ich werde zu nass. Ich gehe tiefer in den kleinen Wald hinein, komme zu einem drei Meter hohen Kreuz, um das herum drei Bänke stehen und man auch von hier aus die Ostsee sehen kann. Die Wahl fällt auf die mittlere Bank, vom Regen einigermaßen dank der Bäume geschützt. Kurz vor 22 Uhr höre ich die beiden Mädchen und den Mann aufbrechen. Von nun an bin ich allein im Wald. Im Radio läuft Sternenhimmel, was strenggenommen eine Lüge ist, denn keine Sterne weit und breit. Im Schlafsack liegend, dringen ein paar Tropfen durch das Blätterdach hindurch, nicht so toll, aber auch kein Beinbruch. Tatsächlich kommen dann doch noch zweimal Leute im dunklen Wald vorbei, ich mach mir keine Platte und schlafe wenig später ein.
Erst 5 Uhr wache ich wieder auf. Die Nacht scheint einigermaßen in Ordnung gewesen zu sein, zumindest zeigt mein Schlafsack keine Anzeichen von Nässe. Über dem Meer geht die Sonne auf, unter mir bleiben sie weiterhin in ihrer Erde liegen. Auch ich bleibe liegen, noch immer auf der Suche nach der Motivation. Ich denke mal wieder an sie, das macht es nicht besser. Erst kurz vor acht stehe ich endlich auf, wohlwissend das bald die ersten Spaziergänger mit ihren Hunden vorbeikommen werden. Nach nur einhundert Metern bin ich auch schon aus dem Wald raus … und mache die erste Pause auf einer Bank oberhalb der Klippe. Fotos vom Sonnenaufgang, Zigarette, ich betrachte mich selbst auf der Kamera oder eher meine Nase, die ein wenig Verdun gleicht und sich dennoch langsam aber sicher erholt. Auf dem angenehmen, schönen Küstenweg geht es weiter, der nächste Campingplatz, zwei Typen in meinem Alter trinken Kaffee auf einer Bank. Etwas Smalltalk. Sie sind begeistert von meiner Wanderung oder zumindest von dem, was sie sich darunter vorstellen. Gemeinsam laufen die beiden jedes Jahr für ein Wochenende ein Stück an der Ostseeküste lang und so kommen auch sie auf ihre Art und Weise irgendwie voran. Für mich geht es weiter, der nächste kleine Wald oberhalb der Küste … doch ich bin nicht so richtig hier, es erinnert mich an Warnemünde und von Warnemünde wiederum daran, wie wir uns kennengelernt haben. Loslassen, sagt sie. Schwierig, denke ich. Es ist wieder ein grauer Morgen, der erste Ort des Tages ist das Seebad Grömitz, kurz nach neun Uhr komme ich am Jachthafen an. Bänke unter einem Dach auf der Strandpromenade laden zu einer Pause ein. Frühstück, der Kicker