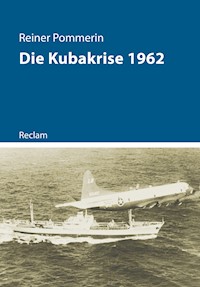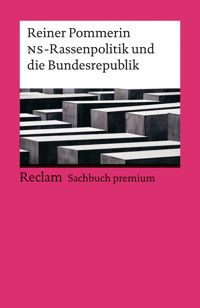
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclam Sachbuch premium
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das »Dritte Reich« ging bei seiner Vernichtungspolitik erschreckend systematisch zu Werke und berief sich dabei immer wieder auf Adolf Hitlers Mein Kampf. Reiner Pommerin legt den ersten vollständigen Überblick zur NS-Rassenpolitik vor: Nicht nur wird darin genau beschrieben, was die einzelnen Opfergruppen (von Menschen mit Erbkrankheiten über Sinti und Roma bis hin zu Homosexuellen) im NS-Staat erleiden mussten. Pommerin geht auch auf die Aufarbeitung der einzelnen Verbrechen nach 1945 ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Ähnliche
Reiner Pommerin
NS-Rassenpolitik und die Bundesrepublik
Reclam
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962239
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: Umschlagabbildung: © Shutterstock.com / Musicheart7
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962239-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014472-5
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
2. Bausteine für eine Rassenideologie
2.1 »Minderwertige«
2.2 »Unwertes Leben«
2.3 »Parasitäres Judentum«
2.4 »Verbrecherrasse Zigeuner«
2.5 »Widernatürliche Unzucht«
2.6 »Rassische Zucht«
3. Hitlers rassenpolitisches Programm
4. Zwangssterilisation, Abtreibung, »unbarmherzige Aussonderung«
4.1 »Reinerhaltung des Blutes«
4.1.1 Zwangssterilisationen
4.1.2 Sterilisierung der Kinder kolonialer alliierter Besatzungstruppen
4.1.3 Zwangsabtreibungen
4.1.4 »Unbarmherzige Absonderung«
4.1.5 Kindermord
4.1.6 »Gnadentod« (T4)
4.1.7 »Sonderbehandlung 14f13«
4.2 Bundesrepublik: Geringe Entschädigung und vergeblicher Kampf um Rehabilitierung
4.2.1 Verweigerung des rassenpolitischen »Opferstatus«
4.2.2 Halbherzige »moralische Rehabilitierung«
5. »Entfernung der Juden aus dem deutschen Volkskörper«
5.1 Gewalt und Boykott
5.1.1 Juristische Ausschließung
5.1.2 »Restlose Auswanderung«
5.1.3 Nürnberger Rassengesetze
5.1.4 Der »Anschluss« Österreichs
5.1.5 Novemberpogrom
5.1.6 »Ausschaltung aus dem Wirtschaftsleben«
5.1.7 Kriegsbeginn und Verfolgung
5.1.8 Deportation und Vernichtung
5.2 Bundesrepublik: Die »Wiedergutmachung« jüdischen Leids
6. »Rassische Absonderung des Zigeunertums«
6.1 Ausgrenzung, Entrechtung, Gewalt
6.1.1 Verfolgung und Ermordung
6.2 Bundesrepublik: Späte Rehabilitierung und Entschädigung
6.2.1 Rassisch verfolgt oder »kriminell« und »asozial«?
6.2.2 Eigeninitiative und Rehabilitierung
7. »Staatsfeind« Homosexueller
7.1 Ausgrenzung, Entrechtung, Gewalt
7.1.1 Verschärfung des § 175
7.1.2 Verfolgung und Ermordung
7.2 Bundesrepublik: Rehabilitierung und Entschädigung
7.2.1 Fortführung der Kriminalisierung
7.2.2 Aufhebung des § 175 und Rehabilitierung
8. Die Gewinnung von »Rassegut«
8.1 Die Förderung ehelicher Geburten
8.1.1 Förderung unehelicher Geburten
8.1.2 Die Förderung von Wehrmachtkindern
8.1.3 Die »Germanisierung« verschleppter Kinder
8.2 Bundesrepublik: Weder Entschädigung noch Rehabilitierung
9. Fazit
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Literaturhinweise
1. Quellen
2. Zeitgenössisches Schrifttum
3. Literatur
Personenregister
[9]Vorwort
»Selten, oder vielleicht tatsächlich nie in der Geschichte hat ein Herrscher, ehe er an die Macht kam, so genau wie Adolf Hitler schriftlich entworfen, was er danach tat.«1
Seit 1920 beschrieb Hitler in Reden, in Mein Kampf (1925/26) und seinem Zweiten Buch (1928) seine Rassenideologie. Weil aus seiner Sicht allein »Blut und Rasse« über die Fähigkeiten und Leistungen eines Volkes und dessen Platz in der Weltgeschichte entschieden, setzte er sich zum Ziel, den »Rassenwert« des deutschen Volkes zu sichern und zu steigern. Am 30. Januar 1933 erreichte Hitler die Machtposition, um eine entsprechende Politik betreiben zu können. Zur Sicherung des »Rassenwertes« folgten Zwangssterilisationen und Abtreibungen, die Ermordung psychisch und physisch Kranker, die Verfolgung und Ermordung von Juden, »Zigeunern« (Sinti und Roma) und Homosexuellen. Zur Steigerung des »Rassenwertes« diente die Förderung ehelicher wie unehelicher Geburten. Auch die von deutschen Soldaten in besetzten Ländern gezeugten »germanischen Kinder« waren hochwillkommen. Zusätzlich wurden »rassisch wertvolle« Kinder aus osteuropäischen Gebieten verschleppt und anschließend im Reichsgebiet »germanisiert«.
Das Ausmaß an Brutalität, Skrupellosigkeit und Menschenverachtung, mit dem Hitlers rassenpolitisches Programm Verwirklichung fand, lässt sich kaum erfassen. Ohne Kenntnis der von Hitler formulierten Ziele ist die NS-Rassenpolitik mit ihren verschiedenen Teilbereichen nicht zu verstehen. Gleichwohl erfuhr sie im Verlauf der NS-Herrschaft weitere rassistische, ökonomische und [10]kriegsbedingte Ergänzungen. Daran waren Institutionen von Staat und Partei sowie Eliten aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft maßgeblich beteiligt.
Bereits die erste Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer (CDU) fühlte sich moralisch verpflichtet, die jüdischen Opfer der NS-Rassenpolitik zu entschädigen. Allerdings sträubte sie sich, wie nachfolgende Regierungen und Parlamentsvertreter, weitere Opfergruppen in das Gesamtspektrum rassisch Verfolgter einzubeziehen. Für Zwangssterilisierte, Hinterbliebene der im Rahmen der »Euthanasie« Ermordeten, »Zigeuner«, Homosexuelle und zur »Germanisierung« verschleppte Kinder schloss die Gesetzgebung der Bundesrepublik Entschädigungsleistungen zunächst aus. Eine Kurskorrektur erfolgte zumeist erst, wenn historische Forschungsergebnisse zu den verschiedenen Bereichen der NS-Rassenpolitik vorlagen. Unterstützend wirkten dabei die Öffentlichkeitsarbeit von Opferverbänden und die Initiativen politischer Parteien im Deutschen Bundestag.
Die folgende Überblicksdarstellung wird durch mehrere Voraussetzungen erleichtert: Erstens liegen inzwischen für alle Bereiche der NS-Rassenpolitik qualifizierte Forschungsarbeiten vor. Die zahlreichen über den Holocaust verfassten Werke ermöglichen es, sich auf das Schicksal der deutschen Juden zu konzentrieren. Das Schicksal der vom Holocaust betroffenen Juden in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten in Ost- und Südosteuropa sowie in der Sowjetunion wird in der umfassenden Edition Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland dargestellt. Sie erfasst in 16 Bänden sowohl Opfer- und Täterdokumente als auch [11]Quellen zum Verhalten der Mehrheitsbevölkerung. Der einfache Zugriff auf diese Edition und die einschlägige Forschungsliteratur in den Bibliotheken erlaubt es, auf einen ansonsten überbordenden Anmerkungsapparat zu verzichten. Die verwendete Forschungsliteratur findet sich in den Literaturhinweisen.
Zweitens haben sich Haltung und Politik der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages verändert: Seit Mitte der 1980er Jahre wurden auch nichtjüdische Opfer nationalsozialistischer Rassenpolitik anerkannt beziehungsweise rehabilitiert. Damit war in vielen Fällen auch eine finanzielle Entschädigung verbunden.
Drittens hat inzwischen die Wissenschaft die genetische Vielfalt der Menschen intensiv untersucht und alle Rassenkonzepte eindeutig als typologische Konstrukte entlarvt.
Die folgende Darstellung der NS-Rassenpolitik und der Umgang damit in der Bundesrepublik ist nicht zuletzt auch persönlich motiviert: Antisemitische Hetze und Gewalt gegen Juden sind schon wieder ebenso alltäglich wie Beschimpfungen und gewalttätige Übergriffe gegenüber Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Offensichtlich können Gedenkstätten, Gedenkfeiern und Gedenkreden die mittlerweile erschreckenden Lücken bei den Geschichtskenntnissen nicht wettmachen.
Zu besonderem Dank für Hinweise und Korrekturen bin ich meinen langjährigen Freunden und Kollegen Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll und Prof. Dr. Manfred Nebelin verpflichtet. Ich widme das Buch meiner Frau Ulrike und meinem Sohn Frederic.
[12]1. Einleitung
»Der nationalsozialistische Rassismus [erschöpfte] sich nicht, wie manche glauben oder glauben machen wollen, in einem zur äußersten Konsequenz getriebenen Antisemitismus. Es war nützlich zu zeigen, dass die Judenvernichtungsaktionen der Hitlerjahre aus der nationalsozialistischen Philosophie und Politik hervorgingen, und sie in den Gesamtzusammenhang der im Namen des Nazirassismus begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuordnen.«1
Dieses Resümee zog 1950 der französische Hauptankläger am Internationalen Militärgerichtshof, François de Menthon, in der Rückschau auf den Nürnberger Prozess. Der »zur äußersten Konsequenz getriebene Antisemitismus« mit den »Judenvernichtungsaktionen der Hitlerjahre« bestimmte längere Zeit die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Allerdings standen noch weitere »im Namen des Nazirassismus begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit« im »Kontext einer breiter angelegten Rassenpolitik« (Peter Longerich).
Die deutsche Bevölkerung zeigte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur wenig Bereitschaft, moralische und politische Verantwortung für Verbrechen der NS-Zeit zu übernehmen. Vielmehr überwog die Einstellung, die Schuld an diesen Verbrechen liege allein beim NS-Staat, den Parteigliederungen und der SS. Die übrige Gesellschaft habe dagegen lediglich eine passive Rolle gespielt. Viele Deutsche betrachteten das »Dritte Reich« als »eine Art geschichtlichen Fremdkörper« (Hans Mommsen) und als eine Last, von der es sich so schnell wie möglich zu befreien galt. [13]Es ging weniger um ein »Nichtwahrhabenwollen« als um ein »Nichtgenauwissenwollen« und ein »Nichtertragenkönnen« (Norbert Frei).
Dies galt in besonderer Weise für die im Rahmen der nationalsozialistischen Rassenpolitik verübten Verbrechen. Nichts Genaues wissen wollte man von der Vernichtung des europäischen Judentums und den KZ. Nichts Genaues wissen wollte man von Zwangssterilisationen und erzwungenen Schwangerschaftsabbrüchen, von der Ermordung angeblich psychisch kranker und behinderter Menschen. Nichts Genaues wissen wollte man von der Ermordung von »Zigeunern«, der Verfolgung Homosexueller und der Verschleppung »blonder und blauäugiger« Kinder aus von der Wehrmacht besetzten Ländern. Weitgehend auf Unverständnis und Ablehnung stießen daher bereits die von den Westalliierten in ihren Besatzungszonen und in den Westsektoren Berlins erlassenen ersten Entschädigungs- und Rückerstattungsregelungen für Verfolgte des NS-Regimes. Als die wahren Opfer der NS-Zeit sahen viele Deutsche in erster Linie wohl sich selbst. Ihrer Ansicht nach waren sie es, die einer Entschädigung bedurften, hatten sie doch Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung und Kriegsgefangenschaft erlitten.
Als aus rassischen Gründen verfolgt galten eindeutig die von einem industrialisierten Völkermord betroffenen Juden. Dass weitere Personen zu den Opfern der NS-Rassenpolitik zählten, gehörte in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch nicht zum Erkenntnisstand der politisch Verantwortlichen. Die Anerkennung und Entschädigung der nichtjüdischen Opfer der NS-Rassenpolitik erschwerte bis Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepublik zum einen die [14]überwiegend noch aus der NS-Zeit übernommene Verwaltungsbürokratie. Der Bundestag hatte ehemalige Beamte wiedereinstellen müssen, weil ansonsten das Defizit an erfahrenem Personal für die neu entstehenden Bundes- und Länderministerien nicht hätte bewältigt werden können. So hatten etwa 50 Prozent der Beamten des neuen Bundesministeriums der Justiz in der Rosenburg in Bonn-Kessenich zuvor der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) angehört. In manchen Abteilungen des Ministeriums betrug ihr Anteil sogar 70 Prozent.
Zum anderen wurde die Anerkennung und Entschädigung der nichtjüdischen Opfer der NS-Rassenpolitik dadurch belastet, dass sich eine wirksame Entnazifizierung der Justiz als undurchführbar herausgestellt hatte. So mussten bereits in den drei westlichen Besatzungszonen Staatsanwälte und Richter eingestellt werden, die Mitglieder der NSDAP gewesen waren. Von den Mitte der 1950er Jahre am Bundesgerichtshof angestellten Richtern hatten fast 80 Prozent bereits in der NS-Zeit als Richter gearbeitet. In der Bundesanwaltschaft lag der Anteil der früheren NSDAP-Mitglieder unter den leitenden Bundes- und Oberstaatsanwälten bis Mitte der 1960er Jahre bei ungefähr 75 Prozent. Von den elf verantwortlichen Bundesanwälten des Jahres 1966 hatten zehn die Parteimitgliedschaft besessen. Von der Mehrheit dieser Staatsanwälte und Richter durfte kaum großes Engagement erwartet werden, wenn es um die Aufklärung und Verfolgung von NS-Verbrechen ging.
Die von mir 1979 vorgelegte Arbeit über die 1937 erfolgte illegale Zwangssterilisation von »Mischlingskindern«, deren Väter aus den Reihen der überseeischen Kolonialtruppen der alliierten Besatzer stammten, erhielt zwar ein [15]großes Presseecho. Die Hoffnung, die Arbeit über die »Rheinlandbastarde« würde dazu beitragen, den Blick auf andere Opfer der NS-Rassenpolitik zu erweitern, blieb jedoch unerfüllt.
Die Anfang der 1980er Jahre erschienenen verdienstvollen Arbeiten von Ernst Klee und Götz Aly legten das Ausmaß der unter dem Deckmantel angeblicher medizinischer Forschung erfolgten Verbrechen bloß. Beide Autoren schilderten die an »behinderten« Jugendlichen und Erwachsenen erfolgten »Euthanasiemorde«. Sie entrissen nicht nur das Schicksal dieser Opfer dem Vergessen, sondern nannten zudem die Namen der überwiegend ungeschoren davongekommenen Täter. Eine Einordnung dieser Verbrechen in den Gesamtzusammenhang der NS-Rassenpolitik blieb allerdings wohl deshalb zunächst noch aus, weil damals zweckorientierte statt rassenpolitische Gründe als deren Ursache angesehen wurden. Dazu verwiesen beide Autoren auf Dokumente aus der NS-Zeit, die Sterilisationen und »Euthanasiemaßnahmen« mit dem Hinweis gerechtfertigt hatten, dass ansonsten die Pflege und Verwahrung von psychisch und physisch Erkrankten hohe finanzielle Belastungen für die »Volksgenossen« im NS-Staat bedeutet hätten. Rassenpolitische Gründe seien allenfalls, so etwa Aly, von solchen Tätern herangezogen worden, die ihr Gewissen entlasten wollten, weil ihnen zweckorientierte Gründe allein für ihr Handeln nicht ausgereicht hätten.
Eine Fülle von lokal- und regionalgeschichtlichen Studien bereicherte in den darauffolgenden Jahren die historische Forschung zur Geschichte der NS-Rassenpolitik. Arbeiten zu Zwangssterilisationen, zur Ermordung von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, zur [16]Verfolgung und Ermordung von »Zigeunern« und zum Schicksal Homosexueller stießen auch Diskussionen über eine Entschädigung und Rehabilitierung bisher unberücksichtigt gebliebener Opfer der NS-Rassenpolitik an. Allerdings forderten die Betroffenen keineswegs nur finanzielle Entschädigungen. Ihnen ging es vor allem um die Anerkennung ihres Status als aus rassischen Gründen Verfolgte. Um diese Anerkennung endlich zu erreichen, schlossen sie sich im »Zentralrat Deutscher Sinti und Roma« oder im »Bund der ›Euthanasie‹-Geschädigten und Zwangssterilisierten e. V.« zusammen. Dort bündelten sie ihre Aktivitäten, betrieben Aufklärung und vor allem gezielte Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Dies führte schließlich zu einer wachsenden Aufmerksamkeit in Gesellschaft und politischen Parteien und schließlich zu – allerdings sehr unterschiedlich ausfallenden – Erfolgen im Bundestag und bei der Bundesregierung.
Der wissenschaftlich »ganz unergiebige« Historikerstreit (Ulrich Herbert) der Jahre 1986/87 lieferte keine Anregungen für eine Korrektur der bisherigen Anerkennungs- und Entschädigungspraxis der Bundesrepublik gegenüber den Opfern der NS-Rassenpolitik. Vielmehr kennzeichnete diesen Streit ein Exzess an Emotionen, ideologischer Voreingenommenheit und persönlicher Gehässigkeit. Offensichtlich ging es weniger um eine Auseinandersetzung mit den provozierenden Thesen von Ernst Nolte, sondern »um Deutungshoheit, um Forschungsmittel und die Besetzung von Stellen«, kurz: um »Personalpolitik und Gesinnungskontrolle« (Hans-Ulrich Wehler).
Wer neben Juden andere Betroffene als Opfer der NS-Rassenpolitik bezeichnete, schien immer noch die [17]Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit des Holocaust in Frage zu stellen. Dies zeigte schließlich die Auseinandersetzung um das 2005 eröffnete Holocaust-Denkmal in Berlin. Allein schon der Vorschlag, den ›Kanon‹ der NS-Rassenpolitik um die Gruppe der Sinti und Roma zu erweitern, zog den Vorwurf nach sich, dies führe zu einer Relativierung des Holocaust. Dabei bestand und besteht nach wie vor keine Gefahr, dass der Holocaust aus dem historischen Gedächtnis der Bundesrepublik verdrängt werden könnte. Schließlich bildet das Gedenken daran für das Selbstverständnis der Berliner Republik den entscheidenden erinnerungspolitischen Bezugspunkt.
1986 veröffentlichte die Historikerin Gisela Bock eine bahnbrechende Arbeit zur Zwangssterilisation. Überzeugend charakterisierte sie diese Eingriffe als eine spezifische Form der NS-Rassenpolitik. Dennoch sah auch die damalige Bundesregierung keine Notwendigkeit, ihre Auffassung zur Anerkennung und Entschädigung von Zwangssterilisierten zu ändern. Ein Umdenken hinsichtlich einer Entschädigung für Homosexuelle als Opfer der NS-Rassenpolitik blieb ebenfalls ausgeschlossen. Vorurteile und der noch bis 1994 gültige § 175 versperrten selbst den Blick auf das Leid der in Konzentrationslager verbrachten Männer mit dem »Rosa Winkel«.
Zwar wird von einigen Historikern aufgrund der Rivalitäten in der NS-Führung und des Kompetenzwirrwarrs im NS-Staat der Stellenwert Hitlers als gering angesehen, doch dessen Überlegungen und Aktivitäten behalten für das Verständnis der Rassenpolitik des »Dritten Reichs« entscheidende Bedeutung. Die Perspektive allein auf Hitlers programmatische Ideen über Judenvernichtung und [18]Rassenherrschaft zu verengen, wäre aber falsch. Trugen doch viele staatliche Institutionen, außerstaatliche Gruppierungen und Eliten aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft für die rassenpolitischen Verbrechen der NS-Zeit Mitverantwortung. Die »Vielzahl von Tätern, Tatorten, Tathergängen und Opfern« (Ulrich Herbert) geriet allerdings erst 40 Jahre nach Kriegsende stärker in den Blick. Deren Erforschung ist noch keineswegs abgeschlossen.
Im Folgenden werden zunächst kurz einige Thesen aus Schriften einer angeblich »wissenschaftlichen« Rassenforschung vorgestellt, aus denen sich Hitler Bausteine für seine Rassenideologie zusammenklaubte. Danach werden Inhalt und Ausmaß des Rassenwahns bei Hitler vorgestellt, um den überdimensionalen Stellenwert, welcher der »Rasse« und dem Erhalt des »Rassenwertes« aus seiner Sicht zukamen, zu verdeutlichen. In den weiteren Kapiteln erfolgt – nach plakativer Heranziehung programmatischer Aussagen Hitlers – eine knappe Darstellung der einzelnen Bereiche der rassenpolitischen Praxis. Am Ende jedes dieser Kapitel wird dann der Weg zur erfolgten oder auch nicht erfolgten Anerkennung, Rehabilitierung und Entschädigung der jeweiligen von der nationalsozialistischen Rassenpolitik betroffenen Opfergruppe in der Bundesrepublik nachgezeichnet.
Da eine Vielzahl von Ausgaben von Mein Kampf existiert, wird bei Zitaten die entsprechende Seitenzahl in der kritischen Edition des Instituts für Zeitgeschichte in München angegeben. Die Zitate aus dem Zweiten BuchHitlers werden der Ausgabe der von Gerhard L. Weinberg herausgegebenen Edition entnommen. Bei einigen wenigen Kurzzitaten oder der Übernahme wichtiger Ergebnisse der [19]Forschung füge ich in Klammern den Namen des jeweiligen Autors hinzu. Alle herangezogenen Parlamentsmaterialien und Beratungsvorgänge lassen sich leicht mit Hilfe des Internets im Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien des Deutschen Bundestages ermitteln.
Die Wortwahl der in diesem Buch verwendeten Begriffe orientiert sich notwendigerweise an der Sprache der Quellen. Das heißt konkret, dass sich der Verfasser in vielen Fällen dazu genötigt sah, auf die Lingua Tertii Imperii zurückzugreifen, wie sie durch den Dresdner Romanisten Victor Klemperer in unübertroffener Weise analysiert und entlarvt worden ist. Dass ich solche Begriffe auch dort stets in kritischer Distanz verwende, wo dies ohne ausdrückliche Kennzeichnung geschieht, muss nicht eigens betont werden.
[20]2. Bausteine für eine Rassenideologie
2.1 »Minderwertige«
Der britische Naturforscher Charles Darwin legte 1859 mit seinem Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder über die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampfe ums Dasein die Grundlagen der Evolutionsbiologie. Im »Kampf ums Dasein« konnten laut seinen Forschungsergebnissen nur diejenigen Arten erfolgreich überleben, welche den harten Prozess der natürlichen Auslese durch eine bestmögliche Anpassung an die Umwelt bestanden hatten. Darwins Werk erschien 1860 in deutscher Sprache. Seine in der Natur erkannten Gesetzmäßigkeiten erfuhren allerdings schon bald eine von ihm ganz unbeabsichtigte Übertragung auf die menschliche Gesellschaft.
Ein zunächst Mitte des 19. Jahrhunderts in französischer Sprache erschienenes Werk des französischen Diplomaten und Schriftstellers Arthur de Gobineau erschien zu Beginn des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache mit dem Titel: Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen. Die Übersetzung hatte Richard Wagner angeregt. Gobineau ging von drei an ihrer jeweiligen Hautfarbe erkennbaren Grundrassen aus. Dominant unter diesen sei eindeutig die weiße Rasse. Sie gehe als Herrenrasse und Kulturbringer auf die Arier zurück, eine – nach Auffassung Gobineaus – geistig, politisch und kulturell überlegene Menschengruppe. Allerdings habe die arische Rasse sich bei der Unterwerfung fremder Völker zu stark mit diesen vermischt und deshalb ihre ursprüngliche »Rassenreinheit« samt ihrer Überlegenheit eingebüßt.
[21]Gobineau und der britische Naturforscher Francis Galton interpretierten Darwins »Kampf ums Dasein« als eine ständige Auseinandersetzung zwischen angeblich minder- und höherwertigen Menschenrassen. Beide Autoren befassten sich mit den vermeintlich negativen Auswirkungen von Rassenmischung und hielten eine Vergrößerung des Anteils positiver Erbanlagen bei Menschen durch Zucht für möglich. Galton beklagte, dass die natürliche Selektion wegen eines »Pseudo-Humanismus« in den Industriestaaten nicht mehr stattfinde. Die höhere Zahl von physisch und psychisch belasteten Kindern aus den von ihm als »minderwertig« angesehenen Bevölkerungsgruppen werde somit zwangsläufig eine Degeneration der menschlichen Rasse nach sich ziehen. Im Rahmen einer von ihm so bezeichneten »positiven Eugenik« müsse daher die Geburtenrate in den nachweislich »begabten« Familien erhöht werden. Maßnahmen einer »negativen Eugenik« sollten hingegen die Geburt »untauglicher« Kinder möglichst verhindern. Überlegungen zu »Verbesserungen« der menschlichen Rasse stellten auch deutsche Anthropologen, Ärzte und Soziologen an.
Der Mediziner Wilhelm Schallmayer veröffentlichte 1891 die Schrift Über die drohende körperliche Entartung der Culturmenschheit und die Verstaatlichung des ärztlichen Standes. Die kulturelle Entwicklung – so sein Fazit – behindere die natürlichen Prozesse der Selektion. Aus diesem Grund müssten zum einen vor einer geplanten Ehe die erblichen Anlagen überprüft werden. Auf diese Weise ließe sich eine erbbiologisch unerwünschte Eheschließung – wie in einigen Staaten der USA und in Skandinavien bereits üblich – rechtzeitig verhindern. Zum anderen hielt [22]Schallmayer die Isolierung von Epileptikern, »Schwachsinnigen«, »gemeingefährlichen Irren« und Verbrechern in geschlossenen Anstalten für angebracht, um deren Fortpflanzung zu unterbinden.
Der Mediziner Alfred Ploetz machte 1895 in Deutschland die Bezeichnung »Rassenhygiene« als Synonym für »Eugenik« publik. Er hoffte, Ehepaare mit Verweis auf eine gefährdete Erbgesundheit ihrer Nachkommen zu einem freiwilligen Verzicht auf Alkohol und Nikotin bewegen zu können. Die meisten deutschen Rassenhygieniker hielten zu diesem Zeitpunkt bei vorliegender Erbkrankheit eine Eheberatung heiratswilliger Partner noch für ausreichend. Eine kleinere Gruppe unter ihnen hielt hingegen eine Kastration oder Sterilisation und bei einer erbbiologisch unerwünschten Schwangerschaft die Einleitung eines künstlichen Aborts für erforderlich. Eine erste Unfruchtbarmachung zur Vermeidung erblich belasteter Nachkommen führte 1897 der durch den »Kaiserschnitt« bekannt gewordene Heidelberger Gynäkologe Ferdinand Adolf Kehrer durch. Der Psychiater und Kriminologe Paul Adolf Näcke, ärztlicher Vorstand der »Anstalt für geisteskranke Männer« im Schloss Hubertusburg bei Leipzig, sah die Unfruchtbarmachung »gewisser Klassen von Degenerierten« als eine Pflicht des Staates an. Allerdings bedürfe es dazu aus Gründen der Rechtssicherheit noch eines entsprechenden Sterilisationsgesetzes.
Auf das gestiegene Interesse an Themen der Rassenhygiene reagierte Ploetz 1904 mit der Herausgabe der Zeitschrift Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie einschließlich Rassen- und Gesellschafts-Hygiene. Die dort erscheinenden Beiträge umfassten die gesamte Bandbreite [23]des damaligen rassenhygienischen Spektrums. 1905 gründete er in Berlin die »Gesellschaft für Rassen-Hygiene«, die eine »Förderung der Theorie und Praxis der Rassenhygiene unter den weißen Völkern« propagierte. Der Gesellschaft traten neben Ploetz der Biologe Erwin Baur, der Psychiater Ernst Rüdin und auch Schallmayer bei. Weitere Gruppen der Gesellschaft bildeten sich bald in Freiburg, München und Stuttgart.
Der Psychiater Emil Kraepelin veröffentlichte 1909 ein Lehrbuch für Psychiater. Geisteskrankheiten – so seine These – seien eindeutig auf Vererbung zurückzuführen. Eine Unterbringung der Betroffenen in Anstalten könne daher die Erblichkeit dieser Krankheit, wenn auch mit hohen Kosten, wenigstens eindämmen. Sein Schüler Rüdin hielt ebenfalls Geisteskrankheiten für vererbbar. Eine Mehrheit der deutschen Rassenhygieniker sah allerdings immer noch das Einverständnis der Betroffenen oder eines Vormunds als notwendige Voraussetzung für eine Sterilisation aus eugenischen Gründen an. Doch die Zahl der Befürworter einer Zwangssterilisation nahm zu, was wohl auch der generellen politischen und sozialen Radikalisierung in Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zuzuschreiben war.
Der Dresdner Sozialhygieniker Rainer Fetscher führte 1919 nach eigener Aussage ohne Rücksicht auf die gesetzliche Situation in seiner Praxis elf Sterilisationen aus eugenischer Indikation durch. Auch er ging davon aus, dass Alkoholismus und Kriminalität erblich bedingt seien. Deshalb begann er, für eine »Kriminalbiologische Kartei des Freistaates Sachsen« »kriminelle Familien« zu erfassen. 1921 legten die Rassenhygieniker Eugen Fischer, Erwin Baur[24]und Fritz Lenz einen Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene (Eugenik) vor. Um Rassenhygiene kam die Wissenschaft jetzt auch institutionell nicht länger herum. Deshalb richtete die Universität München 1923 den ersten Lehrstuhl für Rassenhygiene in Deutschland ein, den Lenz erhielt. Auch er hatte vor, Erbkrankheiten durch Sterilisation zu verhindern.
Der Leiter der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses in Zwickau, Heinrich Braun, führte 1924 bei einem Mädchen und drei Jungen Sterilisationen aus eugenischer Indikation durch. Diese Eingriffe machte er mit Absicht der Öffentlichkeit bekannt. Selbst wenn eine Unfruchtbarmachung oder eine Unterbrechung der Schwangerschaft in Deutschland aus eugenischen Gründen gesetzlich bisher nicht geregelt sei – so argumentierte er –, dürfe ein »Schwachsinniger« operiert werden. Erforderlich sei lediglich, dass ein Arzt die Operation für notwendig erachte und die Einwilligung der Eltern oder der gesetzlichen Vertreter vorliege. Zu den Eingriffen hatte Braun der Zwickauer Medizinalrat Gustav Emil Boeters angeregt. Dieser gab an, bereits selbst 63 »Entartete« sterilisiert zu haben. Über diese Eingriffe sei die Staatsanwaltschaft vorher informiert worden, sei jedoch nicht dagegen eingeschritten. Offensichtlich – so seine Folgerung – habe es sich bei den Eingriffen also um kein Vergehen gehandelt. Um die unklare juristische Situation aber endlich zu beenden, forderte er ein Gesetz zur »Verhütung unwerten Lebens durch operative Maßnahmen«.
Dazu entwarf Boeters einen Vorschlagstext, den er nach seinem Wohnort »Lex Zwickau« nannte. Durch Sterilisation – so lautete sein Vorschlag – solle die [25]Fortpflanzungsfähigkeit von Kindern, die wegen angeborener Blindheit, angeborener Taubheit, Epilepsie oder »Blödsinn« am Schulunterricht nicht mit Erfolg teilnehmen könnten, unterbunden werden. »Geisteskranke«, »Geistesschwache«, Epileptiker, Blind- und Taubgeborene in privaten oder öffentlichen Anstalten müssten vor einer Beurlaubung, spätestens aber vor ihrer Entlassung sterilisiert werden. Frauen und Mädchen, die wiederholt Kinder zur Welt gebracht hätten, deren Väter nicht feststellbar seien, müssten auf ihren Geisteszustand untersucht werden. Bei der Feststellung »erblicher Minderwertigkeit« seien diese Frauen unfruchtbar zu machen. »Erbliche Minderwertigkeit« lag nach seiner Auffassung bei Trunksucht, Morphium- oder Kokainmissbrauch, unverbesserlicher Arbeitsscheu sowie generell bei Landstreichern und »Zigeunern« vor. Personen, bei denen Erbkrankheiten erkannt worden seien, dürften aus seiner Sicht eine Ehe erst nach ihrer Unfruchtbarmachung eingehen. Bei der Regierung des Freistaats Sachsen stießen Boeters Vorschläge allerdings auf keine positive Resonanz. Das Land Preußen wiederum richtete, weil die Durchsetzung eines Gesetzes für Untersuchungen zur Ehetauglichkeit auf Reichsebene aussichtslos schien, ab 1926 auf kommunaler Ebene Eheberatungsstellen ein. Heiratswillige konnten sich dort freiwillig auf ihren Gesundheitszustand untersuchen lassen. Die Nachfrage blieb jedoch gering.
Auf dem Gebiet der Rassenhygiene war in Deutschland bisher keine Grundlagenforschung betrieben worden. Deshalb gründete die »Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.« 1927 in Berlin-Dahlem das »Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik«, dessen Leitung Fischer übernahm. [26]Die Mitglieder des Instituts, zumeist Professoren und Privatdozenten, erhielten Lehraufträge an der Berliner Universität. Offensichtlich bestimmten Sterilisationen aus eugenischen Gründen auch ohne gesetzliche Absicherung während der Weimarer Republik weiterhin den Alltag. So stellte Fetscher Ende der 1920er Jahre anhand einer Umfrage bei 95 Städten fest, dass in 17 der von ihm angeschriebenen Kommunen bereits 117 solche Sterilisierungen, darunter auch einige an Minderjährigen und Entmündigten, durchgeführt worden waren. Da Hitler der erste Weimarer Politiker zu sein schien, der die Rassenhygiene als eine zentrale Aufgabe des Staates ansah, trat eine Reihe von Rassenhygienikern und Humangenetikern schon vor 1933 der NSDAP bei.
2.2 »Unwertes Leben«
Der österreichische Psychologe Adolf Jost regte 1895 in seiner Schrift Das Recht auf den Tod an, eine Tötung auf Verlangen zu ermöglichen, falls eine unheilbare Krankheit vorliege. Der Staat müsse für eine solche Sterbehilfe die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Im gleichen Jahr riet auch Ploetz zur Tötung schwächlicher oder missgestalteter Neugeborener »durch eine kleine Dose Morphium«, weil er dies als Möglichkeit eines »idealen Rassenprozesses« ansah. Vorschläge dieser Art blieben jedoch ohne Echo. Der § 216 des Reichsstrafgesetzbuches, der eine Tötung auf Verlangen unter Strafe stellte, behielt weiterhin Gültigkeit.
Der sächsische Berginvalide Jakob Richter sandte 1901 eine Petition an den Sächsischen Landtag. Er bat darum, ein [27]Gesetz zu erlassen, das es einem Arzt ermögliche, einen unheilbar Kranken mit dessen Einverständnis aus Mitleid von seinem Leid zu erlösen. Der Landtag wies das Anliegen mit Hinweis auf das geltende Gesetz zurück. Der Breslauer Oberlandesgerichtsrat Paul Wilutzky erwähnte in einem Artikel für die Zeitschrift Das Recht zwei Fälle, in denen es bereits zu Tötungen aus Mitleid durch Familienmitglieder und entsprechenden Verurteilungen gekommen sei. Unter der Überschrift »Dem Hunde einen Gnadenstoß, dem Menschen keinen!« warb auch er – allerdings vergeblich – um eine Veränderung der Gesetzgebung. Einen »Gnadentod« für Menschen, so wie er bei alten Haustieren üblich sei, propagierte 1904 der Mediziner und Zoologe Ernst Haeckel in seiner Schrift Die Lebenswunder. Ein solcher »Gnadentod«, so führte er aus, müsse Aussätzigen, unheilbar Geisteskranken, Krebskranken, und verkrüppelten, geistig behinderten und taubstummen Neugeborenen gewährt werden. Er begründete diese Tötungen zum einen mit der möglichen Kostenersparnis im Gesundheitsbereich, zum anderen müssten sie allein schon aus Mitleid vorgenommen werden.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verlagerte sich die Diskussion von der Tötung auf Verlangen hin zu einer staatlich erzwungenen. Anstoß dazu lieferte vor allem die gemeinsame Schrift des Juristen Karl Binding und des Psychiaters Alfred Hoche, die 1920 erschien. Ihr Titel lautete: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. Beide Autoren sprachen sich für die Tötung unheilbar Kranker, Verwundeter und »unheilbar Blödsinniger« aus. Eine solche Tötung sei keineswegs nur ein Akt des Mitleids, sondern sie ergebe sich aus der [28]Beurteilung des Wertes des einzelnen Menschen für die Gesellschaft. Schließlich gingen dem Nationalvermögen für die »überflüssige Pflege« dieser Kranken mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Heizung große Summen verloren. Zudem seien für diese »unfruchtbare« Krankenpflege mehrere tausend Personen erforderlich, die dadurch von »fördernder Arbeit« abgehalten würden. Ein solcher personeller und finanzieller Aufwand für »Ballastexistenzen« sei nicht mehr tragbar. Das Töten dieser Personen stellte aus Sicht Bindings »in Wahrheit eine reine Heilhandlung dar«. Doch selbst bei Juristen, Rassenhygienikern und dem Teil der Ärzteschaft, in dem der Gedanke einer erbbiologisch angeblich notwendigen Sterilisation durchaus Zustimmung gefunden hatte, stießen die Vorschläge zur Beendigung »unwerten Lebens« zunächst nur auf geringe Akzeptanz. Allerdings gab es auch Befürworter wie den bereits erwähnten Medizinalrat Boeters, der nicht nur ein Gesetz für die Sterilisation von Erbkranken, sondern inzwischen außerdem ein Gesetz für eine »Euthanasie« aus erbbiologischen Gründen forderte.
2.3 »Parasitäres Judentum«
Judenfeindschaft, Vertreibung und Gewalt gegen Juden gehörten seit Jahrhunderten zur Geschichte Europas. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich jedoch im Kontext eines radikalen Nationalismus eine neue Art von Feindschaft gegenüber Juden. Sie basierte nicht mehr allein auf religiösen und ökonomischen Stereotypen, sondern berief sich auf angeblich wissenschaftlich belegte biologische Faktoren der [29]rassistischen Theorien, die ich bereits erwähnt habe. Beispielsweise verfasste 1861 ein unbekannter, das Pseudonym H. Naudh nutzender Autor die Schrift Die Juden und der deutsche Staat. Er ging davon aus, dass das Judentum »Ausdruck einer Rasseneigentümlichkeit« sei, die eine »mehrtausendjährige Abschließung und Inzucht« präge. Deutsche Gegner des Judentums nutzten wenig später den Begriff »Antisemitismus« »als Name einer Weltanschauung, die in der Unterscheidung und im Kampf zwischen dem ›Arischen‹ und dem ›Semitischen‹ die Grundlage jeder Kulturentwicklung sah« (Christian Geulen). Der Journalist Wilhelm Marr gründete 1879 die deutsche »Antisemitenliga«. Er verwendete zur deutlicheren Abgrenzung vom religiösen Antisemitismus den Begriff »politischer Antisemitismus«. Eine Assimilierung der Juden, die er häufig als »Ratten« bezeichnete, hielt er für unmöglich; denn Juden könnten allein schon deshalb keine »echten Deutschen« werden, weil sie »anderes Blut« hätten. Gegen das »parasitäre« Judentum, welches nach Weltherrschaft strebe, müsse sich das Germanentum entschlossen zur Wehr setzen. Aus Sicht der Rassenantisemiten waren Juden schon an eindeutigen rassentypischen physischen Merkmale erkennbar. Obgleich solche »Entartungszeichen« einer »jüdischen Rasse« wissenschaftlich völlig unsinnig waren, beeinflussten sie doch die Vorstellungswelt der Zeitgenossen. Bei einigen Medizinern entwickelte sich etwa die Überzeugung, es gebe bei Juden eine Veranlagung zu Nerven- und Geisteskrankheiten.
Um Zeitgenossen, die solchen Auffassungen anhingen, als Wähler zu gewinnen, nutzte das Parteiprogramm der einflussreichen Deutsch-Konservativen Partei antijüdische [30]Argumente und wandte sich 1892 gegen den »zersetzenden jüdischen Einfluss«. Im Reichstag wurden Forderungen nach der »Vernichtung der Juden« laut, zumal diese angeblich die Presse und die Kultur dominierten und über zu viel Macht in der Wirtschaft verfügten. Dem könne nur durch »Entjudung«, also durch die Verdrängung der Juden aus dem Wirtschaftsleben, begegnet werden. Tonangebend waren solche Stimmen in Politik und Gesellschaft des kaiserlichen Deutschlands allerdings nicht.
Der Berliner Philosoph und Nationalökonom Eugen Dühring hielt 1893 die »Judenfrage« ebenfalls für eine »Rassen-, Sitten- und Kulturfrage«: »Die Natur selbst verbietet die Verbindung zwischen Angehörigen der arischen Völker und denen der Judenrasse. Sie bestraft die Übertretung dieses Verbotes an dem Einzelnen mit Unfruchtbarkeit und in Verallgemeinerung, abgesehen von der Rassenverschlechterung sogar mit dem Völkertod.« Um einer solchen Bedrohung durch das »Rassejudentum« zu entgehen, hielt Dühring die Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Leben Deutschlands, eine Kontrolle ihres Vermögens und die Ächtung von Ehen mit Juden für notwendige Maßnahmen. Er bedauerte, dass eine Vertreibung von Juden zurzeit lediglich »bei kollektivem Landesverrat« möglich sei. Als »Endlösung« schlug Dühring die Ausrottung »parasitärer Rassen« vor, womit er in erster Linie die Juden meinte.
Dem Schriftsteller Houston Stewart Chamberlain, einem Schwiegersohn Richard Wagners, galten Rasse und Nation als weitgehend identisch. Wie er in seiner 1899 erschienenen Schrift Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts behauptete, verfügten die Deutschen über den höchsten »Rassenwert«. Daher lag ihm besonders an der [31]Herstellung und dem Erhalt eines »Rassenbewußtseins«, weil dieses den einer »reinen Rasse« zugehörigen Menschen angeblich zu außerordentlichen Fähigkeiten verhelfe. Das »Rassenbewußtsein« bildete für den von ihm erwarteten Kampf zwischen den Germanen und den Juden, die alles Minderwertige und Schädliche verkörperten, eine wesentliche Voraussetzung. Kein humanitäres Gerede könne allerdings die Tatsache verschleiern, dass diese Auseinandersetzung »einen Kampf auf Leben und Tod« bedeute. Chamberlain war außerdem davon überzeugt, dass Menschen wie Hunde und Pferde gezüchtet werden könnten und dass die Menschheit durch eine Züchtung von »Ariern« verbessert würde. Während des Ersten Weltkriegs verbreitete er seine kruden Vorstellungen in Artikeln und Broschüren. Die Popularität seiner Ansichten im völkischen antisemitischen Lager belegten nicht zuletzt die bis 1938 erschienenen 24 Auflagen der Grundlagen.
Auch die Zeit des Ersten Weltkriegs brachte trotz des von Kaiser Wilhelm II. verkündeten »Burgfriedens« kein Nachlassen der Hetze gegen Juden, sondern verzeichnete weiterhin Kampagnen antisemitischer Kräfte. Der »Alldeutsche Verband« bezeichnete im Dezember 1914 die »Ausgrenzung und Vertreibung« der deutschen Juden sogar als ein Kriegsziel. Im Oktober 1916 ließ der Staat den Anteil der Juden unter den Soldaten des deutschen Heeres ermitteln. Diese »Judenzählung« stellte eine Antwort auf den nicht nur in Teilen des deutschen Offizierkorps, sondern vor allem in den Medien, Parteien und antisemitischen Verbänden erhobenen Vorwurf dar, Juden würden sich um den Dienst an der Front drücken. Das Ergebnis der Erhebung wurde allerdings erst nach dem Krieg veröffentlicht. [32]Tatsächlich hatte nämlich proportional gesehen die Zahl der jüdischen Frontsoldaten durchaus der Zahl der nichtjüdischen Frontsoldaten entsprochen. Maßlose antisemitische Attacken füllten die Seiten der von 1918 bis zu ihrem Verbot 1921 erscheinenden Wochenschrift Auf gut deutsch, die der Mitbegründer der NSDAP und spätere Herausgeber des Völkischen Beobachters Dietrich Eckart in München herausgab. Außer dem Vorwurf, Juden hätten sich schamlos während des Krieges bereichert, wurde ihnen nach Kriegsende schließlich sogar die Verantwortung für die deutsche Niederlage und die Unterzeichnung des Versailler Vertrags angelastet. Prominente jüdische Politiker wie Matthias Erzberger (Zentrum) und Außenminister Walther Rathenau (DDP) fielen Anfang der 1920er Jahre der Ermordung durch Rechtsradikale zum Opfer.
Wie schon die Verfassung von 1871 hätte auch die Verfassung der Weimarer Republik eigentlich das Streben der Juden in Deutschland nach Gleichberechtigung erfolgreich beenden können. Entworfen hatte die Weimarer Verfassung mit dem Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Hugo Preuss, sogar ein deutscher Jude. Doch in der Realität wurde den Juden im neuen demokratischen Staat nicht selten eine gleichberechtigte Stellung verweigert. Da viele Deutsche die Juden für die Inflation und die schlechte soziale Lage verantwortlich machten, verzeichneten antisemitische und völkische Organisationen wie der »Alldeutsche Verband« oder der »Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund« großen Zulauf. Die Deutschnationale Volkspartei propagierte 1920 in ihrem Parteiprogramm den »Kampf gegen die Vorherrschaft des Judentums in Regierung und Öffentlichkeit«. Die im gleichen Jahr gegründete [33]NSDAP mit ihrem eindeutig antisemitischen Programm hetzte auch in ihren Veranstaltungen gegen Juden. So forderte ihr Redner Hitler am 15. August 1920 in München »Die Entfernung der Juden aus unserem Volk«. Ebenfalls ein positives Echo fanden in völkischen Kreisen die rassistischen antisemitischen Veröffentlichungen des Nationalsozialisten Alfred Rosenberg. Dieser glaubte ein Streben des »internationalen Judentums« nach Weltherrschaft zu erkennen und wollte das angeblich jüdisch durchdrungene Christentum durch eine neue »Religion des Blutes« ersetzen. Der zunehmende Antisemitismus in Teilen der deutschen Gesellschaft führte zu Übergriffen wie dem Scheunenviertel-Pogrom in Berlin im November 1923, zu körperlicher Gewalt gegen jüdische Mitbürger und zu Schändungen von Synagogen sowie jüdischen Friedhöfen. Dem Desinteresse der Behörden, gegen diese Übergriffe und die Judenhetze energisch vorzugehen, vermochte der 1893 gegründete »Central Verein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens« angesichts einer konservativen Justiz wenig entgegenzusetzen.
So schürten zahllose Zeitungsartikel, Flugblätter, Broschüren und Postillen mithilfe eines abstoßend primitiven und brutalen Vokabulars weiter ungestört den Hass gegen Juden. Sie betrieben völkisch-rassistische Propaganda und lieferten breiten Bevölkerungskreisen rassistische Argumentationshilfen. Dies galt besonders für die seit 1905 in Österreich erscheinenden Hefte der Schriftenreihe Ostara. Diese hatte sich neben der Bekämpfung von Feminismus und Parlamentarismus zum Ziel gesetzt, »die arische Edelrasse durch Reinzucht vor dem Untergang zu bewahren«. Ab 1923 diffamierte die vom Gauleiter für Mittelfranken, [34]Julius Streicher, in Nürnberg herausgegebene antisemitische Wochenzeitung Der Stürmer mit primitiven Hetzartikeln und entsprechenden Karikaturen Deutschlands jüdische Bevölkerung.
2.4 »Verbrecherrasse Zigeuner«
Nach 1871 zielten die Anstrengungen der Länder des Deutschen Reichs in erster Linie darauf ab, »Zigeunern« ihre Wanderungen mit Pferd und Wagen oder Karren und Zelten durch entsprechende Bestimmungen und Kontrollen zu erschweren. Das Anmieten von Stellplätzen für ihre Wohnwagen und die Ausgabe eines Wandergewerbescheins unterlagen zahlreichen Restriktionen und behördlicher Willkür. Die Bezeichnung »Zigeuner« wurde schnell zu einem polizeilichen Ordnungsbegriff.
Da regionale Maßnahmen scheiterten, suchte Reichskanzler Otto von Bismarck die Verordnungen und das Vorgehen der Polizei zu vereinheitlichen. In einem Schreiben an die Länder im Juli 1886 unterschied er zwischen »im Besitz der Reichsangehörigkeit befindlichen« und »ausländischen Zigeunern«. Damit erhielt der Nachweis der Staatsangehörigkeit für den Erhalt eines Wandergewerbescheins entscheidenden Stellenwert. Ausländische »Zigeuner« sollten keinen Wandergewerbeschein mehr erhalten, sondern einfach über die Staatsgrenzen abgeschoben werden, um »das Bundesgebiet von der […] Plage gründlich und dauernd zu befreien«. Die reichsangehörigen »Zigeuner« hingegen gelte es möglichst sesshaft zu machen. Es folgte eine strenge Auslegung der Gewerbeordnung, eine genaue [35]Überprüfung der Ausweispapiere und der gesundheitspolizeilichen sowie tierärztlichen Bescheinigungen. Die härteste Maßnahme für die reichsangehörigen »Zigeuner« bestand im Entzug des Wandergewerbescheins.
Der Turiner Gerichtsmediziner Cesare Lombroso fasste 1902 die seit langem in Europa gegenüber »Zigeunern« bestehenden Vorurteile zusammen. Er kam zu dem Schluss, dass die »äußerlich den Affen ähnlichen« »Zigeuner« eine »Rasse von Verbrechern« seien. Darüber hinaus glaubte er, generell bei ihnen eine vererbte, rassisch bedingte Minderwertigkeit erkennen zu können. Schlugen »Zigeuner« ihr Lager am Rande einer Stadt oder eines Dorfes auf, so sahen sie sich stets mit einer Mischung von Aberglauben und Ängsten konfrontiert.
Einzelne Länder wie Württemberg 1905, Preußen 1906 und Baden 1908 erließen Verordnungen, um »Zigeunern« das Zusammenreisen in Gruppen oder in Familienverbänden möglichst zu erschweren. Nach dem Reichsbürgergesetz von 1913 besaßen »Zigeuner« die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem sie geboren worden waren, und ihr Geburtsort galt als ihr Heimatort. Das Königreich Bayern hatte 1899 in München einen »Nachrichtendienst für die Sicherheitspolizei in Bezug auf Zigeuner« eingerichtet. Dieser »Zigeunerzentrale« mussten umherziehende »Zigeuner« mit Namen, Herkunft und Verwandtschaft gemeldet sowie deren Wanderwege erfasst werden. Da noch weitere Länder solche Daten ebenfalls nach München weitergaben, befanden sich dort 1925 bereits 40 000 Namensakten von »Zigeunern«. Als erstes Land der Weimarer Republik erließ Bayern 1926 ein umfassendes »Gesetz zur Bekämpfung von ›Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen‹«. [36]Es enthielt eine zeitliche Begrenzung des Wanderns mit Wohnwagen und Karren über Land sowie des Mitführens von Tieren und Regelungen darüber, an welchen Plätzen Lager aufgeschlagen werden durften. In Preußen erging im folgenden Jahr ein »Erlass über die Ausgabe von Bescheinigungen«. Er diffamierte »Zigeuner« nicht nur als Gewohnheitsverbrecher, Vagabunden und soziale Schädlinge, sondern schränkte auch ihre Arbeitsmöglichkeiten ein. Ab 1929 wurden von nicht sesshaften und über sechs Jahre alten »Zigeunern« und von nach »Zigeunerart« umherziehenden Personen Fingerabdrücke genommen. Zwar zeigte das Vorgehen gegen »Zigeuner« bereits rassistische Züge, doch zu einem einheitlichen rassenpolitisch motivierten Vorgehen auf Reichsebene mithilfe eines entsprechenden Reichsgesetzes kam es in der Weimarer Republik nicht. Dies sollte sich allerdings ab 1933 ändern, bildete doch »die rassistisch motivierte Verfolgung und Vernichtung […] das Spezifikum der nationalsozialistischen im Verhältnis zur vorhergehenden deutschen ›Zigeunerpolitik‹« (Michael Zimmermann).
2.5 »Widernatürliche Unzucht«
Nach der Französischen Revolution 1789 hoben alle deutschen Staaten die im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation vorgesehene Todesstrafe für homosexuelle Handlungen auf. Im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 bestand die Bestrafung für »unnatürliche Sünden« allerdings noch in einer ein- oder mehrjährigen Zuchthausstrafe. Das 1851 eingeführte Preußische [37]Strafgesetzbuch sah in § 143 für »widernatürliche Unzucht« zwischen Personen männlichen Geschlechts Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und vier Jahren sowie einen zeitlich begrenzten Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte vor. Das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund reduzierte 1870 im neuen § 175 das Höchstmaß der angedrohten Strafe auf zwei Jahre Gefängnis, wobei ein Verurteilter seine bürgerlichen Ehrenrechte allerdings nicht nur auf Zeit, sondern vollständig verlieren konnte. Der § 175 des am 1. Januar 1872 erlassenen RStGB sorgte für die weitere Kriminalisierung Homosexueller im Deutschen Reich. Dort hieß es: »Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.« In der Bevölkerung erhielt der § 175 die diskriminierende Bezeichnung »Schwulen-Paragraph«. Vergleichbare Gesetze mit Bezug auf lesbische Frauen gab es nicht, auch nicht später in der NS-Zeit.
1871 gründete sich das »Wissenschaftlich-humanitäre Komitee« (WhK), zu dessen Mitgliedern der Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld gehörte. Das WhK suchte zum einen, die Streichung des § 175 zu erreichen. Zum anderen setzte es sich zum Ziel, die Gesellschaft über »das Wesen der männlich-männlichen Liebe« zu informieren. Dazu ließ das Komitee Aufklärungsschriften drucken und im gesamten Reichsgebiet verteilen. Doch der überwiegende Teil der Gesellschaft des Deutschen Reichs war nicht bereit, seine Vorurteile zu überwinden, und Homosexualität wurde weiterhin geächtet. Ab 1897 richtete das WhK wiederholt Petitionen an Reichstag und Bundesrat, in [38]denen es die Aufhebung des § 175 forderte. Die erste Petition trug die Unterschriften von über 4000 bekannten Persönlichkeiten, zu denen Politiker, Hochschullehrer aller Fakultäten, Künstler und Schriftsteller zählten. Diese Initiative brachte der Vorsitzende und Mitbegründer der SPD August Bebel im Reichstag ein. Doch scheiterte dieser Versuch ebenso wie alle folgenden. Homosexualität blieb ein Tabuthema und »Schwuler« oder »Homo« blieben abfällig gemeinte und genutzte Begriffe.
Friedrich Krupp sah sich 1902 mit Fotos konfrontiert, die ihn mit jungen Männern auf Capri zeigten. Als die Parteizeitung der SPDVorwärts gerichtliche Schritte gegen ihn forderte, trieb die intolerante Haltung der Gesellschaft den erfolgreichen Essener Industriellen in den Selbstmord. Nicht wenige Homosexuelle sahen wie Krupp