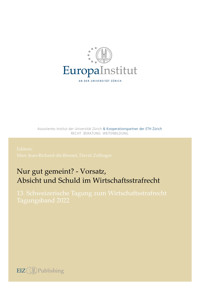
Nur gut gemeint? - Vorsatz, Absicht und Schuld im Wirtschaftsstrafrecht E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: EIZ Publishing
- Sprache: Deutsch
Was wusste und was wollte die beschuldigte Person? Was hat sie geahnt und in Kauf genommen? War sie in der Lage, das Unrecht ihres Verhaltens einzusehen? War es ihr zuzumuten, rechtmässig zu handeln? Ab welchem Stadium kann ihr nicht mehr Gutgläubigkeit zugebilligt werden? Diese Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit stellen im Wirtschaftsstrafrecht oft besondere Anforderungen. Die objektive Seite des Tatgeschehens ist dabei regelmässig viel deutlicher erkennbar als die subjektive. Selbst eine gutgläubige Teilnahme an strafbaren Handlungen ist denkbar. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Alarmsignale auf unlautere Praktiken hinweisen können. Ebenfalls kann eine Rolle spielen, welche konkreten Pflichten in einem bestimmten Bereich vorausgesetzt werden dürfen und ob deren Verletzung zu einem strafrechtlichen Vorwurf führen kann. Wer sich für solche Fragen interessiert, wird in diesem Tagungsband fündig werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nur gut gemeint? - Vorsatz, Absicht und Schuld im Wirtschaftsstrafrecht von Marc Jean-Richard-dit-Bressel und David Zollinger wird unter Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International lizenziert, sofern nichts anderes angegeben ist.
© 2023 – CC BY-NC-ND (Werk), CC BY-SA (Text)
Herausgeber: Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, David Zollinger – Europa Institut an der Universität ZürichVerlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)Produktion, Satz & Vertrieb:buchundnetz.comISBN:978-3-03805-580-8 (Print – Softcover)978-3-03805-581-5 (PDF)978-3-03805-582-2 (ePub)DOI: https://doi.org/10.36862/eiz-580Version: 1.02 – 20230615
Das Werk ist als gedrucktes Buch und als Open-Access-Publikation in verschiedenen digitalen Formaten verfügbar: https://eizpublishing.ch/publikationen/nur-gut-gemeint-vorsatz-absicht-und-schuld-im-wirtschaftsstrafrecht/.
1
Vorwort
Am 19. Mai 2022 führte das Europa Institut in Zürich die 13. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht zum zweiten Mal unter der Leitung der Herausgeber dieses Tagungsbandes durch. Auch in diesem Jahr widmete sich die Tagung einerseits einem Schwerpunktgebiet. Andererseits wurde die (neue) Tradition fortgesetzt, dem Publikum neuste Entwicklungen im Bereich des Verwaltungsstrafrechts (Friedrich Frank), des Steuerstrafrechts (Daniel Holenstein), des Unternehmens-, Korruptions- und Insiderstrafrechts (Nora Markwalder), der Vermögensabschöpfung, Geldwäscherei und internationalen Rechtshilfe (David Zollinger) sowie des Vermögens- und Urkundenstrafrechts (Marc Jean-Richard-dit-Bressel) zu präsentieren.
Das Schwerpunktthema der 13. Tagung war „Nur gut gemeint? – Vorsatz, Absicht und Schuld im Wirtschaftsstrafrecht“. Den ersten Beitrag mit dem Titel „Methodik der positiven Schuld“ liefert Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel. Er zeigt die dogmatische Entwicklung des Schuldbegriffs im Strafrecht auf und formuliert den Begriff von Vorsatz und Fahrlässigkeit als „positiver Schuld“. Im Einzelnen analysiert er die Begriffe „Wissen und Willen“ sowie die pflichtwidrige Unsorgfalt auf der Täterseite und zeigt auch den Bezug bzw. die Abgrenzung zu bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz auf. Schliesslich verweist er auf den praktischen Nutzen der Methodik, die zu einer gezielteren Beweisführung und kritischen Würdigung der vorliegenden Beweise führen kann.
Prof. Nora Markwalder analysiert sodann spezifisch den „Eventualvorsatz im Wirtschaftsstrafrecht“. Sie zeigt detailliert die historische Entwicklung des Eventualvorsatzes in Lehre und Praxis auf und erläutert dessen praktische Bedeutung im Rechtsalltag mit Bezug auf den Bereich des Wirtschaftsstrafrechts. Sie kommt in ihrem Fazit zum Schluss, dass die Beweisschwierigkeiten bei der Erstellung der subjektiven Tatseite, die zur Entwicklung des Eventualvorsatzes als „Ausweitung“ der Willenskomponente geführt haben, im Wirtschaftsstrafrecht akzentuiert vorliegen, da bei solchen Konstellationen häufiger nicht der direkte Wille nachweisbar ist, weshalb auf das ausgeweitete Konzept der „Inkaufnahme“ zurückgegriffen werden muss.
Als dritter Referent macht Prof. Elmar Habermayer Ausführungen zur „Wirtschaftskriminalität – normalpsychologisches Phänomen oder psychische Störung?“. Mit dem Aussenblick des nicht-Strafrechtlers beschreibt er verschiedene Typen von Delinquenten im Wirtschaftsstrafrecht, erläuterte den Begriff der „psychischen Störung“ und zeigt schliesslich den Unterschied zur „Persönlichkeitsstörung“ auf. In seinem Fazit kommt er zum Schluss, dass die Frage, ob Wirtschaftskriminelle gestört oder krank sind, allenfalls auf ein mangelndes Verständnis für die Natur und Schwere von psychischen Krankheiten zurückzuführen ist. Für wirtschaftskriminelle Täter sei das Vorliegen einer psychischen Störung allein schon wegen der für sie erforderlichen Karrierewege kaum möglich; entsprechend sei die Tätergruppe für die Begutachtung weitgehend irrelevant, da deren Karrierewege, die eine effektive Begehung von schwerwiegenden Wirtschaftsdelikten ermöglichen, einem schwer psychisch beeinträchtigten Menschen nicht offenstehen.
Nicolas Leu, Untersuchungsleiter im Strafrechtsdienst des Eidgenössischen Finanzdepartementes, macht sich anschliessend im Rahmen seines Beitrags Gedanken zu „Vorsatz- und Schuldmangel durch fehlendes Pflichtbewusstsein?“. Er erläutert das fehlende Pflichtbewusstsein als Grundlage des strafrechtlich relevanten Irrtums, analysiert den Sachverhaltsirrtum nach Art. 13 StGB sowie den Verbotsirrtum nach Art. 21 StGB und zeigt deren Bedeutung auf anhand konkreter Fallbeispiele aus der Rechtspraxis der Bundesbehörden.
Den Abschluss der Themenreferate macht Peter Pellegrini. Er erläutert das sog. „Ampelprinzip beim Eventualvorsatz“ und zeigt als langjähriger Vertreter der Strafverfolgung auf, wie dieses im subjektiven Bereich bei der Erstellung des Vorsatzes und vor allem des Eventualvorsatzes angewendet wird und wie dessen Auswirkungen in Bezug auf die Anklageredaktion sind. Der Ausdruck „Ampel“ bezeichnet dabei den Übergang von der Gutgläubigkeit („grün“) zur Aufwärmphase des Eventualvorsatzes („gelb“) bis hin zum Punkt, wo sich beim Täter die Gesamterkenntnisse derart stark verdichtet haben, dass – ab einem zu bestimmenden Stichtag – schlechterdings von keiner reellen Geschäftstätigkeit mehr ausgegangen werden kann und so die Berufung auf Gutgläubigkeit scheitert („rot“).
Die verschiedenen Tagungsbeiträge zeigen auf, dass im Wirtschaftsstrafrecht zwar der Schluss von den äusseren auf die inneren Vorgänge nicht gleich offensichtlich ist wie z.B. bei den Delikten gegen Leib und Leben, dass Lehre und Praxis aber durchaus Instrumente entwickelt haben, mit denen den deliktstypimmanenten Unwägbarkeiten begegnet werden kann.
Zürich, Mai 2023 Marc Jean-Richard-dit-Bressel David Zollinger
2
Inhaltsübersicht
Methodik der positiven Schuld
Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, LL.M., Staatsanwalt, Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Titularprofessor an der Universität Zürich
Das Eventualvorsatz im Wirtschaftsstrafrecht
Prof. Dr. Nora Markwalder, Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie unter besonderer Berücksichtigung des Wirtschaftsstrafrechts an der Universität St. Gallen
Wirtschaftskriminalität – normalpsychologisches Phänomen oder psychische Störung?
Prof. Dr. Elmar Habermeyer, Direktor, Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Titularprofessor an der Universität Zürich MSc Ladina Cavelti – wissenschaftliche Mitarbeiterin, Klinik für Forensische Psychiatrie, Psychiatrische Universitätsklinik PUK, Zürich
Vorsatz- und Schuldmangel durch fehlendes Pflichtbewusstsein?
Dr. Nicolas Leu, Untersuchungsleiter, Strafrechtsdienst des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD, Bern
Das Ampelprinzip beim Eventualvorsatz
lic. iur. Peter Pellegrini, Leitender Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Qualifizierte Wirtschaftskriminalität und internationale Rechtshilfe, Zürich
Neuste Entwicklungen im Verwaltungsstrafrecht
Friedrich Frank, Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Strafrecht, Zürich
Neuste Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht: Steuerstrafrecht
lic. iur. Daniel Holenstein, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, NSF Rechtsanwälte AG, Zürich
Neuste Entwicklungen im Unternehmens-, Korruptions- und Insiderstrafrecht
Prof. Dr. Nora Markwalder, Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie unter besonderer Berücksichtigung des Wirtschaftsstrafrechts an der Universität St. Gallen
Neuste Entwicklungen in Vermögensabschöpfung, Geldwäscherei und Internationaler Rechtshilfe
lic. iur. David Zollinger, Rechtsanwalt, Capt Zollinger Rechtsanwälte, Wetzikon
Entwicklungen im Vermögens- und Urkundenstrafrecht
Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, LL.M., Staatsanwalt, Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Titularprofessor an der Universität Zürich
Methodik der positiven Schuld
Marc Jean-Richard-dit-Bressel
Inhaltsübersicht
Vorsatz und Fahrlässigkeit als „positive Schuld“Wissen und WillenTatumständeTäterverhaltenErfolgKupierter ErfolgPflichtwidrige UnsorgfaltTatumständeTäterverhaltenErfolgExkurs: Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und EventualvorsatzDer praktische Nutzen der MethodikLiteraturverzeichnisVorsatz und Fahrlässigkeit als „positive Schuld“
Bis Ende 2006 waren im Schweizerischen Strafgesetzbuch die Artikel mit den Marginalien „Vorsatz und Fahrlässigkeit“, „irrige Vorstellung über den Sachverhalt“ und „Rechtsirrtum“ unter dem Untertitel „Schuld“ zusammengefasst.[1] Der „Zurechnungsfähigkeit“ war ein eigener Untertitel gewidmet, der demjenigen über die „Schuld“ vorangestellt war.[2] In der Lehre regte sei unter dem Einfluss von Hans Welzel[3] seit ungefähr Mitte des letzten Jahrhunderts Kritik an dieser Systematik. Um dieser Kritik Rechnung zu tragen,[4] behandelt der revidierte Allgemeine Teil „Vorsatz und Fahrlässigkeit“[5] unter einem eigenen Untertitel, dem auch der „Sachverhaltsirrtum“ zugehört, während der daran anschliessende Untertitel „Rechtmässige Handlungen und Schuld“[6] neben den Rechtfertigungsgründen die Schuldausschlussgründe regelt, zu denen die „Schuldunfähigkeit“ und der „Irrtum über die Rechtswidrigkeit“ gehören. Nach der herrschenden Lehre komme so besser zum Ausdruck, dass Vorsatz und Fahrlässigkeit Bestandteil des Unrechtstatbestandes seien. Die Schuld sei hingegen ausserhalb des Unrechtstatbestandes verortet und bestehe darin, dass der Täter das Unrecht seines Tuns einsehen könne und in der Lage sei, entsprechend dieser Einsicht zu handeln.[7] Vereinfacht geht es um das Kriterium, ob das rechtswidrige Verhalten für den Täter vermeidbar ist.
Nach hier vertretener Ansicht steht es unabhängig von der Systematik ausser Frage, dass Vorsatz und Fahrlässigkeit Bestandteil des Unrechtstatbestands bilden. Dasselbe muss jedoch auch für die Rechtswidrigkeit und die Schuld gelten. Es ist gerade die Aufgabe des Straftatbestands, ein Verhalten zu definieren, das einen Unwert darstellt, der vermeidbar ist.[8] Durch das Vermeidungsgebot bzw. Verwirklichungsverbot begründet oder bestätigt die Strafnorm die Rechtswidrigkeit des Verhaltens, je nachdem, ob diesem auch ausserstrafrechtliche Normen entgegenstehen.[9] Dass der Straftatbestand im Idealfall nur vermeidbare Unwerte erfassen soll, bedeutet, dass seiner Erfüllung grundsätzlich auch die Schuldhaftigkeit inhärent ist.[10] Diese wird im Regelfall dadurch begründet, dass der Täter den Unwert vorsätzlich oder – bei Fahrlässigkeitsdelikten – durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht herbeiführt. Der Täter kann den Unwert vermeiden, indem er ihn als solchen erkennt, einen auf Vermeidung gerichteten Willen bildet und die gebotene Sorgfalt walten lässt. So betrachtet bleiben Vorsatz und Fahrlässigkeit die dem Tatbestand immanenten positiven Kriterien für die Schuld.[11]
Das von der herrschenden Lehre empfohlene Prüfschema fragt zuerst nach der Tatbestandsmässigkeit und hernach nach der Rechtswidrigkeit und der Schuld. Dabei werden unter dem Titel Rechtswidrigkeit nur Rechtsfertigungsgründe und unter dem Titel Schuld nur Schuldausschlussgründe untersucht. Diese negativen Kriterien stellen ein Korrektiv dafür dar, dass im konkreten Fall der Tatbestand ausnahmsweise ein Verhalten erfasst, das aufgrund der Umstände keinen Unwert darstellt oder sich nicht vermeiden lässt.
Da die herrschende Lehre es nicht mehr zulässt, Vorsatz und Fahrlässigkeit unter dem Begriff der Schuld zusammenzufassen, fehlt ein geeigneter Oberbegriff für diese beiden Kriterien, die das Gesetz als austauschbar bei im Übrigen unverändertem Tatbestand behandelt. Dabei findet die Fahrlässigkeit, soweit das Gesetz sie für die Strafbarkeit genügen lässt, subsidiär zum Vorsatz Anwendung[12] und führt meist zu einem milderen Strafrahmen.[13] Der Begriff „subjektiver Tatbestand“, der im Gesetz nicht erscheint, passt für den Vorsatz, nicht aber für die Fahrlässigkeit,[14] da bei dieser für die strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht ein innerer Vorgang entscheidend ist, sondern eine durch äussere Umstände begründete Sorgfaltspflicht.
Als terminologischer Vorschlag, der im vorliegenden Beitrag Anwendung findet, sind die verschiedenen Varianten des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit unter dem Begriff der „positiven Schuld“ zusammenzufassen.[15] Als Gegenstück dazu lassen sich Schuldausschluss- und -minderungsgründe als „negative Schuld“[16] in die Waagschale legen. Das Wort „positiv“ meint einerseits im Sinne des mathematischen Operators, dass Vorsatz und Fahrlässigkeit die Schuld aufbauen, während die Schuldausschluss- und -minderungsgründe sie abbauen. „Positiv“ bedeutet in der Rechtssprache auch „gesetzlich aufgestellt“,[17] was bezogen auf die Schuld hervorhebt, dass diese dem Tatbestand inhärent ist.
Der vorliegende Beitrag befasst sich nicht weiter mit der negativen Schuld, sondern mit der Methode, wie die positive Schuld in der Praxis systematisch und effizient zu prüfen ist.
Wissen und Willen
„Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.“ (Art. 12 Abs. 2 StGB). Das „Für-Möglich-Halten“ gilt als abgeschwächtes Wissen, das „In-Kauf-Nehmen“ als abgeschwächter Wille. Wissen und Wille und ihre Abstufungen sind naturgegebene Vorgänge im Denk- und Steuerungsapparat des Menschen. Man spricht auch von inneren Tatsachen. Die genaue Definition von Wissen und Willen ist eine philosophische Streitfrage und der Präzisierung durch Legaldefinitionen zugänglich. Gleichwohl liegen beide Phänomene in der Natur des menschlichen Denkvermögens und bestehen unabhängig von gesellschaftlichen Vorstellungen und Regeln.
Als Wissen gilt gewöhnlich das sichere und der äusseren Wirklichkeit entsprechende Gefühl über den Bestand einer Tatsache. Es lässt sich darüber streiten, ob für diese Sicherheit ein objektiver Grund erforderlich ist oder ob sie auch auf reiner Intuition beruhen kann. Im Strafrecht genügt – zumindest in strittigen Fällen – nur das objektiv begründbare Wissen, da es sich in der Beweisführung aus objektiven Umständen herleitet.
Der Wille steuert das menschliche Verhalten in Bezug auf einen Handlungsablauf und die damit verbundene Vorstellung eines Handlungsziels oder – beim Eventualvorsatz – einer möglichen Handlungsfolge.
Die inneren Tatsachen des Wissens und Wollens müssen sich zumindest eine „logische Sekunde“ vor der Ausführung der Tat verwirklichen,[18] damit sie die Handlung begleiten können, wie es die im Gesetzestext verwendete Präposition „mit“ verlangt. Verhaltensweisen, die der Täter vor Erlangen des relevanten Wissens an den Tag gelegt hat, zählen nicht für die Verwirklichung eines Vorsatzdelikts. Es stellt sich deshalb für jeden Teilaspekt des gesetzlichen Tatbestands und genauso für jeden Teilaspekt des potentiell tatbestandsmässigen Lebenssachverhalts die Frage nach dem Wissen und dem Willen des Täters.
Für die meisten objektiven Tatbestandselemente ist eine subjektive Entsprechung erforderlich. Von dem Grundsatz der Symmetrie der objektiven und subjektiven Aspekte gibt es drei Ausnahmen: die objektiven Strafbarkeitsbedingungen, für die es keine subjektive Verankerung braucht und die deshalb nicht dem Unrechtstatbestand zugerechnet werden,[19] die überschiessende Innentendenz, deren objektive Verwirklichung ausbleiben darf, und die überschiessende Aussentendenz, d.h. der vom Täter nicht gewollte und nicht vorausgesehene Erfolg von Fahrlässigkeitsdelikten (unten, III.3.). Diese drei Phänomene sind demnach asymmetrische Strafbarkeitskriterien.
Wer sich an die übliche Aufteilung der Subsumtion des subjektiven und des objektiven Sachverhalts in zwei getrennte Abschnitte hält und gleichzeitig dem Grundsatz der Symmetrie gerecht werden will, ist gehalten, jedes symmetrische Tatbestandselement zwei Mal zu erwähnen.[20] Dadurch wird die Fallanalyse aufgebläht und schwerfällig. Die Leserschaft wird zweimal durch die ganze Geschichte geführt, ohne dass dies einen Gewinn brächte. Im Gegenteil führt die Wiederaufnahme der relevanten Fakten unter dem subjektiven Blickwinkel meist zu einer gewissen Ermüdung. So kommt es, dass die Abhandlung der subjektiven Seite in vielen Fallbearbeitungen[21] ein Schattendasein fristet. Anstatt den ganzen Tatbestand mit veränderter Fragestellung nochmals abzuwickeln, werden oft nur einzelne Aspekte herausgegriffen und mit Gemeinplätzen abgetan. Nicht selten geschieht dies ohne konkreten Sachverhaltsbezug mit der schlichten Behauptung, der Täter habe seine Handlungen und deren Folgen gewusst, gewollt oder zumindest in Kauf genommen.[22] Solche Leerläufe geben nach hier vertretener Ansicht Anlass, die Zweckmässigkeit des Fallbearbeitungsschemas sei zu überdenken.
Der Vorschlag, das auch für die Praxis massgebliche Schema zu verändern, bezweckt keineswegs, die Anforderungen an die Feststellung der subjektiven Tatbestandsmässigkeit zu lockern. Das Gegenteil ist der Fall. Der subjektiven Seite soll zu ihrer vollen Geltung als einem entscheidenden Bestandteil des Unrechtstatbestandes verholfen werden.
Das angestrebte Ziel lässt sich durch eine einfache Umgruppierung der Gliederungsebenen erreichen: Nicht mehr die Unterteilung in objektive und subjektive Kriterien bildet in Bezug auf den jeweiligen Tatbestand die oberste Gliederungsebene, sondern diese Funktion kommt den einzelnen Tatbestandselementen zu. Alle Abschnitte zu einzelnen symmetrischen Tatbestandselementen sind in die Unterabschnitte „objektiv“ und „subjektiv“ aufzuteilen.
Die Hauptgliederung nach Tatbestandselementen öffnet den Blick dafür, dass es nicht angebracht ist, stets mechanistisch nach „Wissen und Willen“ zu fragen.[23] Vielmehr folgt aus der Natur der Sache, dass es Tatbestandselemente gibt, in Bezug auf die nur der eine oder der andere dieser Gesichtspunkte massgeblich ist. Zudem erhalten beide Kriterien je nach der Art des objektiven Tatbestandsmerkmals, auf das sie sich beziehen, ein eigenes Gepräge.[24] Die folgende Tabelle zeigt das Grundgerüst der Aufgliederung von Wissen und Willen:
Objektiver TatbestandWissenWilleTatumständeerforderlichirrelevantKörpereinsatz (bzw. Unterlassung eines gebotenen Körpereinsatzes)im Willen enthaltenerforderlich (aktivierend)Objektiver Erfolg und kupierter Erfolgi.e.S. unmöglich, stattdessen: „als möglich voraussehen“erforderlich (final)In einer Globalbetrachtung aller Tatbestandsmerkmale ist zu verlangen, „dass der vorsätzlich handelnde Täter, auch wenn er das rechtliche Verbot verkennt, so doch einen Sachverhalt verwirklichen will, der ihm widerspricht“.[25] Hat der Täter diesen Sachverhalt entsprechend seinem Willen verwirklicht, folgt daraus zwingend, dass er im Wissen um die relevanten Fakten handelte. Insofern ist die Formel „Wissen und Willen“ ein Pleonasmus.[26] Nützlich wird sie erst bei der Detailanalyse, wenn zu prüfen ist, welche Teilaspekte des Vorsatzes in Bezug auf jedes einzelne Tatbestandselement erfüllt sein müssen, damit der erforderliche Globalwille besteht.
Tatumstände
Die Straftatbestände legen in der Regel gesetzliche Tatumstände wie vorbestehende Pflichten bei Sonderdelikten (Art. 26 StGB)[27] sowie generell Tatobjekte oder Tatmittel fest, die sich vom Täterverhalten i.e.S. getrennt prüfen lassen. Der Tatbestand weist dem Täter seine Rolle zu, im Gefüge von weiteren Rollen, Requisiten und Kulissen. So ist es eine Voraussetzung für die Veruntreuung, den Pflichten als Treuhänder zu unterliegen. Ein noch lebender Mensch ist als Tatobjekt für ein Tötungsdelikt erforderlich. Zur Ausführung eines Diebstahls braucht es eine fremde bewegliche Sache, die sich im Gewahrsam eines andern befindet.
Als aussergesetzliche Tatumstände sind Gegebenheiten anzusehen, die dem konkreten Täterverhalten erst die für dessen Tatbestandsmässigkeit entscheidende Bedeutung verleihen, ohne dass sie einem gesetzlich definierten Tatbestandsmerkmal entsprechen. Das gilt z.B. für die Waffe, über deren Ladungszustand sich der Täter bei der Abgabe des tödlichen Schusses irren kann. Der Umstand ist entscheidend für die strafrechtliche Bedeutung der Manipulation, doch äussern sich die einschlägigen Tatbestände (Art. 111–113 u. 117 StGB) nicht über das Tatmittel. Es ist für die praktische Relevanz des Irrtums mithin nicht ausschlaggebend, ob er ein rechtlich normiertes Element des Sachverhalts betrifft oder nicht.[28]
Mit gesetzlichen und aussergesetzlichen Tatumständen, die hier zu „Tatumständen i.w.S.“ zusammengefasst werden, verhält es sich gleich: Das Wissen des Täters genügt.[29] Es ist umstritten, inwieweit es ihm dabei auch bekannt sein muss, welche Pflichten die Tatumstände i.w.S. im Einzelnen mit sich bringen. Nach hier vertretener Ansicht ist die Erkennbarkeit der rechtlichen Folgen ausreichend, denn es entspricht den Kriterien für den Irrtum über die Rechtswidrigkeit (Art. 21 StGB), wenn der Täter aus den ihm bekannten Fakten unzutreffende rechtliche Schlüsse zieht.[30]
Ob der Täter die Tatumstände wollte, hat keine Bedeutung für die Tatbestandsmässigkeit. Denn die Tatumstände entsprechen dem Zustand vor der Tathandlung. Die Bedeutungslosigkeit des Willens in Bezug auf Tatumstände wird besonders deutlich, wenn es um Sonderpflichten geht, die durch widrige Umstände wie Geldprobleme (Art. 163 ff. StGB) oder Unfälle (Art. 128 StGB) entstehen. Das Strafrecht kann nicht dem Bedürfnis nachgeben, sich einer Pflicht einfach dadurch entledigen zu können, dass sie einem nicht mehr passt.
Der zustandsorientierte Wille, d.h. der Wille, dass ein Zustand so oder anders sei, entspricht nicht dem für den Vorsatz massgeblichen Willen. Der Wille, der in der Definition von Art. 12 Abs. 2 StGB gemeint ist, muss sich auf das eigene Verhalten des Täters beziehen. Dieser handlungsorientierte Wille hat zunächst als aktivierender Wille die Funktion, den Einsatz des eigenen Körpers zu steuern.[31] Mit dem aktivierenden Willen überlagert sich der finale Wille, der uns unseren Körpereinsatz auf ein Ziel ausrichten lässt. In Bezug auf Tatumstände nach einem zustandsorientierten Willen des Täters zu fragen, kann grotesk sein: Der Mörder will gerade nicht, dass seinem Opfer die Eigenschaft als lebender Mensch zukomme. Der Dieb wünscht sich, dass die Sache nicht „fremd“ sei, weshalb er sie sich aneignet. Der Betrüger, der z.B. Investoren mit geschickt vorgespiegelten Ressourcen und Qualifikationen ködert, sähe es nur zu gerne, dass diese Tatsachen wahr wären.
Es ist zwar möglich, dass der Täter bestimmte Tatumstände im Hinblick auf die Tatausführung willentlich herbeiführt. Dies kann einem Teil der Tathandlung in einem mehraktigen Tatbestand entsprechen, z.B. einer Vergewaltigung (Art. 190 StGB), wo der Täter durch eine Nötigungshandlung die Duldungsbereitschaft des Opfers erzwingt, die eine Voraussetzung für den anschliessenden Beischlaf ist. Der Erfolg des ersten wird so ein Umstand des zweiten Akts. Abgesehen davon ist es keine Frage der Tatbestandsmässigkeit, ob der Täter die Tatumstände willentlich herbeiführt oder widerwillig antrifft. Dies kann hingegen einen Einfluss auf das allgemeine Verschulden (Art. 47 Abs. 2 StGB) und auf besondere Verschuldensmerkmale[32] wie die Skrupellosigkeit beim Mord (Art. 112 StGB) haben.
Täterverhalten
Die Frage, ob der Täter mit seinem Körpereinsatz auf die Umstände einwirken wollte, wird in dem hier vorgeschlagenen Prüfschema als Gesichtspunkt des Täterverhaltens i.e.S. betrachtet.
Das Verhalten des Täters im Kontext der gesetzlich definierten Kulissen, Requisiten, Rollen und Beziehungen stellt die eigentliche Straftat dar. Eine wesentliche Komponente des objektiven Verhaltens des Menschen entspricht stets einem Einsatz seines Körpers[33] oder – bei Unterlassungsdelikten – der Unterlassung eines gebotenen Körpereinsatzes. Ein Körpereinsatz ist nicht nur für „Handgreifliches“, sondern auch für jede Art der Kommunikation erforderlich, ob dafür nun die natürlichen Kommunikationsmittel des Menschen wie Stimme und Gebärden oder Medien wie Papier und digitale Netze verwendet werden. Es sind in der Regel Finger oder Stimmbänder zu betätigen, um einen Inhalt auf ein Medium zu übertragen. Manchmal übernehmen andere Körperteile diese Funktion, v.a. wenn Körperschäden dazu zwingen.
Die Wirkung eines Körpereinsatzes hängt wesentlich von den Umständen ab. Der Körpereinsatz erhält erst durch die Umstände eine strafrechtlich relevante Bedeutung. Je nach der Situation braucht der Mensch nur ein Wort zu sagen oder einen Finger zu krümmen, um über die Vermittlung von Geräten oder anderen Menschen eine grosse Wirkung zu erzielen. Diese Wirkung kann zeitlich verzögert oder durch einen Algorithmus an komplexe Bedingungen geknüpft werden, so dass der Eindruck entsteht, ein System arbeite von selbst. Doch für eine strafrechtlich relevante Handlung ist stets der menschliche Körper nötig, auch wenn er sich darauf beschränkt, auf den berüchtigten „roten Knopf“[34] zu drücken.
In der Regel nimmt der Mensch seine Körpereinsätze willentlich vor. Dies gilt jedenfalls für die meisten Körpereinsätze, die strafrechtlich relevant sein können. Der Mensch, der z.B. an einen Ort geht oder etwas sagt, hat dabei das sichere Gefühl, es in der Hand zu haben, stattdessen nirgendwohin oder anderswohin zu gehen bzw. etwas Anderes oder gar nichts zu sagen. Gewohnheiten und Zwänge können ihn daran hindern, diese Freiheit wahrzunehmen. Doch begleitet ihn dabei die Gewissheit, dass die Option besteht, keine nächste Zigarette anzuzünden, einen Umweg zu wählen, kritische Gedanken auszusprechen usw.[35] Wenig überzeugend ist die Meinung, das berühmte physiologische Experiment von Benjamin Libet aus dem Jahr 1979 widerlege den freien Aktivierungswillen.[36] Dort hatten die Versuchspersonen die Aufgabe, im Labor irgendwann eine willentliche Bewegung auszuführen und sich mit Hilfe einer speziellen Uhr den Zeitpunkt des Entschlusses, dies nun zu tun, zu merken. Gemäss den Messungen der Hirnströme sollen diese die Aktivierung vor dem Bewusstsein des Entschlusses eingeleitet haben. Die Interpretation des Experimentes als Widerlegung des freien Willens blendet aus, dass die Versuchspersonen lange vor der Messung der Hirnströme den Entschluss gefasst hatten, bei dem Experiment mitzuwirken und in diesem Rahmen irgendwann kurzfristig den Entschluss zu einer vorausbestimmten Zuckung zu fassen und auszuführen. Dass bei dieser Vorbereitung die fragliche Bewegung reflexartig eingeleitet und mit Verzögerung ins Bewusstsein vordringt, sagt nichts über die Willensfähigkeit des Menschen aus, sondern ist der Automatisierung von Bewegungsabläufen geschuldet. Wer beispielsweise ein paar Schritte tun will und dies auch ausführt, entwickelt kein Bewusstsein für die komplexen Impulse seines Nervensystems, die dafür erforderlich sind. Beim bewussten und willentlichen Gehen blendet es das Bewusstsein in der Regel vollständig aus, welche Muskeln zu betätigen sind, damit der hintere Fuss nach vorn kommt.
Wer sagt, er habe seine Handlung nicht gewollt, stellt kaum je ernstlich in Abrede, seinen Körper durch Betätigung seines Aktivierungswillens eingesetzt zu haben.[37] Meint er tatsächlich den strafrechtlich relevanten Willen, bezieht er sich entweder auf die Tatfolgen und stellt seinen finalen Willen in Abrede (unten, II.3.) oder auf die Tatumstände und macht Sachverhaltsirrtum (Art. 13 StGB) geltend.[38] Keine Entlastung vom Vorwurf der Vorsätzlichkeit bringt es, wenn es der Täter vorgezogen hätte, sein Ziel auf rechtmässigem Weg zu erreichen. So kann er beispielsweise sein Bedürfnis nach einem kindlich wirkenden geschlechtsreifen Sexualpartner lieber mit einer Person knapp ausserhalb des Schutzalters ausleben „wollen“. Dies ist unerheblich, wenn der schliesslich gewählte Partner doch im Schutzalter ist und der Täter dies wusste oder wenigstens für möglich hielt.
Im Hinweis, etwas nicht gewollt zu haben, kann ferner das Eingeständnis der Unbesonnenheit liegen. Lehre und Rechtsprechung verlangen unter dem Gesichtspunkt des Willens einen Entscheid gegen das rechtlich geschützte Gut.[39] Dies bedeutet nicht, dass der Unbesonnene entlastet werden soll, der im Jähzorn dreinschlägt oder reflexartig einer Versuchung nachgibt. Der Vorsatz erfordert keine Reflexion. Bei reinen Tätigkeitsdelikten folgt der Entscheid gegen das Rechtsgut ohne weiteres aus der Kenntnis der Umstände und der Selbstbestimmtheit des Körpereinsatzes, so dass der Entscheid gegen das Rechtsgut nicht Gegenstand eines separaten Beweisthemas ist.[40] Wo der Straftatbestand ein Verhalten ohne Hinweis auf dessen Zweck und Folge beschreibt, ist es nicht angebracht, im Dienste der finalen Handlungslehre nach einem Willensfundament zu suchen, das eine Kausalität kontrolliert.[41] Je nach Auffassung des Zweckbegriffs lässt sich zwar fast jede Verhaltensweise final auslegen,[42] doch ist es auch vertretbar, einen Teil des menschlichen Verhaltens als zwecklos anzusehen.[43] Entscheidend für die vorliegende Frage ist, dass allein der gesetzliche Tatbestand bestimmt, ob ein über den blossen Aktivierungswillen hinausgehender Handlungszweck strafrechtlich relevant ist.[44]
Bei echten und kupierten Erfolgsdelikten (unten, II.3. und II.4.) gilt für den Aktivierungswillen, der den Körpereinsatz steuert, dasselbe wie bei reinen Tätigkeitsdelikten. Auf die Finalität kommt es erst in Bezug auf den Erfolg an.
Eine Störung kann die Kontrolle des Menschen über seinen Körper beeinträchtigen, z.B. Krankheit, Vergiftung oder Schlafwandel. Solche Störungen werden eher als Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB) denn als Vorsatzmangel behandelt. Ferner kann der menschliche Körper gegen den Willen seines Inhabers durch äussere Kräfte bewegt werden, z.B. durch die Schwerkraft beim Stolpern und Stürzen oder durch andere Menschen in einem Gedränge.[45] Doch liegt ohne aktivierenden Willen keine Handlung im strafrechtlichen Sinne vor.[46] Solche Fälle sind Ausnahmen, auf die nur bei konkreten Hinweisen einzugehen ist. In aller Regel bestehen keinerlei Zweifel, dass der Täter seine Mitteilungen und Handgriffe willentlich steuert.[47]
Wird der aktivierende Wille bejaht, weiss der Täter zwangsläufig auch, dass er seinen Körper entsprechend seinem Willen einsetzt. Somit stellt sich in Bezug auf den Körpereinsatz keine gesonderte Frage nach dem Wissen.
Erfolg
Der Erfolg im technischen Sinne ist die im Tatbestand beschriebene Folge des Täterverhaltens.[48] In dem Zeitpunkt, in welchem der Täter das tatbestandsmässige Verhalten verwirklicht, liegt der Erfolg in der Zukunft. Deshalb kann er Täter bei der Ausführung der Tat nicht „wissen“, ob der Erfolg eintritt.[49] Wissen ist die zutreffende Meinung über den Bestand einer gegenwärtigen oder vergangenen Tatsache. Zustände und Ereignisse, deren künftiges Eintreten man als möglich oder praktisch sicher ansieht, sind einer Prognose mit Wahrscheinlichkeitserwägungen zugänglich,[50] nicht aber dem Wissen im Sinne einer präzisen Rechtssprache. An die Stelle des Wissens tritt in Bezug auf den Erfolg das Erfordernis, dass der Täter den Kausalverlauf für möglich halten muss.
Die Lehre unterscheidet direkten Vorsatz ersten und zweiten Grades sowie Eventualvorsatz, je nachdem, ob der Täter den tatbestandsmässigen Erfolg direkt anstrebt oder als Teilschritt zu einem anderen Ziel als sicher oder bloss möglich voraussieht und in Kauf nimmt.[51] Das „In-Kauf-Nehmen“ als abgeschwächte Form des Wollens ist der Schlüsselbegriff für den in Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB definierten Eventualvorsatz.[52] Auch wenn das Gesetz im gleichen Atemzug das „Für-Möglich-Halten“ als abgeschwächte Form des Wissens nennt, tut es dem direkten Vorsatz ersten Grades keinen Abbruch, wenn der Täter mit seiner Handlung einen bestimmten Erfolg anstrebt, dabei aber von niedrigen Erfolgschancen ausgeht.[53] Das gilt zumindest, wenn die Tat vom kalkulierenden Willen eines besonnenen Täters getragen ist: Gewisse Strategien des Verbrechens erfordern eine hohe Zahl von Versuchen, z.B. der betrügerische Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) mit unrechtmässig erlangten Login-Daten für das Online-Banking oder die sog. Enkelbetrüge (Art. 146 StGB). Der Mörder (Art. 112 StGB) kann zu Tarnzwecken eine weniger sichere Methode anwenden.
Bei unbesonnenen Tätern unterbleibt eine Reflexion über die Handlungsfolgen. Deshalb ist ein unmittelbarer Erfolgsbezug der Handlung erforderlich. Der Körpereinsatz muss eine offensichtlich finale Prägung





























