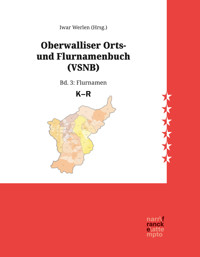
Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch (VSNB) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Besondere an den Oberwalliser Orts- und Flurnamen ist ihr relativ spätes Auftreten. Während die deutsche Schweiz im Wesentlichen seit dem 5. Jahrhundert langsam alemannisiert wurde, war das Oberwallis noch eine gallo-romanische Sprachlandschaft, in der es kaum Spuren des Alemannischen gab. Die früheste alemannische Besiedlung scheint im 9. Jahrhundert geschehen zu sein. Das "Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch" erschließt den Bestand der alemannischen Oberwalliser Namen sprachhistorisch und sprachgeographisch. Es schließt somit eine Lücke zwischen dem schon vollendeten "Urner Namenbuch" und dem im Erscheinen begriffenen "Berner Namenbuch", die das Oberwallis zwar berührten, aber seinen Namenschatz weitgehend ungedeutet ließen. Die verzeichneten Orts- und Flurnamen wurden in den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts erhoben. Sie stammen aus dem agrarischen, alpinistischen und touristischen Bereich, seltener handelt es sich auch um Namen von Straßen und Plätzen. Die Hauptlemmata der Orts- und Flurnamen werde in den Bänden ausführlich dargestellt, etymologisch kommentiert und geografisch verortet. Sie führen als Grundwörter, Bestimmungswörter, in ihrer flektierten und unflektierten Form und begleitet von Adjektiven zur Deutung der Orts- und Flurnamen. Ergänzt wird die Darstellung der Hauptlemmata durch eine Datenbank, die umfangreiche Informationen zu den Lemmata bietet (Belege, geographische Angaben, Kartenangaben etc.). Es entsteht auf diese Art und Weise ein umfassendes Bild der Orts- und Flurnamen des Oberwallis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1013
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[3]Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch (VSNB)
Band 3:Flurnamen K–R
Herausgegeben von Iwar Werlen
unter Mitarbeit vonAnne-Lore Bregy, René Pfammater und Gabriele Schmid
und Valentin Abgottspon, Claude Beauge, Werner Bellwald, Milda Christen, Martin Clausen, Gabriela Fuchs, Dominique Knuchel, Gisèle Pannatier und Stefan Würth
sowie mit zwei Beiträgen von Philipp Kalbermatter
Umschlagabbildung: Bearbeitete Version der Abbildung „Gemeinden des Kantons Wallis“ von Tschubby (https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis#/media/Datei:Karte_Gemeinden_des_Kantons_Wallis_farbig_2021.png), CC BY-SA 4.0
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
Das Gesamtprojekt des Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuchs wurde gefördert durch die Walliser Delegation der Loterie Romande, im Kanton Wallis durch das Erziehungsdepartement und die Dienststellen für Kultur und Hochschulwesen, die Stadtgemeinde Brig sowie anonyme Spender.
Prof. em. Dr. Iwar WerlenWangenhubelstrasse 53173 Oberwangen bei BernSCHWEIZ
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381116225
© 2024 · Iwar Werlen
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 · D-72070 TübingenInternet: www.narr.deeMail: [email protected]
Satz: typoscript GmbH, WalddorfhäslachDruck: Elanders Waiblingen GmbHISBN 978-3-381-11621-8 (Print)ISBN 978-3-381-11622-5 (ePDF)ISBN 978-3-381-11623-2 (ePub)Bestellbar im Bundle mit den Bänden 1 bis 4 unter ISBN 978-3-381-10831-2
Inhalt
K (siehe auch C und G)
L
M
N
O
P (siehe auch B)
Q
R
Verbunden mit dieser Publikation ist eine Datenbank der einzelnen Orts- und Flurnamen. Zusätzlich sind darin die folgenden Informationen hinterlegt: Gemeinde, Kennzahl, Umschrift des jeweiligen Namens, Kartenangaben, geographische Höhe und geographische Länge und Breite, Hauptlemma und Lemma, zusätzliche Angaben; dazu kommen geographische Lage und Höhe, Beschreibung, lebende Belege und historische Angaben mit der Jahreszahl und einem Zitat mit den historischen Belegen der Namen. Das alles ist natürlich nur vorhanden, wenn die Namen lebend sind; wenn nur historische Belege vorhanden sind, werden nur sie dargestellt. Die Installations- und Systemdateien für die Datenbank können Sie unter diesem Link herunterladen: https://files.narr.digital/9783381108312/Datenbank.zip.
K (siehe auch C und G)
Kaal
Kaal ‘kahl’ ist nur belegt in di Kaalhalte ‘die kahle Halde (ohne Bäume)’ (Stalden). Laut Gwp. ein kahler Abhang, der früher bewaldet war. Id. (3, 192 s. v. chal) kennt das Wort nur in der Redensart das ist chal [niedrig, unedel] von im für Basel-Stadt. Siehe auch GrWb (11, 27 ff.). Obwohl das HL nicht dialektal zu sein scheint, gibt es keinen Hinweis auf ein anderes Wort.
Kaaru
Kaaru ‘Ecke, Teil’, auch Name von Dorfquartieren, ist zu frpr. karo < lat. Quadru (Tagmann 1946, 29; Gpsr 3, 112ss.) zu stellen, wozu nach Mathier (2015, 60) auch Salgesch Kaaru gehört. In Salgesch ist es historisch als eys quarros (1339 u. später) belegt. Auch in Kaaru (Albinen; auch bei Mathieu 2006, 13)) gehört hieher, das 1352 u. später ebenfalls als eys quarros belegt ist. Turtmann hat 1328 lo quarro und 1338 deys Karos. In Salgesch ist 1644 Ey Carro Superiori ‘im oberen Teil’ belegt.
di Gaare ‘die Gaare (Gärten, Stücke Land)’ (Agarn) und di Gaarustraass ‘die Strasse in die Gaare (Gärten, Stücke Land)’ (Agarn) sind ebenfalls hieher zu stellen, wie auch di Gaare (Leuk) und Obri Gaarä (FLNK, Leuk).
Unklar bleiben uf di Gaar (Salgesch) und Varnergaar (FLNK, Varen). Beide Belege sind östlich von Salgesch und weit vom Bahnhof (gare) von Salgesch entfernt (Mathier 2015, 90 stellt es hieher). Es handelt sich vermutlich um eine feminine Ableitung quadra, die auch bei Bossard / Chavan (2006, 104) als Carre ‘Ecke, Teil einer Parzelle’ belegt ist.
Kaffee
Kaffee m. ist nur in dr Kaffesee ‘der Kaffee-See (laut Gwp. holten Hirten dort Wasser für Kaffee)’ (Ferden) belegt. Id. (3, 154 s. v. Kaffe) kennt das HL, wo auch dialektale Varianten wie Ggaffe (cf. HL Ggaffe) (wohl zu frz. café) vertreten sind.
Kaiser (FaN)
Kaiser (FaN), auch Keiser, ist zum FaN Kaiser zu stellen. Der FaN ist im Register zu den HRBS und für Zwischbergen in den Quellen (1634 Simone Keiser, 1675 Christian Keiser, 1697 Antonius Keiser usw.) gut belegt.
Eine Diminutivableitung Keyserlin ‘das kleine Gebiet der Familie Keyser’ (1392, Ried-Brig) ist der einzige Simplexbeleg. Hierzu ist auch die Keisermatten ‘die Wiesen der Familie Kaiser’ (1723, Ried-Brig) zu stellen.
Ein starker Genitiv auf /-s/ findet sich in in Keisers Halten ‘in der Halde der Familie Keiser’ (1845, Blatten). Es kann sich hier auch um einen Übernamen handeln.
Die andern Flurnamen gruppieren sich in Mund: Kaiseracher ‘der Acker der Familie Kaiser’, Kaiserstadel ‘der Stadel der Familie Kaiser’, di Kaisertola ‘die Mulde der Familie Kaiser’. Jossen (1989, 76) erwähnt den Namen, der aus Zwischbergen nach Mund kam. In Zwischbergen erscheint der FaN als Keisrigo, einem schwachen Genitiv Plural der kollektiven /-ig/-Ableitung: in Keisrigo Boden ‘im Boden der Familie Keiser’ (1660 u. später) und in Keisrigo Wildÿ ‘in der Wildi (unfruchtbares Gebiet) der Familie Keiser’ (1673). Zu Chäiserstüol cf. HL Kaiser.
Kaiser
Kaiser, abgeleitet von der Amtsbezeichnung, findet sich nur in Chäiserstuol ‘Kaiserstuhl, hier Felskanzel mit Aussicht’ (Ried-Brig) (Id. 11, 306, auch Kristol et al. 2005, 472, GrWb 11, 46). Es handelt sich um eine metaphorische Bezeichnung, hier einer Felskanzel.
Kal
Kal ist nur historisch 1574 in Ernen als der Kalacher belegt. Für das Saastal wird 1821 zú Kalmatten angegeben. In Saas-Fee hat FLNK Chalmattu; historisch ist ab 1836 als zú Kalmatten belegt. 1844 wird ein Peter Sŭpersaxo erwähnt, 1821 in Saastal ein Franz Sŭpersaxo, beide scheinen an Kalmatten gewohnt zu haben oder begütert gewesen zu sein. LT ist gespalten: einerseits heisst die Gegend Chalbermatten, anderseits ist etwas westlicher Ober Chalmattu erwähnt. 1:10000 unterscheidet am gleichen Ort Ober- und Unner Chalmattu. Daraus lässt sich wohl folgern, dass Chalmattu eine Assimilation von /b/ und /m/ aufweist, also aus Chalbmattu folgt. Schwieriger ist Kalacher, da Kälber normalerweise nicht auf Äckern weideten. Es ist eher wahrscheinlich, dass Kal hier schwdt. Challen ‘Glockenschwengel; Klöppel’ und wdt. Challe, Challä (Goms), Challn (Lötschtal), Challu ‘Glockenköppel’ (Id. 3, 194; Grichting 1998, 47; Rübel 1950, 120) meint, wobei wohl metaphorisch die Form des Grundstückes bezeichnet wird. Das HL Kaal ist hier kaum gemeint.
Kalbermatter (FaN)
Kalbermatter (FaN) ist zum FaN Kalbermatter, auch Kalbermatten (AWWB 140) zu stellen, der im ganzen Oberwallis verbreitet war; der Name ist auch belegt bei W. Meyer (1991, 153 ff.) für Turtmann. Der FaN ist nur im Genitiv Singular ts Chalbermattisch Ledi ‘die Aufladestelle der Familie Kalbermatten / Kalbermatter’ (FLNK, Visperterminen) und im Genitiv Plural in pratulum Kalbermattero ‘die kleine Wiese der Familie Kalbermatter’ (1722, Eischoll) und Kalbermattero Alpÿ ‘die kleine Alpe der Familie Kalbermatter’ (1687, Ergisch; 1687 Turtmann) belegt.
Kalpetran
Kalpetran ‘der felsige Fussweg (?)’ ist der Name eines Ortsteils von Embd und befindet sich an der Mattervispa. Der Name ist endbetont, also romanisch.M.S. notierte Kalvutra und Kalfutra, wobei unklar ist, ob der Anlaut bei ihm eine Affrikata /kx/ oder eine Fortis /gg/ darstellt. Historisch erscheint 1304 Galpotram, 1305 Galpotran, 1307 Galpatran, 1388 Galpertran usw.
Ein Genitiv Plural der Burger des Ortes erscheint 1301 in Embd als an dien Galpotrammerro Akern ‘an den Äckern der Leute von Kalpetran’. Belegt ist weiter Kalpetraner Wasserleita ‘die Wasserleitung der Leute von Kalpetran’ (FLNK, Embd).
Eine Deutung des Weilernamens gibt es bisher nicht. Da der Name dreisilbig mit Endbetonung ist, muss ein romanisches (oder gallo-romanisches) Kompositum oder Nomen mit Adjektiv vorliegen, was zu den Namen Gasen, Randa und dem alten Pratobornum (Praborgne) für Zermatt passt. Ob ein lat. callis ‘Fussweg’ (FEW 2, 98) und lat. pětra ‘Stein, Fels’ (FEW 8, 313) zu Grunde liegen, also ‘felsiger Fussweg’, ist unklar, da ältere historische Belege fehlen.
Kamil (PN)
Kamil (PN) ist nur belegt in ts Kamilsch Bildji ‘das kleine Bild Kamils’ (Gampel). Laut Gwp. handelte es sich um ein Bildchen eines verunglückten Knaben. Der PN Kamil ist als Kamill in AWWB (167 s. v. Meichtry) erwähnt. Es handelt sich um die deutsche Schreibweise des frz. Vornamen Camille für Männer. Im Übrigen erwähnt Jordan (2006) die in der Datenbank nicht belegten Namen Kamilsch Chriiz ‘das Kreuz des Kamil’ (224, mit der Bemerkung, dass dort 1910 Kamil Kluser abstürzte), Kamilsch Läärch (323, mit der Bemerkung, dass dort ein Mann namens Kamil verunglückt sein solle), Kamilsch Mat (84, mit der Bemerkung, dass diese Mähwiesenparzelle früher Camille Arnold (1901–1990) gehörte) und Kamilsch Úawand (87, mit der Bemerkung, dass ein früherer Besitzer där Kamil war). Die beiden letzteren Namen gehören zu Simplon, die ersten zwei zu Zwischbergen.
Kammer (FaN)
Kammer (FaN) ist 1715 in Ernen als Kammeroholtz ‘das Holz (Wald) der Familie Kammer’ und 1716 in Visp als Kamero Waldt ‘der Wald der Familie Kammer’ belegt. Kamero, resp. Kammero ist ein Genitiv Plural, der für Besitzer oder Nutzer, hier eines Waldes, steht. Der FaN Kammer kommt im Register zu den HRBS vor.
Kammer
Kammer ist ein komplexes HL. Kammer f., schwdt. Chammer (Id. 3, 248 ff.), im wdt. Chammra, Chammru f. ‘Kammer’ (Grichting 1998, 47; V. Schmid 2003, 68) meint zunächst ein ‘Schlafgemach, jedes zimmerähnliche i.d.R. unheizbare Nebengemach’, in Flurnamen aber wohl häufig eine kammerähnliche Geländeformation (TGNB 2, 2, 118). Belegt ist ein Simplex im Plural t Kammrä ‘die Kammern’ (Gampel), wo auf der Karte keine Gebäude zu erkennen sind, weiter uf Grosschammrun ‘auf den grossen Kammern’ (Blatten), ebenfalls ohne Gebäude. Als Bestimmungswort kommt das HL vor in der Chammergrabu ‘der Kammergraben’, der als Holzschleif bezeichnet wird; auch hier ist kein Gebäude zu sehen. 1391 ist in Glis Kamersleýf belegt (die Lesung Kremersleyf kann wohl ausgeschlossen werden), ob hier ein FaN Kammer vorliegt, ist unklar.
In Törbel findet sich lebend ze Chämmbrinu ‘bei den Kammern’, benannt wohl nach den Stadeln, die es hier gibt. Dazu gesellt sich der Chämbricheer ‘der Cheer (Kurve der Strasse) bei ze Chämbrinu’.
Mehr Schwierigkeiten bietet ts Chammer mit neutralem Geschlecht (Naters). Es kann sich um ein neutrales Kollektiv handeln; hier fliessen in einem wohl kammerartigen Graben der Kelchbach und andere Bäche zusammen. 1445 heisst einer dieser Bäche Kamberbach ‘der Bach beim Chammer’ und 1736 ist an den wilden Kamer Knubel ‘an den wilden Hügel im Chammer’ (Naters) belegt.
Vermutlich ein FaN ist in Kammers Sand ‘das Sandgebiet der Familie Kammer’ (1860, Eyholz) belegt. Der FaN Kammer ist mehrfach im Register der HBRS bezeugt (cf. HL Kammer (FaN)).
Kämpfen (FaN)
Kämpfen (FaN) (AWWB 141), bis heute lebendig, tritt in der Form Chempfe / Chempfu und als Chempfigo (Gen. Plur. mit /-ig/-Ableitung) auf. Die Genitivform ts Chempfe ‘des Kämpfen’ ist als Plural ‘die Leute des Kämpfen’ zu verstehen. Belegt ist es in ts Chempfe ‘das Gut der Familie Kämpfen’ (Ernen), mit einem Genitiv ts Chempfe Hitgi ‘die kleine Hütte der Familie Kämpfen’ (Obergesteln, FLNK Kämpfe Higgi), auf Kempfen Bielen ‘auf dem Hügel der Familie Kämpfen’ (1772, Naters), mit einem Genitiv Plural Kempfigo Wald ‘der Wald der Familie Kämpfen’ (1716/17, Glis) und zusammengesetzt als der Kämpfigwald ‘der Wald der Familie Kämpfen’ (Randa).
Kanaal
Kan’aal ist zu hdt. Kanal (Kluge / Seebold252011, 458) und schwdt. Kanal m. wie nhd. ‘Kanal, künstlich angelegter Wasserlauf, Wasserleitung’ zu verstehen. Grichting (1998, 121) kennt wdt. Kanaal ‘Wasserlauf (künstlicher)’. Die historisch belegten canalem bzw. canalis (Inden und Salgesch) gehen auf lat. canālis ‘Kanal, künstlich angelegter Wasserlauf’ zurück (canālis m./f., eine Substantivierung von lat. canālis ‘rohrförmig’, zu lat. canna f. ‘kleines Rohr, Schilf’ FEW 2, 168 ff.).
Belegt sind: ad Canalem (1356, Inden) und ad Canalem (1337, Salgesch; später jn Canali). Vermutlich handelt es sich hier um eine Wasserleitung.
der Kanaal (Leuk) ist zweimal belegt: zum einen meint der Name den Abflusskanal des Kraftwerkes Millachru (Agarn), zum andern ist der Wasserkanal durch den Pfynwald zur Alusuisse in Chippis gemeint. Die Firma existiert in dieser Form nicht mehr. Bei der Kanaal ‘Wassergraben vom Brigerbad her’ (Lalden) handelt es sich um einen Entwässerungsgraben in der Rottenebene.
Als Grundwort erscheint das HL in folgenden zweigliedrigen Zusammensetzungen: Hennebique-Kanal (FLNK, Bitsch; benannt nach dem Erbauer François Hennebique), Muttkanal ‘der Kanal bei ts Mutt (flaches Stück Land)’ (FLNK, Niedergesteln), dr Nordkanaal ‘der im Norden (der Rottenebene) verlaufende Entwässerungskanal’ (Raron; FLNK Nordkanal), der Schipferkanaal ‘der Kanal beim Gebiet Schipfer’ (Raron), Tüüchkanal ‘der Kanal beim Tüüch’ (FLNK, Bratsch). Komplexer sind: der Gross(grund)kanaal (Raron, LT und FLNK Grossgrundkanal) ‘der Kanal im grossen Grund (Talebene des Rotten)’ (Raron), der Grossgrundkanal ‘der Kanal im grossen Grund’ (Visp) [die beiden Namen betreffen den gleichen Kanal], der Unner Fälkanaal ‘der Kanal durch das untere Feld’ (Turtmann; FLNK Unnärfäldkanal), Wannumosskanal ‘der Kanal durch das Wannumoss (sumpfiges Land bei der Wanna (Mulde))’ (Niedergesteln).
Als Bestimmungswort erscheint das HL nur in Zusammenhang mit Brigga ‘Brücke’. Belegt sind di Kanalbrigga ‘die Brücke über den Kanal (des Kraftwerkes Mörel)’ (Grengiols) und ts Unner Kanalbriggi ‘die untere kleine Brücke über den Kanal’ (Baltschieder).
Das HL bezieht sich in der Rottenebene vor allem auf Kanäle, die zur Entwässerung dienten.
Kanndere
Kanndere ist als t Kchandere, vadu Chandere (Agarn, FLNK Channerä) belegt. FLNK und die flektierte Form legen ein Chandere nahe; die anlautende Form mit /kch/ ist offenbar nur durch eine Assimilation des anlautenden Artikels entstanden. Die historischen Formen sind 1308 choudanna, 1380 eys choudanyers, 1338 eys chandaneys, 1334 eys chaudanỳers(?), 1355 eys chandaneuz, 1358 eys chandanyers, 1364 eis chaldonyers. Sie beziehen sich auf chaudanne ‘warme Quelle’, vgl. Bossard / Chavan (2006, 48). Die belegte Form Chandere legt jedoch eher Chintre etc. nahe, das laut Bossard / Chavan (2006, 109) auf lat. cancere ‘der Zaun, das Absperrgitter’ (Gpsr 3, 581) zurückgeht. Darum wird als Deutung ‘das Grenzgebiet’ gegeben.
Als Kompositum mit dem HL als Bestimmungswort kommen der Cenderacker (1693) und im Kander Acker (1694) (beide Agarn) vor; gemeint ist wohl der Grenzacker.
Kanoona
Kanoona f. ist nur in ts Kanoonuroor ‘das Kanonenrohr (steile Ski-Abfahrt)’ (Blatten; Saas-Fee) belegt. Zu stellen ist es zu schwdt. Kanonen f. wie nhd. ‘Kanone’ und wdt. Kanoona, Kanoonä (Goms) ‘Kanone’ (Id. 3, 309; Grichting 1998, 120). Die Anwendung von ‘Kanonenrohr’ auf eine steile Ski-Abfahrt ist metaphorisch.
Kantiina
Kantiina f. ist in zwei verschiedenen Formen übernommen: eine mit anlautendem /g/ und eine mit anlautender Affrikata /kx/. Als ze Gantinu ‘bei der Kantine’ (Naters) bezeichnet es einen Dorfteil, in dem sich beim Bau des Simplontunnels (1898–1905; 1912–1921) die Arbeiterkantinen befanden. Vermutlich ist es direkt aus it. cantina ‘Keller, Weinschenke’ in der übertragenen Bedeutung ‘Speiseraum’ übernommen (s. unten).
In Oberwald ist der Kantiinecheer ‘die Kurve der Furkastrasse bei der (Arbeiter-)Kantine’ und der gleiche Name für ‘die Kurve der Grimselstrasse bei der (zerstörten) Kantine’ belegt. Letztere wurde um 1890 von einer Lawine verschüttet. Auf der Karte 1:10000 sind beide Orte als Kantiniercheer belegt. Kantine ist laut Kluge / Seebold (252011, 471) aus dem frz. cantine ‘Soldatenschenke, Weinkeller’ übernommen und verallgemeinert; es wurde aus dem it. cantina entlehnt. Die Ableitung Kantinier ist wohl aus dem Frz. cantinier ‘Kantinenwirt’ übernommen. Die Strassen wurden in der Zwischenzeit umgebaut; die Kurvennamen gibt es amtlich so nicht mehr.
Kapaa
Kapaa n. ist als ts Kapáá (Naters; FLNK Kapaa) auf ca. 1900 m (Alpwiesen) belegt. Historisch kommt 1736 im Kapaag vor. Gwp. meint, es handle sich um “Kap(l)aa”; bei den Alpwiesen handle es sich um das Eigentum des früheren Kaplans Bammatter. Der Anlaut ist unsicher, da M.S. {k} auch für die Affrikata [kx] schreibt.
Nimmt man die historische Form im Kapaag ernst, dann liegt wohl ein Kollektivum zu wdt. belegten Paagg ‘Brei (nass, aus Erdreich)’ (Grichting 1998, 149) vor; der gleiche Stamm erscheint als pakk (FEW 7, 475 mit mehreren Verweisen auf frpr. pakot ‘boue’ (Schlamm), ebenso Bridel 1866, 274 s. v. pakot). Kapaag wäre dann ‘das schlammige Gebiet’, mit einem romanischen Stamm und einem deutschen Kollektivsuffix.
Stellt man sich auf den Standpunkt, dass der historische Beleg unsicher ist, lässt sich der Name nicht deuten. Das würde auch die volksetymologische Umdeutung durch die Gwp. erklären.
Kapälla
Kapälla f. ist zu schwdt. Chappelen f., wdt. Kapälla, Kapällä, Chappla, Dim. Kapälli, Kapällu f. ‘Kapelle’ (Id. 3, 382 f.; Grichting 1998, 121) zu stellen. Formal ist zu unterscheiden zwischen der lat. Form Capella, der verdeutschten Form Capellen, der dialektalen Form Chappla oder Chapplu und der zweitbetonten Form Ka’pälla, die an hdt. Kapelle angelehnt ist. Capella und die deutschen Formen beziehen sich ursprünglich auf ein Gebäude, in dem ein Umhang des Hl. Martin von Tours als Reliquie aufbewahrt wurde (Kluge / Seebold252011, 472). Diminutive sind Ka’pälli und Chapelti. Inhaltlich sind damit nicht nur kleine Kapellen gemeint, sondern manchmal auch Bildstöcke mit Heiligenbildern oder Kruzifixen. In einigen wenigen Fällen werden damit Geländeformationen bezeichnet, die an Kapellen erinnern. In lateinischen Texten erscheint auch der Terminus Sacellum ‘kleines Heiligtum, Kapelle’. Das HL kommt in rund 200 Namen vor.
Das Simplex Kapälla / Kapälle / Kapällu ist zusammen mit Capellen, Chapällu, Chapolu, Chapulu und Chaplu rund dreissig Mal im ganzen Gebiet belegt, häufig mit Präpositionen wie bi, hinner, mit, ob, unner, zer verbunden, womit meist der Bezirk um die Kapelle herum gemeint ist. Simplizia im Diminutiv sind seltener: Kapälli ist sieben Mal belegt, zum Chappeli einmal in Randa, obem Chapelti und unnerem Chapelti je einmal in Münster.
Attributive Adjektive sind selten, am häufigsten ist t Aalt Chappla (Wiler), zer Aaltu Chappelu (Saas-Balen), zer Aaltu Chappolu (Visperterminen) und einmal Latein: infra Capellam antiquam ‘unter der alten Kapelle’ (1739, Zeneggen). Weitere Adjektive: zum Chleinu Kapäli ‘zum kleinen Kapellchen’ (Saas-Balen), im Grosen Capellÿ ‘in der grossen kleinen Kapelle’ (1768, Leuk), vnder dem kleinen Capeltÿ (1756 u. später, Ritzingen), únder der Niwen Kapellen (1692, Oberwald), zur Nÿwen Capellen (1753, Ausserberg), Rot Kapälli ‘die kleine rote Kapelle’ (Gampel) und tsch Schreejend Chappelti ‘die kleine Kapelle, bei der es stark zieht’ (Ferden).
Als Grundwort in zweigliedrigen Komposita ist Kapälla mit seinen Varianten sehr häufig. Das geläufigste Muster ist die Angabe des Ortes der Kapelle, sei das eine Alp, ein Dorfteil, ein Weiler, ein Wald oder eine andere Flur. Beispiele dafür: Albukapälli ‘die kleine Kapelle auf der Alba’ (Visp), t Bleickukapälla ‘die Alpe in den Bleiken’ (Simplon), Gsteikapälli ‘die kleine Kapelle im Gestein’ (Mund), Hiischerkapälla ‘die Kapelle beim Weiler Ze Hiischru (Zenhäusern)’ (Bürchen; bei Gattlen 2007 so nicht bekannt), ts Saagikapälli ‘die kleine Kapelle (Bildstock) bei der Säge’ (Zwischbergen), Waldkapälla ‘die Kapelle im Wald’ (Visperterminen) und viele andere.
Ein zweites, selteneres Muster ist die Angabe der Heiligen, denen die Kapelle geweiht ist: St. Annakapälla ‘die Kapelle der Hl. Anna’ (Raron), ts Sant Joosopsch Kapälli ‘die kleine Kapelle des Hl. Josef’ (Visperterminen), ts Jopsch Kapälli ‘die kleine Kapelle des Hl. Josef’ (Saas-Fee). Dieses Muster kann alternativ ersetzt werden durch einen nachgestellten Genitiv: die Kappellen Sant Jodren ‘die Kapelle des Hl. Theodul (Landespatron)’ (1542, Törbel) oder – lateinisch – capella ‘S.S. Anna’ et Jacobj ‘die Kapelle der Hll. Anna und Jakob’ (1672, Zwischbergen).
Komplexere Konstruktionen entstehen, wenn der Bezugsort einen mehrgliedrigen Namen hat, wie in t Oberwaldchapla ‘die Kapelle im oberen Wald’ (Wiler), zer Riätholzchaplun ‘bei der Kapelle beim Rietholz’ (Kippel) oder ts Scheitwägunkapälli ‘die kleine Kapelle beim Scheideweg’ (Hohtenn).
Als Bestimmungswort ist Kapälla mit folgenden Grundwörtern zu zweigliedrigen Komposita verbunden: Acher, Bäärg, Biel, Bodu, Egg(a), Eie, Gartu, Güed, Hubel, Lischa, Matta, Schleif, Schluocht, Spiicher, Stuck, Tschugge, Viertel, Wald, Wang und Wäg. Nur einmal kommt hier eine Ableitung auf /-er/ vor, eine Stellenbezeichnung: t Kappelermatta ‘die zur Kapelle (St. Anna) gehörende Wiese’ (Raron).
Auch hier sind komplexere Formen möglich, aber nur eine ist belegt: der Aalt Chappoluwäg ‘der Weg bei der alten Kapelle vorbei’ (Visperterminen).
Kapetschiiner
Kapetschiiner ist nur als bim Kapetschiinerbrunne ‘bei der Kapuzinerquelle’ (Ulrichen) belegt. Das HL ist zu schwdt. Kapuziner, wdt. Ggapputschiner, Ggappäschinär (Goms), Kappeschiner, Chappuschinär (Leuk), Ggapputschinär m. ‘Kapuziner’ oder Pflanzenname ‘Kapuzinerle, Bach-Kapuziner, Geum rivale, Bach-Nelkenwurz’ (Id. 3, 402 f.; Grichting 1998, 87) zu stellen. Geum rivale (Lauber / Wagner / Gygax52011, 246) kommt in der ganzen Schweiz vor und ist auch subalpin und alpin nachgewiesen. Der Pflanzenname dürfte hier einschlägiger sein als der Orden der Kapuziner, der in Ulrichen keine Niederlassung hatte.
Kapil
Kapil ist nur historisch 1747 in Staldenried als im Kapilacher ‘im Kapellen-Acker’ belegt. Vermutlich liegt eine Schreibform zum HL Kapälla ‘Kapelle’ vor, das dialektal auch als Chappel (Id. 3, 382 f. s. v. Chappel) erscheinen kann.
Kapitol
Kapitol n. ist nur als ts Kapitol (Visperterminen, auch FLNK, LT Kapittol) belegt. Grichting (1998, 121) kennt Kapittl, Kapittäl (Goms), Kappittul (Mattertal), Kappittil ‘Kapitel, Vorwürfe’. Der Akzent liegt überall auf der zweiten Silbe. Wie die historischen Belege von 1569 ds Cappittell und 1572 aúffm Capitell zeigen, ist der Auslaut ein unbetonter Vokal. Da es sich um ein Neutrum handelt, tritt die Regel der Vokalharmonie mit /i/ nach Rübel (1950, 7) nicht ein. Die Deutung ist schwierig. Id (3, 399 f. s. v. Kapitel) und GrWb (2, 606 s. v. Capitel) unterscheiden den Teil eines Buches von der geistlichen Bedeutung. Ersteres kommt kaum in Frage, das zweite wäre als Besitztum des (Dom-)Kapitels in Sitten zu verstehen; damit stimmt überein, dass der Ort im Mittelalter dem Domkapitel abgabepflichtig war (Grichting in http://www.hls-dhs-dss.ch/de/articles/002820,2014-12-27[21.09.2020;IW]). RN (2, 74) kennt capitellum ‘Köpfchen’ (REW 1637, FEW 2, 257) für einen ‘Bildstock’, der in Visperterminen jedoch nicht belegt ist. Die Deutung als “Vorwürfe” kommt kaum in Frage. Insgesamt bleibt sie aber unsicher.
Weiter ist das HL als Bestimmungswort in der Kapitolcheer ‘der Cheer beim Kapitol (Wegkehre beim Gebiet Kapitel)’ (Visperterminen, auch FLNK) belegt; die Motivation dafür ist unbekannt.
Kaplaa
Ka’plaa m. ‘Kaplan’ ist zu wdt. Kaplaa m. ‘Kaplan’, mhd. kapellân (aus lat. capellanus ‘Hilfsgeistlicher’) zu stellen. Davon abgeleitet ist Kaplanii f. ‘Kaplanei’ zu mhd. kaplânîe; zur Bezeichnung von Gütern, die dem Unterhalt des Kaplans und der Kaplanei dienten (BENB 1, 2, 419; LUNB 1, 1, 506; Grichting 1998, 121).
Das HL erscheint als vorangestellter starker Genitiv Singular in ts Kaplaasch Eie ‘die Aue des Kaplans, die der Kaplanei gehörte’ (Münster). Als Bestimmungswort Ka’plaa ist es belegt in di Kaplaahüsmatte ‘die Wiese beim Haus des Kaplans’ (Münster) und t Kaplaamärweri ‘der Acker des Kaplans / der Kaplanei’ (Münster).
Das Simplex der Ableitung Kaplanii ist 1691 in Raron als in der Kaplanÿ ‘im Gut, das zur Kaplanei gehört’ belegt. Dazu ist die Ableitung auch als Bestimmungswort belegt: Kaplaneigút ‘das Gut, das der Kaplanei gehört’ (1853, Stalden), nebet dem Caplaneÿ Gúoth ‘neben dem Gut, das der Kaplanei gehört’ (1803, Ernen), in den Kaplaneÿ Reben ‘in den Reben, die der Kaplanei gehören’ (1838, Visp), di Kaplaniimattu ‘die Wiese, die der Kaplanei gehören’ (Leuk) und t Chaplaniischiir ‘die Scheuer, die der Kaplanei gehört’ (Kippel).
Karf
Karf ist nur 1642 in Zwischbergen als an den Karf belegt. Das Genus ist maskulin. Es scheint, dass der Flurname zu einem Pflanzennamen Carum carvi ‘Kümmel’ (Lauber / Wagner / Gygax52014, 980; GrWb 11, 207 s. v. Karbe) zu stellen ist. GrWb gibt an der Stelle mehrere Belege aus den nordischen und südlichen Ländern an. Kluge / Seebold (252011, 474 s. v. Karbe) nehmen eine Entlehnung aus mlat. care(i)um an, das auf arab. karāwijā ‘Kümmel’ zurückgehe. Die maskuline Form entspricht dem frz. le carvi ‘Echter Kümmel’. Ob diese Herleitung stimmt, ist unklar. Sie kann sowohl aus dem Italienischen wie aus dem Deutschen stammen. Für Zwischbergen kommen beide Sprachen in Frage.
Karisier
Karisier kommt nur einmal vor in der Karisiertstei ‘der Stein der Liebespärchen’ und ist zum Verb schwdt. karessiere(n), karisiere(n) ‘schön tun, den Hof machen, (lieb)kosen; um ein Mädchen werben und es abends besuchen; eine Liebschaft unterhalten, verliebten Umgang haben, Buhlschaft treiben, z.T. auch im unzüchtigen Sinn’ (Id. 3, 428; Grichting 1998, 121) zu stellen; übernommen aus dem frz. caresser ‘zärtlich berühren’ (FEW 2, 439 ff. zu lat. carus teuer).
Karl (PN)
Karl (PN) ist einerseits wohl zum PN Karl (Id. 3, 460 ff.) zu stellen, anderseits auch zu den FaN Carlen oder Karlen (beide AWWB 50).
Belegt ist als Simplex ts Kaarli ‘der Ort, wo ein Karl Seiler 1847 hinunterfiel’ (Simplon). Jordan (2006, 1872) kennt den Ort und berichtet auch den Unfall eines Karl Seiler 1847. Weiter nennt er di Kaarligalärii, die an der Stelle 1958–1961 gebaut worden sei. Heute ist sie mit der Siitibrunnugalärii zusammengebaut.
Ein vorangestellter Genitiv ist in ts Kaarlisch Garaasch ‘die Autowerkstätte des Karlen (FaN)’ (Stalden) erwähnt; früher habe der Ort Chimatta ‘die Wiese beim Kinn (Schlucht)’ geheissen. Heute befindet sich dort die Rallye Garage. Komplex ist der vorangestellte Genitiv in ts Kaarlifrantsch Chriz ‘das Kreuz des Franz, Sohn des Karl (Imsand)’ (Ulrichen). Es handelt sich um ein Erinnerungskreuz an einen Mann namens Franz Imsand, dessen Vater Karl geheissen habe (so die Beschreibung).
Sicher ein PN-Beleg liegt vor in Karl Böschweg (FLNK, Saas-Fee), der zur Erinnerung an Karl Bösch, Ingenieur (1914–1992), benannt wurde (cf. HL Bösch (FaN)).
Als Bestimmungswort erscheint das HL in Karliblätze ‘die kleinen Stücke Land, die dem Karl / der Familie Karlen gehören’ (Ried-Brig) und der Ggaarlowang ‘der Grasabhang des Karl / der Familie Carlen’ (Birgisch). In beiden Fällen ist nicht klar, ob ein PN oder ein FaN vorliegt.
Karlen (FaN)
Karlen (FaN) ist der FaN Carlen oder Karlen, zum Taufnamen Karl gebildet und unterschiedlich geschrieben (AWWB 50, 141). Im Einzelfall kann aber auch der PN Karl gemeint sein (cf. HL Karl (PN)).
Karlen kommt als Erstglied vor in in Karlen Garten ‘im Garten der Familie Karlen / des Karl’ (1700, Zeneggen), der Kaarlustafil ‘der Stafel der Familie Karlen’ (Oberems) und Karleegga ‘die Ecke der Familie Karlen’ (FLNK, Lax).
Die kollektive Ableitung auf /-ig/- im Genitiv Plural Carligo / Karligo ‘der Leute des Karl’ ist belegt als terram Karligo ‘der Boden der Familie Karlen’ (1656, Zeneggen) und an Carligo Waltt ‘am Wald der Familie Karlen’ (1628, Grächen). Die Formen Karlen Has (1661) und vnder Carligo Haus (1682) ‘das Haus der Familie Karlen’ sind für Mund belegt; der FaN ist auch in Jossen (1989, 72) als ausgestorben erwähnt.
Kaschlaa
Nur in Grengiols befinden sich die Kaschlää (gespr. ‘kcha’schlää’) Pl.; Sg. ist Kaschlaa (gespr. ‘kcha’schlaa’) des Auxilius Heynen und daneben die Kaschläärischä ‘Geröllhalden neben den Kaschlää’. Lautlich lässt sich der Name zu Kastlan (cf. HL Kastlan) stellen; am ehesten kann ein metaphorischer Gebrauch (‘aussehen wie ein Kastlan’) vorliegen.
Kastlan
Das Lemma Kastlan (gespr. Chascht’laa) ist in Flurnamen nur als Bestimmungswort belegt; es ist zu wdt. Kastellán, Kastlan m. ‘Burgvogt; höherer Beamter, spez. Oberhaupt und Richter eines Zehndens bzw. einer Gemeinde’ (Id. 3, 535; siehe auch Ph. Kalbermatter, Rechtshistorische Begriffe s. v. Kastlan) zu stellen. Dazu gehören die historischen Belege Castlans Acher (St. Niklaus) und Castlans Biel (Visperterminen), sowie ts Chaschlaasch Brannd (Stalden) und t Kaschtlaweid (Leukerbad). Das Lemma ist verwandt mit anderen Ableitungen zu lat. castellum (FEW 2, 468).
Kastor
Kastor, dial. auch Kaschtor, ist einer der beiden Gipfel, die nach den Dioskuren oder Zwillingen Castor (4223 m) und Pollux (4092 m) von Domherr Josef Anton Berchtold (1780–1859, Mitarbeiter an der Dufour-Karte) so benannt wurden. Schreibweise auf LT ist Castor. Der italienische Name ist Punta Castore (LT).
Katharina (PN)
Katharina (PN) ist nur in Tsangkatriine Bode ‘der Boden, der zum Altargut der Heiligen Katharina gehörte (zum Altar der Hl. Katharina vgl. W. Ruppen (1979, 28 ff.))’ (Ernen); FLNK St. Katrinebode). Der Name der Heiligen ist als Katarīne (Id. 3, 560 f.) mit dialektalen Varianten verzeichnet; der Text nimmt Bezug auf den Altar der hl. Katharina.
Kaufmann (FaN)
Kaufmann (FaN) ist nur belegt als Choifmasch Chumma ‘die Chumma (Mulde) des Kaufmanns / der Familie Kaufmann’ (Ferden). Es ist unklar, ob hier ein FaN oder eine Berufsbezeichnung vorliegt. Der starke Genitiv würde für beide gelten. Die Mulde befindet sich auf rund 2500 m auf der Kummenalp. Wenn der FaN Kaufmann vorliegt, dürfte eher ein bernischer Name gemeint sein; im Wallis selbst ist Kaufmann als FaN nur für eine Person in Leuk auf Grund unsicherer Verhältnisse belegt (Familiennamenbuch der Schweiz 2, 959).
Kauften
Kauften ist nur 1769 in Leuk als des Kauften Bodens ‘des gekauften Bodens’ (Genitiv konstruktionsbedingt) belegt. Der hier gemeinte Boden wurde gekauft, nicht vererbt. Das Partizip Perfekt ist zu schwdt. chaufen ‘kaufen’ und wdt. chöüffe, chöüffä (Goms), choiffn (Lötschtal), chöüffu od. choiffu ‘kaufen, einkaufen’ (Id. 3, 170; Grichting 1998, 52) zu stellen. Das sonst zu erwartende /g(e)-/ wird hier assimiliert.
Kech
Kech ist zu schwdt. chëch, chäch, käch ‘lebenskräftig, -frisch, rüstig’, von Sachen z.T. in den Begriff des Ausserordentlichen, Gewaltigen übergehend, mhd. quëc ‘lebendig, frisch, fest’ und wdt. chäch, käch ‘kräftig, gesund’ (Id. 3, 120; Grichting 1998, 46) zu stellen. Es ist belegt in dr Chächbrunn ‘die lebendige Quelle / der lebendige Brunnen’ (Kippel), sowie zem Kechbrunnen ‘beim der lebendigen Quelle / dem lebendigen Brunnen’ (1382, Ulrichen) und bÿm Kechgraben ‘beim lebendigen Graben’ (1543 u. später, Ulrichen). Zu Kechbrunne(n) > mhd. quëc-brunne eig. ‘lebendiger Quell’ vgl. Id. (5, 687 f.).
Khoreten
Khoreten ist nur einmal belegt 1759 in Simplon als in den Khoreten. Es handelt sich um einen Dativ Plural, der auf dial. (-eta) auslautet. Letzteres ist laut Sonderegger (1958, 524) zu /-eta/ (< /ôdi/ôti/) zu stellen. Gemeint ist wohl ein Ort, an dem Korn (Getreide) angebaut wurde, vgl. schwdt. Chorn ‘Korn, Getreide’ und wdt. Choore, Choorä (Goms), Choorn (Lötschental), Chooru ‘Korn, Getreide’ (Id. 3, 469 f.; Grichting 1998, 52).
Kiechler (FaN)
Kiechler (FaN) ist nur 1549 in Selkingen als Kiechlers Boden ‘der Boden der Familie Kiechler’ belegt. Der FaN ist als Kiechler (NWWB 2, 127) im 16. Jhdt. im Zehnden Goms bekannt.
Kienzner (FaN)
Kienzner (FaN) ist zu FaN Kienzner zu stellen. Das heutige Zienzihiischinu ‘bei den Häusern des Zienzi’ (Mund) wird historisch z Kienzenheisren ‘bei den Häusern des Kienzi’ (1638, Mund) genannt. Jossen (1989, 76) erwähnt den FaN Kienzner für Mund. t Chienzleri ‘die Wasserleitung der Familie Kienzner’ (Mund) wird historisch aqueductum Kuenzinerro ‘die Wasserleitung der Familie Kienzner’ (1344) genannt. Dem FaN liegt demnach ein umgelautetes und entrundetes Kuonz (zu Kuonrad) zu Grunde (Id. 3, 379 f.).
Kilchenmann (FaN)
Kilchenmann (FaN) ist nur als starker Genitiv Singular belegt in ob Kilchenmanns Huss ‘ob dem Haus des Kilchenmannes / der Familie Kilchenmann’ (1615, Grächen). Der FaN kann in dieser Form nicht nachgewiesen werden; es existiert aber ein FaN Zurkirchen (AWWB 303).
Kilometer
Kilometer m. ist nur als bim Kilometerstei ‘beim Kilometerstein’ (Oberwald) belegt. Die Flur weist heute keinen Stein mehr auf. Sie liegt südwestlich von Oberwald: von der Kirche in Oberwald bis hieher sei es genau einen Kilometer weit gewesen. Das HL ist zum hdt. Kilometer m. (Kluge / Seebold252011 s. v. kilo-) zu stellen; Masseinheit, die 1000 m entspricht.
Kind
Kind ist als Simplex nicht belegt. Als Diminutiv erscheint nur Chingjunu (St. Niklaus, FLNK Chingene) und laut M.S. auch Kinndjini. Laut Beschreibung handelt es sich um Steinhaufen zwischen Wiesen. Dieser Name ist wohl nicht zu Kind, resp. schwdt. Chind und wdt. Chind (Id. 3, 336; Grichting 1998, 48) zu stellen, sondern als Diminutiv zu schwdt. Chinn ‘Spalte im Erdreich oder Fels’, wdt. Chi ‘Schlucht, Felsgrund’ (Id. 3, 320; Grichting 1998, 48; cf. HL Chi) zu stellen.
Hingegen gehören ts Chinderheim ‘das Kinderheim’ (Turtmann), t Kimmbetti ‘die Kindbette’ (Niederwald), der Chindobiel ‘der Hügel der Kinder’ (Ausserberg, auch FLNK und LT) und t Kchinnumatta ‘die Wiese der Kinder’ (Grächen, auch FLNK), historisch 1304 als der Kyndo Matta mit einem Genitiv Plural, zum HL Kind. Ebenfalls Genitiv Plural ist der Kindo Acher ‘der Acker der Kinder’ (1527, Ried-Mörel). Die Belege mit Chindo / Kindo bezeichnen ursprünglich Erbstücke der Kinder des vorherigen Besitzers. Anlautendes /k/ in lebenden Namen ist als agglutinierter Artikel im Plural zu verstehen. t Kimmbetti meint einen Bildstock, wobei wohl auf das Kindbett (Schwangerschaft) der Muttergottes Maria Bezug genommen wird.
Kinderen
Kinderen ist nur einmal belegt in beÿ der Kinderen Schür ‘bei der Scheuer der Kinder (?)’ (1775, Binn). Ob hier wirklich ein Genitiv Plural des Nomens Kind (schwdt. Chind (Id. 3, 336; Grichting 1998, 48)) vorliegt, ist unklar (cf. HL Kind). Es könnte sich auch um eine verhochdeutschte, wohl falsch verstandene Form zum HL Chi ‘Schlucht’ handeln, das in Ausserbinn als ts Chinneschiir ‘die Scheuer beim (Binne-)Kinn (Schlucht der Binna)’ vorkommt.
Kinting
Kinting ist nur 1712 in Leuk als in der Kinting ‘im Gut des Quintin’ belegt. Es handelt sich vermutlich um di Ginntig (cf. HL Ginntig), die auf einen früheren PN vom Typ Quintin zurückgeführt wird. Der Name ist ursprünglich wohl lateinisch.
Kipp
Kipp f. ist sicher nur in Mühlebach als Kipp (FLNK) und ob der Kipp (FLNK) erwähnt. Es könnte sich um das hdt. Wort Kippe ‘künstlich aufgeschüttete Halde’ handeln, das aber dialektal nicht belegt ist; die Karten zeigen an der Stelle einen künstlichen Abhang. Der Beleg t Chippfet (Täsch) lässt sich sowohl als Chipf + Fet, wie auch als Chipp + Fet analysieren (cf. HL Chipf); eine Assimilation zu Chid/t + Fet liegt wohl nicht vor. Bei der Deutung gehen wir von Chipf + Fet aus, also ‘die Grasbänder bei der Kipfe’.
Kippel
Kippel, dial. Chiipel ist zunächst der Name einer der Gemeinden des Lötschentals. Historisch ist es 1320 als Kybuel, 1437 Kypill (zweimal), 1440 Kypil, 1440 Kÿpill, 1445 Kipl, 1482 Kippil usw. belegt. 1508 gibt es apud Kupuell, das eine falsche Entrundung im ersten Teil und eine Deutung zu Büel ‘Hügel’ im zweiten Teil annimmt. Die ältesten Belege machen klar, dass eine Entrundung (/ü/ > /i/) nicht möglich ist, da das /i/ schon im 14. Jahrhundert vorhanden ist; die Entrundung erscheint sonst erst um 1500. Der wechselnde Vokal im zweiten Teil wird gelegentlich auf Büel zurückgeführt, was nur bei einer Erstbetonung mit Abschwächung des zweiten Teils zur Endung -bil möglich wäre. Laut Kristol et al. (2004, 481) ist eine romanische Herkunft des Namens, wie sie z.B. bei Studer (1896, 141) zu finden ist, der den Namen zu lat. capella ‘Kapelle’ stellt, unwahrscheinlich. Eine Herkunft von hd. Küppel, Kippel m. ‘Berg, Hügel’ (GrWb 11, 2771 und 2775 s. v. Kuppe) (nach Kristol et al., 2004, 481) ist kaum möglich, da die Form im Schweizerdeutschen Gupf (Id. 2, 390) heissen würde. Nicht haltbar ist die Annahme, dass anlautendes /k/ vorhanden gewesen sei; auch in anderen Fällen ist heutiges dialektales /ch/ schriftlich als /k/ realisiert worden, z.B. Kiematt ‘Kühmatt’ (1662, Blatten), das heute Chiämad ausgesprochen wird. Lautlich würde eine Ableitung auf /-el/-il/ (Sonderegger 1958, 523) als Stellenbezeichnung zum Nomen Chīb ‘Zorn, Wetteifer, Zank, Streit’ (Id. 3, 105 f.), also etwa ‘der Ort, um den es Streit gibt’, passen (was auch das sonst undeutbare lange /i:/ erklären wurde), aber das Nomen ist sonst für das Oberwallis nicht belegt (vgl. aber HL Strit). Insgesamt ist so für den Gemeindenamen keine Deutung möglich.
Neben dem Gemeindenamen tritt das HL nur als Bestimmungswort auf, in zweigliedrigen Komposita mit folgenden Grundwörtern Chumma, Egg(a), Fura, Ried und Wald. Komplexer sind ts Inder und ts Uister Chiipelriäd ‘das innere (taleinwärts liegende) und das äussere (talauswärts liegende) Ried bei Kippel’, nur historisch auch im Obren Kippellried ‘im oberen Ried bei Kippel’ (1715), Indru und t Uistru Chiipelfurä ‘die inneren (taleinwärts liegenden) und die äusseren (talauswärts liegenden) Furchen von Kippel’, in den Kipelriedhalten ‘in den Halden beim Ried bei Kippel’ (1855 u. später), in Innern Kippelriedhalten ‘in der Halde beim inneren Ried bei Kippel’ (1870 (oder davor)) und Chiipelwaldwäg ‘der Weg durch den Kippelwald’ (FLNK) (alle Kippel).
Kiri
Kiri ist nur einmal belegt in Kirihanselöübe ‘die Lauben des Kirihans’ (Ulrichen), eine Alpweide. Vermutlich liegt ein assimilierter Artikel /di/ vor, sodass sich Chiri ergibt, das entweder ein Kurzname oder ein Übername eines Mannes ist, der mit Vornamen Hans hiess. Chiri lässt sich zu Chorn ‘Korn, Getreide’ (Id. 3, 469) (vgl. Chire, Kiru (Leuker Berge), Chiri (Schattenberge, Leukerberge) ‘Obstkern, Weizenkorn’ (Grichting 1998, 49)) stellen; ein PN oder FaN dazu ist jedoch nicht belegt.
Kitzen
Kitzen ist nur belegt in Kitzenboden (1411, Ausserberg) und zwar zum PN Hans Gertzen a dem Kitzenboden ‘Hans Gertschen a(b) dem Kitzenboden’. Es handelt sich vermutlich um eine verschriebene oder verlesene Form von Ritzenboden zum Weilernamen Ritzubodo ‘der Boden bei den Ritzen (Grasbändern)’, der seit 1306 in Ausserberg und Raron belegt ist.
Klaa
Klaa f. ist nur in Leukerbad belegt. t Klaa ist eine langgestreckte Wiesenzone (vgl. R. Grichting 1993, Blatt 2, Nrn. 7, 18, 19, Blatt 3, Nrn. 3, 9, 16), durch die der Klaagrabu (FLNK) zieht; der Glaagrabu ist die etwas irreführende Form unter Nr. 40162, wo LT Glaagraben und SK Claagraben haben. Unterschieden werden t Ober und t Unner Klaa. Historisch erscheint das HL 1358: eys clax, 1367: deyc clas, 1437: eys claa, 1628: in d Claa. Gedeutet wäre der Name am ehesten zu lat. claru ‘klar’ zu stellen (Meyer 1914, 113; Gpsr (4, 84ss. s. v. clair)) und meint dann etwa ‘die Lichtung’ (vgl. im Deutschen HL Plutt).
Klaara (PN)
Klaara (PN) ist in Klaarahaselbodo ‘der Boden mit Haselstauden der Klara’ (Glis) belegt. Es handelt sich um den PN Klara (Id. 3, 685 s. v. Chlāre). Unklar ist, ob es sich um eine (frühere) Besitzerin handelt.
Klachten
Klachten ‘abgegrenzt’ ist nur 1338 in zer klachten Wason (Täsch) belegt. Es handelt sich um ein Partizip Perfekt zum Verb lâchen ‘im Wald die Grenzzeichen aufsuchen und auffrischen’ (Id. 3, 1001). Die seltsame Form ‘bei der abgegrenzten Wiese’ lässt sich eventuell durch die Formulierung apud zer klachten Wason erklären; der Schreiber hat zunächst das lat. apud, dann das gleich bedeutende dt. zer gewählt, was auf ein fehlendes Verständnis des Namens hindeutet.
Klägen
Klägen ist nur belegt in in den Steinklägen (1788, Unterbäch). Laut Dr. Gregor Zenhäusern (p.c.), der in Unterbäch wohnt, handelt es sich um Steinschläge in Ginals, wofür jedoch Belege fehlen. Alternativ könnte Klägen zu wdt. Chlakk ‘Spalte, Riss’ (Grichting 1998, 49) und schwdt. Chlack, Chläck, Pl. Chleck (neben -ä-) m. ‘Spalte, Riss, Ritze, in Holz, Gestein, Gemäuer, Erdreich, Eis und Firn’, (…) ‘Erdschrunde, kleines Bergtal, Einschnitt, Bachbett, Schlucht, Tobel’, mhd. klac (Id. 3, 639 f.) zu stellen sein.
Klarei
Klarei ist nur einmal belegt als Klarei (Salgesch, auch FLNK). Die Beschreibung sagt, es handle sich um einen Dorfteil im Osten. Mathier (2015, 68) kennt den Namen. Er zitiert hierzu Tagmann (1946, 30), der den Namen auf lat. glarea ‘Kies’ (FEW 4, 149; cf. HL Glaret) und das Kollektivsuffix /-etu/ zurückführt und es als ‘Gebiet mit viel Kies, kieshaltiges Gebiet’ bezeichnet. Bossard / Chavan (2006, 62) erwähnen u.a. Glarey als ‘[s]ol graveleux’. Der Anlaut von Klarei wird als Fortis /k/ ausgesprochen, nicht als Affrikata.
Klause
Klause ist nur einmal als Grundwort in Baltschieder Klause SAC (Baltschieder) vertreten. Es handelt sich um eine SAC-Hütte auf dem Gebiet der Gemeinde Baltschieder auf 2783 m ü.M. Das HL ist wohl zu Klause (GrWb 11, 1035 f.) zu stellen und meint eine ‘[v]erschlossene, schwer zugängliche, enge behausung’.
Klufner
Klufner m. ist nur einmal 1860 in Steg als zúm Klúfner belegt. Es handelt sich um eine männliche Stellenbezeichnung auf /-er/ (Sonderegger 1958, 541 ff.) zum Nomen Chlŏben ‘Geräte zum Einklemmen, Festhalten, -Haken, Verpflöcken’ (Id. 3, 617 f.), das von Id. für das Wallis auch als Chlŏfen verzeichnet wird, also ‘der Ort, wo man Geräte zum Einklemmen gewinnt’. Grichting (1998, 50) kennt es als Chlofe, Chlofo (Schattenberge), Chlofn (Lötschtal), Chlofu ‘Kloben (Türzapfen), Kastriergerät, Riegel’; (vgl. auch V. Schmid 2003, 77 f. zu Chlobo und Chlofo beim Hausbau). Das /u/ kann auch aus Chluppen ‘Geräte zum Festklemmen, Kneipen; Klammer’ stammen (Id. 3, 666 ff.).
Klummerte
Klummerte ist nur als t Klummerte (Inden; FLNK u. LT Klummärte) belegt. Die Form ist wohl ein Plural. Das anlautende /k/ ist als Affrikata /kχ/ notiert. Der Anlaut könnte deswegen auch einen agglutinierten Artikel enthalten. Das offene /ä/ der zweiten Silbe kann einen jüngeren Dialektstand notieren als das /ə/ von M.S. Es bleibt unklar, ob das zu Grunde liegende HL dt. oder frpr. ist. Am nächstliegenden ist Chlummere (Thun, BENB 1, 2, 478), wo das Wort nach Hubschmied auf lat. columbarium ‘Taubenschlag, Friedhof mit Asche-Urnen’ zurückgeführt wird (die Lage macht allerdings heute diese Herleitung schwer erklärbar). Diese Deutung verbietet sich in Inden allerdings aus zwei Gründen: zum einen befindet sich t Klummerte laut LT ausserhalb eines bewohnten Gebietes, zum andern enthält es ein /t/, das im zitierten Namen nicht enthalten ist und auch nicht erklärt werden könnte. Eine frpr. Deutung ist schwierig, da clos in Clos Martin ‘eingefriedetes Gut (des Martin)’ (Gpsr 4, 128 ss.) in Inden als Glüü erscheint. Die Entwicklung von Martin zu -merte, resp. -märte ist eher unwahrscheinlich; in Salgesch wird t Bismerting auf aqueductum dou martini ‘die Wasserleitung des Martin’ zurückgeführt; hier ist klar, dass aus Martin das frpr. Marting wird. Beide Deutungen müssen also zurückgewiesen werden; der Name bleibt so ungedeutet.
Kluschite
Kluschite ist als Kluschite ‘die Glockenblumen’ (Leukerbad; SK und LT Kluscheten; FNLK Kluschitä) belegt. Historisch ist es 1695 als in die Kluschette bezeugt. R. Grichting (1993, Blatt 2, Nr. 16 und Blatt 3, N4. 4) kennt es als Kluschitä, dazu noch Kluschitubodu (Blatt 2, Nr. 17). Das anlautende /k/ ist wohl als Fortis /k/ zu lesen, nicht als Lenis /g/. Am nächstliegenden dürfte das frz. clochette ‘kleine Glocke’ (Gpsr 4, 118 ss.) sein, in seiner botanischen Bedeutung als ‘Glockenblume’ (unter 4°); vgl. hierzu die verschiedenen Pflanzen unter dem Namen Campanula (Lauber / Wagner / Gygax52014, 1030–1040).
Kluser (FaN)
Kluser (FaN) ist lebend nur als der Chlüüserbodo ‘der Boden der Familie Kluser’ (Ried-Brig) belegt. Historisch erscheint er 1746 in Simplon als in Klúsero Boden ‘der Boden der Leute von Klusen’ / der Familie Kluser. Der FaN ist als Kluser (AWWB 141) für den Bezirk Brig belegt und auch als Zenklusen bekannt.
Knakten
Knakten ‘abgenagt’ kommt nur einmal vor in an der Knakten Flh (1895, Embd). Es handelt sich wohl um ein attributiv verwendetes Partizip Passiv zum schwdt. Verb ge-nagen ‘abnagen’ (Id. 4, 695 f.). Deuten lässt sich der Name als ‘Fluh, die abgenagt aussieht (wie ein abgenagter Knochen?)’. Die Schreibung Knakten lässt sich aus der Fortisierung von an- und inlautendem /g/ zu /k/ erklären.
Knecht (FaN)
Knecht (FaN) ist in den meisten Belegen wohl als FaN zu sehen. In den Quellen erscheint der FaN Knecht mehrfach, so 1400 Johann Knecht, 1690 Antonius Knecht (beide Eischoll) und 1683 Anthony Knecht (Raron). Von den Namenbelegen stammen drei aus Eischoll: 1648 in Knechtsachren ‘in den Äckern der Familie Knecht’, 1740 die Obrun Knechtsmatten ‘die oberen Wiesen der Familie Knecht’, 1697 ob Knechts Treien ‘oberhalb der Viehwege der Familie Knecht’. Für Niedergesteln ist 1685 in Knechtigo Halten ‘in der Halde der Familie Knecht’ mit dem Genitiv Plural der /-ig/-Ableitung bezeugt. Der einzige lebende Beleg ist Chnächtschmatta ‘die Wiese der Familie Knecht / des Knechtes’ (Blatten). In diesem Beleg könnte auch eine der Deutungen von Chnëcht ‘Knecht; junger Bursche’ (Id. 3, 720 ff.) gemeint sein.
Knoden
Knoden ist nur historisch in am Knodenlandt (1707 u. später, Ausserberg) und am Knodenland (1803, Raron) belegt. Es handelt sich um die gleiche Flur. Knoden ist zu schwdt. Chnoden ‘Knoten; Gelenkknoten’ usw. (Id. 3, 734) und wdt. Chnode, Chnodä (Goms), Chnoda (Mattertal), Chnodo (Schattenberge), Chnodn (Lötschtal), Chnodu m. ‘Knöchel (Fussgelenk)’ (Grichting 1998, 51) zu stellen. BENB (1, 2, 481) kennt ein historisches Knoden und verweist auf die Stelle im Id.www.ortsnamen.ch kennt für Kirchberg (SG) den Flurnamen im Chnode. Vermutlich liegt eine metaphorische Deutung vor: ‘das Land, das wie ein Knoden (Knöchel) aussieht’.
Knou
Knou ist nur belegt in t Knouhitta (Steinhaus mit /l/-Vokalisierung, auch FLNK; LT Chnollhitta). Es handelt sich um eine Assimilation des anlautenden Artikels zum Nomen Chnolle, verbunden mit der /l/-Vokalisierung, also eine (Alp-)Hütte bei einem Knollen, einem Erdklumpen. Zu schwdt. Chnolle ‘Knollen, Klumpen; Erdscholle, etc.’ und wdt. Chnolle, Chnollä (Goms), Chnolla (Mattertal), Chnolln (Lötschtal), Chnollu ‘Knolle’ (Id. 3, 740; Grichting 1998, 51).
Koch (FaN)
Koch (FaN) ist in ts Chochbielti ‘der kleine Hügel der Familie Koch / eines Koch’ (Glis) und der Chochbieltischleif ‘der (Holz-)Schleif beim Chochbielti (kleiner Hügel der Familie Koch)’ (Glis) belegt. Der FaN scheint nicht belegt, doch ist im Register zu den HRBS der FaN Kechli, Köchli usw. belegt. Es kann aber auch eine Berufsbezeichnung vorliegen. Der FaN oder die Berusbezeichnung sind zu schwdt. Choch ‘Koch’ und wdt. Choch, Chooch (Lötschtal) ‘Koch’ (Id. 3, 124 f.; Grichting 1998, 52) zu stellen.
Kocher
Kocher, auch Chocher ist nur in Birgisch belegt. Zentral ist der Name ts Chocherli ‘die kleine heisse Stelle’ (Birgisch, FLNK Chocherli). Es handelt sich um ein Diminutiv zu einer Stellenbezeichnung (Sonderegger 1958, 541). Als Bestimmungswort ist es mit folgenden Grundwörtern verbunden: t Kocherachini ‘die kleinen Äcker beim Chocherli’ (Birgisch), das Kochergässlein ‘die kleine Gasse vom / zum Gebiet Chocherli’ (1802, Birgisch), Chochertola ‘die Mulde im Chocherwald (Wald oberhalb des Chocherli)’ (FLNK, Birgisch), ts Chocherturrli ‘der kleine Turm (Vermessungspunkt) im Chocherwald (beim Chocherli)’ (Birgisch), Chocherwald ‘der Wald oberhalb des Chocherli’ (Birgisch). Die Beschreibung nennt das Chocherli ‘im Sommer sehr heiss’. Das verbindet schwdt. choche ‘kochen, sieden’ und wdt. choche, chochä (Goms), chochun (Lötschental), chochu ‘kochen’ (Id. 3, 126 f., Grichting 1998, 52) im Sinn von ‘heiss sein’ mit den übrigen Belegen.
Kolben
Kolben ist dreimal belegt. Einmal als Cholbini (FLNK, Termen), das vermutlich identisch ist mit auf den Kolbenen (1730, Ried-Brig). Als Bestimmungswort erscheint es 1824 in Bellwald in af dem Kolben Platz. Letzteres dürfte der sonst Cholplatz ‘Platz, wo Kohle gebrannt wurde’ genannte Platz sein. Die ersten zwei Belege könnten sich auf einen Pflanzennamen beziehen, wobei unklar ist, auf welche Pflanze genau. Cholbe(n) werden im Schweizerdeutschen aufgrund ihrer Blütenform zum einen der Schlaf-Mohn (Papaver somniferum), aber auch die Kohldistel (Cirsium oleraceum) genannt; weitere Pflanzen zählt Id. auf (Marzelll 1, 583 ff.; 3, 561 ff.; Id. 3, 225 ff.; Lauber / Wagner / Gygax5, 2014, 152 s. v. Papaver somniferum und 1148 s. v. Cirsium oleraceum machen allerdings klar, dass die beiden Pflanzen im Oberwallis nicht vorkommen; jedoch sind andere, ähnlich benannte, dort bekannt). In der Literatur zu den Pflanzen im Oberwallis fehlt jedoch Cholbe. Grichting (1998, 52 s. v. Cholbe) kennt nur den Motorkolben, sodass die Deutung unsicher ist.
Kollegium
Kollegium n. ist zu schwdt., wdt. Kollegium n. ‘Lateinschule der älteren Zeit; Mittelschule’ und wdt. Kollegium ‘Gymnasium’ (Id. 3, 211; Grichting 1998, 122) zu stellen. Es ist nur in Brig belegt und allgemein der geläufige Name des Kollegiums Spiritus Sanctus an diesem Ort. Anlautendes /k/ wird hier normalerweise als Affrikata ausgesprochen, manchmal auch nur aspiriert, aber nie als Fortis ohne Hauchlaut.
Kolwir
Kolwir kommt in einem Dokument von 1304 als Jm Kolwirgarten (1304, Visp und Lalden) vor.M.S. hat einmal Kolwin notiert (Lalden), einmal Kolwir (Visp); die Nachprüfung durch Ph. Kalbermatter (p.c.) ergab Kolwirgarten. Der Kontext legt zwar Wingarten nahe, aber dann bliebe Kol- unerklärt. Kolwir kann nicht gedeutet werden; am nächstliegenden wäre Kolbwurz (GrWb 11, 1612), das hier wohl als ‘zwiebelartiger Knollen’ zu umschreiben wäre. Da jedoch eine direkte Bestätigung fehlt, kann eine Deutung nicht gegeben werden.
Komabara
Komabara ist nur als Komabara (Salgesch, FLNK Gomabara) mit Erstbetonung und Nebenbetonung auf der dritten Silbe belegt. Mathier (2015, 46) kennt Gomabara und führt es auf gallorom. *cumba ‘Tal, Schlucht’ und ein unklares zweites Element zurück, das er als Adjektiv interpretiert. Es scheint aber, dass das zweite Element frz. barre, patois bara ‘Zaun, Deich, Damm’ ist (Gpsr 3, 262; Bossard / Chavan 2006, 136 s. v. Barre mit der Bemerkung, im Wallis sei mit barre frz. digue ‘Deich, Damm’ gemeint). Die Bedeutung wäre dann ‘das Tal mit dem Damm’. Es handelt sich um einen Graben im Waldgebiet Brinju nördlich des Dorfes Salgesch.
Kon
Kon ist nur 1638 in Grengiols als im Kon (Kor?) belegt. Im Dokument wird die Flur als pasturagjium ‘Weide’ bezeichnet. Am nächstliegenden wäre das HL Choore ‘Korn’. Da aber das HL unsicher ist, weitere Angaben fehlen und das Dokument keine näheren Informationen gibt, lässt das HL sich nicht sicher deuten.
Kongkordia
Kongkordia ‘Konkordia’ ist das Bestimmungswort für das nach der Place de le Concorde in Paris benannte Firnfeld (Kongkordiaplatz (Fieschertal)), wo sich die Ströme des Grossen Aletsch- und Jungfraufirns, des Ewig Schnee Felds und des Grünhornfirns vereinigen und von wo der Grosse Aletschgletscher ausgeht (GLS 1, 584).
Konrad (PN)
Konrad PN ist nur 1356 in Grengiols als am Knrat Schleyff ‘am Schleif des Konrad (PN)’ belegt. Das HL ist zu schwd. Kuen(e)rat ‘Konrad’ (Id. 3, 335) zu stellen. Der PN geht zurück auf Conrad et al. (Förstemann 1, 373).
Konsul
Konsul ist nur belegt in der Konsulhubel ‘der Hügel mit dem Haus der Familie Konsul’ (Oberwald). Dies folgt aus der Angabe der Gwp. Unsere Quellen erwähnen den FaN Konsul nicht. Wie Ph. Kalbermatter (2008, 339) ausführt, sind jedoch in den historischen Quellen die Ausdrücke “consules”, “gunsel”, “procuratores” und “sindici” vertreten, um lokale Amtsinhaber (Gewalthaber) zu bezeichnen. Es ist deswegen unklar, ob hier noch eine Spur dieser Amtsbezeichnung vorhanden ist, oder ob ein Übername vorliegt.
Kopli
Kopli f. ist nur einmal in di Kopli (Ried-Brig; FLNK Kobli) belegt. In den historischen Belegen erscheint der Name auch als n. (1707 u. 1770), sonst als f. Das Grundstück befindet sich unterhalb des Weilers Schlüecht (Ried-Brig) in relativ ebenem Gelände. Historisch ist 1700 u. später ein Hanffeld dort erwähnt, 1790 ist von Matten die Rede.
Der Name scheint eine feminine Ableitung oder (historisch) ein Diminutiv zu einem wohl ital. coppa ‘Becher’ zu sein, einer Farbe im Tarockspiel, das im Wallis verbreitet war, vgl. Goppen (Id. 2, 389). Eine Ableitung vom Verb gōpen ‘spielen, schäkern’ (Id. 2, 388) ist ebenfalls möglich, wobei der Vokal dann ein langes /o:/ wäre. Beide Deutungen sind sehr unsicher. Ein Anschluss an den PN Goppi (wie in Goppisberg, Goppenstein u. HL Goppisch) ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Kopüür
Koppür f. ist nur in Simplon als di Kópüür belegt, wobei /k/ für eine anlautende Affrikata /kχ/ steht. LT hat Cupür, 1:10000 Kopür. Jordan (2006, 30) kennt Ggópüür. Er verweist auf Favre, der 1876 in einem französischen Text coupure schreibt. Es handelt sich um frz. coupure in der Bedeutung “grévasse dans une montagne” (Spalte im Berg) (FEW 2, 871 s. v. cŏlăphus; Gpsr 4, 421 s. v. coupure).
Korjobsch
Korjobsch ist nur belegt im Genitiv ts Korjobsch Fet ‘die Grasbänder der Familie mit dem Beinamen Korjob’ (Saas-Almagell). Laut Gwp. handle es sich um den Beinamen ts Koriersch einer Almageller Familie; der Beiname dürfte auf das frz. courrier ‘Post(bote)’ (FEW 2, 1565 ff. s. v. cŭrrĕre laufen; Gpsr 4, 444) zurückgehen. Der Flurname und die Angabe der Gwp. für Saas-Almagell stimmen aber nicht zusammen; am ehesten ist eine Verkürzung aus courrier und Jakob (Id. 3, 32) zu erkennen. Aus den zur Verfügung stehenden Angaben lässt sich jedoch der Beiname nicht rekonstruieren.
Kotynguen
Kotynguen ist ein Plural, der nur in Glis 1320 belegt ist, und zwar als in dien Kotynguen, resp. in dyen K(/h?)otynguen. Die Schreibung /gu/ ist auch sonst im Dokument für /g/ vorhanden. Der Stamm kann zum PN Goda ‘Guter’ (Förstemann 1, 659) gestellt werden; der Name wäre dann zu übersetzen als ‘die Güter der Leute des Goda’. Diese Deutung ist jedoch sehr unsicher.
Kraegen
Kraegen ist nur 1527 in Ulrichen als Zen Krgen, 1567 als Zen Kraogenn belegt. Es handelt sich um einen Teil des Ulricher Blasen. Zu Grunde liegt wohl Chragen ‘Hals, Schlund, Gurgel’ (Id. 3, 789 ff.), das als ‘enge Stelle’ (BENB 1, 2, 498 f.) verstanden werden kann, also ‘bei den engen Stellen’. Der Hinweis an der zitierten Stelle auf Zinsli (1946, 323) verweist nicht auf Chrage(n), das nicht behandelt ist, sondern auf Gurgel.
Kram
Kram ist 1395 in Naters als Kramgassa ‘die Kram-Gasse (Gasse, wo man einkauft)’ und 1577 als superius der Kramgassen ‘oberhalb der Kramgasse’ belegt. Ebenfalls hierzu gehört in der Kremmer Matten ‘in der Wiese des Krämers / der Familie Krämer’ (1807, Ergisch). Der FaN Kremer ist im Register zu den HRBS belegt, ebenso Krämer als Berufsbezeichnung am gleichen Ort. Das HL ist zu schwdt. Chram m. ‘Krambude, Krämerware’, mhd. krām(e) (Id. 3, 809; BENB 1, 2, 501 f.) zu stellen; Chramgasse ‘Gasse mit Kramladen’ (Id. 2, 452) hat einen eigenen Eintrag.
Kraphen (FaN)
Krapphingo ist 1305 in Kraphhingo Hsern (1305, Stalden) und, kürzer, als Kraphenstadel (1391, Stalden) belegt. Im ersten Beleg sind die Leute des Krappho mit einem /-ing/-Suffix gemeint, im zweiten wohl einfach die Familie. Laut Ph. Kalbermatter (p.c.) ist der FaN Kraphen in einem Beleg von 1396 in Raron bezeugt, wo ein Johannes, Sohn des Matheus Kraphen von Stalden erwähnt ist. Es ist also davon auszugehen, dass Kraphen ein FaN (wohl aus Stalden) ist. AWWB stellt den Namen zum FaN Graven (AWWB 115) und situiert ihn vor allem in Eyholz.
Kre
Kre ist nur in Krewaldt ‘Krähenwald’ (1597, Eisten) und Krewaldt ‘Krähenwald’ (1695, Staldenried) belegt. Es handelt sich wohl um den gleichen Wald, da die beiden Gemeinden aneinander grenzen. Kre ist hier zum Vogelnamen Chrääja (Krähe) zu stellen, das unter schwdt. Chräjen ‘Krähe’ und wdt. Chrääja, Chrääjä (Goms), Chreeja ‘Krähe’ (Id. 3, 803 f.; Grichting 1998, 52) belegt ist. Gemeint ist dann ein Wald mit Krähen.
Krebs
Krebs ist nur als Bestimmungswort belegt und zwar zu Krebzbrunne ‘die Quelle / der Brunnen mit Krebsen’ (1309, Raron), Krepsbrunno ‘die Quelle / der Brunnen mit Krebsen’ (1304, Visp), Krepzbrunnen ‘die Quelle / der Brunnen mit Krebsen’ (1308, Baltschieder) und Krezpzbuinda ‘der Pflanzplatz mit Krebsen (Krezpzbuinda ist wohl verschrieben aus Krepz-)’ (1305, Raron). Spätere Belege mit Krebs sind nicht bekannt. Das HL ist zu schwdt. Chrëbs ‘das Tier (Krebs)’ und wdt. Chräbs, Chrebs ‘Krebs’ (Id. 3, 781; Grichting 1998, 53) zu stellen. Als FaN ist Krebs im Oberwallis nicht belegt.
Kreinznelen
Kreinznelen ist nur 1804 in Bratsch als in den Kreinznelen belegt. Es handelt sich laut Dokument um ein Stück Garten (eingehegtes Stück Land) in Niedergampel (das damals zur Gemeinde Bratsch gehörte). Da die Lesung unsicher ist, könnte der Name zu einem anderen Beleg von 1774 gestellt werden, der ebenfalls in Niedergampel als jn den Creütz Reben ‘in den Reben beim Kreuz (unklar)’ belegt ist (vgl. Nr. 42921). Ob diese Deutung stimmt, ist unklar.
Kreis
Kreis m. ist nur 1794 in Steg als im Kreis belegt. Laut Dokument handelt es sich um ein Stück Wiese im Stegergrund, das im Kreis genannt werde. Der nächstliegende Beleg ist schwdt. Chreis m. ‘Kreis’ (Id. 3,852), allerdings kennt Grichting (1998) das Wort nicht, während Wipf (1910, 78 und 121) Chreis aufweist. Ob Ge-reis ‘Herrichtung’ (Id. 6, 1297 ff.) in einer seiner Bedeutungen hier zutrifft, bleibt unsicher, da der Kontext unklar ist. Laut TGNB (2, 2, 341 s. v. Kreis) bezeichnen solche Flurnamen den Besitzer eines Grundstücks. Im Wallis ist der FaN jedoch nicht belegt. Eine Deutung ist deswegen nicht möglich.
Kres
Kres ist nur 1308 in Eischoll als Kresaker ‘der Acker mit Kresse (Lepidium sativum)’ belegt. Laut Lauber / Wagner / Gygax (52014, 532) handelt es sich wohl eher um Lepidium campestre ‘Feld-Kresse’, die in der ganzen Schweiz belegt ist und wohl auch etwas höher wächst. Das HL ist als schwdt. Chressen ‘Brunnenkresse, auch Gartenkresse’ belegt (Id. 3, 852); bei Grichting (1998) fehlt es. Hingegen erwähnt es Bielander (1985 [1948], 100) als Chresche.
Kreuzer (FaN)
Kreuzer (FaN) ist zum FaN Kreuzer, auch Kreutzer, Chritzer und weiteren Varianten zu stellen (AWWB 142). Belegt sind: Creútzero Feld ‘das Feld der Familie Kreuzer’(1652, Eyholz), Cricero Geblet ‘die Felsplatten (Kollektiv) der Familie Kreuzer’ (1693, Raron), der Beleg von 1693 ist auch in Ausserberg belegt, wo weiter in Creützern Geblet ‘die Felsplatten (Kollektiv) der Familie Kreuzer’ (1780) steht, in Krizero Tschill ‘in der Tschill (unklar) der Familie Kreuzer’ (1716, Visp), der Chritsergrund ‘der Grund (Grundstück im Talboden) der Familie Kreuzer’ (Visp, heute Areal der Lonza AG), Chrizerhalte ‘die Halde der Familie Kreuzer’ (FLNK, Eischoll), t Chrizerhaaltjini ‘die kleinen Halden der Familie Kreuzer’ (Visperterminen), in Chrützeri Matten ‘in den Wiesen der Frau Kreuzer’ (1748, Ausserberg; 1806 als in der Kreútzerin Matten). Vermutlich liegt überall der FaN Kreuzer vor; im letzten Beleg könnte auch die Wasserleite / Suon der Familie Kreuzer gemeint sein.
Kriffon
Kriffon f. ist nur 1389 in Lalden als Zer Kriffon belegt. Es handelt sich um eine Wiese. Das Wort ist klarerweise feminin, sodass wohl nur schwdt. Griffen ‘Rind oder Kuh von dunkler Farbe oder mit weissen Streifen, Flecken an den Seiten des Bauches’ (vereinfacht; auch für das Oberwallis belegt; Id. 2, 719) anzunehmen ist. Ein Anklang an den Grīff ‘Greif’ (Id. 2, 709) ist kaum gemeint, da dieses Nomen maskulin ist. Zu Grunde liegt aber wohl das Verb grīffen ‘greifen’ (Id. 2, 713).
Kristall
Kristall n. ist zu hdt. Kristall, schwdt. Christall ‘Kristall, Bergkristall’ (Id. 3, 868 f.) zu stellen. Belegt ist es 1602 in Simplon als das Kristall, ein Gut (in weiterem Kontext als predium bezeichnet; Dank an Ph. Kalbermatter, p.c.) jenseits des Krummbaches in Simplon. Ungewöhnlich ist das Genus Neutrum für ein Wort, das normalerweise nur als maskulin erscheint. Ein Kollektiv, wie sonst bei neutralen Nomina, ist wohl nicht gemeint. Die Benennung nach einem Kristall ist sehr ungewöhnlich. Eine alternative Deutung kann jedoch ausgeschlossen werden.
L
Laa
Laa ‘lassen’ ist der Infintiv eines Verbs, das im Beleg wasch di Geiss zämuleend ‘der Ort, wo sie die Ziegen zusammenlassen (vermutlich die Bildung der Ziegenherde vor dem Alpauftrieb)’ (Staldenried) vorkommt. Der Ort befindet sich heute im Wald bei einem Kreuz; unweit davon ist ein Sportplatz zu sehen. Gwp. sagt, dass im Frühjahr die Ziegen erstmals an diesem Ort <zusammengelassen> wurden; als Datum wird der 25. Juni angegeben. Das Verb ist zu schwdt. lān, lōn, wdt. la, laa ‘lassen’, im Beleg präfigiert mit wdt. zämu, schwdt. z(e)sämmen- ‘zusammen’ zur Bezeichnung einer Flur, wo die Ziegen im Frühjahr erstmals ‘zusammengelassen’ werden (Id. 3, 1393ff, 1412; Grichting 1998, 124). Vgl. auch HL Zämu.
Laag
Laag f. ist nur einmal historisch in Brig als Zer Laag (1537 u. später) belegt; es wird als Haus mit Stall und Speicher bezeichnet. Der Hausname geht wohl auf eine der Bedeutungen von schwdt. Lāch, Lāg m., f., n. ‘Einschnitt; Kerbe, Scharte’, mhd. lāche(ne) f. ‘Einschnitt, Grenzzeichen’ und wdt. Laag ‘Lage, Schicht’ (





























