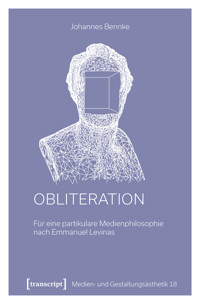
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Medien- und Gestaltungsästhetik
- Sprache: Deutsch
Es gibt keine Kreativität ohne Obliteration – also ohne Überschreiben und Entwerten oder Vergessen und Vernichten. Johannes Bennke setzt erstmals die Obliteration ins Zentrum der Medienphilosophie und deckt im Anschluss an Emmanuel Levinas in ihr etwas bildlich Negatives auf. Als Differenzfigur erlangt die Obliteration gestalterische Sprengkraft sowie ethische und epistemologische Relevanz. Über Bildkonjunktionen als genuine Methode der Bildwissenschaft entsteht so eine Theorie der Kunst und eine Philosophie des Medialen nach Levinas, die sedimentierte Wissensformen erschüttert und im Zeichen eines Lebens mit Anderen erneuert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die E-Book-Ausgabe erscheint im Rahmen der »Open Library Medienwissenschaft 2023« im Open Access. Der Titel wurde dafür von deren Fachbeirat ausgewählt und ausgezeichnet. Die Open-Access- Bereitstellung erfolgt mit Mitteln der »Open Library Community Medienwissenschaft 2023«.
Die Formierung des Konsortiums wurde unterstützt durch das BMBF (Förderkennzeichen 16TOA002).
Die Open Library Community Medienwissenschaft 2023 ist ein Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Technische Universität Berlin / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Bochum | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | Technische Universität Braunschweig | Universitätsbibliothek Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden) | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Goethe-Universität Frankfurt am Main / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek Freiberg | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek | Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Universitätsbibliothek Kassel | Universität zu Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitätsbibliothek Mannheim | Universitätsbibliothek Marburg | Ludwig-Maximilians-Universität München / Universitätsbibliothek | FH Münster | Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) der Carl von Ossietzky Universität | Oldenburg | Universitätsbibliothek Siegen | Universitätsbibliothek Vechta | Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar | Zentralbibliothek Zürich | Zürcher Hochschule der Künste
Sponsoring Light: Universität der Künste Berlin, Universitätsbibliothek | Freie Universität Berlin | Hochschulbibliothek der Fachhochschule Bielefeld | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Fachhochschule Dortmund, Hochschulbibliothek | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Bibliothek | Hochschule Hannover - Bibliothek | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Hochschule Mittweida, Hochschulbibliothek | Landesbibliothek Oldenburg | Akademie der bildenden Künste Wien, Universitätsbibliothek | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hochschulbibliothek
Mikrosponsoring: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e.V. | Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Evangelische Hochschule Dresden | Hochschule für Bildende Künste Dresden | Hochschule für Musik Carl Maria Weber Dresden Bibliothek | Filmmuseum Düsseldorf | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg | Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater Hamburg | Hochschule Hamm-Lippstadt | Bibliothek der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | HS Fresenius gemGmbH | ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe | Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig, Bibliothek | Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF - Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek Regensburg | THWS Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Westsächsische Hochschule Zwickau | Palucca Hochschule für Tanz Dresden
Diese Arbeit wurde von der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar im September 2021 als Dissertation angenommen und für die vorliegende Publikation erneut durchgesehen und überarbeitet.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Erschienen 2023 im transcript Verlag, Bielefeld
© Johannes Bennke
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz (BY-SA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird. (Lizenz-Text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de) Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmateral. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlagkonzept: Natalie Herrmann, Theresa Annika Kiefer, Lena Sauerborn, Elisa Siedler, Meyrem Yücel
Designkonzeption & Umschlagabbildung: Andreas Sieß
Gestaltung & Satz: Johannes Bennke
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
https://doi.org/10.14361/9783839467916
Print-ISBN 978-3-8376-6791-2
PDF-ISBN 978-3-8394-6791-6
EPUB-ISBN 978-3-7328-6791-2
Buchreihen-ISSN: 2569-1767
Buchreihen-eISSN: 2703-0849
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.CACHER POUR MIEUX MONTRER
Urszenen der Obliteration
1.1Etymologie der Obliteration
1.1.1Überschreiben
1.1.2Auslöschen und Zerfallen
1.1.3Widerstehen
1.2Grand Oblitérateur: Sacha Sosno
1.2.1Alexandre Sosnowsky
1.2.2Genese der Obliteration
1.2.3Gesang der Obliteration
1.3Obliterierte Obliteration
Überschriebene
1.3.1Schreiben über Obliteration
1.3.2Obliterierte Alterität
1.3.3O(x,y)
1.3.4List der Ent-fernung
1.4Medientheorien der Obliteration
1.4.1-. --- .. ... . / ..- -. -.. / ..- -- -.-. --- -.. .. . .-. ..- -. --.
1.4.2Obliterierte Kanäle
1.4.3Kreative Affirmation
2.VOM GESICHT ZUM IKONISCHEN DENKEN
2.1Die Kunst, den Dingen ein Gesicht zu geben
2.1.1Obliterierte Gesichter bei Wassili Grossman
2.1.2Obliterierte Existenz bei Nikolaj Gogol
2.1.3Semelfaktivität bei Vladimir Jankélévitch
2.1.4Désintéressement bei Emmanuel Levinas
2.2Ikonisches Denken nach Levinas
2.2.1Die Wirklichkeit und ihr Schatten
2.2.2Zur Ikonizität der Obliteration
2.3Vom Bilderverbot zum Gebot der Bilder
2.3.1Bilderverbot bei Levinas
2.3.2Ikonoklastische Ikonophilie
2.3.3Alternanz des ikonischen Denkens
3.TESTIMONIALE BILDEPISTEMOLOGIE
3.1Bildkonjunktionen
3.1.1Bild & Zeigen
3.1.2Bild & Negativität
3.1.3Bild & Zeit
3.1.4Bild & Wissen
3.2Obliteration & Ästhetik – Une oblitération peut en cacher une autre
3.2.1Exteriorisierte Semelfaktivität
3.2.2Desintegrierende Obstruktion
3.2.3Kontinuierliche Bildkonversion
3.2.4Partikulare Testimonialität
3.2.5Fazit: Ästhetische Gerechtigkeit
4.MEDIENPHILOSOPHIE & OBLITERATION
4.1Zur Kritik der Basismedien
4.1.1traduttore traditore – Wort
4.1.2L’image peut en cacher le temps – Bild
4.1.3Die Vielheit der Musen – Ton
4.1.4Inkonsistente Vielheiten – Zahl
4.2Levinas als Medienphilosoph
4.2.1Vom Medium zum Amedialen
4.2.2Von der Materialität zur Manifestation
4.2.3Von der Medialität zur Diachronie
4.2.4Von der Performativität zur Eschatologie
4.2.5Von der Reflexivität zur Testimonialität
4.3Für eine partikulare Medienphilosophie
4.3.1Obliteration als Praxis und Konzept
4.3.2Zur partikularen Medienethik
4.4Fazit: A media oblivionalis? Obliterate it!
Quellenverzeichnis
Danksagung
Für Barbara und Louis
Wie auch immer dieser Krieg einmal enden wird, wir haben ihn schon gegen euch gewonnen, und auch wenn einige davonkommen, wird ihnen die Welt nicht glauben. Es wird vielleicht Zweifel, Diskussionen, historische Forschungen, aber keine Gewißheit geben, denn wir werden die Beweise zusammen mit euch zerstören. Und wenn zufällig ein Beweis oder irgendjemand von euch überleben sollte, wird die ganze Welt sagen, da die Ereignisse, von denen ihr berichtet, viel zu ungeheuerlich sind, als da man ihnen Glauben schenken kann; man wird sagen, da es sich um Übertreibungen der alliierten Propaganda handelt; man wird euch nicht glauben, sondern uns, die wir alles leugnen werden. Wir sind es, die die Geschichte der Lager diktieren werden.
SS-Offizier
Primo Levi, Die Untergegangenen und die Geretteten1
Einleitung
In einer leidenschaftlichen Rede vor dem US-Repräsentantenhaus bezeichnet ein Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Oktober 2019 die Leugnung von Völkermord als Obliteration. Obliteration sei etwas, das über das Töten von Menschen hinausgehe, denn „genocide denial is the last act of a genocide. First, you obliterate a people, then you seek to obliterate their memory, and finally you seek to obliterate the memory of the obliteration.“2
Mit der Anerkennung eines Genozids aber werde gegen ein Memorizid angegangen, gegen die Vernichtung aller Spuren der Erinnerung, einem totalen Vergessen. Während solch juristische Auseinandersetzungen zentral für den Erinnerungsprozess sind, wird die Frage immer wichtiger, wie ein Erinnern von Genoziden des 20. Jahrhunderts aufrechterhalten werden kann, angesichts der mit dem Generationenwechsel einhergehenden kontinuierlichen Entfernung von den Opfern und den Überlebenden. Wie ist es möglich, die Erfahrungen des Verlustes und der Scham jener Generationen auch in der Zukunft nicht nur zu bewahren, sondern auch zu aktualisieren? Wie funktioniert eine Ethik des Erinnerns durch Medien und in künstlerischen Praktiken, die eine Erinnerungskultur nicht nur pflegen, sondern auch voranbringen? Und wie kann das Erinnern eine bestimmte Art des Vergessens einschließen? Diese Fragen wiegen schwer, erfordern aber einen beweglichen und unerschrockenen Umgang im Denken.
Zur Beantwortung dieser Fragen stelle ich die Obliteration ins Zentrum dieser Arbeit. Es gibt einen erstaunlichen Widerspruch zwischen der Wirksamkeit der Obliteration und der Unkenntnis ihrer Mechanismen. Sie ist alltäglich und zugleich verborgen. Sie ist überall dort wirksam, wo etwas gelöscht, getilgt, überschrieben oder vergessen gemacht wird. Das zumindest legt ihre etymologische Bedeutung nahe, die wahlweise auf das Lateinische „obliterare“ oder „oblinere“ zurückgeht und dort ein Überschreiben, Auslöschen, Zerfallen oder ein Vergessen bezeichnet. Es gibt hier zunächst eine Verwirrung der Bedeutungs- und Gebrauchsweisen, da im Englischen wie im eingangs erwähnten Zitat die Obliteration mit Zerstörung und absoluter Vernichtung assoziiert wird, während im Französischen die Obliteration den nüchternen Vorgang des Stempelns bezeichnet. Denkt man allerdings an die bürokratische Maschine der Nazis, die mit Stempeln und Listen über Leben und Tod entschieden, so taucht die Obliteration im Assoziationshorizont des Krieges als finstere Negationsfigur atomarer Vernichtung, genozidaler Auslöschung und totaler Herrschaft auf.
In ihren Gebrauchsweisen entfernt sich die Obliteration von dieser vernichtenden Bedeutungsdimension. Sie ist mehr als die bloße handschriftliche Streichung (rature) in Manuskripten.3 Trotz einiger Ähnlichkeiten unterscheidet sie sich auch vom Palimpsest, das wesentlich an Sinn und Sprache gebunden bleibt. Der Vorgang des Stempelns erinnert vielmehr an eine Performativität, die mit einem Statuswechsel einhergeht, wobei etwas eine begrenzte Gültigkeit oder Geltung erhält. Die Obliteration erhält damit eine zeitliche Dimension, die etwa auch den Schreibprozess selbst einbezieht: Der französische Ethnograph und Schriftsteller Michel Leiris bezeichnet in einer Passage seiner autoethnographischen Schrift seinen Schreibvorgang als ›biffures‹ (Streichungen) und mit den homophonen ›bifurs‹ (Weggabelungen, Abzweigungen oder Abweichungen). Wie hängen dann die Zeitlichkeit der Obliteration und ihre Ästhetik zusammen?
In den 1970er Jahren hat der Künstler Sacha Sosno (1937–2013) die Obliteration zum Prinzip seiner Kunstpraxis erhoben. Sosnos Kunstwerke sind für die vorliegende Arbeit ein wichtiger Ausgangspunkt, zumal er sich auch in Texten zu seiner Kunst geäußert hat. Für Sosno besteht die Obliteration in einem Spiel von Verstecken und Zeigen, das er auf die Formel bringt: cacher pour mieux montrer4 – kaschieren, um besser zu zeigen. Die École de Nice um Yves Klein, Jean Tinguely und Arman bilden für Sosno einen zentralen Orientierungspunkt für seine Kunst. In seinem Œuvre bezieht sich Sosno auf bekannte Werke der Kunstgeschichte und obliteriert sie in der Regel durch geometrische Formen, die mal Bereiche auf Fotografien und Malereien verdecken, mal Skulpturen aushöhlen oder ausfüllen. Dies wirkt befremdlich und rätselhaft.
Die Frage, die mich hier interessiert, ist, was diese disparaten Gebrauchsweisen miteinander verbindet, welche Rolle das jeweilige Medium dabei spielt, und wie sich dies beschreiben lässt. Die Obliteration bezeichnet also sowohl eine Praxis als auch ein Konzept. Die Ausgangslage stellt sich dabei paradoxerweise materialreich und materialarm zugleich dar. Denn obgleich die Obliteration vielfältig an Phänomenen ist, wurde vergleichsweise wenig über sie geschrieben. Das erste Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es daher, zunächst einmal die disparaten Einsichten zur Obliteration zu versammeln, zu ordnen und schließlich deren Relevanz für die Bild- und Medienwissenschaft aufzuzeigen.
Die vorliegende Arbeit behandelt das Œuvre Sacha Sosnos und berührt die Nachkriegskunst in Frankreich und insbesondere die École de Nice. Es ist aber nicht das Ziel, eine Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts unter der Perspektive der Obliteration aufzuarbeiten und verwandte Kunstpraktiken zu versammeln. So sind beispielsweise nicht alle Übermalungen auch Obliterationen und nicht alle Obliterationen zeigen sich in Form von Überlagerungen von Farben, Material oder Formen. Bevor demnach geklärt werden kann, ob es sich bei einem Kunstwerk um eine Obliteration handelt, bedarf es der Bestimmung einer Obliterationsästhetik.
Dabei nimmt der französisch-jüdische Philosoph Emmanuel Levinas5 (1906–1995) eine besondere Rolle ein. Er ist einer der wenigen Philosophen, der sich zur Obliteration geäußert hat. In einem Kunstgespräch mit der französischen Philosophin Françoise Armengaud akzentuiert er dies in knappen Zügen, und nimmt dabei für seine Verhältnisse vergleichsweise affirmativ Bezug auf Fragen zur Kunst.6 Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil Levinas für seine Ethik, nicht für seine Ästhetik bekannt ist.
In der Regel wird das gesprochene Wort im Vergleich zum monographischen Werk leichtfertig an den Rand geschoben. Hier, in diesem kurzen Gespräch deutet sich jedoch an, dass Levinas der Kunst die Möglichkeit einer ethischen Intervention zuspricht und die Obliteration mehr ist als eine bloße Streichung und künstlerische Praxis. Dieses Gespräch kann daher gelesen werden als Zeugnis davon, dass die Obliteration im Spannungsverhältnis von Ethik und Ästhetik anzusiedeln ist. Diese wegweisende Einsicht kann für die vorliegende Arbeit kaum überschätzt werden. Obgleich das impulsgebende Zentrum des Buches in einer Kunst liegt, die den Dingen ein Gesicht gibt (Kapitel 2.1), geht es darin aber um ein ikonisches Denken (Kapitel 2.2.). Dass auf diesen Überlegungen aufbauend die Obliteration auch als ein medienphilosophisches Konzept gelesen werden kann, ist die forschungsleitende Hypothese für die gesamte Untersuchung. Dadurch fällt auf überraschende Weise auch ein neues Licht auf das Werk von Levinas selbst. Ihn als Medienphilosophen zu profilieren ist daher das zweite Anliegen der Arbeit.
Für Levinas ist das Werk von Martin Heidegger zeit seines Lebens ein wichtiger Bezugspunkt geblieben. Hier geht es aber nicht darum, eine Ästhetik nach Levinas in Abgrenzung zu Heideggers Ausführungen zur Kunst auszubuchstabieren. Vielmehr geht es darum, die Obliteration als eigenständige Kunstpraxis und als medienphilosophisches Konzept überhaupt erst einmal lesbar zu machen. Gerade in ihrer zeitlichen Dimension stünde die Obliteration etwa in der Nähe von Performativitäten in den Künsten. Aber was für ein Performativitätsbegriff geht mit der Obliteration einher? Handelt es sich um ein dekonstruktives Konzept, das mit Wiederholung, Rekontextualisierung, und der Versetzung von Zeichen arbeitet, oder um ein am Ereignis orientiertes Konzept, das auf Nichtwiederholbarkeit von Akten aus ist und damit eher Singularitäten meint?7 Die generative Seite der Obliteration herauszudestillieren – ohne sie ihrerseits zu obliterieren – ist dabei aus mindestens vier Gründen eine methodische Herausforderung, die schließlich für die vorliegende Arbeit strukturgebend ist.
Erstens ist der Begriff kein Terminus technicus, weder in der Literatur-, Kultur-, Bild- und Medienwissenschaft, noch in der Philosophie. Zudem ist die Quellenlage wie bereits erwähnt recht dünn. Es gibt bisher keine Studie, die die Obliteration außerhalb des engen Rahmens um den Künstler Sacha Sosno und den schmalen Kommentar von Levinas systematisch behandelt hat. Françoise Armengaud, die Sosno und Levinas 1986 miteinander bekannt gemacht hat, schlägt eine semiotische Lesart der Obliteration vor, allerdings bleibt die Bedeutung und Funktion der Obliteration hier noch undeutlich und für die Medientheorie gänzlich unbrauchbar.8 Neben der Wandlungsfähigkeit ist eine weitere irritierende Eigenart der Obliteration ihre Unkenntlichkeit: Die Obliteration hat ohne Zweifel negativistische Züge und es gibt gute Gründe dafür, warum die Obliteration bisher wissenschaftlich kaum bearbeitet wurde. Sie entzieht sich einer eindeutigen Systematik und wo sie zum wissenschaftlichen Objekt gemacht wird, droht sie mit wissenschaftlichen Mitteln ihrerseits obliteriert zu werden. Ähnlich wie bei genadelten Exemplaren einer Schmetterlingssammlung zeigt diese weniger die Objektivierung des Untersuchungsgegenstandes als das Ordnungssystem selbst. Es ist ein klassisches epistemologisches Dilemma, dass der Untersuchungsgegenstand bis zu einem gewissen Grad still gestellt werden muss, um überhaupt erforscht werden zu können, wobei man riskiert, darüber Eigenschaften aus dem Blick zu verlieren, die ihn ausmachen.
Zweitens bedarf es einer gewissen Reinigungsarbeit am Begriff. Die Profilierung der Obliteration durch und mit Hilfe der Schriften von Levinas für eine medienphilosophische Lesart ist nicht selbstverständlich. Das Werk von Levinas gehört nicht zum Kanon der Medienwissenschaft und wird in der Regel in der Sozialphilosophie, Theologie und Ethik als Referenz für eine alteritäre Ethik herangezogen. In der Medienwissenschaft wurde dies bisher nur in Ansätzen entweder am Leitmedium der Sprache oder mit Fokus auf dem zentralen Konzept einer alteritären Ethik bei Levinas getan, dem Antlitz oder Gesicht, le visage.9 Wie wird die Obliteration von Levinas neu kontextualisiert und welche Akzentverschiebung nimmt er vor? Wie steht die Obliteration in Verbindung mit dem Antlitz? Und wenn die Obliteration hier vom Medium der Sprache gelöst wird, wie gelingt dann ihre medienphilosophische Profilierung? Die hier vorgeschlagene Perspektive zielt damit auf eine wegweisende Kritik am medienwissenschaftlichen Kanon und seinen Kategorien und fordert auch gängige Lesarten des Werks von Levinas heraus. Ein ikonisches Denken im Werk von Levinas aufzuzeigen dient zwar dem Argument, stellt aber auch das Werk von Levinas in ein neues Licht.
Drittens schlage ich vor, das Bild als Basismedium der Obliteration aufzugreifen. Bei diesem Registerwechsel von der Sprache zum Bild geht es darum, einen neuen Ansatz für ein Bilddenken zu finden. Bisher nämlich, gibt es keine genuin ikonische Methode in den Bildwissenschaften, zumindest keine, die es erlaubt, Einsichten in die Obliteration zu gewinnen. Die bildwissenschaftliche Forschung hat in den letzten Jahren den Akzent von der Bildontologie (Was ist ein Bild?) auf die Bildpragmatik (Was machen Bilder?) verschoben und dabei den Fokus auf Zeitlichkeit,10 Negativität,11 und Wissen12 gelegt. Offen bleibt hier aber die Frage, wie eine genuin ikonische Methode aussähe, die dem Bild als eigenständiges Medium Rechnung trägt und die Spannung zur Sprache nicht auflöst. Dies ist zugleich ein Beispiel dafür, wie fantasieanregend die Obliteration für das Bilddenken ist. Und wie grenzt sich die Obliteration von anderen Bildnegationen ab, wie etwa der Zerstörung von Bildwerken, ihrer ikonoklastischen Übermalung oder Parodierung? Kann das teilweise obliterierte Bild, ein partikulares Zerstören und Vergessen, dem Erinnern dienen? Wenn es in diesem Sinne eine bestimmte Obliterationsästhetik gibt, was sind dann ihre Merkmale und wie lassen sie sich bestimmen? Und wie kann einem absolutem Vergessen entgegengewirkt werden?
Viertens besteht in der weiteren Genese der Obliteration selbst zum medienphilosophischen Konzept die Herausforderung darin, eine Sprache für die Obliteration zu finden. Das heißt, wenn die Obliteration einen neuen Aspekt in die Medienwissenschaft einführt, was ist dann der Gewinn für die Medientheorie bzw. Medienphilosophie und welche Fragestellungen und Methoden zeichnen sich darin ab? Werden dadurch mediale Prozesse anders beschreibbar? Und welche Rolle spielen hier jene Kategorien, die in den letzten beiden Dekaden im Zusammenhang medienphilosophischer Überlegungen vor allem im deutschsprachigen Raum von verschiedenen Philosophinnen und Medienwissenschaftlern vorgeschlagen wurden und nicht spannungsfrei zu dem stehen, was international unter German Media Theory verstanden wird: Medium, Medialität, Materialität, Performativität und Reflexivität.13 Hier besteht die Chance für die Levinasforschung darin, die Dynamik seines Schreibens neu zu perspektivieren und sein Werk anschlussfähig zu machen für Diskussionen in Kunst und Medien. Die Obliteration erscheint dann als eine Negationsfigur mit generativer Kraft, die hier als eine „philosophische Apparatur“14 in den Blick kommt und von den Werkzeugen des Denkens handelt.
Was aber passiert, wenn die Obliteration selbst zum Ausgangspunkt medienphilosophischen Denkens wird? Es bedarf neuer Formulierungen, neuer Methoden, neuer Unreinheiten an den Begriffen und einer Erweiterung des Gegenstandsbereichs der Medienphilosophie. Wenn etwa in Bezug auf Bildern vom Zeigen oder Sich-Zeigen die Rede ist, handelt es sich dann um ein reines Zeigen oder ist es kompromittiert durch ein Erscheinen? Wenn die Obliteration eine begrenzte Gültigkeit aufweist und damit Geltungsfragen stellt, was bedeutet dies für die gerade genannten medienwissenschaftlichen Kategorien? Inwiefern gilt damit das Unreine der Begriffe auch für die Medienphilosophie selbst und welchen Status hat das Partikulare im Vergleich zum Universellen und Singulären? Der ethische Impuls dieser Frage zielt sowohl auf das Medium der Medienphilosophie als auch darauf, es zu reflektieren. Mit einer gewissen programmatischen Emphase hat dieser ethische Impuls Eingang in den Untertitel der Arbeit gefunden: Für eine partikulare Medienphilosophie nach Emmanuel Levinas.
Die Obliteration erschöpft sich nicht in Negationen und scheint in die Nähe von dekonstruktivistischen Konzepten zu rücken. Auch wenn im Laufe der Arbeit Denkfiguren der Dekonstruktion und Kritischen Theorie anklingen, wie etwa das „désœuvrement“15 bei Maurice Blanchot und Jean-Luc Nancy oder das „Inoperative“ bei Giorgio Agamben, die „Semelfaktivität“16 bei Vladimir Jankélévitch, die „Instauration“17 bei Etienne Souriau oder die „Nichtidentität“18 bei Theodor W. Adorno so können hier nur Aspekte und Verwandtschaften aufgezeigt werden.
Hier geht es darum, die Obliteration nicht nur als mediale Praxis lesbar zu machen, sondern auch über die metaphorische Verwendung bei Levinas hinaus als medienphilosophisches Konzept produktiv zu machen. Wenn die Obliteration also eine eigene Episteme ausbildet, die in Bezug zum Vergessen und Erinnern steht, dann lässt sich eine wichtige Unterscheidung treffen. Wie ist es möglich zu unterscheiden zwischen dem Vergessen um der Sicherung der eigenen Privilegien willen und dem Vergessen um des Anderen willen? Anders formuliert: Wie lassen sich Destruktionen unterscheiden, die die vorhandene Ordnung der Repräsentationen, Modelle und Denkweisen bewahren, von Zerstörungen eben jener Modelle und Ordnungssysteme? Es ist daher höchst wichtig zu wissen, ob wir nicht von der Obliteration zum Narren gehalten werden. Besteht nicht die Hellsichtigkeit darin, im Angesicht einer Welt, in der sich allein im letzten Jahrzehnt ein Bündel an Destruktionskräften weiter beschleunigt hat, unterscheiden zu können zwischen einer dunklen Destruktion um der Zerstörung von Andersartigkeit willen und einer helleren Destruktion um der Zukunft für nachfolgende Generationen willen?
Steht die Obliteration daher kontraintuitiv im Dienste einer noch näher zu beschreibenden Zukunft in der Gegenwart und gerade nicht im Dienste der Vergangenheit? Wie lässt sich trotz aller Negation diese positive, affirmative Seite der Obliteration, die sich hier abzeichnet, beschreiben? Und wenn die Obliteration im Alltäglichen anzusiedeln ist, wo sie verborgen und wirksam zugleich ist, wie ist dann eine Sensibilität möglich, die sich weder von jenen Destruktionskräften in die Irre führen noch von einem Moralismus leiten ließe? Führt also die Obliteration ausgehend von einer ethischen Perspektive auf eine Politik von Entscheidungen und Unterscheidungen hinaus, die medienästhetische Praktiken an die Möglichkeit einer Zukunftshoffnung koppelt?
1Zitiert nach Carlo Ginzburg, „Beweis, Gedächtnis, Vergessen“, in: WerkstattGeschichte 30 (2001), S. 50. In der deutschen Fassung fehlt diese Passage: Primo Levi, Die Untergegangenen und die Geretteten, München: dtv 42020, S. 7.
2 Congressman Brad Sherman, Senior Member of the House Foreign Affairs Committee and Member of the Congressional Armenia Caucus in einer Rede vor der Abstimmung zur Anerkennung des Völkermords an den Armeniern: „Sherman Heralds House Recognition of the Armenian Genocide“, https://www.youtube.com/watch?v=15Mq5zLfyyo, 2’57", hochgeladen am 29.10.2019 [zuletzt aufgerufen am 18.07.2023]. Vgl. Sarah D. Wire, „House overwhelmingly approves resolution recognizing Armenian genocide“, online unter: https://www.latimes.com/politics/story/2019-10-29/house-approves-resolution-recognizing-armenian-genocide [zuletzt aufgerufen am 18.07.2023].
3 Vgl. Almuth Grésillon, „La rature“, in: dies., La mise en oeuvre: itinéraires génétiques, Paris: CNRS-Éditions 2008, S. 83-96.
4 Sacha Sosno, „Il n’y a pas d’images…“, in: ders., De la perception esthétique, Nice [u.a.]: Les Editions Ovadia 2011, S. 61.
5 Beim accent aigu im Namen von „Lévinas“ handelt es sich um eine frankophone Schreibweise. Levinas hat seinen Namen ohne Akzent geschrieben, was ich hier übernehme. Die Variante mit Akzent greife ich nur bei entsprechenden Quellenhinweisen auf.
6 Emmanuel Levinas, Die Obliteration. Gespräch mit Françoise Armengaud über das Werk von Sacha Sosno, übers. v. Johannes Bennke, Jonas Hock, Berlin, Zürich: diaphanes 2019.
7 Dieter Mersch, „Einleitung“, in: Jens Kertscher, ders. (Hg.), Performativität und Praxis, München: Fink 2003, S. 9.
8 Françoise Armengaud, L’art de l’oblitération. Essais et entretiens sur l’œuvre des Sacha Sosno, Paris: Éditions Kimé 2000.
9 Sam B. Girgus, „Beyond Ontology: Levinas and the Ethical Frame in Film”, in: Film-Philosophy 11, Nr. 2 (2007), S. 88-107, Online unter: http://www.filmphilosophy.com/2007v11n2/Girgus.pdf [zuletzt aufgerufen am 13.01.2023].
10 Gottfried Boehm, Die Sichtbarkeit der Zeit, Paderborn: Fink 2017.
11 Emmanuel Alloa, „Ikonische Negation. Unter welchen Umständen können Bilder verneinen?“, in: Lars Nowak (Hg.), Bild und Negativität, Würzburg: Königshauses & Neumann 2019, S. 51-82.
12 Dieter Mersch, Epistemologien des Ästhetischen, Berlin, Zürich: diaphanes 2015.
13 Ob weitere Kategorien wie etwa die Operativität auch dazu zählen, soll hier nicht entschieden werden. Georg Christoph Tholen, Zäsur der Medien. Kulturphilosophische Konturen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002. Sybille Krämer, Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, Dieter Mersch, Materialität, Präsenz, Ereignis, München: Wilhelm Fink 2002. Lorenz Engell, „Medientheorien der Medien selbst“, in: Jens Schröter (Hg.), Handbuch Medienwissenschaft, Stuttgart: Metzler 2014, S. 207-213. Lorenz Engell, Frank Hartmann, Christiane Voss (Hg.), Körper des Denkens. Neue Positionen der Medienphilosophie, München: Fink 2013.
14 Philosophische Apparaturen sind „Objekt generierende Reflexionen der geordneten Materie auf sich selbst“, die wirkungsmächtig auf unser Denken einwirken. Vgl. Lorenz Engell, „The Beauty of the Theory of Beauty“, in: Joachim Kipper, Markus Rautzenberg, Mirjam Schaub, Regine Startling (Hg.), The Beauty of Theory. Zur Ästhetik und Affektökonomie von Theorien, München: Fink 2013, S. 114. Vgl. Lorenz Engell, „Tasten, Wählen, Denken. Genese und Funktion einer philosophischen Apparatur“, in: Stefan Münker, Alexander Roessler, Mike Sandbothe (Hg.), Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs, Frankfurt a.M.: Fischer 2003, S. 53-77.
15 Maurice Blanchot, Der literarische Raum, Zürich: diaphanes 2012, S. 40. Jean-Luc Nancy, Die undarstellbare Gemeinschaft, Stuttgart: Edition Schwarz 1988. Giorgio Agamben, Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2002, S. 72.
16 Vladimir Jankélévitch, Das Ich-weiß-nicht-was und das Beinahe-Nichts, Wien: turia + kant 2010, S. 143, 249.
17Etienne Souriau, Die verschiedenen Modi der Existenz, Lüneburg: Meson Press 2015.
18 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, S. 18.
Urszenen der Obliteration
Eine der Urszenen der Obliteration ist vom französischen Künstler Sacha Sosno als Anekdote überliefert. In seinen zahlreichen Interviews variiert er die Darstellung jenes Abends im Jahre 1971 immer wieder, diese Beschreibung aber sticht in ihrer Plastizität heraus.
Ich war im Kino, rue du Dragon in Paris. In der Pause spielte ich mit einem Marker auf Pressefotos, um mir die Zeit zu vertreiben. Es war, glaube ich, eine Ausgabe von Libération. Während ich gewisse Teile des Bildes durchstrich, sah ich, dass etwas ganz anderes passierte. Sobald ich zu Hause war, suchte ich meine Schwarz-Weiß-Abzüge heraus, die ich in Biafra angefertigt hatte, und kaschierte sie, um einige Partien zu verdecken. Ich möchte nicht sagen, dass ich eine Eingebung hatte, das wäre zu viel. Aber an jenem Tag habe ich wirklich meine eigene Sprache entdeckt.1
In Interviews reichert Sosno diese Urszene der Obliteration mit einigen Details an: Er habe die Fotografie, „mechanisch und gedankenlos“ überstrichen, während es sich bei der Fotografie, um diejenige eines befreundeten Fotojournalisten gehandelt und das Motiv eines Kriegsgebietes gezeigt habe.2 In einer anderen Variante dieser Anekdote waren gar sein Künstlerfreund Arman mit seiner Frau Corice dabei.3 Während er also gedankenlos vor dem Kino in einer Bewegtbildpause spielerisch eine Fotografie mit Gewaltdarstellungen bekritzelte, ereignete sich der Urmoment seiner künstlerischen Sprachfindung. Während der Pause montiert er seinen eigenen Film, indem er das Bild durchstreicht und es damit seinerseits in Bewegung versetzt und es in ein Kippbild, in ein dialektisches Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, An- und Abwesenheit überführt.
Arman ist der erste, der ihn ermutigt, dieses Konzept auszuarbeiten und der gedankenlosen Kritzelei nachzuspüren. Tatsächlich nämlich steht im Zentrum der sosnoschen Obliteration ein ikonoklastischer Akt, der die Bedeutung des Bildes konvertiert oder den Sinn ganz auslöscht. Weitere Plausibilität erhält dieser ikonoklastische Akt durch seine zwei Jahre zuvor erschienene Publikation über Biafra, einem Bildband mit einer schmalen Textsammlung mit prominenten Autoren.4 In Biafra wird er Zeuge eines Bürgerkriegs, mit Hungersnöten, Massakern, Folter- und Bombenopfern durch Luftangriffe, sowie hungernden Kindern. Die Publikation ist als Appell an die Mitmenschlichkeit angelegt und schwankt zwischen ikonophilem Glauben an die Bildwirksamkeit der Repräsentation von Elend und Gewalt und der gleichzeitigen Skepsis gegenüber der Wirkung des Sensationscharakters ihrer Motive. Wenn er also ins Zentrum seiner obliterierenden Bildpraxis Darstellungen von Gewalt setzt, die ihrerseits mit einer Geste ikonischer Gewalt verdeckt oder zensiert werden, dann steht am Beginn seiner Praxis eine Frage an das Medium Bild: Wie kann der Spektakelcharakter des Bildes gestört und die Betrachterin auf andere Weise in das Bild involviert werden (Abb. 1)?
Wie die folgenden etymologischen Bedeutungen zeigen, ist es keineswegs selbstverständlich, dass der Begriff der Obliteration mit einer solchen ikonoklastischen Bildpraxis in Verbindung gebracht wird. Weder in den mündlichen und schriftlichen Äußerungen von Sosno, noch in kritischen Kommentaren zu seinem Werk sind zu dieser Vermählung von Praxis und Begriff konkrete Aussagen zu finden. Auch im französischen Sprachgebrauch verbindet sich der Begriff nicht ohne Weiteres mit Sosnos Praxis.
Dass es sich bei dieser Vermählung um einen arbiträren Akt handelt, macht der Philosoph Philippe Lacoue-Labarthe in einer andere Urszene der Obliteration deutlich, die er am Übergang von Denken und Sprache ansiedelt und als „List der Ent-fernung“ bezeichnet (Kapitel 1.3.4). Das wiederum macht die Obliteration für die Medientheorie interessant. Denn dann beschreibt die Obliteration nicht nur eine Praxis, sondern einen Vorgang im Herzen der Medialität. Als Konzept handelt die Obliteration dann von den Instrumenten des Denkens. Und wenn die Obliteration von Levinas als Konzept zwischen Ethik und Ästhetik nobilitiert wird, wie ich noch zeigen werde, dann steht für ihn in der Kunst mehr auf dem Spiel als der Genuss und das Schöne (Kapitel 2.2). Und wenn die Obliteration hier in den Kontext der Medienphilosophie gestellt wird, dann ist dies eine Urszene ganz eigener Art, wenn dabei bestehende Kategorien, Konzepte und Methoden der Medienwissenschaft neu perspektiviert werden.
Abb. 1: Sacha Sosno, Chant Africain, 1972.
Nach einer ersten etymologischen Annäherung werde ich Sosnos Arbeiten kunsthistorisch kontextualisieren und durch seine Verbindung zur École de Nice plausibel machen, warum der Begriff der Obliteration – obgleich arbiträr – eine naheliegende Wahl für Sosno gewesen ist. Im weiteren Verlauf interessieren mich dann insbesondere die bild- und medienphilosophischen Implikationen seiner Obliterationspraxis.
1.1Etymologie der Obliteration
Die Suche nach den verschiedenen Bedeutungsdimensionen der Obliteration gleicht einem kriminalistischen Spiel. Überraschend ist zunächst, dass der Begriff in zahlreichen deutschen Sprachlexika gar nicht geführt wird, und wo sich doch Einträge zur Obliteration finden, irritiert das Bedeutungsspektrum. So wird zumeist auf die ökonomisch-juristische Bedeutung der „Tilgung“ oder auf die medizinische Bedeutung der „Verstopfung von Hohlräumen“ hingewiesen.5 Konsultiert man weitere Wörterbücher, so finden sich zwei Wortursprünge: zum einen geht Obliteration auf das Lateinische „oblinere“ zurück und bedeutet „beschmieren; verstopfen.“6 Das Partizip Perfekt „oblitus“ führt schließlich zur Nominalbildung „Obliteration“ mit der entsprechenden Bedeutung von Verstopfung. Zum anderen entsteht Obliteration aus dem Lateinischen „oblitterare“ oder „obliterare“ und hebt auf die Bedeutungsdimension von „überstreichen, auslöschen“ ab, was in der Nominalform auch auf das Gedächtnis bezogen wird, und „das Vergessen“ bezeichnet.7
Etymologisch betrachtet setzt sich Obliteration aus dem lateinischen Präfix ›ob‹ und dem Suffix ›littera‹ zusammen. ›Ob‹ bezeichnet einerseits einen räumlichen Widerstand andererseits im übertragenen Sinne auch einen Widerstand, der sich gegen bestimmte Zwecke richtet. Dabei nimmt das ›ob‹ als Richtungsangabe insbesondere konfrontativen Charakter an: „entgegen“, „gegenüber, vor“8, aber auch „nach … hin“, „gegen“ im Sinne einer Hinführung zu einem Ort.9 Im übertragenen Sinne dieses Gegenübers ist „in Ansehung, hinsichtlich“ eines Zwecks auch ein Interesse gemeint und zwar „sowohl die äußere Veranlassung als den inneren Beweggrund bezeichnend“10. Im Hinblick auf eine solche zielgerichtete Aufmerksamkeit, ist die Überwindung des Hindernisses entscheidend. Das Präfix ›ob‹ markiert also einerseits den Moment einer Konfrontation mit einem Hindernis, andererseits den Umgang mit einem solchen Hemmnis: Dieses widerständige Element im Präfix ›ob‹ bleibt in einer Reihe von Wortbildungen, die zum Teil klanglich assimiliert sind, latent vorhanden: Obstruktion, Offensive, Offizier, Okkasion, Opposition, Opus, Operation, Objekt.11 So wird etwa ein Objekt oder eine Obstruktion durch eine Operation aus dem Weg geräumt. Der militärisch-aggressive Charakter klingt etwa in ›offensiv‹ oder Offizier an und weist damit auf jenes Gewaltmoment hin, das Sosno am Ursprung der Obliteration verortet.
Mit dem Suffix ›litéra‹, das auf das lateinische ›littera‹ zurückgeht, ist die ganze Bandbreite sprachlicher Äußerungen aufgerufen, insbesondere in Form des geschriebenen Wortes, dem Text, der Schrift.12 Die Zusammenführung von Präfix und Suffix bringt also ein widerständiges Element mit der Schrift und dem Schreiben zusammen. Buchstäblich übertragen bezeichnet die Obliteration also eine Art ›Gegenschrift‹, ›Überschreiben mit oder von Schrift‹ oder der ›Auslöschung von Schrift‹. So geben denn einige Lexika auch „ausstreichen oder abschaffen“13 als Sinnebene für das Lateinische ›oblitterare‹ an, dessen Doppel-T durch Aphärese in der Nominalform getilgt und zu obliteratio mit einfachem „t“ wird – eine linguistische Form der Obliteration.
Abgesehen davon, dass sich innerhalb der Begriffsbildung der Obliteration solche linguistischen Formen der Obliteration finden, bleibt aber unklar, was ausgestrichen wird oder wogegen sich das Streichen von Schrift eigentlich richtet: Gegen bereits Geschriebenes? Gegen Sinngenese? Gegen die Leser:innen? Gegen etwas der Schrift Äußerliches? Wichtig ist hier, den Verbalcharakter des Obliterierens und drei zentrale Operationen festzuhalten: das Überschreiben, Auslöschen und Widerstehen.
1.1.1Überschreiben
Die Bedeutung von ,überschreiben‘ und ,überstreichen‘ ist in gleich mehreren Disziplinen und Alltagspraktiken anzutreffen. In enger Anlehnung an das Medium der Schrift bezeichnet Obliteration in einer selbstreflexiven Wendung im Französischen auch eine ,Unlesbarmachung‘ (rendre illisible) und ,Unverständlichkeit‘ (incompréhensible), die mit dem Gewicht, der Bürde oder Ablagerung durch die Streichung einhergeht (le charger de ratures)14 bis hin zur kompletten Auslöschung der Buchstaben und des Sinns (effacer la lettre).15 Auch hier klingen die anderen beiden Dimensionen der Obliteration an: das Hindernis in Form der Unlesbarkeit und die Auslöschung in Form der Buchstabentilgung und Sinnentleerung. Im literaturwissenschaftlichen Kontext werden handschriftliche Manuskripte, die solche Streichungen beispielsweise in Form von Korrekturen mittels Durchstreichen, Ausradieren, Ergänzung aufweisen unter dem Begriff der ›rature‹, der Streichung diskutiert.16 All diesen Fällen der teilweisen Vernichtung, der Kassation von Schriftstücken, Akten und Urkunden, „ist gemein, dass sich die Zerstörungsabsicht gegen den abstrakten Textinhalt richtet, das Geschriebene selbst jedoch weitgehend lesbar und der Textträger im Großen und Ganzen unbeschädigt bleibt.“17
Der Obliteration im Sinne der Überschreibung kommen damit zwei zentrale Bedeutungsdimensionen zu: zum einen der Akt des Durchstreichens, die Tilgung, und zum anderen der Akt des Wiederlesbarmachens, das gemäß einer Spurensuche den Indizien folgt.
Abb. 2: Schuldbuch der St. Vinzenzkirche (1448-1475), Folie 1c und 1r, Stadtarchiv Bern, Signatur: SAB_A_4_1.
a. Tilgen
Die Tilgung bezeichnet in der Buchführung eine Rückzahlung an Schulden, die im Schuldbuch „durch die Streichung als erledigt markiert“18 werden. Das Tilgen bezeichnet also keineswegs die spurlose Löschung von Akten, sondern das sichtbare (handschriftliche) Streichen von Buchhaltungseinträgen, bei dem das Gestrichene zwar weiterhin lesbar, aber ökonomisch getilgt und juristisch beigelegt ist (Abb. 2). Das Streichen richtet sich hier an den Schuldvertrag und -betrag, der im Akt des Streichens als erledigt markiert und damit ad acta gelegt wird. Die Schuld ist überwunden, sie ist getilgt und als solche weiterhin les- und nachweisbar. Die Lesbarkeit des Tilgens ist beispielsweise in Fällen relevant, wo der Gläubiger Ansprüche geltend machen möchte, die bereits getilgt wurden. In diesem Falle weist das Schuldbuch die Schuld als getilgt aus.
In der französischen Alltagssprache unterhält die Obliteration eine enge Beziehung zum Postwesen: Insbesondere in der Philatelie hat sich eine ökonomisch-juristische Bedeutung der Obliteration erhalten. Hier bezeichnet die Obliteration den Vorgang des Stempelns einer Briefmarke. In den kunstkritischen Aufsätzen zu Sosno ist dies die häufigste Bedeutungsebene, die aufgerufen wird.19 Bei ›timbre oblitéré‹ handelt es sich um eine abgestempelte Briefmarke, die durch Auftragung eines Stempelabdrucks annulliert und damit keiner zweiten Nutzung zugeführt werden kann (Abb. 3).20 Bei diesem alltäglichen und vermeintlich trivialen Vorgang handelt es sich also um einen Akt, bei dem durch den Stempelabdruck ein Validierungsprozess durchlaufen wird, mit dem ein Statuswechsel einhergeht: Die Marke wird auf ihre Gültigkeit geprüft, durch Stempelabdruck legitimiert, auf ihren entsprechenden Wert geprüft und bei erfolgreicher Validierung zugleich annulliert. Damit wird sichergestellt, dass die Briefmarke nur einmal zirkuliert. Sie dient also nur einmal, ist abgenutzt und wird ausrangiert, bestenfalls landet sie bei Sammlern oder Philatelisten. Der einmalige Vorgang des Stempelns hat aber neben den ökonomisch-juristischen auch machtpolitische Implikationen: In einer an Foucault angelehnten Lektüre kann der Stempelabdruck auch als Einschreibung einer politischen und ökonomischen Macht gelesen werden. Der Stempelabdruck aktualisiert die unternehmerische Legitimierung oder Autorisierung einer Staatsmacht. Historisch betrachtet rufen die niedrigen Portogebühren im 18. Jahrhundert eine Existenz-Technik ins Leben, die die zirkulierenden Diskurse allererst hervorbringt. Das Porto produziert einerseits also eine bürgerliche Gesellschaft,21 andererseits wird an ihm durch Motiv und Stempel das Monopol der Staatsmacht sichtbar. Bemerkbar wird dies insbesondere dann, wenn diese Machtinstanzen nicht mehr existieren: Ein nicht unbedeutender Teil der Faszination an Briefmarkensammlungen geht von Motiven ferner Länder aus, die längst nicht mehr existieren, mit Stempeldaten von längst vergangenen Zeiten durch Autorisierungsinstanzen, die ihr Monopol oder ihre Existenz längst eingebüßt haben.22 So wird an den abgestempelten Briefmarken im historischen Kontrast mit einer vergangenen Gegenwart nicht nur ein weiterer Statuswechsel sichtbar, sondern auch die zeitliche Dimension der Obliteration.
Abb. 3: Gestempelte Briefmarken.
Abb. 4: Ticket des öffentlichen Nahverkehrs in Wien.
Bei diesem Prozess gewinnen allerdings die Briefmarken durch die Stempelmarkierungen (cachet d’oblitération) einen eigenen ästhetischen Wert und können in Briefmarkensammlungen (collection d’oblitération) sogar einen erheblichen ökonomischen Wert bilden. Die Obliteration macht dieses simple, aber wirkungsvolle ökonomisch-juristische Prinzip sichtbar und es begegnet einem in öffentlichen Verkehrssystemen und überall dort, wo Zugänge kontrolliert werden: in Institutionen wie Kinos, Theatern, Bibliotheken, Schließfächern oder hochgesicherten Laborräumen. „Identify yourself!“, „Passports!“, „Tickets, please!“, „May I see your invitation card?“ Bis heute findet sich auf einigen Tickets des öffentlichen Nahverkehrs die höfliche, aber verbindliche Aufforderung: Veuillez oblitérer (Abb. 4).
In diesem Sinne bezeichnet die Obliteration nicht nur, dass ein Hindernis vorliegt, sondern auch die Art und Weise, wie der Schwellenmoment der Verifizierung vonstattengeht. Wird das Ticket eingerissen, perforiert oder ein Segment abgetrennt? Stempel, Riss, Aufdruck, Lochung oder andere Perforationen, haben ihren eigenen ästhetischen Wert, der hier wesentlich an das Medium Papier gebunden ist. Ökonomisch-juristische Verfahren des Legitimierens, Validierens und Annullierens und technische Prozesse des Formatierens und Distribuierens, sowie ästhetische Praktiken des Tilgens und Rezipierens sind also Teil der Wertschöpfungskette der Obliteration.
b. Decodieren
Neben dieser öffentlichen Zirkulation geht es in anderen Wissensbereichen um die bedeutungsstiftende Methode: In der forensischen Anthropologie bezeichnet die Maxillary Suture Obliteration Method ein Verfahren zur Bestimmung des Skelettalters zum Zeitpunkt des Todes.23 Die Methode basiert auf der Untersuchung von Nähten des Oberkieferknochens zu benachbarten Gesichtsknochen, wobei insbesondere der Grad der Sichtbarkeit dieser Nähte ein Anzeichen des Alters gibt. Je weiter die Nähte verwachsen und damit nicht mehr sichtbar sind, desto fortgeschrittener ist das Alter des (menschlichen) Skeletts. Wegen der zunehmenden Verwachsung – und damit Verwischung der Spuren der Naht – nimmt ab einem bestimmten Grad die Genauigkeit der Altersbestimmung wieder ab. Obliteration bezeichnet hier also den Grad einer nicht mehr sichtbaren Naht („Obliteration was defined as any portion of a suture no longer visible.“)24 (Abb. 5).
Abb. 5: Maxillary Suture Obliteration Method. „Suture closure at obelion (see text): (a) open; (b) minimal; (c) significant; (d) obliterated. (The location of the parietal foramen on b and c are darkened by pencil marks.) Photos by Julie R. Angel; specimens courtesy of the University of New Mexico-Albuquqerque, Maxwell Museum of Anthropology, #103, #176; and of the State of New Mexico, Office of the Medical Investigator.“ Steven N. Byers, Introduction to Forensic Anthropology, London: Routledge 2017, S. 396.
In der kriminalistischen Forensik bezeichnet Obliteration das Decodieren und Dechiffrieren von Handschriften, Geheimsprachen oder Seriennummern (etwa von Waffen). Dabei fächert die Forensik die spezifischen Operationen der Obliterationen auf: überschreiben, ergänzen, verschleifen, abreiben, abschürfen, wegätzen, abschlagen etc. So werden beispielsweise mittels chemisch-physikalischer Ätzung Handschriften wieder lesbar gemacht oder abgeschliffene Seriennummern von Handfeuerwaffen wieder rekonstruiert. Dabei bezeichnet Obliteration sowohl die Unlesbarkeit, als auch den gegenteiligen Prozess der Wiederlesbarmachung und Wiederherstellung von ausgelöschten und unverfügbar gemachten Spuren.25 Dies ist insofern bemerkenswert, als die Obliteration damit sowohl das unlesbare Beweismittel, das Spuren von Verfall trägt, bezeichnet, als auch den Prozess des Wiederherstellens, Wiederlesbarmachens oder Reparierens, und zudem das Ergebnis der Reparatur. Objekt, Prozess und Produkt sind also in der Obliteration nicht klar voneinander getrennt. Die obliterierte Handschrift ist darin ebenso eingefasst, wie der Prozess ihrer Wiederlesbarmachung und das Ergebnis der Dechiffrierung (Abb. 6 & 7).26
Abb. 6 & 7: Obliterierte Handschrift und dechiffrierte Handschrift. Drexler Document Laboratory, LLC.
Die Obliteration wird hier erkennbar als eine naturwissenschaftliche Methode, die wesentlich auf kausaler Rekonstruktion, plausiblen Wahrschein-lichkeiten und ihrer Überprüfbarkeit basiert. Reste, Relikte und Ruinen liefern dabei das Zeichenmaterial für Archäologen, Forensiker und Spürhunde, um Kultur- und Sprachräume mit ihrem Glauben, ihren Gewohnheiten und Grundsätzen zu entziffern.
Räumlich betrachtet versammeln sich unter Obliteration sämtliche Operationen der Überschreibung oder Überstreichung. Was hier also besonders hervortritt, sind Spuren als Auftragungen auf Oberflächen, die darüber ihren Charakter und Sinn verlieren oder verändern. So handelt es sich bei beiden forensischen Methoden im Wesentlichen um eine Kulturtechnik des Spurenlesens. Diese methodisch-kognitive Herstellung von Wissen hat Sybille Krämer mit Carlo Ginzburg auch als epistemologisches Indizienparadigma bezeichnet.27 So ist das Motiv, sich überhaupt mit dem Lesen von Spuren oder Reparaturen zu beschäftigen, häufig hermeneutischen Ursprungs: es geht um Sinnproduktion.28 Die Obliteration markiert damit sowohl das Auslöschen wie den Wiedergewinn von Sinn. Eine Leitfrage für die hier genannten Verfahren ist: Wie kann das, was einmal gewesen ist, so wiederhergestellt werden, dass es sinnhaft ist? Das Unlesbare, wird wieder lesbar gemacht und damit einem Verständnis zugeführt, das als Indiz rechtswirksame Konsequenzen haben kann. Ob es sich hierbei um das Decodieren von verschlüsselten Nachrichten handelt oder um das Dechiffrieren von Handschriften oder Knochennähten: prinzipiell ähneln sich diese hermeneutischen Verfahren in ihrer Zielsetzung, einen verifizierbaren Sinn zu generieren.
1.1.2Auslöschen und Zerfallen
Die zweite Bedeutungsdimension der Obliteration im Sinne der Destruktion kann wiederum in eine aktive und eine passive Obliteration unterschieden werden: Auslöschen und Zerfallen. Dies wird insbesondere in der Verwendungsweise in der Alltagskultur deutlich.
a. Aktive Destruktion: Auslöschen
Bei der aktiven Obliteration handelt es sich im englischen Sprachgebrauch um eine umfangreiche Palette an Phänomenen, die auf das destruktive Potential von Vernichtung abheben. Es gibt im Englischen kaum ein stärkeres Wort für totale und absolute Auslöschung.29 Eine solche Destruktion basiert auf einer ursprünglichen Differenz in Form der intentionalen Unterscheidung von Freund und Feind, Eigenem und Fremden, Innerem und Äußerem, Identität und Alterität, ,Wir‘ und die ,Anderen‘. Das Ideal der Auslöschung ist eine zielgerichtete Handlung mit Tötungsabsicht, der alle investierten Mittel untergeordnet sind, um sämtliche Widerstände zu überwinden. Der Destruktionswille, der sich in der Obliteration ausdrückt, ist maßlos. Er lässt sich skalieren bis hin Genoziden, der atomaren Zerstörung ganzer Landstriche oder der ökologischen Katastrophe im planetarischen Ausmaß. Der aktive Destruktionswille zeigt das Gewaltmoment dieser ursprünglichen Differenz an. Diese Gewalt richtet sich vornehmlich gegen menschliche und tierische Körper, Landschaften, Maschinen und Dinge. Diese aggressive Dimension, in der Hass, Krieg und die Vernichtung des Feindes im Mittelpunkt stehen, ist die vermutlich wirkungsmächtigste Bedeutungsdimension, die Auswirkungen nicht nur für den Sprachgebrauch in der Politik hat, sondern auch für die Metaphernbildung in Literatur, Wissenschaft und Popkultur.
In der Politik ist die Verwendung von „obliteration“ die maximal mögliche Androhung einer totalen Vernichtung des Gegners als Feind.30 Das deutsche Wort „Feindschaft“ geht auf das althochdeutsche ,fiant‘ oder ,viant‘ zurück und bedeutet Hass.31 Beim Hass ist der Bezug zum Anderen geprägt durch eine intendierte physische oder memoriale Vernichtung.32 So überrascht es nicht, dass die Obliteration titelgebend wird in Computerspielen mit Kriegsszenarien.33 „Total obliteration“ bezeichnet im Englischen also nicht nur die Vernichtung von Kriegsgerät, sondern die umfassende Eliminierung des Feindes und seiner Lebensgrundlagen und greift auch auf die räumliche Destruktion von Landschaften aus, die entweder durch Bombardierung zerstört, verstrahlt oder durch Industrieeinfluss kontaminiert wurden. Im ökologischen Sinne nimmt die Obliteration mit Bezug auf die Zerstörung von Umwelten und das Aussterben von Tierarten eine planetarische Dimension an.34 Obliteration ist in diesem räumlichen Sinne grenzenlos.
Über die Vernichtung des Anderen hinaus bezeichnet die Obliteration aber noch viel grundlegender die Tilgung jeglicher Existenzberechtigung. Diese kann auf unterschiedliche Weise abgesprochen werden und ich nenne hier zwei zentrale Formen, die beide die Variante einer ›Politik des Vergessens‹ bezeichnen: dies betrifft einmal die Ausgrenzung aus dem Bereich derjenigen, die Anteil haben beispielsweise an einem Glauben an Gott: So ist in einer der liturgischen Texte der Biblia Sacra Vulgata von einer Exkommunikation aus der Glaubensgemeinschaft die Rede, wenn sich jemand für die Reichtümer, die er angesammelt hat, undankbar gegenüber Gott erweist. Jener wird mit Vergessen bestraft: „Dann er ist vergeblich auf die Welt kommen, und gehet hin zur Finsternuß, und sein Nam wird durch Vergessenheit ausgetilget werden.“35Durch das Löschen des Namens wird der Undankbare aus der Gemeinde der erinnernden Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen und das Vergessen zum exkommunizierenden Akt.
Anders als in der religiösen Glaubensgemeinschaft gibt es in der säkularen Bürgergemeinschaft eine äquivalente Form der Ausgrenzung: das Löschen von Erinnerungen oder die Streichung des Namens aus dem kulturellen Gedächtnis. Die „Formen des Vergessens“36 können hierbei sehr verschiedentlich ausfallen und sowohl Menschen als auch Schriften und andere Artefakte betreffen. Angestrebt ist dann nicht die physische Tötung von erklärten Feinden oder missliebigen Zeugen, sondern eine Neuordnung des kanonischen Erinnerns durch Löschung von Inschriften, Archiven und anderen Speichermedien wie Filme oder Festplatten, sowie die Beseitigung all jener Reste, die Hinweise auf frühere Existenzen und Taten geben, und zwar in der Weise ohne dabei Spuren zu hinterlassen. So als ob das, was war, niemals existiert habe.
In der Schriftkultur bezeichnet die damnatio memoriae das zumeist „politisch motivierte Ausmeißeln der Namen von bedeutenden Persönlichkeiten, um das Andenken an sie zu schädigen bzw. aus der Welt zu schaffen.“37 Es ist eine feindlich gesinnte Intention, die sich nicht direkt gegen die Person und deren physische Integrität richtet, sondern gegen eine Gedächtniskultur, die sich ihrer erinnert. Ähnlich verhält es sich mit ikonoklastischen Zerstörungen von Kunstwerken, Denkmälern, Gotteshäusern oder ganzen Siedlungen.38 Auch hier zielt deren Zerstörung beispielsweise auf die Tilgung kultureller Andersartigkeit und ihrer Erinnerung, um den eigenen Herrschaftsanspruch auch auf die Geschichte auszudehnen. Im Extremfall geht diese Art der Erzählung mit einer Weltsicht einher, die mit dem absoluten Anspruch der totalen und umfassenden Deutungshoheit über Vergangenes (und Künftiges) auftritt. Harald Weinrich sieht in diesem Zusammenhang den eigentlichen Skandal der Shoah im Memorizid an den Juden.39 Die Obliteration greift also nicht nur räumlich und physisch aus, sondern auch imaginär und tritt damit an die Grenze der Vermittelbarkeit. Etwas wird dann unaussprechlich, unvorstellbar oder unerinnerbar. In diesem Falle kann man „nur“ nach (ästhetischen) Formen suchen, damit umzugehen.
Obliteration ist in seiner aktiven Destruktion also mehr als eine physische Beschädigung oder Zerstörung von Geschriebenem. Zwar wird im Sprachgebrauch auf die spurlose Annihilation – die Reduzierung auf ein Nichts, ein Zunichtemachen, eine Vernichtung40 – abgehoben, doch auch das Auslöschen hinterlässt Spuren. Es kommt also einem Phantasma gleich, davon zu sprechen, dass es eine absolute Vernichtung bis hin zum totalen Vergessen gibt. Denn jeglicher Beweis wäre zugleich ein Gegenbeweis. Etwas, das auf ein Vergessen hinweist, ruft es in Erinnerung. Die Obliteration bezeichnet damit weder ein bloßes Zerstören noch ein reines Auslöschen.
Unterhalb dieser dominierenden Bedeutungsdimensionen des Auslöschens liegt die Schrift als paradigmatisches Medium der Obliteration. Es geht mir hier in den folgenden Kapiteln darum, in der Diskussion mit einigen künstlerischen Werken diese als Obliterierungen nachzuvollziehen ohne vor der Angst zurückzuschrecken, „sich in den Details der Praktiken zu verlieren […].“41 Vielmehr geht es darum, danach zu fragen, was diese Kunstwerke umgekehrt über das Konzept aussagen können und wie weit die Schrift als Paradigma der Obliteration trägt.
b. Passive Destruktion: Zerfallen
Die passive Obliteration zielt insbesondere auf die nicht-intentionale Unumkehrbarkeit der Zeit. Dies materialisiert sich zum einen in Formen des Vergessens und zum anderen in Spuren der Abnutzung. So zeigt sich die zeitliche Dimension der kontinuierlichen Abnutzung von materiellen Oberflächen beispielsweise durch Patina, Rost- und Witterungsspuren, wie man es etwa von Moos bedeckten Steinskulpturen her kennt, die den Jahreszeiten ungeschützt ausgesetzt sind („Sculptures qui s’oblitèrent avec le temps.“).42 Die Obliteration geht damit auf die altfranzösische Bedeutung zurück und wird hier zum Sinnbild eines passiven Vorgangs einer Abnutzung durch den Zahn der Zeit. Dieses Sichabnutzen zeigt sich beispielsweise in Form von Abblätterungen, Ablösungen, Abtragungen und Abbrüchen, Splitterspuren und Verwischungen, Verwachsungen und Verwitterungen.
Der britische Empirist John Locke hat diesem natürlichen Verfall in seinem Essay Concerning Human Understanding ein Denkmal gesetzt und dabei den Zerfall des Gedächtnisses mit dem Bild vermodernder Grabsteine in Verbindung gebracht.
So sterben die Vorstellungen unserer Jugend, gleich unseren Kindern, oft vor uns, und die Seele gleicht Gräbern, wo, wenn man ihnen nahe tritt, zwar das Erz und der Marmor geblieben ist, aber die Inschrift vor der Zeit verlöscht und die Bildnerei vermodert ist. Die Bilder in unserer Seele sind nur mit schwachen Farben gemalt; wenn sie nicht aufgefrischt werden, erbleichen und verlöschen sie.43
Locke ruft damit ein Bild des Gedächtnisses als ein Speicher (repository)44 auf, dessen Sicherheitssystem fragwürdige Lücken aufweist. Das Gedächtnis wird hier also beschrieben als ein Ort, der anfällig ist für Zerfall, Zerstreutheit und Zersetzung: „[...] so verwischen sich allmählich die Eindrücke, und es bleibt zuletzt nichts übrig.“45 In diesem Sinne ist die Obliteration begleitet von einem passiven Vorgang des Verfalls in der Zeit.
Es gibt zahllose Beispiele für Formen des Verfalls von Gedächtnisträgern: So ist der Tintenfraß eine Form der Schriftzersetzung, genauso wie die unsachgemäße Lagerung von Dokumenten deren Trägermaterial durch eine solche nicht-intendierte Zerstörung zerbröselt oder verfault. Es können darunter auch chemisch-physikalische Zersetzungsprozesse von instabilen Farben durch UV-Licht verstanden werden, wie es etwa beim sogenannten Berliner Blau der Fall ist. Die Farbe wird seit dem 18. Jahrhundert in der europäischen Malerei verwendet und es ist gerade ihre labile Eigenschaft die innerhalb der Malerei zur Sorge führt und außerhalb der Malerei eine erstaunliche Karriere gemacht hat.46 Auch bei abgeblättertem Putz oder kriegszerstörten Ruinen handelt es sich in diesem Sinne um obliterierte Wände, Gebäude und verlassene Städte. Bis hin zu Geisterstädten reicht die Imagination von Szenarien, in denen sich die Natur kulturelle Artefakte wieder zurückerobert hat und ein nostalgisches Amalgam von Natur und Kultur abgibt.47 Der restauratorische und denkmalpflegerische Umgang mit solchen Abnutzungen wird kontrovers debattiert, wobei es dabei im Wesentlichen um den Umgang mit dem kulturellen Gedächtnis geht.48 Die Obliteration wird hier zum Zahn der Zeit, der „am Leiden der Materie auf ihrem Weg durch die Geschichte“49 mitwirkt, am Mörtel nagt und prunkvolle Farben erblassen lässt.
1.1.3Widerstehen
Die einzige Quelle, die die Obliteration explizit im Sinne ihrer dritten Bedeutung, des Hindernisses und des Widerstands, als Fachbegriff einsetzt, ist die Medizin: Dort bezeichnet Obliteration eine Verwachsung, verknotete Blutgefäße, Gefäßverstopfungen oder gestörte Funktionsabläufe im Organismus durch Fremdkörper, was etwa durch eine Operation getilgt werden kann.50
Entgegen der dünnen Quellenlage zum widerständigen Aspekt der Obliteration, lassen sich aber in all den bereits genannten Beispielen Widerständigkeiten aufweisen. Im Falle der passiven Destruktion bei Patina und anderen Verfallsspuren handelt es sich um die Unumkehrbarkeit der Zeit. Die aktive Destruktion hat es mit materiellen Hindernissen zu tun: Körper, Landschaften und Dinge können nicht ohne Weiteres vernichtet werden. Es bedarf eines erheblichen logistischen Aufwands, um ihrer habhaft zu werden.51 Landschaften können unzugänglich, unwägbar, unübersichtlich und weitläufig sein. Dinge können unhandlich, ungeordnet und verborgen sein. Und Körper kommen in der Regel massenhaft vor, sind dezentral verteilt, können sich wehren, tarnen und verstecken.
Im Falle des Indizes etwa zeigt sich Widerständigkeit in der erst zu entziffernden Spur, die ein zu entschlüsselndes Geheimnis birgt. Sie gilt es, zu decodieren und im Kontext der vorhandenen Informationen zu interpretieren. Im Falle der ökonomischen Tilgung muss die Höhe des Geldbetrages zurückbezahlt und Fristen eingehalten werden, im Falle des Post- und Ticketsystems zudem die Briefmarke und das Ticket im Verbundsystem Gültigkeit besitzen. Im politischen Kontext bedarf es der Zugehörigkeit: ohne Zugehörigkeit gibt es keine politische Teilhabe. Bei Obliterationen im etymologischen Sinne hat man es also immer mit Formen von Widerständigkeit zu tun: mit Unumkehrbarem, Unhintergehbarem, Unsichtbarem, Unverständlichem, Unlesbarem, Ungültigem und Unzugehörigem.
*
Obliteration bezeichnet damit im etymologischen Sinne einen Prozess der schriftlichen Auslöschung, bei dem Spuren hinterlassen werden. Darüber hinaus zeigt sich aber in der Fach- und Alltagssprache ein breites Bedeutungspektrum. Es geht nun nicht darum, semantische Ursprünge geltend zu machen oder eine ,eigentliche Bedeutung‘ zu evozieren. Es geht vielmehr darum, einen Assoziationshorizont aufzuspannen, in dem Aspekte für die weitere Analyse angestimmt werden. Die Etymologie legt zwar nahe, dass die Obliteration an die Schrift als mediales Paradigma gebunden ist. Ihr Bedeutungsspektrum und Phänomenbereich geht aber weit über die Schrift hinaus. Damit ist das Spektrum an Phänomenen erweitert um Tilgungsphänomene im Allgemeinen, seien dies Tötungen von Menschen und ihr Vergessen, die Überwindung von Widerständigkeiten auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen, oder seien dies nicht-intendierte Verfallsformen. Beispielsweise haben die drei genannten Operationen der Obliteration eine räumliche und zeitliche Dimension, die sowohl in der Spur als auch im Prozesshaften deutlich wird. Während die Spur einer Obliteration von einem Ereignis in der Vergangenheit zeugt und in die Gegenwart hineinreicht, zeugt sie zugleich auch von einem Statuswechsel des obliterierten Objekts. Ich werde daher in den folgenden Kapiteln zeigen, dass die Obliteration von epistemologischer, ethischer, und politischer Relevanz ist. Im ersten Schritt diskutiere ich die künstlerischen Arbeiten von Sacha Sosno und zeige, dass der Obliteration noch andere Bedeutungen abzugewinnen sind, um schließlich deren medientheoretische Implikationen aufzuzeigen.
1.2Grand Oblitérateur: Sacha Sosno
Sacha Sosno hat seine künstlerische Praxis eng an die Obliteration geknüpft. Anstelle aber Sosno seinerseits einzig unter der Perspektive seines Werkes zu betrachten „als ob die Produktion eben jene die gesamte Aufmerksamkeit und Energie des Künstlers auf sich gezogen und darin erschöpft hätte […]“52, möchte ich hier vielmehr danach fragen, inwiefern die Obliteration über die Obliterationspraxis von Sosno hinausgeht. In der folgenden Darstellung greife ich in loser Folge einige biographische Knotenpunkte von Sosno auf, wobei es nicht um eine historische Erzählung geht, sondern um die Gründe, weshalb Leben und Obliteration häufig miteinander in Verbindung gebracht werden.
1.2.1Alexandre Sosnowsky
Sacha Sosno wurde als Alexandre Sosnowsky am 18. März 1937 in Riga, Lettland, geboren und entstammte einer Milliardärsfamilie.53 Stärker als die jüdische Identität der Familie wog das kommunistische Engagement des Vaters. In den Wirren des Zweiten Weltkrieges floh die Familie 1941 in die Schweiz,54 ließ sich 1945 in Nizza nieder und kaufte ein Apartment im Hôtel de Palais, indem auch der Maler Henri Matisse sein Atelier hatte.55 Um Sosno die Integration in Frankreich zu erleichtern, gaben die Eltern anstelle von Riga Marseille als seinen Geburtsort an.56 Als Kind lernte Sosno französisch, russisch, englisch, deutsch, spanisch und aufgrund der Kinderfrau auch etwas finnisch. Zuhause sprach man französisch.57 In frühester Kindheit erlebte Sosno also den Zerfall einer sozialen Ordnung und macht mehrere Verlusterfahrungen: Heimat, Freunde und Verwandte, Hab und Gut, Geld und mit der Zeit auch einige Sprachen.58
Unter dem Eindruck des Malstils von Henri Matisse plante Sosno ein Kunststudium, was der Vater strickt ablehnte („in der Familie gibt es keine Farbkleckser“)59. Sosno studierte von 1956–1958 in Paris an der Sciences Po Rechts- und Politikwissenschaften und war regelmäßiger Besucher der Cinématèque. In seinen filmkritischen Texten zeigt er, dass er mit der Nouvelle Vague, sowie mit den Diskussionen in den Cahiers du Cinéma um die ästhetischen Genrebrüche mit dem klassischen Hollywoodkino vertraut war.60
Nach seinem Studium kehrte er 1958 nach Nizza zurück und machte Bekanntschaft mit Yves Klein, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle und Armand Fernandez (Arman). Die monochromen Gemälde von Klein veranlassten Sosno dazu, einen Großteil seiner Malereien zu verbrennen, von denen nur wenige die Flammen durch die rettende Hand seiner Mutter überlebten.61 Mit der Gründung der Zeitschrift Sud Communications im Jahre 1961 verfolgte Sosno ein journalistisches Interesse, schrieb über die École de Nice und realisierte mehrere Kurzfilme.62 Während der Zeit seines Militärdienstes 1962 in Toulouse, fand er auf dem Gelände der Kaserne eine Ansammlung galloromanischer Gräber und half bei der archäologischen Arbeit.63 1963 kehrt er nach Paris zurück und wird Pressefotograf.
Von 1965 bis 1969 arbeitet Sosno als Reportagefotograf in verschiedenen Krisengebieten der Welt. Er dokumentiert den Nordirlandkonflikt, Armut in Bangladesh und die Hungersnot in Biafra, wo er Zeuge von Kriegsopfern und hungernden Kindern wird, aber auch vom Willen der Lokalbevölkerung beeindruckt ist, „unter dieser Todesgefahr“64 ein alltägliches Leben zu leben. 1969 publiziert Sosno seine Fotografien aus Biafra als Teil eines Bildessayband.65
1971 fertigt Sosno seine ersten Obliterationsarbeiten an, indem er Teile seiner Fotografien aus Biafra übermalt. Er obliteriert auch seinen Namen: Von nun an tritt er nicht mehr unter seinem bürgerlichen Namen Alexandre Sosnowsky in Erscheinung, sondern mit seinem Kürzel Sosno. Auch seine Künstlerfreunde Armand Pierre Fernandez (Arman) und César Baldacchini (César) hatten es so gehalten. Im Jahre 1972 und 1973 fotografiert Sosno deutsche Konzentrationslager und widmet sich Motiven der Kunstgeschichte. Anfang der 1970er Jahre nimmt er an der Wanderausstellung L’Art Vidéo teil, in dessen Fahrwasser der Kunstkritiker Bernard Teyssèdre die L’Art Sociologique ausruft. Nach ersten Einzelausstellungen in Nizza und San Remo hatte Sosno 1974 seine erste Einzelausstellung in Paris (Galerie Mony Calatchi)66 und druckte im Ausstellungskatalog einen Auszug aus Umberto Ecos Zu einer Semiotik des visuellen Codes.67
Von Sommer 1976 bis Oktober 1979 überquert Sosno gemeinsam mit seiner Frau Mascha auf einem Segelboot den Atlantik bis nach Venezuela, wo sie auf verschiedenen Inseln die meiste Zeit verbringen. In Caracas verkauft Sosno alle seine Bilder, und fasst den Entschluss Skulpturen anzufertigen.68 Neben seinen Erlebnissen in Biafra bezeichnet Sosno diese Segelreise als weiteren großen Einschnitt in seinem Leben.69 Unfähig nach ihrer Rückkehr in einer Großstadt wie Paris zu leben, ziehen sie nach Nizza. Von ihren Künstlerfreunden fast vergessen, nimmt Mascha Sosno eine Arbeit als Modedesignerin auf und Sosno beginnt seine ersten Skulpturarbeiten. Zunächst widmet er sich noch in der Tradition des Nouveau Réalisme den Industrieobjekten, fertigt aber ab 1979 auf einer Reise nach Indien in Neu-Delhi seine ersten Bronze-Statuen.
1983 werden einige Bronzestatuen von Sosno im Musée des Beaux Arts Jules Chéret in Nizza gezeigt. Es folgen Ausstellungen in Nizza (1984) und New York (1985), sowie Reisen nach Lettland, Korea, China, Japan und Ägypten. 1988 werden zwei 26 Meter hohe Statuen in das Élysee-Palace Hotel in Nizza verbaut, er trifft durch Vermittlung von Françoise Armengaud in Paris Emmanuel Levinas und heiratet im gleichen Jahr Mascha Sosno. Sosno interessiert sich immer mehr für die Verbindung von Architektur und Skulptur und entwickelt die „bewohnbare oder bewohnte Skulptur.“70 Die bekannteste Arbeit La Tête Carée entsteht 2002 neben dem Musée d’art moderne et d’art contemporain, beherbergt die Arbeitsräume für die Administration der städtischen Zentralbibliothek Louis Nucéra und ist gesäumt von einem Skulpturengarten, für den Sosno Namensgeber wird (Jardin Sacha Sosno). 2013 stirbt Sosno an einem Herzinfarkt in Monaco. Posthum eröffnet seine Frau 2015 Le Guetteur, eine 22 Meter hohe bewohnbare Skulptur, die die administrativen Räume für ein Shopping-Center in Cagnes-sur-Mer, einem Nachbarort von Nizza, beherbergt. Armengaud bezeichnet Sosno etwas scherzhaft als „Grand Oblitérateur“71 und nimmt damit sowohl Bezug auf die immer größer werdenden Obliterationsarbeiten als auch auf ihre facettenreichen Bedeutungen.
1.2.2Genese der Obliteration
Wie Sosno dazu kam, seine künstlerische Praxis 1971 mit dem Begriff der Obliteration zu benennen, ist bisher weder von der Kunstkritik noch von den philosophischen Kommentaren herausgearbeitet worden. In den anekdotischen Darstellungen scheint es fast so, als ob der Begriff sich gleichfalls wie die Praxis „gedankenverloren“72 eingestellt habe. Auch wenn die Quellen sich im Falle von Sosno zur Heirat von Praxis und Konzept ausschweigen, ist es aber dennoch möglich, neben Spekulationen auch gute Grunde dafür anzuführen, weshalb Sosno auf „die Geste der Streichung und das Visuelle des Verbergens“73 so sensibel reagierte und sich für ihn der Begriff der Obliteration aufdrängte.
a. Das Leben ist schöner als alles
Sosnos Leben und Werk sind eng mit dem Nouveau Réalisme und insbesondere der École de Nice verbunden. Darin spielte er jedoch eine besondere Rolle: Neben Claude Rivière und Pierre Restany war er einer der ersten Kunstkritiker, der bereits 1961 über die École de Nice geschrieben hat.74 Erst zehn Jahre später wird er selbst künstlerisch aktiv. Die École de Nice hatte weder eine Theorie, noch gemeinsame Prinzipien oder eine Ideologie, sondern ist vielmehr zu verstehen als lose Gemeinschaft talentierter Künstler:innen am gleichen Ort.75 Es war der Kunstkritiker Pierre Restany, der in drei Manifesten zwischen 1960 und 1963 diese Künstler:innen als Nouveau Réalistes bezeichnet hatte. Darunter verstand er das konkrete Eingreifen der Künstler:innen in die Wirklichkeit um die „Verbreitung der Empfindsamkeit jenseits der logischen Grenzen seiner Wahrnehmung“76 zu erreichen. Sosno beschreibt die ästhetische Ausrichtung der Nouveau Réalistes etwas konkreter: Künstler wie Arman und Jean Tinguely wandten sich den ausrangierten Objekten zu und orientierten sich dabei an den Dadaisten, insbesondere Kurt Schwitters, Hans Arp und Francis Picabia.77 Ausgediente Möbel, ausrangierte Autos und andere Gerätschaften wurden zu Skulpturen arrangiert oder – wie im Falle von César – der Schrottpresse übergeben. Die Affichisten rissen übereinander geschichtete Plakate von den Hauswänden, um auf diese Weise eine spontane Form entstehen zu lassen. Mit solchen Décollages distanzieren sie sich vom Akt des Malens und Klebens.
Damit tritt Kunst als radikaler Gestus des anno zero auf im „Klima kultureller Unter-Information der Nachkriegszeit.“78 All diesen ästhetischen Praktiken wohnt ein destruktives oder autodestruktives Element inne, das sich sowohl gegen eine klassische Auffassung einer Kunst des Wahren, Guten, Schönen richtet, wie gegen das Werkhafte der Kunst. Jean Tinguely etwa baute aus Metallschrott eine autodestruktive Skulptur, die im Museum of Modern Art in New York sich selbst zugrunde richtete.79
Es stellt damit eine Art sich selbst obliterierende Maschine dar: nutzlos kannibalisiert sie sich selbst. Hingegen weisen die Décollages





























