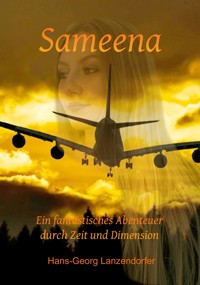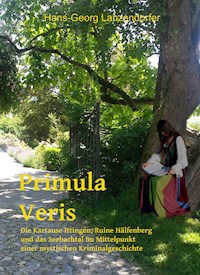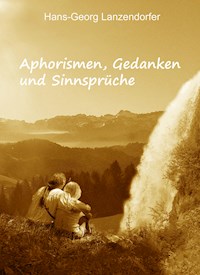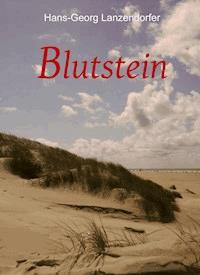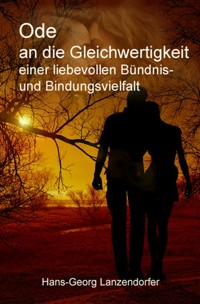
Ode an die Gleichwertigkeit einer liebevollen Bündnis- und Bindungsvielfalt E-Book
Hans-Georg Lanzendorfer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Männer und Frauen, als die offensichtlichste und naturgegebene Geschlechtsunterscheidung, haben sich seit Menschengedenken geliebt und umgarnt. Andernfalls wären sie bereits vor Jahrthundertausenden ausgestorben. Die unnatürliche Feindschaft zwischen den Geschlechtern beruht tragischerweise auf der Überheblichkeit und der unbeschreiblichen Vermessenheit eines gut durchdachten, organisierten und perfekt orchestrierten menschlich-ideologischen Irrtums. Dies zeigt sich in der stark zweifelhaften männlichen Ansicht, dass das Weib und der Mann von unterschiedlicher Wertigkeit sei. Diese Überzeugung wurde perfekt kultiviert und im Denken der Menschen verankert, insbesondere mit dem allmählichen Aufkommen der christlichen Kultreligion vor etwa 1800 Jahren. Zweifellos obsiegen seither letztendlich auch die liebevollen Gefühle füreinander. Zumindest, solange sie nicht mehr im Strohfeuer der «(Ver)liebtheit» brennen, die anfängliche Glut noch nicht erkaltet ist, weder apodiktischen Prinzipien geopfert wurden und entgegen aller Widrigkeiten liebevoll gewachsen sind. In bestmöglicher Form wandelt sich die einstige «(Ver)liebtheit» in ein zeitlebens beständiges und dauerhaftes Liebesverhältnis. Bereits 1792 schrieb die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft in ihrem Buch «Verteidigung der Rechte der Frau» (1792) zu dieser Thematik: Indem sie über das eheliche Glück hinausschaut, sichert sie sich die Achtung ihres Mannes, bevor es nötig ist, gemeine Künste anzuwenden, um ihm zu gefallen und eine sterbende Flamme zu nähren, die von Natur aus zum Erlöschen verurteilt ist, wenn das Objekt vertraut wird, wenn Freundschaft und Nachsicht an die Stelle einer glühenden Zuneigung treten. Dies ist der natürliche Tod der Liebe. Die Menschen sind gefühls- und empfindungsorientierte Wesen. All ihr Bestreben liegt in der Befriedigung und Erreichung einer andauernden und endlos glücklichen inneren und äusseren psychischen Wohlbefindlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Georg Lanzendorfer
Ode an die Gleichwertigkeit einer
liebevollen Bündnis- und Bindungsvielfalt
Hans-Georg Lanzendorfer
Ode an die
Gleichwertigkeit einer
liebevollen Bündnis- und Bindungsvielfalt
Gedanken über gefühlvolle, monogame, polygyne, polyandrische und polyamore, gleich- und gegengeschlechtliche
Beziehungsformen. Die Gleichwertigkeit des «Weiblichen» und «Männlichen» sowie
von Menschen jeglichen «gefühlten»Geschlechts
Eine philosophisch-soziologische Betrachtung
Impressum
Texte: © 2025 Copyright
Hans-Georg Lanzendorfer
Umschlag: © 2025 Copyright
Hans-Georg Lanzendorfer
Verantwortlich für den Inhalt:
Hans-Georg Lanzendorfer
Schweiz
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorwort
Einleitung
«biologische» und «gefühlte» Geschlechter
Eine kurze Erläuterung zur deutschen Sprache
Etymologische Bedeutungen
«Wahrheit» ist eine relative und subjektive Interpretation - auch die vorliegende!
KAPITEL 1
Liebesdimensionen und Verhaltensweisen
… über die «Liebe» und das «(Ver)liebtsein»
… über die Selbstwirksamkeit
… über die bedingungslose «Gleichwertigkeit» der Menschen jeglichen Geschlechts
… über die Gleichwertigkeit der Geschlechter im Kontext von Religion und Glaubenssystemen - Eine kritische Betrachtung
KAPITEL 2
Essenz des Menschseins
… die «Kraft der Psyche und Gedanken»
… über die «Seele» und «Psyche»
… über die Herausforderungen der Psyche
… eine Ode an den menschlichen Körper
KAPITEL 3
Sexualität, Ipsation, Selbstbefriedigung, Masturbation und Onanie
… über die Wichtigkeit der autoerotischen Erfahrungen zur Psyche-Hygiene
… über die Vielfalt des Sexuellen
… über die Geschichte der Prostitution
KAPITEL 4
Lesbianismus, männliche Homosexualität und Bisexualität
... über die «virile» Homosexualität
… über den weiblichen Lesbianismus
KAPITEL 5
… über das Wunder der Weiblichkeit
… geschichtliches zum «Schossraum/Vulva»
...über die weibliche Schönheit
Sexiest Weib
KAPITEL 6
… über die Männlichkeit
Der geheilte Mann
KAPITEL 7
Zuwendungen in Partnerschaften
KAPITEL 8
Liebevolle Bündnis- und Bindungsformen
… über die Komplexität von Liebe und Treue
… über die Polyamorie, Polyandrie, Polygamie, Polygynie etc.
… über die Komplexität der Polyamorie
… auf ein Wort zur Platonie-Liebe
KAPITEL 9
… auf ein letztes Wort zur «Tugend»
Schlusswort
Anhang
Berühmte Pionierinnen 1646 bis 2007
Vorwort
Werte Leserschaft
Dieses Buch ist ein elysisches Raumschiff auf Entdeckungsreise, welches eine Welt beschreibt, deren Erkundung möglicherweise noch Jahrhunderte benötigt.
Die ersten Zeilen meines siebten Werkes entstanden bereits im Jahr 2007, während ich noch Mitglied der «Freien Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien» in Hinterschmidrüti war. Ursprünglich stellte es eine umfassende Sammlung meiner Notizen und Texte zur Pflege sowie zu den Umgangsformen in gefühlvollen Liebesbeziehungen dar. Zu diesem Zeitpunkt wurden von mir bereits mehrere Artikel und Texte über die Gleichwertigkeit der Geschlechter und die Vielfalt von Beziehungen veröffentlicht. Zudem verfasste ich 2004 einen offenen Brief an den damaligen Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien in den USA, Arnold Schwarzenegger, in dem ich die Legalisierung und die Gleichwertigkeit gleichgeschlechtlicher Beziehungen thematisierte. Als «Mann» mittleren Alters, geboren 1962, der bereits mehrere gescheiterte Partnerschaften hinter sich hat, erschien es mir lange Zeit als ein grosser Hohn, ein Buch zu diesem Thema zu verfassen. Mittlerweile sind jedoch einige weitere Werke aus meiner Feder entstanden: eine Biografie im Jahr 2001, ein Buch über philosophische Lehren aus dem Jahr 2006, ein Werk mit meinen eigenen Aphorismen und Sinnsprüchen aus dem Jahr 2018 sowie bisher drei Romane, die zwischen 2017 und 2021 veröffentlicht wurden. Das Leben ist ein ständiger Prozess der Veränderung und Bewegung. Viele unterschiedliche Menschen haben mich auf kurzen oder langen Wegen begleitet, sind jedoch irgendwann wieder in ihre eigenen Richtungen abgebogen. Nachdem ich im Herbst 2024 meine zahlreichen und unveröffentlichten Texte durchgesehen hatte, verspürte ich den starken Drang, dieses vorliegende Werk über die «Gleichwertigkeit aller Menschen und Geschlechter» endlich zu beenden. Es hat sich langsam, aber stetig entwickelt, an vielen Wochenenden, Abenden, auf meinem Arbeitsweg im Zug oder während beruflicher Pausen. Ich hätte mir gewünscht, Mary Wollstonecraft (1759–1797), die britische Schriftstellerin und Philosophin, beratend an meiner Seite zu haben. Mit ihrem bemerkenswerten Werk «Verteidigung der Rechte der Frau» hat sie bereits vor rund 250 Jahren grossen Mut bewiesen. Ihre Geschichte, ihre Texte und ihr unermüdlicher Einsatz für die «Gleichwertigkeit» der Geschlechter haben mich tief berührt und waren letztlich der Anstoss sowie die Initialzündung, dieses Werk zu Ehren ihrer Person zu vollenden. Was nun vor euch/Ihnen liegt, ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Es liegt nicht an mir, zu entscheiden, ob es von gutem Wert ist. Es erhebt jedoch keinen Anspruch auf Perfektion, sondern spiegelt meine Gesinnung und Haltung zur «Gleichwertigkeit einer liebevollen Bündnis- und Bindungsvielfalt» wider sowie den aktuellen Stand meines Könnens und Vermögens.
Hans-Georg Lanzendorfer
im Frühjahr 2025
Einleitung
«Dieses Werk basiert auf über drei Jahrzehnten sozialpädagogischen und psychiatrischen Erfahrungswissens, Erkenntnissen und Einsichten über die Psychologie unserer menschlichen Existenz. Es entstand auch auf der Basis meiner langjährigen Mitgliedschaft im Verein FIGU, der «Freien Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien».
Aus persönlichen Gründen habe ich den Verein im Jahr 2016 nach rund drei Jahrzehnten verlassen. Dennoch habe ich die einzigartigen Werke, Aufgaben und die Bedeutung der Vereinsarbeit bis heute nie in Frage gestellt.
Im achten Kapitel bringe ich diesem Vermächtnis meinen Respekt entgegen, indem ich einen kurzen Beitrag zur «Platonischen Liebe» präsentiere, der aus dieser Quelle stammt und unbedingt in dieses Buch aufgenommen werden sollte.
Mein doch etwas umfangreich geratenes Werk erhebt keinerlei dogmatischen oder wissenschaftlichen Anspruch auf eine sogenannte «wahrliche Wahrheit». Obschon vereinzelte Belange durch meine Belesenheit tiefgründig recherchiert oder bestätigt sind, kann infolge von Nichtverwendung von Zitierungen auf diesbezügliche Quellenangaben und Buchhinweise verzichtet – jedoch darauf hingewiesen werden.
Empirische Studien zu diversen meiner Aussagen sind mittlerweile von einer wertvollen und zahlreichen Autorenschaft in Buchform zu finden und daher für die Leserschaft überprüfbar. Meine Aussagen spiegeln nach bestem Können und Vermögen die gegenwärtige Summe all meines lebenslang erlangten Wissens, Erfahrungen und Fachkenntnisse wider. Sie dienen als reiner Denkanstoss für alle suchenden, forschenden und lebensinteressierten Menschen jeglichen Geschlechts auf diesem wundervollen Planeten Erde (Terra).
Es mag sein, dass mein Buch für die Eine oder den Anderen etwas zu lang geraten ist. Selbstredend kann es jederzeit beiseite gelegt und während der kommenden 30 Jahre gelesen werden.
Aus meiner persönlichen Sicht jedoch immer begleitet von einer harmonischen und klangvoll schönen Musik.
Das menschliche Leben und die vielfältigen Formen von Beziehungen, sei es gleich- oder gegengeschlechtlich, gefühlsorientiert, monogam, polygyn, polyandrisch oder polyamor, lassen sich nun einmal nicht mit wenigen Worten zusammenfassen.
Es ist nachvollziehbar, dass meine Sprache und Schriftform für manche befremdlich oder eigenartig wirken. Dennoch ist es mir in sprachlicher Hinsicht von grosser Bedeutung, alte Begriffe unserer traditionsreichen deutschen Ausdrucksweise wieder ans Licht zu bringen und zu verwenden.
Kein anderer Lebensbereich umtreibt die Menschen jeglichen Geschlechts intensiver als gute, harmonische, verbindliche, beständige und gefühlsorientierte Beziehungsformen und Bindungen in einem gleich- oder gegengeschlechtlichen Liebesverhältnis. Stabile Gemeinschaften und tiefgründige Freundschaften verlängern und bereichern zweifellos das menschliche Leben. Die wichtigste Studie hierüber bietet das Leben selbst. Zumindest für diejenigen Menschen, die bereit sind, den Konflikten, Disharmonien und Streitigkeiten, reflektiert und mit einer gewaltsamem Gewaltlosigkeit, weisen Klugheit sowie einem gesunden Vernunfts- und Verstandesdenken zu begegnen.
Dennoch prägen alltägliche Konflikte, Schwierigkeiten, Probleme und Unannehmlichkeiten den Alltag der Menschheit. Wo sich Menschen begegnen, in Gemeinschaften binden ist auch die Konfrontation nicht weit.
In jede liebe- und gefühlvolle, harmonische und bindende Lebensgemeinschaft gehört auch die konstruktive Auseinandersetzung und Interaktion zur wachsenden Beziehungspflege. Das ist selbst auf diesem Erdplaneten weder ein ausserirdisches Phänomen, noch ein neu zu entdeckendes Geheimnis.
Gleichsam zweier sich nahe stehender Geschwister, prägen auch die beiden Begriffe «Konkurrenz» und «Kongruenz» auf den ersten Blick eine seltsame Symbiose. Sie sind dennoch von absoluter Gegensätzlichkeit. Die «Konkurrenz» bezieht sich auf Wettbewerb und Rivalität, während «Kongruenz» die Übereinstimmung oder Harmonie zwischen Elementen beschreibt.
Leider begegnen sich die Menschen zu oft in einer latenten «Konkurrenz». Dennoch erwächst aus dem Gegensätzlichen auch das Neue. Menschen teilen sich ihre Gefühle, Eindrücke, Meinungen, Ansichten und Haltungen. Seit vielen Jahrhunderten setzt sich jedoch in einem bösartigen und intriganten Wettstreit die «Konkurrenz» über die «Kongruenz», was zu einem bedauerlichen Schauspiel der Unterdrückung und Abwertung des weiblichen Geschlechts durch ein allmählich schwindendes Patriarchat führt. Vielfach legitimiert durch die vermeintliche Überlegenheit des Mannes.
In Tat und Wahrheit jedoch auf der Basis einer längst überholten Autorisation durch althergebrachte Kultreligionen sowie weiberfeindliche und machistische Ideologien.
Demgegenüber kämpft das «Weib/Frau» seit rund dreitausend Jahren für die Gerechtigkeit gegen die männliche Dominanz.
Ganz bewusst wurde von mir infolge einer massiven Verkomplizierung auf die modernen Genderzeichen* verzichtet und die herkömmliche Schreibweise verwendet.
Sofern in meinem Buch nicht ausdrücklich auf das Weib/Frau oder den Mann verwiesen ist, wird der geschlechtsneutrale und ehrwürdige Begriff «Mensch» grundsätzlich für Personen jeglichen Geschlechts verwendet.
Männer und Frauen, als die offensichtlichste und naturgegebene Geschlechtsunterscheidung, haben sich seit Menschengedenken geliebt und umgarnt. Andernfalls wären sie bereits vor Jahrthundertausenden ausgestorben. Die unnatürliche Feindschaft zwischen den Geschlechtern beruht tragischerweise auf der Überheblichkeit und der unbeschreiblichen Vermessenheit eines gut durchdachten, organisierten und perfekt orchestrierten menschlich-ideologischen Irrtums. Dies zeigt sich in der stark zweifelhaften männlichen Ansicht, dass das Weib und der Mann von unterschiedlicher Wertigkeit sei. Diese Überzeugung wurde perfekt kultiviert und im Denken der Menschen verankert, insbesondere mit dem allmählichen Aufkommen der christlichen Kultreligion vor etwa 1800 Jahren.
Zweifellos obsiegen seither letztendlich auch die liebevollen Gefühle füreinander. Zumindest, solange sie nicht mehr im Strohfeuer der «(Ver)liebtheit» brennen, die anfängliche Glut noch nicht erkaltet ist, weder apodiktischen Prinzipien geopfert wurden und entgegen aller Widrigkeiten liebevoll gewachsen sind.
In bestmöglicher Form wandelt sich die einstige «(Ver)liebtheit» in ein zeitlebens beständiges und dauerhaftes Liebesverhältnis. Bereits 1792 schrieb die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft in ihrem Buch «Verteidigung der Rechte der Frau» (1792) zu dieser Thematik: Indem sie über das eheliche Glück hinausschaut, sichert sie sich die Achtung ihres Mannes, bevor es nötig ist, gemeine Künste anzuwenden, um ihm zu gefallen und eine sterbende Flamme zu nähren, die von Natur aus zum Erlöschen verurteilt ist, wenn das Objekt vertraut wird, wenn Freundschaft und Nachsicht an die Stelle einer glühenden Zuneigung treten. Dies ist der natürliche Tod der Liebe.
Die Menschen sind gefühls- und empfindungsorientierte Wesen. All ihr Bestreben liegt in der Befriedigung und Erreichung einer andauernden und endlos glücklichen inneren und äusseren psychischen Wohlbefindlichkeit. Das Streben nach einer zwischenmenschlichen Bindung und Nähe zu einem geliebten Menschen liegt daher in der tiefsten Natur unserer ureigenen Persönlichkeit. Selbst dann, wenn dieses Bedürfnis und die jeweiligen Gefühle vordergründig von entgegengesetzten Prioritäten kaschiert, verneint oder gewaltsam durch eigene und selbst auferlegte Zwänge, Ideologien sowie kultreligiöse oder sektiererische Dogmen unterdrückt werden.
Letztendlich sind Menschen soziale Wesen. Selbst im Einsiedlertum werden und wurden kompensatorisch, sakrale, vermeintlich heilige oder sogenannte spiritistische Bindungen zu imaginären Wesen, Gottheiten, Heiligen, Naturgeister oder die Einheit mit der schöpferischen Natur gesucht.
Entgegen der eingefleischten Verherrlichung des kultreligiösen Eremitentums und deren angebliche visionäre Erfahrungen sprechen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zur Einsamkeit eine andere Sprache. Deren Ergebnisse sind schockierend. Wer sich dauerhaft einsam fühlt, erhöht sein Sterberisiko um 26 Prozent. Sozial isoliert, steigt es auf 29 Prozent. Bei Menschen, die permanent alleine leben, können 32 Prozent erreicht werden.
Leider ist der wahrliche psychische Zustand vieler sogenannten «Heiligen» der Vergangenheit nicht mehr empirisch überprüfbar. Manche Überlieferungen lassen aus heutiger Sicht jedoch eine gewisse Psychopathologie nicht mehr ausschliessen, die infolge fehlender Sozialkontakte entstanden sein könnte.
Sanfte Berührungen, der Austausch von Zärtlichkeiten, eine harmonische und erlebbare Nähe und Wärme, erwiderte Liebesbekundungen, körperliche und/oder gefühlvolle Bindungen zu Menschen jeglichen Geschlechts sind wesentliche Faktoren zur Gestaltung und Erquickung der eigenen psychischen, gefühls-, physischen, mentalen und bewusstseinsmässigen Gesundheit. Unabhängig davon, ob es sich dabei um eine gleich-, gegengeschlechtliche oder zwischengeschlechtliche Bindung zu einem oder mehreren Menschen handelt.
Das Gefühlsleben, das Spüren und Erfühlen sowie Empfindungen usw. gehören zu den wesentlichen Grundlagen unserer Handlungen und Entscheidungen. In unserer schnelllebigen modernen Welt gewinnen die ursprünglich sozialen und kreativen Werte allmählich wieder an Bedeutung. Gleichzeitig treten die traditionellen, moralisierenden und angstverbreitenden Lehren der Religionsgemeinschaften zunehmend in den Hintergrund, was letztlich dem Wohl der gesamten Menschheit dient.
«biologische» und «gefühlte»Geschlechter
Es gibt nur ZWEI «biologische» Geschlechter, so nämlich das WEIBLICHE und das MÄNNLICHE. Bereits 1735 hat der Naturforscher Carl von Linné (*23. Mai 1707, † 10. Januar 1778) den Begriff des «Sexus» in die wissenschaftliche Literatur eingebracht. So nämlich die «binäre Geschlechterordnung» oder «binäre Geschlechtsidentität».
Ende 1741 wurde von Linné Professor an der Universität Uppsala und neun Jahre später deren Rektor. In Uppsala führte er seine enzyklopädischen Anstrengungen weiter. Seine beiden Werke «Species Plantarum» (1753) und «Systema Naturæ» begründeten die bis heute verwendete wissenschaftliche Nomenklatur (Bezeichnung- oder Benennungssystem) in der Botanik und der Zoologie.
Der «Sexus» bezieht sich auf das «biologische» Geschlecht, so also auf das «weibliche» und «männliche». «Männliche» Individuen werden evolutionsbiologisch definiert als «Spermienproduzenten». «Weibliche Individuen» sind biologisch definiert als «Eizellen Bereitstellerinnen mit Gebärfunktion».
Seit den wissenschaftlichen Untersuchungen durch Carl von Linné ist es in den vergangenen 300 Jahren keinem Biologen gelungen, ausserhalb der «weiblichen und männlichen Gameten», eine dritte «Gametenform» zu finden. Somit sind bis heute keine Mischformen aus männlichen Spermien und weiblichen Eizellen bekannt.
Unter der Bezeichnung «SEX» wird in der Biologie seit rund 200 Jahren der «Befruchtungsvorgang» zwischen der Eizelle und dem Spermium verstanden und definiert. Vielfach wird die Erotik und das sexusbiologische Geschlecht miteinander verwechselt. Aus einer erotischen Handlung kann durch den sexuellen Akt neues Leben entstehen, es ist aber keine Notwendigkeit. Bis heute existiert jedoch in Tat und Wahrheit keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass ausserhalb der beiden biologischen Geschlechter des «WEIBLICH» und «MÄNNLICH» ein drittes Geschlecht nachzuweisen ist. Aus biologischer Sicht existieren jedoch überprüfbar tausende wissenschaftliche Studien und Abhandlungen über die Existenz der beiden genannten Geschlechtsformen. In der Evolutionsforschung spielt der «biologische» Begriff «Gender» eine wichtige Rolle. In wissenschaftlichen Kreisen wird daher die politische und pseudowissenschaftliche Behauptung, dass mehr als zwei Geschlechter existieren, als «vor darwinistischer» Aberglaube bezeichnet.
Wie erklärt, wird «Sexus» als biologisches Geschlecht definiert, «Sex» hingegen als der «Befruchtungsvorgang». Oscar Wilhelm August Hertwig, (*21. April 1849, † 25. Oktober 1922), war ein deutscher Anatom, Zoologe und Entwicklungsbiologe. Während einer Reise von 1875 beobachtete er erstmals am nahezu durchsichtigen Seeigel-Ei in seinen einzelnen Stadien unter dem Mikroskop die Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch eine männliche Samenzelle. Wofür er letztendlich Berühmtheit erlangte. Im Jahr 1955 führte John Money, ein neuseeländischer Psychologe und Sexualwissenschaftler (1921 - 2006) die Begriffe «gender identity» (Geschlechtsidentität) und «gender role» (Geschlechterrolle) ein. Somit eine Mischform des Genderismus, um die Diskrepanz zwischen einem «erwarteten» und «tatsächlichen» Verhalten bei Intersexuellen oder transsexuellen Menschen zu beschreiben.
John Money definierte dadurch das sehr umstrittene Model des «psychosozialen Geschlechts des Menschen», bzw. die Möglichkeit, «gefühlt», entweder «weiblich» oder «männlich» zu sein.
Aus biologischer und wissenschaftlicher Sicht stimmen jedoch bei 99% der Menschen das «biologische» und «gefühlte», bzw. der «Sexus» und «Gender» Geschlecht der Menschen überein. Gemäss der Wissenschaft besteht jedoch bei einer sehr kleinen Minderheit eine sogenannte «Genderdysphorie». Diese bezeichnet das Unbehagen oder die Unzufriedenheit mit jenem Geschlecht, welches dem Menschen bei seiner Geburt zugewiesen wurde. Menschen mit einer echten «Genderdysphorie» haben dadurch das Gefühl, dass ihr Körper oder die gesellschaftlichen Erwartungen an ihr Geschlecht nicht zu ihrer eigenen Identität passen. Dies kann zu psychologischen und gefühlsmässigen Belastungen führen. Die echte «Genderdysphorie» tritt weit vor der Pubertät eines Jugendlichen beiderlei Geschlechts auf und ist eine anerkannte medizinische und psychologische Diagnose. Das ROGD-Phänomen, oder «Rapid Onset Gender Dysphoria», bezieht sich jedoch auf die Beobachtung, dass Jugendliche plötzlich und in relativ kurzer Zeit eine «unechte» und «gefühlte» Geschlechtsdysphorie entwickeln. Dieses Phänomen steht insbesondere im Zusammenhang mit sozialen und kulturellen Einflüssen, welche die Identitätsfindung von Jugendlichen stark beeinflussen und stören können.
Der heutige Genderismus basiert jedoch überwiegend auf den sehr umstrittenen Definitionen und Arbeiten des Psychologen John Money, welche besagen, dass die gefühlte Geschlechtlichkeit variabel sei. Aus biologisch-wissenschaftlicher Sicht wird diese Theorie nicht bestätigt und als psychologische Ideologie betrachtet. Dies aus jenem Grund, weil bei über 99% der Menschen der «Sexus» bzw. das «biologische» Geschlecht mit dem «Gender», bzw. dem «gefühlten» Geschlecht überein stimmen.
In unserer gegenwärtigen Gesellschaft wird der «Genderismus» als eine latente Ideologie und ein Modekult in die breite Öffentlichkeit getragen, was zu einer starken Orientierungslosigkeit bezüglich der Geschlechterzugehörigkeit führt. Diese Tatsache ist aus «entwicklungspsychologischer» Sicht höchst fragwürdig, wenn an Schulen den Kindern und Jugendlichen ihre eigene Geschlechtlichkeit als zweifelhaft gelehrt wird. Kinder haben jedoch ein natürliches Verständnis dafür, dass der «Sexus», so also das «biologische» Geschlecht, mit dem «gefühlten» Geschlecht, bzw. dem Gender übereinstimmen. Die Wissenschaft warnt eindeutig vor den gesellschaftlichen Folgen dieser politischen «Unkenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen» innerhalb der «Gender-Bewegung». Sie setzt auf Aufklärung gegen den sogenannten «Trans-Gender-Modekult»
Eine kurze Erläuterung zur deutschen Sprache
Die deutsche Sprache ist zweifellos ein äusserst umfangreiches und beispielloses Werkzeug. Mit ihrem wortgewaltigen Fundus an Begriffen bietet sie die Möglichkeit, ungeahnte und kleinste Unterscheidungsmerkmale minutiös zu definieren und zu beschreiben. Ein bedenkenswertes und interessantes Beispiel findet sich in der Verwendung des alten Wortwertes «Weib» für den neuzeitlichen Begriff «Frau». Im Gegensatz zu der gängigen Auffassung hat der Begriff «Weib» jedoch keinen kultreligiösen Bezug. Tatsächlich hat dieses Wort eine viel ältere, respektvolle und ehrwürdige Herkunft.
Diese Betrachtung ist besonders in der heutigen Zeit, in welcher der «Genderdiskurs» oft unbeholfen wirkt, von grosser Bedeutung. Sie steht im Kontrast zu den sozialen, gesellschaftlich geprägten und individuell erlernten Geschlechterrollen.
In Anbetracht der berechtigten Forderung nach «Emanzipation» und Gleichberechtigung empfiehlt es sich ebenfalls, jene altehrwürdigen Begriffe und Zusammenhänge näher zu betrachten, mit denen geschlechtsspezifische Belange beschrieben und determiniert werden. Es gilt daher auch, gewisse Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
Mit der sogenannten «Emanzenbewegung», welche im Volksmund überwiegend als abwertenden Begriff verstanden wird, hat sich in gewissen Kreisen eine Art Gegenkultur gegen die berechtigte Forderung zur Gleichwertigkeit und Gleichheit von Weib und Mann gebildet. Nicht wenige Frauen aus der genannten Bewegung haben es sich zum erklärten Ziel gesetzt, unter starkem Gegendruck das männliche Geschlecht in einem Geschlechterkampf mit seinen Mitteln und Waffen zu bekämpfen und zu beherrschen. Diese Haltung ist unter den gegebenen Voraussetzungen durchaus verständlich, jedoch ebenfalls nicht mehr zeitgemäss.
Seit Jahrtausenden wurde das weibliche Geschlecht durch das Patriarchat versklavt und unterdrückt. Das ist eine geschichtlich unwiderlegbare Tatsache. Gleichsam der Unterdrückung des Weiblichen durch den Mann, wird die Gleichwertigkeit, Gleichheit und Gleichberechtigung der Geschlechter, gegenwärtig durch sogenannte «Emanzen» - auch als «Kampflesben» beschimpfte «Gleichberechtigungskämpferinnen» leider mitunter in den Schmutz gestossen.
Druck erzeugt jedoch Gegendruck. Leider haben in der Vergangenheit besagte weibliche Kräfte in ihrer Wut diese männliche Unart instrumentalisiert und übernommen. Diese Entwicklung wird früher oder später keine guten Früchte tragen und tatsächlich in einem wortwörtlichen «Kampf der Geschlechter» enden.
Das «Weib» und der «Mann», werden letztendlich nur durch die «mutualistische» Symbiose ihrer Verschieden-Geschlechtlichkeit, die schöpferisch-naturgegebene Bestimmung der Gleichheit, Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit erreichen und erfüllen. In einem mutualistischen Verhältnis profitieren jegliche Partner voneinander. An dieser Stelle bedarf daher der altehrwürdige Wortwert «Weib» einer tiefgründigeren Erläuterung. Gemäss etymologischem Wörterbuch wird der Begriff «Weib» auf die alte indogermanische Verwendung des Begriffes «Ueib», zurückgeführt, was in der Übersetzung «die Wurzel» bedeutet. Dieser indogermanische Begriff «Ueib», die Wurzel, weist auf das Prinzip des «Gebärenden» hin. Das «Weib» verweist somit in tiefer Ehrwürdigkeit auf die Wurzel des Lebens, aus der nach einem Befruchtungsakt das Leben erwächst und aus der das Leben seine Nahrung bezieht.
Das «Weib» stellte somit im indogermanischen Sprachgebrauch die «Wurzel» oder die «Mutter» des neu kreierten und werdenden Lebens dar. Eine «Wurzel», welche die Frucht des neuen und heranwachsenden Lebens in sich trägt, es ernährt und wachsen lässt und bis zur Loslösung durch die Geburt, mit dieser Frucht, also dem noch embryonalen Wesen verbunden ist. Selbstredend sind diese ehrwürdigen weiblichen Werte bis zum heutigen Tag von uneingeschränkter Gültigkeit.
In Unkenntnis dieser Sachlage wurde die ehrwürdige alte Bezeichnung «Weib» in der heutigen Gegenwart zu einem üblen Schimpfwort degradiert. So sind unter anderem Begriffe wie «Fischweib, Hutzelweib, Klatschweib, Kuppelweib, Mannweib, Marktweib, Satansweib, Schandweib, Teufelsweib oder Waschweib» usw. zu finden, sowie im Weiteren auch die Bezeichnungen «Weibsbild, Weibsmensch, Weibsperson oder Weibstück» usw. welche in ihrer Verwendung auf eine Entwertung hinweisen. Im Grunde handelt es sich dabei um entwürdigende und abgeänderte Begriffe, welche den altehrwürdigen Wortwert «Weib» als das Gebärende und die «Hervorbringerin» neuen Lebens zu einer frivolen, vulgären und liederlichen Person und Schandfigur degradieren und ihrer eigentlichen Natur disqualifizieren.
Im Weiteren wurde die altehrwürdige Bezeichnung «Weib» im neueren Sprachgebrauch durch den Allerweltsbegriff «Frau» ausgewechselt und ersetzt. Ein relativ neues Wort, dessen wirkliche Bedeutung vielen Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr geläufig ist. Selbst in den meisten Nachschlagewerken der jüngsten Zeit werden diese beiden Begriffe «Frau» und «Weib», einer und derselben Bedeutung zugeordnet.
Seinen eigentlichen Ursprung hat der Begriff «Frau» jedoch in der altdeutschen Sprache. Die Bezeichnung «Frau» findet sich im Mittelhochdeutschen unter der Bezeichnung «fru» und «vrouwe», sowie im Weiteren auch im Althochdeutschen «frouwa». Es stellen die weiblichen Formen der althochdeutschen Bezeichnungen «fro», «frauja» oder «fron» in ihrer männlichen Benennung so viel wie «Herr» oder «Gebieter» dar.
Zudem weist laut Etymologie der Begriff «fra» eine gewisse Verwandtschaft zum Adjektiv «vorne», oder «die Vordere» oder «die Erste» auf. Somit bedeutet also der Begriff «Frau», «die Herrin» oder «die Gebieterin». Daraus leitet sich in Zusammensetzung auch der altbekannte Begriff des spätmittelhochdeutschen Wortes aus dem 15. Jahrhundert, «frouwenzimmer», also das heutige Wort «Frauenzimmer» ab. Der Begriff Frauenzimmer war gebräuchlich als Bezeichnung für das Gemach der Herrin oder der Edeldame, wobei deren Wohn- und Schlafräumlichkeiten eben als Frauenzimmer oder frouwenzimmer bezeichnet worden sind. Von diesem althochdeutschen Begriff «frouwe» oder auch «frouwa» wurde dann auch die heute gebräuchliche Form des «Fräulein» abgeleitet. Es war das «frouwelin», die kleine Herrin oder auch die vornehme junge Dame.
Als weiteres Beispiel existiert im Sprachgebrauch zum Wort «Fron» auch die Wortzusammensetzung «Frondienst». Der Frondienst, welcher als geschuldete Herrschaftsarbeit betrachtet wurde. In kultreligiöser Verwendung ist damit die Arbeit für den Herrn oder für den Besitz des Herrn oder die Arbeit am Besitz eines vermeintlich «Lieben Gottes» gemeint. Eine Tätigkeit oder ein Dienst, der ohne direkte materiell-monetäre Entlohnung verrichtet wurde und daher unentgeltlich erbracht werden musste. Um den Wert einzelner Begriffe genauer definieren und verstehen zu können, ist es in der Regel ratsam, den Ursprung der Wörter, bzw. deren Etymologie zu klären. Wird also in diesem vorliegenden Buch der Wortwert «Weib» anstelle von «Frau» verwendet, so ist damit das «Weib» als die ehrwürdige «Wurzel», «Hervorbringerin» und das «Gebärende» sowie die Hüterin und Beschützerin des Lebens angesprochen. Mit dieser Bezeichnung wird ganz offensichtlich die umsorgende Mutter, die Hausmutter oder in diesem Sinne auch die Ehegattin bezeichnet, welche in Wechselwirkung und in uneingeschränkter Gleichwertigkeit mit ihrem männlichen Gegenüber und in Gegenseitigkeit, die Familie sowie den gesamten Hausstaat zusammenhält.
Im Gegensatz zum «Weib», tritt die «Frau», also «die Herrin» als eine «herrschende Gebieterin» auf. Die «Frau» ist definitionsgemäss als Dame der «Herrschaft», die herrschende Vorgesetzte über ihre Bediensteten. Sie versorgt ihren Haushalt nicht selbst. Die Herrin lässt ihre Kinder in der Obhut von Ammen, Erzieher oder Erzieherinnen und hat für alle übrigen Arbeiten ihre Hausangestellten und Bediensteten.
Das unverheiratete Mädchen (der Ursprung des Mädchen liegt in der Vereinfachung von «Mägdchen». Mitte 17Jh. Magd im Sinne von Jungfrau), wurde als Jungfer, Jungfrau oder im althochdeutsch «juncfrouwa», also Edelfräulein verwendet. Der unverheiratete junge Mann, welcher «Jungmann» oder «Junggeselle» genannt wurde, ging bei der Suche nach einer Lebenspartnerin auf Brautschau oder auf die «Weibschau». Der verheiratete Mann, also der Ehemann, wurde als «beweibt» bezeichnet. Das «Eheweib» ist die Gattin ihres Gatten oder die Gemahlin ihres Gemahls und umgekehrt der Gatte seiner Gattin oder der Gemahl seiner Gemahlin.
Der tiefe und naturgegebene Sinn wirklich evolutiver Emanzipation liegt daher in der bewusst gelebten Gleichwertigkeit der Geschlechter. Jedoch weder in einer Gleichmachung noch im Kampf derselben gegeneinander. Nicht nur die «Frau» und das «Weib», sondern auch der Mann, sowie alle naturgegebenen fluiden oder nicht-binären Geschlechtsformen bedürfen letztendlich der Emanzipation in absoluter Gleichwertigkeit. Wenn daher die «Weiber» der Neuzeit, berechtigterweise nach Emanzipation in diesem Sinne verlangen, dann also nur gemeinsam mit dem Manne. So also der «Mann» und das «Weib», Mann und Frau zusammen als symbiotische Einheit. Denn «ALLES ist EINS und EINS ist ALLES».
Jegliche Menschen, unabhängig ihres physischen Geschlechts, bedürfen einander gleichermassen in der Form einer Symbiose und Teilhabe, zur Begehung ihrer persönlichen sowie gemeinsamen natürlichen, gefühlsmässigen, psychischen, bewusstseinsmässigen und körperlichen Evolution.
Als weiteres, zweifelhaftes Beispiel geschlechtsbezogener Konkurrenz, dient hier die abgeänderte Verwendung des Indefinitpronomens «man». In neuerer Zeit findet sich in gewissen Texten die bis anhin nicht existente Form der Kleinschreibung «frau».
Das «Wiktionary» schreibt hierzu: «In Zusammenhang mit der Neuen Frauenbewegung nutzen feministische Sprachkritikerinnen das Pronomen «frau» in frauenspezifischen Kontexten, um bewusst das Indefinitpronomen man zu vermeiden». Laut Duden wird ausdrücklich auf die korrekte Rechtschreibung «man» verwiesen. Im Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch, wurde mit der Bezeichnung «man», «irgendeiner» oder «irgendjemand», bzw. «jeder beliebige Mensch» bezeichnet. Das Pronomen «man» entwickelte sich aus dem Nominativ Singular dieses Substantivs. Zusammen mit verwandten Wörtern in anderen indoeuropäischen Sprachen geht es zurück auf *manu- oder *monu- «Mensch» (Humanum). Dieses «Indefinitpronom» wurde also ohne jegliche geschlechtliche Zuweisung auf das jeweilige Subjekt verwendet. Es ist auch zu finden in den Wörtern jeder(mann), (man)che, je(man)d, je(man)den, nie(man)d oder auch nie(man)den etc. Wobei bei der Verwendung dieser Begriffe irgendwelche Menschen, also «Mannen» jeglichen Geschlechts in Gleichwertigkeit beschrieben sind.
Die Verwendung des neu kreierten indefiniten Pronomens in Kleinschreibung «frau», weist also in seinem wirklichen Wert darauf hin, dass damit in einer gewissen «egozentrischen» Weise nur die sogenannten «Herrinnen» oder die weibliche «Herrschaft» angesprochen ist. Herrinnen, die sich mitunter hervortun und sich gegebenenfalls über die Masse der Menschen stellen. Ihr weibliches Geschlecht somit in überheblicher Form aus der Gleichwertigkeit aller Geschöpfe heraus nehmen und über diese hinweg stellen, und zwar mit dem speziell auf sie und ihren Kreis abgestimmten Indefinitpronom «frau».
Auf diese Weise wird durch jene unbedachten Zeitgenossinnen der Emanzipationsbewegung deutlich offengelegt, dass sie sich über die Bedeutung der wirklichen Emanzipation nicht tiefgründig bewusst sind, nur auf die materiellen Belange achten und einzig auf diese oberflächlichen Belange sehr grossen Wert legen. Letztendlich jedoch nicht auf die wirkliche, tiefgründige und naturgegebene Gleichwertigkeit mit dem Mann, sondern umgekehrt auf die eigene Überheblichkeit und Unterdrückung des männlichen Geschlechtes. Es zeigt sich diese Haltung darin, dass diese sogenannt «emanzipierten» Weiber, das indefinite Pronomen «man» aus Unkenntnis der etymologischen Zusammenhänge mit dem Substantiv «Mann» in Beziehung setzen und das Indefinitpronom «man» in kämpferischer Haltung durch ein «frau», in Kleinschreibung, ersetzen. Wird jedoch erneut eine einseitige – und diesmal weibliche Dominanz, in diesem Sinne angestrebt, wird sich die unrühmliche und Jahrtausend alte Geschichte der konkurrierenden Geschlechter permanent und zu aller Übel wiederholen.
Zwangsläufig würde eine derart einseitige Emanzipationsentwicklung neue negative Kräfte kreieren und freisetzen, die erfahrungsgemäss nur im Verderben und mit Zerstörung enden können. Anzustreben ist somit eine natürliche Gleichwertigkeit aller «biologischen» und «gefühlten» Geschlechter. Folgen die Frauen der Neuzeit jedoch dem Beispiel des Mannes aus den vergangenen Jahrtausenden, werden die beiden Kräfte schnell aufeinanderstossen und sich erneut gegenseitig in den Abgrund stürzen.
Nicht nur aus philosophischer, sondern auch aus natürlicher Sicht erfüllt der Mensch aller «biologischen» und «gefühlten» Geschlechter innerhalb der Natur eine ganz bestimmte Aufgabe. Durch seine Fähigkeit des bewussten Lernens, dem Sammeln von Erkenntnissen und Wissen, sowie sein Erfindungs- und Entwicklungsstreben, als Folge der Umsetzung seiner wissenschaftlichen Einsichten, wird er zum Erfüllenden der naturgegebenen Prinzipien. Das weibliche Prinzip ist das Gebärende. Es ist im wörtlichen Sinne des Wortes die «Wurzel des menschlichen Lebens». Durch die Weiber und das Weibliche werden Familien, Sippen, Völker und universumweit ganze Menschheiten, sowie jegliche Lebensformen geboren und erhalten. Denn alleine die edle Wurzel garantiert das Überleben und die Fortentwicklung allen Lebens.
In der schöpferischen Natur und deren Prinzipien wird daher das Weibliche als Gebärendes in ganz besonderer Weise beschützt, geehrt und geachtet. Diese Tatsache zeigt sich in der Flora und Fauna durch anatomische Besonderheiten und ausgeklügelte Möglichkeiten zur Tarnung, körperlicher Stärke, Kraft und Ausdauer, wie sie den männlichen Lebensformen in dieser Art und Weise nicht gegeben sind.
Durch das hoheitsvolle Weibliche erblüht die Natur in ihrer unbeschreiblichen und majestätischen Pracht in stetiger Wiederholung und jahreszeitlichem Wechsel zu neuem Leben. Sie lässt das Leben entstehen, wachsen und gedeihen in myriadenfältiger Form und Gestalt.
Die schöpferische Natur wird von den wunderbaren Schwingungen des Weiblichen durchflutet und mit ihrem betörenden Duft geschwängert. Dem Weiblichen gebührt daher, entgegen jeglichen altherkömmlichen kultreligiösen Dogmen, Entwertungen und Diskreditierungen die höchste Achtung, Respekterweisung und Ehrwürdigkeit. Denn ohne dessen Fähigkeit der Empfängnis, des Wachsenlassens und Gebärens wären die Menschen des gesamten Weltenraums nicht überlebensfähig. Ohne das Weibliche schwinden im gesamten, mikrokosmischen als auch im makrokosmischen Weltenraum die Grundlagen des Lebens dahin. Selbst die Atemluft und Lebensgase werden durch das Prinzip des Weiblichen geboren, sowie jegliche Speisen, die dem Menschen aus dem Boden wachsen, um ihn zu nähren und zu erhalten.
Jedwedes animalische, faunaische oder menschliche Leben findet seinen Ursprung im Weiblichen. Das universelle Bewusstsein hat im Weiblichen ihr eigenes, materielles und hochenergetisch feinstoffliches Überleben abgesichert und dieses mit ausgefallenen und höchst komplexen Mechanismen und Vorgängen zur eingeschlechtlichen Zeugung des Lebens ausgestattet. Unter Berücksichtigung des zeitgenössischen Sprachgebrauchs, jedoch im Bewusstsein der ehrwürdigen Unterschiedlichkeit erscheint es mir in diesem Buchwerk angemessen, situativ beide Begriffe «Weib» und «Frau» zu verwenden.
Etymologische Bedeutungen
Bindung, Bündnis, Beziehung, Ehe, Versprechen, das Wort geben, Gelöbnis und Tugend
In diesem Buch stehen die altehrwürdigen Konzepte «Bindung, Bündnis, Beziehung, Ehe, Versprechen, das Wort geben, Gelöbnis und Tugend» im Mittelpunkt aller Ausführungen. Sie beschreiben das Konzept einer liebevollen und bindenden gleich- oder gegengeschlechtlichen Zusammengehörigkeit sowie ein ethisches Engagement auf der Basis des menschlichen Bewusstseins, des Psyche- und Gefühlslebens.
Nicht selten kommt es vor, dass im deutschen Sprachgebrauch Unklarheiten oder Missverständnisse über die genaue Bedeutung von Wörtern auftreten. Deshalb ist es interessant, im Vorfeld die etymologische Herkunft dieser Begriffe zu erforschen.
Der Begriff «Bindung» entstammt dem mittelhochdeutschen «binden», was «festmachen» oder «zusammenbinden» bedeutet. Es leitet sich von dem althochdeutschen «bintan» ab, welches ebenfalls «binden» bedeutet. Beide Begriffe beschreiben eine Art des sozialen, physischen, gefühlsmässigen oder bewussten «bindenden» Zusammenhalts.
Das «Bündnis» entspringt etymologisch dem mittelhochdeutschen Wort «bündnis», welches sich auf eine «Bindung» oder ein «Zusammenbinden» bezieht. Es ist verwandt mit dem althochdeutschen «bundi», was so viel wie «Bündel» oder «Verbindung» bedeutet. Der Begriff hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und bezeichnet heute eine Übereinkunft oder Zusammenschluss zwischen Personen, Gruppen oder Staaten, um gemeinsame Ziele zu verfolgen oder einander zu unterstützen.
Die «Beziehung» geht zurück auf das mittelhochdeutsche «beziunge», was so viel wie «Verbindung» oder «Zusammenhang» bedeutet. Es setzt sich zusammen aus dem Präfix «be-«, welches eine Art von «Beziehung» oder «Verbindung» anzeigt, und dem Verb «ziehen», was «ziehen» oder «anziehen» bedeutet.
Im Kontext zur Begrifflichkeit des «Eheversprechens» ergibt sich ebenfalls spannendes. Der Begriff «Ehe» findet seine Wurzeln im althochdeutschen Wort «ewa», was so viel wie «Gesetz» oder «Vereinbarung» bedeutet. Dieses Wort ist verwandt mit dem mittelhochdeutschen «ewe» und dem neuhochdeutschen «Ehe». Die etymologische Entwicklung zeigt, dass der Begriff ursprünglich eine rechtliche oder vertragliche Bedeutung hatte, die sich im Laufe der Zeit auf die institutionalisierte, bzw. juristische «Bindung» zwischen zwei Personen ausgeweitet hat.
Das «Versprechen» entstammt dem mittelhochdeutschen «versprichen», welches sich wiederum aus dem althochdeutschen «farsprehhan» ableitet. Der Begriff setzt sich aus dem Präfix «ver», das oft eine Veränderung oder eine Richtung anzeigt, und dem Verb «sprechen» zusammen, was «reden» oder «sich äussern» bedeutet. In diesem Sinne bedeutet «Versprechen» also «etwas aussprechen» oder «eine Zusage machen» oder etwas «von sich geben». Es bezieht sich darauf eine Handlung zu vollziehen, eine Verpflichtung oder ein Bekenntnis abzugeben, etwas zu tun oder zu gewähren. Das Wort trägt in sich somit die Bedeutung von Vertrauen und Verbindlichkeit, da es eine Erwartung schafft, dass das «Versprochene» eingehalten wird. Das «Versprechen» ist somit eine bewusste Zusage oder die selbstauferlegte Verpflichtung, etwas Bestimmtes zu tun oder zu gewähren. Es ist eine aktive Handlung, bei der jemand eine Erklärung abgibt, die eine Erwartung schafft, dass diese Zusage tatsächlich eingehalten wird. Ein Versprechen kann sowohl verbal, schriftlich oder per Handschlag gegeben werden und ist oft mit einer moralisch-ethischen oder rechtlichen Verantwortung verbunden. Der Unterschied zwischen einem «Versprechen» und der Aussage «ein Wort zu halten» liegt in der Bedeutung und dem Kontext der beiden Begriffe.
Die Aussage «ein Wort halten» bezieht sich in der Verwandtschaft zum Wortwert «Versprechen» auf die Verpflichtung, die man bei der Abgabe des «Versprechens» eingegangen ist. Es bedeutet, dass man die Zusage, die man gegeben hat, auch tatsächlich einhält. Es ist also eher eine Reflexion über die Integrität, Authentizität, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit eines Menschen. Zusammengefasst ist das «Versprechen» die Handlung des Zusagens, während «ein Wort halten» die Verpflichtung beschreibt, die aus dieser Zusage resultiert.
Das Wort «Gelöbnis» hat seine Wurzeln im mittelhochdeutschen «gelöbnis» und im althochdeutschen «gilobniz». Es setzt sich zusammen aus dem Präfix «ge-» und dem Verb «löben», was so viel wie «loben» oder «versprechen» bedeutet. Ein Gelöbnis ist also im Schwerpunkt ein «feierliches» Versprechen oder eine Zusage, oft in einem zeremoniellen Kontext. Es drückt die Absicht aus, eine bestimmte Handlung auszuführen oder sich an eine bestimmte Verpflichtung zu halten.
Die «Tugend» ist ein Begriff, der in der Ethik verwendet wird und sich auf positive Eigenschaften oder Verhaltensweisen eines vernunftbegabten Menschen bezieht, die als moralisch gut angesehen werden. «Tugenden» sind oft mit einer Charakterstärke, Integrität und der Fähigkeit verbunden, aus einer Klugheit heraus das Richtige zu tun. In vielen philosophischen Traditionen, wie zum Beispiel bei dem vielzitierten Aristoteles, wird Tugend als eine Art von Exzellenz betrachtet, die es einem Individuum ermöglicht, ein gutes und erfülltes Leben zu führen.
Etymologisch stammt das Wort «Tugend» vom mittelhochdeutschen «tugent». Was so viel wie «Kraft» oder «Fähigkeit» bedeutet. Es hat seine Wurzeln im althochdeutschen «tugund», welches ebenfalls «Kraft» oder «Stärke» bedeutet. Diese Ursprünge deuten darauf hin, dass die «Tugend» nicht nur eine moralische Dimension hat, sondern auch mit der Fähigkeit verbunden ist, bestimmte ehrwürdige Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu entwickeln, zu leben und zu zeigen.
«Wahrheit» ist eine relative und subjektive Interpretation - auch die vorliegende!
Die Wahrheit als Summe aller gesammelten Erkenntnisse, Erlebnisse, Einsichten und Erfahrungen ist immer ein persönliches Gut. Diese Thematik umfasst zahlreiche Aspekte der Relativität. Seit vielen Jahrhunderten wird sie von vorwiegend selbsternannten männlichen Gurus, Sehern, Erleuchteten, Heiligen, Mächtigen, Politikern, Helden, Religionsführern, Ideologen, Propheten, Vordenkern, Meistern, Pfarrern, Priestern sowie von vermeintlich «Wissenden» und «Weisen» unterschiedlichster Art immer wieder als verbindliches Dogma für ihre Anhänger und Jünger proklamiert. Sie ist als solche jedoch immer «relativ» und entspricht lediglich der persönlichen Interpretation aller gegenwärtigen Erfahrungen, Ansichten, Irrungen und Meinungen.
Einzig und allein die Natur, bzw. deren biologische, chemische oder physikalische Prinzipien und Gesetzmässigkeiten, sind als solche in ihrer offensichtlichen Manifestation von relativ klarer «Wahrheit». Zumindest auf der Höhe unseres gegenwärtigen Verstandesdenkens und wissenschaftlich erfassbaren Erkenntnissen. Es kann derzeit nur darüber spekuliert werden, welche Geheimnisse sich in den tiefen physikalischen oder unermesslich höheren feinstofflichen Ebenen des gesamten Weltenraums noch verbergen.
Die vermeintliche Begrenzung unseres Universums, wird nach irdischem Massstab, gegenwärtig (2025) mit einer Entfernung, bzw. einer «relativen Wahrheit» von 13,819 Milliarden Lichtjahren angegeben. Diese astronomische Angabe entspricht ohne Zweifel in keiner Art und Weise den wahrlichen Gegebenheiten. Die effektive «galaktische Wahrheit», deren wir schlicht und einfach noch nicht gewahr wurden, liegt wahrscheinlich schier unmessbar darüber hinaus.
Obschon die irdischen Messgeräte und Apparaturen von einer erstaunlichen Hochentwicklung zeugen, sind ihre durchaus überwältigenden Ergebnisse lediglich auf die aktuelle Messfähigkeit unserer technischen Gegenwart ausgerichtet. Im Gegensatz dazu vertreten grenzwissenschaftliche Kreise ganz andere Ansichten. Demnach befindet sich dieses sogenannte DERN-Universum seit etwa 46,6 Billionen Jahren in einem Expansionsprozess, der voraussichtlich noch weitere 109 Billionen Jahre andauert. Anschliessend wird es einen Rückfall geben, der sich über einen Zeitraum von wiederum 155,5 Billionen Jahren erstreckt. Zudem wird Brahma, einer der Hauptgötter in der hinduistischen Tradition, als Schöpfer des Universums zitiert. Ihm wird ebenfalls ein Lebenszyklus von 311 Billionen Jahren zugeschrieben, in dem sich das Universum vollständig entfalte. Spannend sind an diesem Beispiel der Widerspruch zu unserer Astrowissenschaft und die hinduistischen Quellen. Fazit: Die «wahrliche Wahrheit» ist immer relativ.
Im Sinne der endlosen schöpferisch-natürlichen Evolution und Weiterentwicklung, ist selbst diese Erkenntnis und die universelle Wissenschaft, in ihrer dauernden und evolutiven Wandelbarkeit und Expansion als «Wahrheit» relativ. In jedem Bruchteil unserer irdischen Zeitrechnung entwickelt sich die kreierende, gesamtuniverselle Natur, um einen wohl unermesslich hohen Faktor unaufhörlich weiter. Ihre Entwicklung und Evolution bleibt niemals stehen und ist in ständiger Bewegung. Dadurch wird verständlich, dass sich selbst die schöpferisch-naturgegebene «wahrliche Wahrheit» stets verändert, niemals stagniert und sich «ad infinitum» in einer endlosen Dauer in die nächst höheren Schwingungsebenen hinauf entwickelt.
Ebenso ändert sich auch der menschlich-physische Körper, seine Psyche, das Gefühlsleben und die Formen seines Bewusstseins mit jedem Augenblick in die nächst höheren Sphären weiterer Erfahrungen, Erkenntnisse und Einsichten. In seiner persönlichen «wahrlichen» und absoluten «Wahrheit» bleibt sich der Mensch stets Mensch. Jedoch mit jedem Sekunden-Bruchteil seiner Lebenszeit in minimaler und unmerklicher Form seiner individuellen Wesensform gewandelt.
Im Gegensatz zu den mittelalterlichen, kultreligiösen und dogmatischen Glaubensvorstellungen sowie den pathologischen Wahnvorstellungen über eine imaginäre Gottheit, ist der Mensch, der nicht von Glaubensneurosen beeinflusst oder indoktriniert ist, in der Lage, durch die Kraft seiner Gedanken und seines Bewusstseins weitgehend selbstbestimmt zu leben. Er selbst entscheidet über die Richtung und die Führung seines Lebens. Über sein Schicksal und seine Bestimmung. Dennoch wird er in der gesellschaftlichen Sozialität von zahlreichen Fügungen und äusseren Umständen begleitet, auf deren zahlreichen Wirkungen er keinen unmittelbaren und direkten Einfluss hat. Unweigerlich haben auch genetische, endogenetische, bindungspsychologische, fremd- und selbsterzieherische, astrologische, kabbalistische oder chiromantische Kräfte und Energien einen kausal adäquaten Einfluss auf die Bestimmungen jedes Einzelnen.
Die Komplexität der individuellen Lebens-Wahrheiten, konfrontiert den Menschen in seiner alltäglichen Existenz permanent mit der naturgegebenen Logik und kausalen Auswirkungen seines Tuns und Handelns. Alltägliche «relative» Wahrheiten seiner Umwelt, argumentieren mit zahlreichen und komplexen Überraschungen, Unannehmlichkeiten und Unvorhergesehenem.
Die äusseren Geschicke, bzw. das sogenannte «Schicksal» im Sinne des etymologisch mittelhochdeutschen «geschick», also etwas von «aussen geschicktes» oder «zugeteiltes» fordert durchaus ihren Tribut. Manches davon wird dem Menschen widerstreben. Selbst das Eremitenleben labt sich an der Wechselwirkung des Inneren und Äusseren.
Der kluge, aufmerksame und aufrichtige Mensch lernt aus seinen evolutionsbedingten Fehlern und wird sich stets bemühen, diese kreativ und lösungsorientiert zu beheben. Viele Menschen streben nach einem Leben in Bequemlichkeit und Zufriedenheit. Sie neigen dazu, die Herausforderungen und Unannehmlichkeiten des Lernens, des eigenständigen Denkens sowie der Selbstverantwortung zu vermeiden. Oft geschieht dies, weil sie durch verschiedene Glaubensrichtungen dazu angeregt werden, ihre persönliche Verantwortung an eine höhere Macht abzugeben. Vielmehr vertrauen sie in ihrer eigenen «Wahrheit» auf den schnöden Mammon, auf Götter, deren Heilige, ideologische oder stellvertretende Vordenker/innen oder führende Mächte aller Couleur. Häufig, weil sie sich der eigenen Selbstwirksamkeit und Wirkmächtigkeit disqualifizieren sowie die energetische Macht der eigenen Gedanken bezweifeln. Mit Hilfe der verschiedenen Kultreligionen haben sie einen Zustand des persönlichen Stillstands oder der evolutiven Stagnation erreicht. Die intrinsische, selbst motivierte Suche nach dem schöpferisch-natürlichen Sinn des Lebens, nach freiem Denken und der Erforschung der wahren, «inneren» Wahrheit wird oft in die Hände anderer gelegt. Infolgedessen hat der Mensch gelernt, seine eigene Wahrheit kritiklos den Bedürfnissen anderer anzupassen und zu verändern.
Seinem ureigenen Denken und der Selbstverantwortung enthoben, hat er diese mit den bunten Farben extrinsischer Verbote kaschiert und himmelhoch jauchzend in unverständliche, kultreligiöse Worte und Auslegungen gekleidet. Die «wahrliche» Wahrheit der schöpferischen Natur mag vermutlich weder falsche Schnörkel noch Schönfärberei. Der Trägheit des eigenen Denkens ist diese eine unnötige Last und böse Spielverderberin für eine schwerfällige Lebensweise. Denjenigen Menschen, welche sich zurückbesinnen auf die ursprünglichen, natürlichen Prinzipien, ist die bewusste Selbstbestimmung weich wie Samt, wohltuend wie Balsam und höchste psychische, gefühls- und bewusstseinsmässige Erbauung. Der schöpferischen Natur, ihren evolutiven Gesetzmässigkeiten und Verhaltensregeln, ist nicht daran gelegen, sich hinter einer falsch ideologischen Maskerade, einem kultreligiösen Deckmantel oder wissenschaftlichen Täuschungen zu verstecken.
Die relative und persönliche «wahre Wahrheit» spielt eine bedeutende Rolle im Leben jedes eigenverantwortlichen, selbstbestimmten, selbstwirksamen und intrinsisch motivierten Menschen und ist entscheidend für dessen Persönlichkeitsentwicklung. Naturgegebene Gesetzmässigkeiten der Kausalität lassen sich jedoch niemals unterdrücken oder überlisten und die Überheblichkeit wird immer ihren Meister finden.
Noch einmal sei daher darauf hingewiesen. Dieses kleine Werk gibt nach bestem Wissen und Gewissen die derzeitige Gesamtheit aller im Laufe des Lebens gesammelten Kenntnisse, Erfahrungen und Fachkompetenzen eines Suchenden und Forschenden wieder. Zweckdienlich als reiner Denkanstoss für alle Interessierten an der Menschheitsfamilie jeglichen Geschlechts auf diesem wundervollen Planeten Erde (Terra).
KAPITEL 1
Liebesdimensionen und Verhaltensweisen
«Omnia Vincit Amor», ein Vers des Dichters (Virgilius) Virgil *15.10.70 v.Z. †21.9.19 v.Z.) «die Liebe triumphiert über alles», war bereits vor zweitausend Jahren so wenig ein Geheimnis wie heute. Das urschöpferische Universalbewusstsein, der sichtbaren und unsichtbaren Natur, beruht auf dem Prinzip der Alleinheitlichkeit: «ALLES ist EINS und EINS ist ALLES» im gesamt universellen WIR-Bewusstsein. Deshalb gibt es weder einen moralischen Anlass, ideologische Dogmen, kultreligiöse Verbote oder Ächtungen, noch irgendwelche pseudophilosophischen Einwände, die es verbieten oder einschränken würden, gleichzeitig mehrere Menschen jeden Geschlechts zu lieben. Was also ist Liebe?
Selbst am Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Gefühlserlebnis der uns bis anhin bekannten «Liebe» ein weithin unlösbares Mysterium. Sie kann in ihrer kausalen Ursächlichkeit nicht mit den empirischen Mitteln der empirischen Wissenschaft ergründet werden, ohne auf die neurochemische Ebenen von Neurotransmitter, Botenstoffe oder Bindungshormone, wie das Oxytocin, Serotonin, Dopamin, Endorphin, Noradrenalin, Phenethylamin und viele andere mehr, reduziert zu werden. In der Definition eines vor Jahren verlorenen Freundes beschreibt er die «Liebe» wie folgt: «Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, selbst in allem mitzuleben und mitzuexistieren, so in allem Existenten: in Flora und Fauna, im Mitmenschen, in jeglicher materiellen und geistigen Lebensform, gleich welcher Art, und im Bestehen des gesamten Universums und darüber hinaus.»
Die irdische Menschheit dieses Planeten «Terra» befindet sich in ihrer «Jetztzeit» auf dem höchstmöglichen evolutiven Kulminationspunkt ihrer gegenwärtigen Entwicklungsebene. Gemessen am gesamt universellen Massstab, liegt unsere Menschheit wohl auf einem kaum festzulegenden Niveau zwischen jenen Welten und Planeten, auf denen sich das humanoide Leben eben erst durch die Aminosäuren bildete und jenen Erdplaneten, auf denen sich dieses während Jahrmilliarden Zeiträumen bereits in unvorstellbare Hochgeistebenen des Feinstofflichen entwickelt hat.
Mit dem Hochgefühl der uns gegenwärtig bekannten «Liebesformen» wird es sich ebenso verhalten. Gemäss der schöpferisch-natürlichen Logik sind auch die «Gefühls- und Empfindungsregungen» parallel zum bewusstseins- und artgemässen Entwicklungsstand der jeweiligen Menschheit ausgerichtet. So also von der niedersten materiell-bewusstseinsmässigen Ebene bis hinauf in die höchsten Höhen feinstofflicher Geistbewusstseins-Formen.
Das rein- oder feinstofflich Geistige und die Materie in ihrer Unterscheidung wirklich zu erfassen, fällt dem Erdenmensch in seinem gegenwärtigen Verstandes- und Vernunftsdenken noch äusserst schwer. Selbst das «Geistige» wird in seinem philosophischen, kognitiv-mentalen und esoterischen Denken materialistisch definiert. Das Amt für «geistiges» Eigentum (IGE) in der Stadt Bern, (Schweiz) ist die zuständige Behörde für den Schutz von sogenanntem «geistigem» Eigentum, worunter Ideen, Patente, Marken, Design und Urheberrechte verstanden werden.
Bereits die konkrete Unterscheidung von Begriffen wie «Gefühl», «Emotionalität» und «Empfindung», «Fühlen», «Spüren», «Erfühlen», «Ahnung», «Eingebung», «innere Stimme», «Gespür» usw. fällt den Menschen, entgegen jeglichen Definitionsversuchen nicht leicht. Vieles wird daher im Sprachgebrauch einander gleichgesetzt, obschon es sich grundlegend um verschiedene Erfahrungsmomente handelt. Eine spezifische Erläuterung den den genannten Begriffen wird im Kapitel 2 näher beschrieben.
Fazit: Dieses vorliegende Buchwerk beschreibt lediglich die gegenwärtig verständliche Form der «gefühlsbasierten Liebesformen». Ich bin nicht in der Lage, hochentwickelte und über Äonen hinweg evolvierte, rein geistige sowie schöpferisch-naturgegebene, universelle Liebesformen der Zukunft zu beschreiben. Schlicht und einfach aus dem Grund, weil wir in der «wassermännischen Jetztzeit», noch keinerlei Kenntnisse darüber besitzen, welche «geistenergetischen Liebesformen» der Menschheitsfamilie in künftigen Entwicklungsebenen der kommenden Jahrtausende noch bevorstehen.
Für das Gros der Erdenmenschen ist es vielfach bereits eine schier unüberwindbare Herausforderung, mit ihrer Vielfalt an Gefühlen und den eigenen Vorstellungen von Liebe und Partnerschaften klarzukommen. Wenn man von der erdenmenschlichen Form der gefühlvollen Liebe ausgeht, die sich derzeit in ihrem laufenden Entwicklungsstand befindet, ist sie vermutlich noch weit entfernt von den universellen und schöpferisch höchsten, feinstofflichen Liebesschwingungen. Um diese zu erreichen, sind wahrscheinlich noch viele weitere Leben an erdenmenschlicher Entwicklung erforderlich. Selbstredend schliesst dieser Umstand jedoch in keiner Art und Weise aus, dass sich die Menschen dieser Erde in einer innigen und tiefen gedanklich-gefühlsmässigen und liebevollen Zuneigung verbunden sind. Diese Tatsache sollte auf keinen Fall als «negativ» konnotiert werden.
In den gegenwärtig höchstmöglichen und gefühlvollen Liebesformen spiegelt sich der aktuelle irdische Entwicklungsstand wider. Diese Gefühlsregungen sind jedoch in keinster Form von minderem Wert oder zu entwerten, sondern einander hochachtungsvoll und in liebevoller Zärtlichkeit als höchstes Gut des irdischen Menschseins entgegenzubringen und einander zu schenken.
Das gleich- und/oder gegengeschlechtliche Liebesleben und folglich dessen konstruktiven und alltäglichen Auseinandersetzungen mit einem geliebten Menschen, sind als psychisches, gefühls- und bewusstseinsmässiges Zusammenwirken eine sehr anspruchsvolle Herausforderung. Insbesondere deshalb, weil sich im Laufe des Lebens die Gedanken, die anfängliche Sympathie, die wachsende Verliebtheit, die Zuneigung und das Gefühl der Verbundenheit in tiefere und harmonischere Schwingungsformen verwandeln können, die zu einer echten und beständigen Liebe heranwachsen. Vielleicht liegt hierin die spekulative und geheimnisvolle Grundlage einer erneuten Begegnung, in einem späteren Leben und als neue Persönlichkeit. Aus Autorensicht ein sehr schöner Gedanke, denn schöne und prägende Begegnungen sind so selten wie der blaue Larimar.
Nachdenkliche, offene und forschende Freigeister werden in diesem Zusammenhang mit den interessanten, noch weithin unerforschten Spekulationen über mögliche Zusammenhänge, Auswirkungen und Gesetzmässigkeiten zur Reinkarnation konfrontiert. Im Zusammenhang mit unserem irdischen Liebesleben eröffnet diese spannende Vorstellung einer menschlichen Wiedergeburt ungeahnte und neue Denkhorizonte. Aus deren Sichtweisen die liebes- und gefühlvollen Bündnis- und Bindungsformen in einem neuen Licht erscheinen. Ein Liebesglanz, welcher während der kommenden Jahrhunderte wohl noch lange ein ungelöstes Geheimnis bleiben wird. Die Beweislage für eine abermalige, sogar mehrmalige Wiedergeburt in einem neuen Menschenkörper bleibt offen und ist gegenwärtig mit empirisch-wissenschaftlichen Methoden noch nicht zu erbringen.
Das naturgegebene Prinzip der Wiederholung und Repetition, der stetigen natürlichen Evolution, Fort- und Weiterentwicklung ihrer Kreationen, lässt diese Hypothese jedoch in einem logischen Licht erscheinen. Zur Erreichung seines evolutiv höchstmöglichen Zieles stehen dem menschlichen Individuum gemäss dieser Logik womöglich unzählige neue Menschenleben zur Verfügung. Die wiederholte Fleischwerdung eines hochgeistig-energetischen «Alter Egos», (grenzwissenschaftlich auch «Geistform» genannt), in einem neuerlichen Menschenkörper, ist keine Erfindung alt-moderner Kultreligionen oder der Esoterik. Mittlerweile ist sie auch ein wissenschaftliches Forschungsgebiet.
Für die parapsychologische Hypothese, dass die Reinkarnation ein reales Naturphänomen sei, stellen beispielsweise Ian Stevensons Untersuchungsergebnisse die derzeit besten Argumente dar. Er selbst sprach gemäss den vorhandenen Angaben zu seiner Arbeit nie von Beweisen in diesem Zusammenhang, sondern nur von «Fällen, die eine Reinkarnation nahelegen».
Ian Stevenson (* 31. Oktober 1918 in Montreal, Kanada; † 8. Februar 2007 in Charlottesville, Virginia, USA), war ein kanadischer sowie US-amerikanischer Psychiater und Begründer der Reinkarnationsforschung. Diese wird uns an späterer Stelle noch mehrmals begegnen.
Im duftenden Wesen jeder Blütenpracht gebiert auch das stetige Werden und Vergehen des Lebens. Ein drohender Abschied begleitet jegliche Begegnungen. In jeder schönen Erinnerung liegt das flüchtige Vergessen, in jedem kurzen Augenblick das Sehnen nach der liebevollen und harmonischen Geborgenheit. Auf den Flügeln unserer unausweichlichen Sterblichkeit schwebend, werden wir Menschen durch den unendlichen Raum und die zeitlichen Dimensionen getragen.
Menschen sehnen sich danach, respektiert, geliebt, zärtlich berührt, gehört und verstanden zu werden. Lebenslängliche Gefährten- und treue Freundschaften, stabile, beständige Liebes-Partnerschaften, ein einfühlsames Verstandenwerden definieren fraglos die stetige Suche nach dem Sinn des Lebens. Menschen sind geboren zur liebevollen Sozialität und sie verdorren ohne Ihresgleichen. Zeitlebens suchen sie nach authentischen Bindungen und einer stabilen Sicherheit, auf deren Treue und Verlässlichkeit sie in guten wie in schlechten Zeiten vertrauensvoll und ohne überflüssige Worte setzen können.
Im Laufe des Lebens festigen sich die Persönlichkeit und der Charakter. Menschen bilden sich Meinungen und Ansichten, wie sie auch Erkenntnisse, Einsichten, Erfahrungen und das Erleben mehren. Gleichsam jedoch auch Intoleranz und Vorurteile. Vielfach haben die Menschen sehr schnell konkrete Vorstellungen, Idealbilder oder Visionen zur Hand bezüglich des Charakters und des Wesens einer neuerlich erwählten Liebschaft.
Durch eigene, gute und belastende Erfahrungen, individuellen Neigungen, eingespielten Gewohnheiten sowie durch persönliche Charaktereigenarten werden oft sehr hohe, selbstbezogene Ansprüche und Massstäbe in die neuen Begegnungen und Bekanntschaften gelegt. Fremde Persönlichkeiten, neue Bekanntschafts- oder Freundeskreise, wünscht man sich im besten Fall so geartet, wie sie einem selbst zu eigen sind.
Die gleichen Interessen zu verfolgen, ähnliche Ansichten zu vertreten, nährt im Volksmund die Aussicht auf Erfolg im Liebeswerben. Denn «gleich» zu «gleich» gesellt sich gern. Das «Gleichgesinnte» fühlt sich zueinander hingezogen, doch auch die «Gegensätze» ziehen einander an. Beide Konzepte sind in gefühlvollen, zwischenmenschlichen Beziehungen gleichermassen von Wichtigkeit und können unterschiedliche Dynamiken erzeugen. Menschen umhüllen sich gern mit der Aura des höchsten Massstabes aller Perfektion. Allem voran bezüglich der eigenen Umgänglichkeit und Leutseligkeit.
Der Liebesmarkt lebt jedoch selten von der nachsichtsvollen Gnade. Eine der grössten Lügen vieler Menschen lautet daher: «Ich liebe dich, wie du bist, denn nur die «inneren» Werte sind mir wichtig». Der allererste Eindruck einer unverhofften Begegnung spricht jedoch eine andere Sprache und entscheidet gemäss Neurobiologie bereits nach rund 33 Millisekunden über «Sein» oder «Schein».
Die Schönheit und Attraktivität haben bereits durch ihre «Tageslichttauglichkeit» gewonnen, denn auch das Auge isst mit. Ein ansprechend angerichtetes Gericht kann den Appetit anregen und das Esserlebnis insgesamt verbessern. Nur die verzückte Naivität will hinter vorgehaltener Hand vehement das Gegenteil vertreten. Denn die «Eitelkeit des Schönen» sucht im glitzernden Lichterglanz der Präsentation zu prahlen und zu brillieren.
In der Würde einer liebevollen Weiblichkeit, der respektvollen Anerkennung und einfühlsamen Wertschätzung, der Empathie und individuellen Stärke liegt auch das Liebesglück der psychischen Versehrtheit. Denn nur der Pfau in seiner Farbenpracht vibriert sein Rad in Überheblichkeit. In der Sprachkultur der Neuzeit treibt selbst der «Liebesbegriff» sonderbare Blüten. In unbedachter, zwischenmenschlicher Faselei, naiver Lächerlichkeit, Unbeständigkeit und schnellem Wandel trägt sie den üblen Beigeschmack des flüchtigen Konsumverhaltens. In der Oberflächlichkeit des Lebens wird die «Liebe» nicht selten «so nice and lovely». Der feine Kuchen, «Oh, I love it», wie das schöne Wetter, «das ich liebe».
In der Vollkommenheit aller Formen liegt die Kugel, in der Vervollkommnung allen Lebens die schöpferische Schöpfung, in der Vollkommenheit des menschlichen Wesens seine Psyche, die Gefühle und die Kräfte des Bewusstseins. Unter den wahrlichen Menschen bildet der vollkommenste Satz ihrer Sprache: «Ich liebe dich». So mancher, der dich jedoch mit Blumen, schönen Worten und mit Komplimenten überhäuft und ehrt, in Tat und Wahrheit eitle Schmeichelei und Tand begehrt.
Dadurch existieren im Sprachgebrauch und im Verständnis zahlreicher Menschen keinerlei Unterschiede mehr zwischen der verbalen Liebesbekundung an einen Menschen und dem Ausdruck für das lediglich «Mögen» einer kulinarischen oder jeglichen anderen leidenschaftlichen «Liebhaberei». Man «liebt» eben auch das, was man lediglich mag! Die Vielfalt an Liebesformen gewinnt dadurch eine durchaus materialistische Dimension zur Leidenschaft.
Dieser Begriff findet seine Wurzeln im mittelhochdeutschen Wort «lîdenschaft», das sich aus dem althochdeutschen «līdan» ableitet, was so viel wie «leiden» oder «erleiden» bedeutet. Das Wort setzt sich somit aus zwei Teilen zusammen: «Leid» und «Schaft». «Leid» bezieht sich auf das Empfinden von Schmerz oder Leiden, während «Schaft» eine Form von Zustand oder Eigenschaft beschreibt. In diesem Zusammenhang kann «Leidenschaft» also als ein Zustand des «Leidens» oder der intensiven Emotionen verstanden werden. Es ist daher wichtig, auf die angemessene Verwendung dieses Begriffs zu achten, wenn es darum geht, in Tat und Wahrheit ein gefühlsmässiges Hochgefühl zu beschreiben.
Das etymologische Wörterbuch weiss über die Herkunft der Begrifflichkeit «Liebe» zu berichten: «Liebe» führt zurück zum althochdeutschen «liob», was «lieb» oder «teuer» bedeutet. Das Wort «teuer» vom althochdeutschen «tiuri», was «wertvoll» oder «kostbar» bedeutet. Einmal mehr lohnt sich auch bei diesem Begriff «Liebe» der Blick auf dessen Herkunft.
Er verdeutlicht letztlich erneut, dass es sich um einen gefühlsintensiven inneren Zustand handelt, der sich zwar mit unserer Psyche erfassen lässt, jedoch in seiner tiefen Essenz kaum in Worte gefasst werden kann. Unbestritten werden auf den harmonischen Schwingungen und energetischen Wellen dieser geheimnisvollen und wohlgefälligen Gefühlsregungen eine liebevolle, gegen- oder gleichgeschlechtliche Bindungs-Gewissheit der Zusammengehörigkeit zwischen zwei oder mehreren Menschen übertragen.
… über die «Liebe» und das «(Ver)liebtsein»
Rein wissenschaftlich betrachtet gleicht die «(Ver)liebtheit» einem pathologischen Suchtverhalten. Sind wir glücklich verliebt, wird in unserem Gehirn der lebenswichtige Botenstoff und Hormon «Dopamin» ausgeschüttet. Es steigert die Motivation, die Vorfreude und aktiviert das sogenannte Belohnungssystem. Aus diesem Grund wird es auch als «Glückshormon» bezeichnet. Die Verliebtheit als euphorische Gefühlsregung ist jeglichem Geschlecht eigen.
Das «Verlieben» und «Verliebtsein», als euphorisch-gefühlsmässiges Hochgefühl, wirkt durch den möglichen Realitätsverlust im Vergleich, ähnlich wie eine halluzinogene Droge. Liebeshormone fluten das Gehirn. Nebst zahlreichen anderen Neurotransmitter, werden jedoch vor allem Dopamin, Serotonin, Adrenalin und Oxytocin verantwortlich gezeichnet. Nicht von ungefähr wird bei der Verliebtheit von einem «(ver)lieben» im Sinne eines «(zer)lieben» bzw. dem Auseinanderbrechen und Zerreissen des Verstandesdenkens gesprochen.
In Situationen, in denen Menschen in wahnsinnige Anfälle der Verliebtheit geraten und sich in höchst unlogische und euphorische Handlungen verstricken, verlieren sie auf gewisse Weise tatsächlich ihren Verstand und ihr logisches Denken. Davor ist niemand, weder Mann noch Weib, noch Menschen jeglichen Geschlechts, gefeit. Bereits in alten Schriften und Überlieferungen ist davon die Rede, dass sich selbst die höchsten Wissenden und Weisen, Göttinnen und Götter, einem vom Liebeswahn befallenen Menschen nicht in den Weg zu stellen wagten, weil diese in ihrer Sturheit und in ihrem Durchsetzungswillen nicht zu bremsen seien. Dies jedoch nur so lange, bis sich der Sturm des euphorischen Hochgefühls und der hormonellen Überflutung der (Ver)liebtheit etwas gemässigt und die Betroffenen wieder aus dem nebulösen Zustand ihrer Sinne zurückzukommen befähigt sind.
Durch die Kraft ihrer Gedanken und Gefühle vermögen die Menschen effektive, wahrlich bindende und beständige Liebesformen füreinander aufzubauen. Diese sind jedoch nicht mit jenen Wunschvorstellungen, Phantasien, Gedanken und Gefühlsregungen zu verwechseln, die einen Menschen als besonders attraktiv, sympathisch, erfolgreich, berühmt oder anziehend definieren.
Auf diesen gedanklichen Grundlagen resultieren jene eingebildeten und selbsterschaffenen Gefühle und Illusionen, die sich in Form von Wünschen, Sehnsüchten und Begierden usw. als (Ver)liebtheit äussern. Die reine Verliebtheit als euphorisch-gefühlsmässiges Hochgefühl entsteht in der Regel aus Wunsch-Gedanken, aus illusorischen oder aussichtslosen Vorstellungen, naiven Einbildungen oder aus einem Glauben. Leider sind diese oftmals das gedanklich bekräftigte Produkt, selbstbetrügerisch-intrinsischer Motive, sowie einer selbstauferlegten und selbstsuggestiven Blindheit.
Eine gedanklich erzeugte, illusorisch-euphorische (Ver)liebtheit, kann in ihrer flüchtigen Wandelbarkeit zwangsläufig keine oder nur äusserst selten eine wahrliche Beständigkeit finden. Die Verliebtheit gleicht und endet daher oft in einem Strohfeuer, welches sich rasch und intensiv entfacht und vom Winde getrieben verbreitet. Jedoch bereits nach kurzer Zeit und ohne Nahrung sein Ende findet. Die gedanklich erzeugte Verliebtheit ist in ihrer Beständigkeit sehr gefährdet.
Durch Stimmungsschwankungen aller Art beeinflusst, kann sie sich unter Umständen sehr schnell verflüchtigen oder gar in eine Form der Hass-Liebe, Antipathie und Ablehnung wandeln. Gemäss dem Bundesamt für Statistik registrierte die schweizerische Polizei im Jahr 2023 genau 19918 Straftaten im häuslichen Bereich. Diese Zahl ist auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen vier Jahren. Die meisten Straftaten wurden in einer bestehenden (52,5%) oder ehemaligen Partnerschaft (28,1%) verzeichnet. Mit 70,1% ist die Mehrheit der insgesamt 11479 polizeilich registrierten geschädigten Personen im Jahr 2023 weiblich. Wie im Vorjahr 2023 wurden 25 vollendete Tötungsdelikte im häuslichen Bereich verzeichnet. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass es sich bei all diesen Schicksalen um Menschen handelt, die sich unter Umständen unter einer romantischen Voraussetzung kennengelernt und sich im Sturm der (Ver)liebtheit die «Liebe des Lebens» geschworen haben.
Die irdischen zwischenmenschlichen Beziehungsformen der Gegenwart basieren jedoch gemäss dem Evolutionsstand des Erdenmenschen noch während Jahrtausenden auf den Schwingungen einer reinen gefühlsorientierten Bindung. Dem tugendhaften Menschen ist daher jede zwischenmenschliche Bindungsform «heilig». Die Bemühung um die lebenslängliche Beständigkeit ist von höchster Ehrwürdigkeit. Letztendlich ist es jedoch kaum von massgebender Wichtigkeit, um welche Art und Form es sich bei einer liebevollen zwischenmenschlichen Beziehungsform handelt, solange diese nicht in bösartiger Absicht zu psychischen und gefühlsmässigen Verletzungen führt.
Die bösartige Missachtung, Untreue oder feige Verleugnung ihrer hohen Werte wird für alle beteiligten Menschen zu einer sehr schmerzlichen Erfahrung der Wortbrüchigkeit und des Vertrauensbruchs. Die unvermeidbaren, logischen Folgen und Auswirkungen einer illusorischen und Gefühls gesteigerten «Euphorie-Verliebtheit», wie deren unweigerliche Auflösung und Trennungen, bergen in sich schwere psychische und gefühlsmässige Verletzungen und Schmerzen. Dies kann bei mental labilen Personen zu erheblichen Enttäuschungen, Depressionen, Melancholie und psychischen Störungen führen. Infolgedessen können sich Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, die den Aufbau zukünftiger Partnerschaften und zwischenmenschlicher Beziehungen aller Art beeinträchtigen.
Die hormongeschwängerte «Euphorie-Verliebtheit» lässt offensichtliche, psychische Nachteile und ungünstige Voraussetzungen für eine wahrlich liebevolle, zwischenmenschliche, engere Bindung im Nebel des Entzückens verschwinden. Wobei die persönlichen Wünsche, Bedürfnisse, Begierden und Neigungen schier grenzenlos überbewertet werden. Jede neue (Ver)liebtheit basiert auf entsprechenden Gedanken und Gefühlen, auf Wünschen und Vorstellungen. Dennoch ist sie unter Umständen nebst der erstlichen Sympathie-Liebe die grundlegende Basis einer sich entwickelnden, endlos und urewig dauernden, wahrlichen und tiefen Liebe.
Die wertvolle, wachsende Liebe wird durch tiefgreifende Gedanken und liebevolle Gefühle für einen Menschen aufgebaut, die auf einer tiefgreifenden und ehrlichen zwischenmenschlichen Beziehung und einem allmählichen gedeihenden Wachstum beruhen. Die Entstehung einer solchen Bindungsform kann unter Umständen sehr lange dauern und ist mit dem aufflackernden Strohfeuer einer «(Ver)liebtheit» in keiner Art und Weise zu vergleichen. Diese echten Gefühlsformen einer erwachenden und tiefgründigen Liebe basieren auf einer im «Innersten» fühlbaren Gewissheit und Empfindung der vertrauten Zusammengehörigkeit. Sie bezeugen dem Menschen, entgegen allen Widrigkeiten des Lebens, eine hohe Qualität seines noch vorhandenen Gefühlslebens.
Selbstredend ist an dieser Stelle bezüglich des deutschen Wortwertes (Ver)liebtheit (in Klammer) eine Erklärung angebracht. Denn bereits in der eigentlichen Anwendung des Begriffes liegt ein grundlegender Widerspruch verborgen. Eine «Antinomie», welche bereits auf die Undurchführbarkeit dieses Zustandes verweist.
Wie bereits eingangs erwähnt, beinhaltet die deutsche Sprache einen unvergleichlichen Wortschatz. Dennoch ist sie auch vor missverständlichen Begriffen nicht gefeit. Es sind Ausdrücke, welche im Volksmund eine althergebrachte Verwendung finden, in ihrem eigentlichen Wert jedoch oft das Gegenteil der transportierten Aussage beinhalten. Um diesen Sachverhalt gründlicher zu betrachten, sollen an diesem Beispiel jene deutschen Wörter und Begriffe herangezogen werden, welche mit der Anfangssilbe «Ver» beginnen.
Im «Wahrig deutsches Wörterbuch» kann unter der Silbe (Präfix) (Ver) ... folgende und richtig definierte Erklärung gefunden werden. Ver. <in Zus> zur Bezeichnung des Abweichens von der Richtung, des Falschen, des Verkehrens ins Gegenteilige. Das Präfix «ver» weist zudem eine Verwandtschaft zum verbalen Präfix «zer» auf. Über diese verbal Präfix, weiss das «Bedeutungs-Wörterbuch» Nr. 10 des DUDEN folgendes zu erläutern: (zer)- <verbales Präfix>: durch das im Basiswort genannte Tun, Geschehen machen, das etwas (ein Ganzes, eine glatte Fläche) beschädigt, aufgelöst, zerstört, getrennt wird (auseinander-, entzweit). Offensichtlich deutet das Präfix «Zer» oder «Ver», auf eine Aufhebung, bzw. auf das Auseinandernehmen, das Auseinanderziehen oder das Trennen eines bestimmten Zustandes hin.
Es stellt sich daher die berechtigte Frage weshalb für das Zusammenfügen einer Sache oder Gegenständen, einzelnen Personen, Gruppen, einem Bund oder einem Bündnis, das Nomen «Vereinigung», «Verbund» oder «Verbindung» Verwendung findet? Bei genauer Betrachtung fällt der aufmerksamen Leserschaft das Paradoxon dieser Ausdrücke sofort ins Auge. Eine Bindung oder Bündnisse können entweder eingegangen werden oder eben nicht. Dementsprechend müssen diese Bindungsformen mit der richtigen Bezeichnung des realen und wirklichen Zustandes der Zusammengehörigkeit benannt und bezeichnet werden. Die Bindung kann demgemäss und logischerweise nicht durch eine «(Ver)Bindung» auseinander-zusammen-gebunden oder voneinander-weg-zusammen-gebunden werden.
Die Mitglieder in einem sprach gebräuchlichen und daher sogenannten «Verein» sind korrekterweise entweder «geeint» in einer «Einigung», «Einung» oder «Innung». Der in unserem Sprachgebrauch als «Einung» beschriebene Begriff «Verein» stellt also diesbezüglich ein klares Paradoxon dar. Dies aus dem Grunde, da die eingegangene Bindung im Moment der Zusammenführung im wörtlichen Sinne sogleich wieder Zer-(Ver)-trennt, die «Vereinigung» also in sich bereits «auseinander-geeint» wird. Daher sind in der deutschen Sprache nicht wenige Begriffe zu finden, bei denen genau dieses Paradoxon auftritt. Ausdrücke, die sich jedoch im allgemeinen Volksgebrauch derart tief im Bewusstsein und Sprachverständnis der Menschen eingeprägt haben, dass dieser Sachverhalt nach heutigem Verständnis fast nicht mehr zu ändern oder rückgängig zu machen ist.
Die Fehlanwendung von (Ver)-Wörter ist jedoch vor allem hinsichtlich einer unbewussten und unterbewussten psychologischen Wirksamkeit von Wichtigkeit, bei welcher ein gefühlsmässiges Zusammenkommen oder ein Zusammenfügen irgendwelcher Art beschrieben oder festgelegt werden soll. Diese finden sich beispielsweise bei den Substantiven wie: Verwirklichung, Verzeihen, Verlieben, Verlobung, Versicherung, Vermögen, Verstehen, Verein, Vertrag, Verheiraten, Verhalten, Verbindung, Vertrauen, Verehren usw.
Im deutschen Sprachschatz finden sich annähernd zweitausend Worte, die mit dem Präfix «ver» beginnen. Dennoch lassen sich nach wie vor altehrwürdige Bezeichnungen finden, welche auf eine aussagekräftige Urform ohne das genannte Präfix verweisen wie zum Beispiel. (Ver)ein/Einung, Einigung, die (Ver)lobung / Gelobung, Gelübte. Das (Ver)halten / Haltung, das (Ver)mögen / Mögenschaft, die (Ver)teidigung / Trutzung. Die (Ver)zeihung / Zeihung, die (Ver)wandtschaft / Zugewandtschaft oder Beigewandtschaft, Angewandtschaft, die (Ver)ehrung / Ehrung, das (Ver)trauen / Trauen etc. Ganz bewusst ist daher im Buchtitel dieses Werkes von «Bündnis- und Bindungsformen» die Rede.