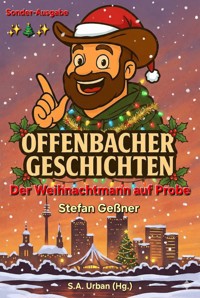5,99 €
1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Offenbacher Geschichten
- Sprache: Deutsch
Moderne Schildbürgerstreiche treffen auf echten Offenbacher Charme – manchmal absurd, manchmal historisch, immer mit einem Augenzwinkern. Skurrile Anekdoten, schräge Storys und zu Herzen gehende Geschichten aus Offenbach, die oftmals so wahr und zeitnah anmuten, dass man sich fragt, ob sie nicht sogar in der eigenen Stadt passiert sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stefan Geßner
Offenbacher Geschichten - Band 1
12 seltsame, absurde und (fast) wahre Geschichten in jeweils 6 Kapiteln
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Die Offenbacher und der Fahrradweg
2. Die Offenbacher und die maroden Gehwege
3. Die Offenbacher und die Maskottchen-Mission
4. Die Offenbacher und das große Stadionversprechen
5. Die Offenbacher und die Rattenplage von Waldhof
6. Die Offenbacher und das abgerissene Hochhaus, das nie neugebaut wird
7. Der Hauptmann von Offenbach
8. Die Offenbacher und die E-Roller-Armee
9. Die Offenbacher und die Frage, warum sie Hunde laufen lassen und Steine anbinden
10. Die Offenbacher und das verschwundene Ortsschild
11. Die Offenbacher und die übergriffigen Enten
12. Die Offenbacher und der Maaschiffer, der nie anlegte
Impressum neobooks
1. Die Offenbacher und der Fahrradweg
Ein seltsames Geschehnis in sechs Kapiteln
Erstes Kapitel: Wie der Gedanke geboren ward
In jenen Tagen, da das Laub sich vom Baum löste wie träge Gedanken aus müden Köpfen, begab es sich, dass der Rat der Stadt Offenbach tagte. Die Luft im Saal war schwer vom Duft kalten Kaffees und warm gewordener Amtlichkeit. Ein jeder saß auf seinem Platz, das Haupt geneigt über Papiere, deren Inhalt längst verdorrt war wie Herbstlaub.Da hob der Bürgermeister, ein Mann von rundem Gesicht und noch rundlicherem Denken, das Haupt und sprach mit gewichtiger Stimme: „Es ist Zeit, dass wir Spuren hinterlassen – nicht nur im Staube unserer Gassen, sondern in den Herzen der Menschen.“
Die anderen nickten beflissen, denn Nicken war ihre liebste und sicherste Tätigkeit. Doch sie wussten nicht, welche Spur wohl die rechte sei.Da trat ein junger Referendar hervor, noch bleich vom Staube der Registraturen, und sprach mit zarter Stimme: „Was, wenn wir einen Weg für Fahrräder schaffen?“
Ein Raunen ging durch den Saal, als hätte ein fremdes Wort Einlass gefunden.Ein Weg – nicht für Kutschen, nicht für Autos, nein: für Fahrräder! Die Offenbacher besaßen zwar wenige Räder, doch Meinungen hatten sie in großer Zahl.„Das Volk wird es lieben!“, rief ein Stadtrat, der sonst nie etwas liebte außer Würstchen mit Kraut.„Es klingt nach Fortschritt!“, rief eine Stadträtin, die stets von Fortschritt sprach, ohne ihn je zu sehen.Und die Dritte, eine Dame, die immer alles mit sorgenvoller Miene betrachtete, fragte: „Doch wo soll der Weg beginnen?“
Man sah sich im Saal um, als könnte der Anfang vielleicht auf dem Teppich zu finden sein.Da erhob sich der alte Hausmeister, ein schweigsamer Mann, der die Pflanzen im Rathaus mit heimlicher Liebe versorgte. Er sprach leise, beinahe wie zu sich selbst: „Ein Weg beginnt dort, wo keiner ihn erwartet.“
Da nickten alle sehr weise, als hätten sie solches stets gewusst.So beschlossen sie, den neuen Fahrradweg im Süden der Stadt zu beginnen, dort, wo einst ein Brunnen gestanden hatte, an den sich niemand mehr recht erinnern wollte.Mit Maßbändern, Kreide und einer Portion guter Absicht machten sie sich daran, das Gelände zu vermessen.Als der Tag zu Ende ging, stand nichts weiter als ein vager Entschluss im Raum – doch die Offenbacher waren zufrieden.Denn was ist ein größerer Anfang als ein fester Entschluss?
Zweites Kapitel: Von der Planung und ihren Irrwegen
Kaum war der Gedanke geboren, wuchs er wie ein junger Baum, den niemand zu stutzen wagte. Die Offenbacher gaben sich große Mühe, als wollten sie nicht nur einen Weg bauen, sondern gleich ein Denkmal für die Ewigkeit. Ein Planungsausschuss wurde gegründet, ein Ausschuss für Ausschüsse folgte sogleich.Man beauftragte einen Fachmann aus der fernen Stadt Wiesbaden, der schon Radwege gebaut hatte, die auf Brücken endeten, wo keine Brücken waren. Er trug einen schmalen Schal, sprach in Fachbegriffen und lächelte selten, was man für Klugheit hielt.
Mit langen Stöcken und noch längeren Plänen schritt man das Gelände ab. Man diskutierte Kurvenradien, Sonnenstand und die Laune des Windes.„Der Weg darf nicht zu gerade sein“, sprach der Fachmann, „denn Geradlinigkeit ist langweilig.“Also malte man Bögen, Windungen und kleine Schleifen, die keinem Ziel dienten außer sich selbst.
Die Farbenfrage wurde lang und gründlich besprochen. Grün sei zu ökologisch, Blau zu verträumt, Gelb zu heiter. Man einigte sich auf ein mattes Grau, das man „Betonpoesie“ nannte.
An einer Sitzung sagte einer: „Der Weg soll breiter sein als zwei Kühe nebeneinander.“Und ein anderer ergänzte: „Aber schmaler als ein Linienbus.“Da wurde viel gerechnet, viel gezeichnet und am Ende so gebaut, dass ein Fahrrad kaum hindurchpasste – doch zwei Fußgänger bequem nebeneinander gehen konnten.
Man errichtete kleine Hügelchen, damit es nicht zu bequem sei. In der Mitte pflanzte man zur Verschönerung ein paar Sträucher, durch welche man sich künftig hindurchschlängeln müsste.Ein Schild wurde entworfen: „Radfahrende bitte freundlich sein.“Ein anderes folgte: „Betreten auf eigene Gefahr.“
Die Beleuchtung wurde solarbetrieben, doch stand sie stets im Schatten großer Bäume. Der Weg führte an einem Bolzplatz vorbei, machte einen Umweg um ein Gebüsch, und mündete schließlich in einem Feldweg voller Schlaglöcher.Als das Werk auf dem Papier vollendet war, klopfte man sich auf die Schultern. Die Pläne wurden dreifach gedruckt, laminiert und an die Wand im Rathaus genagelt.
Der Bürgermeister ließ verlauten: „Wir bauen nicht nur einen Weg, wir bauen ein Versprechen.“Niemand fragte, an wen.
Drittes Kapitel: Vom großen Bauwerk und kleinen Wundern
Der Tag des ersten Spatenstichs wurde mit feierlicher Miene und belegten Brötchen begangen. Ein roter Teppich führte über das Erdreich, das bald geformt, geebnet und gefestigt werden sollte – so stand es jedenfalls im Protokoll.Der Bürgermeister trug einen Helm, der ihm zu groß war, und ein Lächeln, das zu klein geriet. Mit goldfarbenem Spaten stach er in die Erde, doch traf sogleich auf etwas Hartes: ein altes Fundament, das niemand auf dem Plan gefunden hatte.
„Die Geschichte spricht zu uns“, rief der Stadtchronist gerührt.Doch der Bauleiter seufzte nur und forderte schweres Gerät an. Ein Bagger wurde bestellt, doch der Fahrer, neu in der Stadt, bog falsch ab und pflügte stattdessen eine Schaukel auf dem Spielplatz um.„Ein Anfang ist ein Anfang“, murmelte man, während Kinder weinten und Tauben empört davonflatterten.
Als endlich das rechte Stück Erde gefunden war, begannen die Bauarbeiten mit viel Lärm und wenig Plan. Man goss Beton, wo Kies vorgesehen war, und vergaß zu verdichten, was fest sein sollte. Ein Teil des Weges sackte ab, ein anderer hob sich wie eine sanfte Welle.
„Es sieht lebendig aus“, sagte der Landschaftsarchitekt, „so, als ob der Weg atmet.“Niemand widersprach, denn man war zu müde zum Denken.
Ein halber Kreis wurde gelegt, weil der Plan falsch gehalten worden war – doch niemand wollte es zugeben, und so nannte man es einen „meditativen Schlenker“.
Laternen wurden gesetzt, aber verwechselt – nun leuchteten sie tagsüber und schliefen nachts.Ein Schild mit der Aufschrift „Willkommen auf dem Fahrradweg“ wurde versehentlich verkehrt herum montiert. Ein Passant fragte, ob es sich um moderne Kunst handle. Der Bauleiter nickte.
Ein kleines Wunder geschah, als eine Pflasterfläche tatsächlich gerade geriet. Man war so erstaunt, dass man drumherum eine Bank stellte und ein Denkmal errichtete: Zur Ehre des einzigen geraden Abschnitts stand darauf.
Die Anwohner beobachteten das Geschehen aus sicherer Entfernung, sie schüttelten die Köpfe, aber sie taten es freundlich.Denn in Offenbach wusste man: Wo gebaut wird, da wächst auch die Geschichte.Wenn auch schief.
Viertes Kapitel: Von der feierlichen Eröffnung und anderen Verwirrungen
Als der Bau des Fahrradwegs nach vielen Wochen des Grabens, Pflasterns und Ratens vollendet war, beschloss man, das Werk der Öffentlichkeit zu übergeben. Die Sonne stand mild am Himmel, als hätte auch sie Mitleid, und der Platz am Anfang des Weges wurde geschmückt mit Fähnchen, Girlanden und einem kleinen Pavillon, der im Wind klapperte.
Der Bürgermeister trug seine beste Schärpe und hatte sich einen Leitspruch zurechtgelegt: „Wo ein Wille ist, da ist ein Weg – und wo ein Weg ist, da soll gefahren werden.“Niemand verstand ganz, was er meinte, aber alle klatschten höflich. Die Blaskapelle des Seniorenvereins „Heitere Klarinetten“ war eingeladen, doch sie hatten ihre Noten vergessen. Stattdessen spielten sie etwas, das verdächtig nach der Titelmelodie einer Fernsehserie aus den 1980ern klang.
Ein Band aus rotem Stoff wurde über den Anfang des Weges gespannt – Symbol des Neubeginns. Der Bürgermeister hielt die Schere bereit, doch sie schnitt nicht.„Symbolisch ist auch schön“, murmelte jemand aus dem Publikum.
Als Höhepunkt der Zeremonie sollte ein Radfahrer erscheinen – ein Mann mit goldener Hose, goldenem Helm und goldenem Fahrrad. Er hatte sich eigens angemeldet, doch er kam nicht. Später stellte sich heraus, dass er auf Google Maps einen Wegpunkt verpasst hatte und in einer Sackgasse stand, irgendwo in Bürgel. Da erklärte sich spontan eine ältere Dame bereit, die zufällig mit einem Rollator vorbeikam. Man half ihr auf ein Leihrad, das man aus dem Stadtmarketingbüro geholt hatte. Sie fuhr drei Meter, lächelte milde, verlor das Gleichgewicht und fiel in eine Rabatte mit Lavendel. Das Volk klatschte begeistert.„Eine heldenhafte Einweihung!“, rief ein Stadtrat mit Träne im Knopfloch.
Kinder warfen Konfetti, das sich in den Speichen einer Parkbank verhedderte. Eine Gruppe Jogger bog um die Ecke, sah den neuen Weg, und wich erschrocken aus – auf die Straße. Ein Hund bellte gegen das erste Hinweisschild.
Zum Schluss sprach der Bürgermeister noch einmal, während hinter ihm ein E-Scooter scheppernd umfiel: „Möge dieser Weg uns allen offenstehen – und möge er befahren werden mit Freude, Pflichtgefühl und Helmpflicht!“
Ein sanfter Applaus.
Ein zögerlicher Windstoß.
Der Weg war nun eröffnet.
Doch niemand fuhr.
Noch nicht.
Fünftes Kapitel: Von der Suche nach dem ersten Radfahrer
Die Tage vergingen, und der Fahrradweg lag da wie ein neues Buch, das niemand aufzuschlagen wagte. Kein Reifen knirschte über das Pflaster, kein Klingeln durchbrach die Stille. Nur der Wind fuhr darüber, als wolle er testen, ob der Weg auch ohne Verkehr bestehen könne.
Im Rathaus begannen erste Stirnen sich zu kräuseln.„Es liegt vielleicht am Wetter“, murmelte jemand, obwohl es sonnig war.„Vielleicht wissen die Leute nichts davon“, meinte ein anderer, obwohl Schilder, Broschüren und ein Interview im Wochenblatt erschienen waren.„Oder die Menschen sind einfach zu bequem geworden“, sagte der Kulturbeauftragte, der nie ein Fahrrad besessen hatte.
Da beschloss man, eine Kampagne zu starten. Sie hieß „Rad dich frei!“ und wurde von einer Werbeagentur entworfen, die früher für Wurstwaren zuständig gewesen war. Auf großen Plakaten zeigte man glückliche Menschen, die sich lachend durch grüne Landschaften bewegten – leider handelte es sich um Bilder aus Dänemark.
An einem Montagmorgen stellte man eine Musikbox auf den Weg, die fröhliche Melodien spielte. Doch sie wurde nach zwei Stunden von einem Eichhörnchen umgeworfen.
Man setzte eine Belohnung aus: Wer als erster den gesamten Weg durchfuhr, sollte ein Brötchen-Abo für ein Jahr erhalten.Ein älterer Herr erschien mit einem E-Bike, fuhr drei Meter, bemerkte dann die Schlangenlinie des Weges und rief: „Ist das Kunst oder kann man da fahren?“ Er drehte um.
Ein Kind verlor sein Laufrad im Gebüsch bei der ersten Kurve und musste von seiner Mutter gerettet werden.Ein Student versuchte den Weg mit seinem Longboard, doch die Pflasterrillen stoppten ihn jäh.
Ein Influencer drehte ein Video über den Weg und lobte die „meditative Unbenutzbarkeit“. Das Video wurde dreitausend Mal geteilt – jedoch nur von Menschen, die weit weg wohnten.
Da setzte man sich erneut zusammen.„Vielleicht ist der Weg zu gut“, meinte der Bürgermeister nachdenklich. „So gut, dass sich niemand würdig fühlt, ihn zu befahren.“Alle nickten. Denn nicken ist in Offenbach nie falsch.
Und so wartete der Weg weiter – geduldig, still und ganz und gar unbefahren.Wie ein Versprechen, das keiner einzulösen wagt.
Sechstes Kapitel: Von Kosten, Erkenntnis und einer Bank am Wegesrand
Der Radweg lag nun da, wie ein Gedicht, das keiner liest, wie ein Sofa, auf dem niemand sitzt, wie ein Schirm an einem windstillen Tag. Die Blätter fielen, die Farben verblassten, und der Asphalt begann, sich leise zu setzen, als im Rathaus die Stunde der Abrechnung schlug.
Der Kämmerer, ein Mann mit dünnem Haar und dicker Brille, stand vor einer Tafel mit Zahlen und kratzte sich mit dem Bleistift am Ohr, was er stets tat, wenn es teuer wurde. Er hustete leise, dann sprach er: „Die Gesamtkosten betragen ... mehr als geplant.“
Ein Raunen ging durch den Ratssaal.Der Bürgermeister hob eine Braue, so hoch wie nie zuvor. „Mehr als das Hallenbad?“, fragte er. „Mehr als die Bronzestatue von Friedrich dem Unbemerkten?“
Der Kämmerer nickte. „Mehr.“
Man habe vergessen, die Umleitungskosten zu berechnen. Die Beratungshonorare. Den Bagger, der auf dem Spielplatz stand. Die Solarlampen, die nie leuchten. Und das Denkmal für den einzigen geraden Meter.
„Wie viel mehr?“, flüsterte jemand.Der Kämmerer räusperte sich. „Etwa ... dreihunderttausend Euro.“
Ein Schweigen senkte sich über den Saal wie ein dichter Nebel.Dann sprach der Bürgermeister feierlich: „Nun gut. Ein Weg, der so wenig benutzt wird, ist immerhin gut erhalten.“
Einige nickten. Andere starrten aus dem Fenster. Wieder andere dachten an Dänemark.
Da trat der alte Hausmeister wieder hervor, der schon beim ersten Kapitel gesprochen hatte und sagte mit leiser Stimme: „Ein Weg ist nicht immer zum Fahren da. Manchmal genügt es, dass er da ist.“
Die Worte sanken nieder wie Schneeflocken.