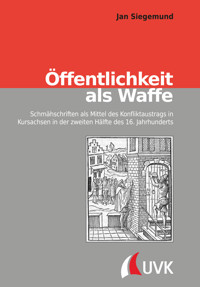
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven
- Sprache: Deutsch
Der Einsatz von Schmähschriften galt als weit verbreitetes Phänomen vormoderner Streitkultur. Die vorliegende Publikation trägt dazu bei, ein neues Licht auf die Strukturen und Dynamiken frühneuzeitlicher Öffentlichkeit zu werfen. Auf der Grundlage von Kriminalakten erstellte, mikrohistorische Fallstudien zeigen, wie diese ,libelli famosi' eingesetzt und verbreitet wurden, welche Effekte sie zeitigten und wie Betroffene sich gegen die oft anonymen, öffentlichkeitswirksamen Angriffe zur Wehr setzten. Die Analyse verdeutlicht daürber hinaus den Sonderstatus der Schriften im Repertoire der damaligen Mittel eines ehrbezogenen Konfliktaustrags, der bedingt war durch eine neuartige Öffentlichkeitssensibilität am Beginn der Frühen Neuzeit, und verweist auf die Existenz einer öffentlichen Meinung avant la lettre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Siegemund
Öffentlichkeit als Waffe
Schmähschriften als Mittel des Konfliktaustrags in Kursachsen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Einbandmotiv: „Von Schmähungen mit Schrifften“, aus: Joos de Damhouder, Praxis rerum criminalium Gründlicher Bericht und anweisung […], Frankfurt am Main 1565 [VD16 D61], fol. 248v. Digitalisat der Universitätsbibliothek Heidelberg, CC PDM 1.0 DEED.
DOI: https://www.doi.org/10.24053/9783739882031
© UVK Verlag 2024— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1437-6083
ISBN 978-3-7398-3203-6 (Print)
ISBN 978-3-7398-0613-6 (ePub)
Inhalt
Meiner Familie ist dieses Buch gewidmet.
Abkürzungsverzeichnis
*
Eigene Paginierung
ADB
Allgemeine Deutsche Biographie
DWB
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, URL: <https://www.woerterbuchnetz.de/DWB>
EDN
Ezyklopädie der Neuzeit
GuG
Geschichte und Gesellschaft
HStD
Hauptstaatsarchiv Dresden
HZ
Historische Zeitschrift
LaSA
Landesarchiv Sachsen-Anhalt
NDB
Neue Deutsche Biographie
Pfarrerbuch
Verein für Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen e. V. (Hg.): Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen, Bd. 1-10, Leipzig 2003-2009
RAW
Ratsarchiv Wittenberg
StadtAD
Stadtarchiv Dresden
StadtAL
Stadtarchiv Leipzig
StC
Staatsarchiv Chemnitz
ZHF
Zeitschrift für Historische Forschung
Danksagung
Wie alle umfangreicheren Arbeiten lässt sich auch eine Dissertation nur gut bewältigen, wenn man sie in einem günstigen Umfeld, professionell wie privat, in Angriff nehmen kann. Ich kann mich glücklich schätzen, dass dies bei mir der Fall war.
Die vorliegende Arbeit wurde im Januar 2022 als Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. phil.) an der Technischen Universität Dresden eingereicht und für den Druck überarbeitet. Entstanden ist sie ebendort am Sonderforschungsbereich 1285 „Invektivität. Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung“ und somit in einem Rahmen, den ich rückblickend nur als privilegiert bezeichnen kann. Der erste Dank gilt Gerd Schwerhoff, der die Arbeit in einer gelungenen Mischung aus Freiraum beim Entwurf eigener Ideen und Unterstützung bei der Entwicklung selbiger betreut hat, sowie Alex Kästner, der mir auch bei kurzfristig(st)en Anfragen immer mit Rat zur Seite stand. Ich bin froh darüber, dass aus dem professionellen Verhältnis bald auch ein freundschaftliches wurde. Gleiches gilt für meine SFB-Kolleg:innen: Stefan Beckert, Philipp Buchallik, Gabriel Deinzer, Ludovica Sasso, Katja Schulze, Franziska Teckentrup, Wiebke Voigt und die Fußballmannschaft „Zwietracht Falkenbrunnen“.
Ulrike Ludwig sei nicht nur dafür gedankt, dass sie das Zweitgutachten übernommen hat, sondern auch für die pointierte und konstruktive Kritik, welche die Arbeit wesentlich verbessert hat. Hiram Kümper ist der Grund dafür, dass ich den Weg in die Wissenschaft einschlagen konnte, hierfür und für seine Unterstützung seit nunmehr zehn Jahren bin ich sehr dankbar. Mit Benny Seebröker und Max Rose wusste ich nicht nur zwei ausgezeichnete Frühneuzeitler, sondern auch gute Freunde an meiner Seite.
Ohne Freund:innen und Familie wäre dieses Buch sicher nicht entstanden, auch bei ihnen möchte ich mich bedanken: bei Lisa dafür, dass sie sich alles anhört und mir immer wieder auf die Beine hilft; bei Dani, Sascha, Melanie und Lukas weil sie mich schon so lange treu begleiten; bei Kaddi für ihr bedingungsloses Wohlwollen; bei Michael für sein Verständnis und das ein oder andere Doppelbock.
Besonderen Dank verdienen meine Eltern Kerstin und Uwe, die alle Grundlagen gelegt und es mir ermöglicht haben, bis hierher zu kommen, meine Schwester Anna, die immer an mich glaubt, und Franzi, die mir Halt gibt und mich stets daran erinnert, was im Leben eigentlich wichtig ist. Euch ist dieses Buch gewidmet.
1Einleitung
Am 25. Juni 1594 erließ der Magistrat der Stadt Leipzig ein Mandat gegen offenbar vielfach in der Stadt zirkulierende famos schrifften, paßquill und anderr schand und schmehekedichte, die zu nichts anders, denn zu aufruhr, vorkleinerung, despect, mißverstand und verbitterung führten und weder herren noch knechtes verschonten.1 Nicht nur die Autor:innen2 der Schmähschriften sollten verfolgt und mit harten Strafen belegt werden, sondern auch diejenigen, die sie verbreiteten, ganz gleich ob öffentlich oder heimlich. Bei dieser Verordnung handelte es sich keineswegs um einen Leipziger Einzelfall, im Gegenteil: Das Mandat berief sich explizit auf bestehendes Reichsrecht. Tatsächlich finden sich ausführliche Bestimmungen gegen schmähende Schriften in den relevantesten Gesetzeswerken des 16. Jahrhunderts, im Strafrecht der Carolina ebenso wie in den Reichspolizeiordnungen und wichtigen Werken der Rechtspraktiker wie beispielsweise Joos de Damhouders praxis rerum criminalium (1554).3 Das Delikt der Anfertigung und Verbreitung von libelli famosi wird in diesen Verordnungen insgesamt als weit verbreitete, äußerst schädliche Praxis bezeichnet. Die Carolina führt es etwa zwischen kapitalen Verbrechen wie Münzfälschung oder Zauberei. Das in diesen Rechtstexten durchscheinende, zeitgenössische große Interesse an Schmähschriften steht im Kontrast zur weitgehenden Vernachlässigung des Gegenstands durch die historische Forschung.4 Dabei wurden sie schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Johannes VOIGT als wichtige Quelle der Geschichtswissenschaft beschrieben.5VOIGT erklärte die Existenz der schmähenden Schriften (die er von akademischen Streitschriften abgrenzte, mit der nur „ein Gelehrter gegen einen Gelehrten“ hätte kämpfen können) mit der streitbaren Natur des Menschen und nahm sie als vox populi ernst, als „Stimmen aus jener Zeit, die uns den Grimm und Zorn der Zeitgenossen über des Kaisers Geistesbann, ihr Seufzen und Klagen über den schweren Druck des kaiserlichen Herrscherjoches jetzt noch vernehmen lassen.“6 Jüngere Forschungen, die sich dem Phänomen ‚Schmähschriften‘ unter aktuellen, kulturgeschichtlichen Fragestellungen widmen, sind hingegen äußerst rar gesät. Dies liegt wohl auch daran, dass in „anonymen und heimlich in Umlauf gesetzten libelli famosi und Pasquille[n] […] Zeugnisse ungezügelter Zornesausbrüche [und] schlicht Kuriositäten einer ‚finsteren‘ Zeit“ gesehen werden.7 Im Gegensatz dazu erfolgt die Annäherung an die behandelten Schmähschriften in dieser Arbeit über die Leitperspektive des Invektivitätskonzepts, das Herabsetzungsphänomene zu relevanten Untersuchungsobjekten bei der Analyse sozialer Prozesse und Strukturen erhebt.8 Invektivität, so die These, die den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen bildet, stellt einen zentralen Aspekt für ein angemessenes Verständnis von den Mechanismen und Dynamiken frühneuzeitlicher Öffentlichkeit dar.9 Schmähschriften bieten dabei einen konkreten Zugang zur Bedeutung von Öffentlichkeit im Alltag der Menschen des 16. Jahrhunderts.
1.1Vielfalt des Untersuchungsgegenstands
Beim Begriff ‚Schmähschrift‘ handelt es sich zunächst um eine vorrangig rechtliche Containerkategorie, die auf den Unrechtscharakter des Gegenstands abhebt. Dass sich hinter diesem Begriff eine große Vielfalt an Schriften, ganz unterschiedlich in Form und Inhalt und aus verschieden gelagerten Kontexten, verbirgt, belegt ein kurzer Blick in einige sächsische Archive.
Beispielhaft versammelt eine zwischen 1583 und 1588 entstandene Akte unter der Überschrift schmeschrifften und famos libel mehrere Schriftstücke unterschiedlicher Couleur, die jeweils eine landesherrliche Untersuchung provoziert hatten.1 Eine wichtige Gruppe bilden gedruckte Bücher, zumeist konfessionell-politische Traktate, die entweder in Sachsen erschienen, oder außerhalb gedruckt aber von Buchhändlern auf der Leipziger Messe verkauft worden waren.2 So beklagte sich der Humanist Nicodemus Frischlin (1547–1590) bei Kurfürst August (1553–1586) über ein in Magdeburg gedrucktes Traktat, durch das er sich als Schmäher des deutschen Adels verleumdet fühlte. Er regte nicht nur eine Inquisition gegen den Drucker an, sondern lieferte das für eine Drucklegung gedachte Manuskript seiner Antwort gleich mit. Ebenso Eingang in die Akte fand ein handschriftlich verfasstes, gereimtes Pasquill, das der Leipziger Bürger Abraham Bötticher gegen den calvinistischen Hofprediger Johann Salmut (1552–1622) verfasst und in der Thomaskirche ausgelegt hatte.
Für den Besitz eines schmehebuchleins, das die Zerstörung des Altars des Heiligen Benno im Meißner Dom thematisierte, mussten sich 1542 zwei Bautzner Kaplane rechtfertigen.3 Sie gaben an, ein Reisender aus Polen hätte ihnen das Werk erfolgreich als ‚neue Zeitung‘ angepriesen. Tatsächlich handelte es sich vor allem um einen schriftlichen Angriff auf die Ehre namentlich genannter Einzelpersonen – was die beiden Kaplane nach eigener Aussage erst zu spät bemerkt hätten.4 Ebenfalls als ‚schriftliche Schmähung‘ bezeichnete die Landesregierung eine Sammlung lateinischer und deutscher Lieder sowie Predigtexte, derentwegen sie 1574 den Küster Matthäus Dorn inhaftieren ließ.5 Dieser hatte die Texte verfasst, teilweise in der Kirche ausgelegt, schließlich unter der Überschrift Pharao Ultimo gesammelt und gemeinsam mit einem unterzeichneten Brief an den kurfürstlichen Hof geschickt.6 In die gleiche Kerbe schlug als famos und injuri schrifft ein lateinisches Gedicht des Studenten Michael Rosinus, das sich gegen Kurfürst Christian I. (1586–1591) richtete und für dessen Anfertigung und Verlesung im Stipendiatenhaus er gemeinsam mit seinem Cousin des Landes verwiesen wurde.7
In gänzlich weltlichen Angelegenheiten wurden in Freiberg im Jahr 1560 ‚Schmähschriften‘ an den Toren des Doms und des kurfürstlichen Schlosses Freudenstein angebracht. Es handelte sich um Beschwerdeschriften neue Methoden der Erzschmelze betreffend, in denen die kurfürstliche Verwaltung harsch angegriffen wurde.8 Eine derartige Kritik an der Obrigkeit findet sich aber auch in anderen Konstellationen und in unterschiedlichen medialen Formen. So verfasste der Bürgermeister von Rochlitz 1574 mutmaßlich ein ‚Schmähgedicht‘ gegen den örtlichen Schösser und hängte es am Rathaus auf.9 Ende des 16. Jahrhunderts ließen gar die Grafen von Mansfeld unter anderem ein anonymes, bissiges pasquil und schmeschrifft auf den Kurfürsten, sowie ein Spottgedicht gegen einen ihnen unliebsamen Bürgermeister anfertigen und veröffentlichen.10
Im sächsischen Hauptstaatsarchiv finden sich außerdem typische, zwecks Einforderung von Schulden ausgestellte ‚Scheltbriefe‘ inklusive entsprechender Darbietungen von defäkierenden Säuen und Eseln sowie Schandstrafen, entweder als aufwendige Zeichnung oder als einfachere textliche Darstellung.11 Vergleichbare schmähende Schriften entstanden auch in anderen Kontexten: So schlug der Händler Andreas Langener 1569 in Dresden mehrseitige, offiziell anmutende und unterzeichnete Klageschriften gegen einen Adligen an, um diesen zum gerichtlichen Austrag eines seit längerem bestehenden Streits zu bewegen.12 Daneben finden sich auch ‚Pasquille‘ in Form von kurzen, anonymen und komischen Spottgedichten, wie sie beispielsweise in Leipzig 1578 gegen mehrere Bürger:innen verbreitet wurden.13 In Hinblick auf den literarischen Anspruch sicherlich am unteren Ende der großen Skala der Schmähschriftenqualität anzusiedeln ist schließlich ein ‚Pasquill‘ in Form eines ungelenken Zweizeilers, das dem Obermeister der Leipziger Schlosser, Hans Müller, mit Fäkalien an die eigene Werkstatt geklebt wurde.14
Die kurze Übersicht macht deutlich, dass die Gegenstände, die unter dem Begriff Schmähschrift oder verwandten Namen gefasst wurden, buchstäblich vom rüde drohenden Schmierzettel aus der Feder nahezu illiterater Personen bis hin zum ausgefeilten, gedruckten theologischen Traktat reichen.15 Vielfalt ist auch hinsichtlich des Umfangs sowie der ästhetischen und materiellen Ausgestaltung zu konstatieren: Es finden sich Handschriften und Drucke, einzelne Zettel und gebundene Bücher, stark beleidigende und förmliche Sprache, Prosa und Gedichte, aufwendige Zeichnungen und schmuckloser Text. Hinsichtlich der Zielpersonen sind vor allem solche Schriften zahlreich vertreten, welche die Obrigkeit kritisierten, jedoch finden sich unter den Betroffenen auch Geistliche, einfache Adlige oder reiche Mitglieder der Bürger- und Handwerkerschaft. Auch Anlässe und Inhalte unterscheiden sich deutlich: Neben den Themenfeldern Politik und Religion konnten alle Formen von (behaupteter) Devianz aufgegriffen werden, wobei Vorwürfe abweichender Sexualmoral sowie ökonomisches Fehlverhalten besonders häufig sind. Es ist also Ulinka RUBLACK zuzustimmen, dass die Schmähschriften „uns in die Welt des politischen Protests und der kleinen Komödien, der Nachbarschaftszwiste und Arbeitskonflikte“ führen.16
Systematische Studien zur Begriffsgeschichte und zum Gebrauch der einzelnen Bezeichnungen liegen bislang nicht vor. Eine Ausnahme bildet der Begriff des Pasquills, dessen Eingang ins Deutsche am Beginn der Frühen Neuzeit zuletzt einige Aufmerksamkeit erfahren hat.17 Entstanden im Zusammenhang mit humanistisch geprägten Gebräuchen, den römischen Pasquinaden, bezeichnete ‚Pasquill‘ zunächst satirische Spottgedichte, die durchaus eine gewisse Legitimität für sich beanspruchen konnten.18 Im deutschen Sprachraum wurde der Begriff seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts allerdings zunehmend als Synonym für illegitime Schmähschriften allgemein gebraucht. In den für diese Arbeit konsultierten Akten zeichnen sich Pasquille gegenüber anderen Schmähschriften aber durch den zusätzlichen Gebrauch von literarischen Stilmitteln (Reime, satirische und komische Elemente) und ihre Anonymität aus. Es ließe sich also etwas überspitzt formulieren, dass im vorliegenden Betrachtungszeitraum zwar alle Pasquille als Schmähschriften, nicht aber alle Schmähschriften als Pasquille bezeichnet werden konnten. Die im Lauf des Jahrhunderts zunehmend bedeutungsgleiche Verwendung der beiden Begriffe kann nach Gerd SCHWERHOFF auf zwei Weisen interpretiert werden, nämlich als ‚Aufwertung‘ der Schmähschriften, denen über die Aufnahme der Pasquille eine gewisse Akzeptanz als Medium potentiell legitimer Kritik zukam, oder als obrigkeitlicher Versuch, alle Schmähschriften – also auch Pasquille – zu kriminalisieren. Der Blick auf die Entwicklung der Rechtsnormen19 und den in den Fallstudien dieser Arbeit sichtbar werdenden Umgang mit den schmähenden Schriften legt nahe, der zweiten Lesart zu folgen – wenngleich auch Positionen zu finden sind, in denen den libelli famosi unter bestimmten Umständen Legitimation zugesprochen wurde.20
In Anlehnung an den Sprachgebrauch der Quellen wird ‚Schmähschrift‘ im Folgenden als Oberbegriff verwendet, unter dem ähnliche Bezeichnungen (etwa ‚Schmähgedicht‘, ‚-zettel‘, ‚-buch‘ oder lateinische Begriffe wie libelli famosi), aber auch die spezifischeren Begriffe ‚Pasquill‘ und ‚Scheltbrief‘21 subsumiert werden.22 In der bislang einzigen umfassenden Untersuchung zu Schmähschriften nimmt Günter SCHMIDT aus rechtshistorischer Perspektive eine Systematisierung der genannten Vielfalt vor, indem er seine Gegenstände auf Grundlage von Rechtstexten in libelli famosi im weiteren Sinn (die er mit ‚Pasquillen‘ gleichsetzt), libelli famosi im engeren Sinn (die einen anonymen Straftatvorwurf enthalten), Scheltbriefe zur Schuldeinforderung und Schriften der Kontroversliteratur einteilt.23 Zwar ist diese Einteilung der von SCHMIDT angestrebten Übersichtsdarstellung sicherlich zuträglich. Einer am historischen Phänomen selbst und der Perspektive der Menschen des 16. Jahrhunderts interessierten Untersuchung erweist sie sich hingegen weniger zweckdienlich, da sie eine scheinbar präzise Unterscheidung vornimmt, die allenfalls auf einen Teil der Quellen angewandt werden kann und zudem dem zeitgenössischen, auf die Schmähung konzentrierten funktionalen Verständnis der Schriften nicht entspricht. Schmähschriften, Pasquille und verwandte Quellen lassen sich nur schwer mit traditionellen, auf formalen Aspekten gründenden Gattungsbegriffen fassen.24 Insofern der Begriff Schmähschrift (unrechte) Herabsetzungen, Angriffe auf die Ehre von Personen oder Gruppen etikettiert, handelt es sich bei ihm vielmehr um eine „category of action“.25 Eine systematische Annäherung an diese Kategorie bedarf dementsprechend der Betrachtung dieser Herabsetzungshandlungen, also der Praxis der Anwendung von und Reaktion auf Schmähschriften, die von der Rechtsgeschichte bislang ausgespart wurde.
1.2Schmähschriften in der Ehr- und Konfliktforschung
Als Akte der Herabsetzung stellen sich Schmähschriften zunächst als Gegenstand der historischen Ehr- und Konfliktforschung dar, innerhalb derer sie jedoch lediglich am Rande thematisiert werden. Das verhältnismäßig geringe Interesse überrascht schon angesichts der großen Aufmerksamkeit, welche die Zeitgenoss:innen den Schmähschriften schenkten. Allerdings finden sich Bezüge auf die Verwendung von Schmähschriften relativ häufig in Fallstudien, die den Gegenstand nicht in den Fokus stellen.1 Im Folgenden sind daher vorrangig Werke aufgeführt, die sich dem Thema explizit und zentral widmen.
Historische Arbeiten zu Beleidigungen beziehungsweise Injurien zählen Schmähschriften zwar erwartungsgemäß zu ihren Gegenständen, lassen diesen aber häufig keine allzu große Aufmerksamkeit zukommen.2 Lediglich Ralf-Peter FUCHS widmet in seiner maßgeblichen Arbeit zu westfälischen Beleidigungsklagen vor dem Reichskammergericht zwischen 1525 und 1805 den Schmähschriften ein eigenes Kapitel und betont dabei ihre Bedeutung, die weite Verbreitung der Praxis und das ihnen innewohnende Drohpotential, das sie von anderen Formen der Injurie abhob.3 Das 16. Jahrhundert bezeichnet er, wie SCHMIDT, als Hochphase des Pasquillenwesens. Ursächlich waren seines Erachtens nach die Ausbreitung der Drucktechnik sowie Themen und Streitkultur der Reformation.4FUCHS unterscheidet in seinen Ausführungen verschiedene Formen von Schmähschriften, nämlich die bereits genannten Scheltbriefe, Pamphlete der humanistischen und konfessionellen Streitkultur (beide zusammengefasst als „Adels- und Konfessionspasquille“)5 sowie solche Schmähschriften, die im Verlauf von Rechtsverfahren ‚entstanden‘: Mit der entsprechenden Etikettierung von Prozessschriften der Gegenpartei versuchten die Akteur:innen, vor allem Anwälte, sich gegen unsachgemäße Beschuldigungen zur Wehr zu setzen. Die Praxis, dem Gegenüber das Anfertigen verleumderischer Schmähschriften zu unterstellen, konnte durch die naheliegende Erwiderung des Vorwurfs zu einem prozesstechnischen „Fass ohne Boden“ werden.6 Dabei ist eine zentrale Erkenntnis, dass es sich bei dem Begriff ‚Schmähschrift‘ vor allem um eine Zuschreibung handelt, die unter Umständen über den bezeichneten Gegenstand wenig aussagt, denn „[g]rundsätzlich konnte fast alles, was schriftlich fixiert worden war, durch eine entsprechende Interpretierung zu einer Schmähschrift werden.“7 Im von FUCHS herangezogenen Quellencorpus, den Reichskammergerichtsakten, finden sich beinahe ausschließlich Vertreter der dritten, in den „Juristenduellen“8 entstandenen Form der Schmähschriften, auf die sich seine Detailstudien entsprechend beziehen. Genuine, zwecks Herabsetzung außerhalb des Prozesswesens entstandene Schmähschriften erfahren daher nur überblicksartige Betrachtung.
In den einschlägigen Sammelbänden zur Ehrforschung wird das Thema kaum behandelt.9 Einzige Ausnahme stellt ein für die vorliegende Arbeit richtungsweisender Aufsatz von Ulinka RUBLACK zu Schmähschriften als „Anschläge[n] auf die Ehre“ dar.10RUBLACK betont die weite Verbreitung der Praxis im europäischen Raum, wobei sie sich nicht auf die bei FUCHS genannten Prozessschriften oder konfessionelle Kontroversliteratur bezieht, sondern auf anonyme, schriftliche Angriffe auf Individuen. Im Rahmen dieses Aufsatzes stellt sie schlaglichtartig wichtige Thesen zur Schmähschriftenpraxis auf, denen auch die vorliegende Arbeit nachgeht: Mit Blick auf ihre Funktionen und Effekte in Konfliktverläufen werden Schmähschriften von RUBLACK als Endpunkte eines von Invektiven geprägten Vorspiels behandelt, die sich anhand dreier Merkmale von anderen Formen der Injurie abhöben. Erstens verhinderten sie durch ihre Anonymität die ansonsten in Ehrhändeln typischerweise umgehend erfolgenden Reaktionen der Betroffenen. Zweitens führten sie zu einem besonders großen Publikum, wobei das Interesse aus dem Unterhaltungswert, der Bekanntheit der Betroffenen und der Brisanz der Inhalte resultierte. Drittens ermöglichten Schmähschriften persönliche wie politische Kritik an Personen, die ansonsten nicht angreifbar waren.11
Insgesamt wird jedoch die Bedeutung von Schmähschriften im frühneuzeitlichen Konfliktmanagement – auch im Vergleich zu anderen Streitmitteln – bislang von der Forschung zur vormodernen Konflikt- oder Streitkultur nicht thematisiert.12 Gleiches gilt für die artverwandte Historische Kriminalitätsforschung, die Schmähschriften zwar als Form der informellen sozialen Sanktion nach gescheiterter Konfliktlösung kennt, ihnen darüber hinaus jedoch keine systematische Betrachtung widmet.13 Derart als soziale Sanktion und Praktik außergerichtlicher Konfliktregulierung betrachtet, stehen die Schmähschriften außerdem den vormodernen Rügebräuchen, wie etwa dem Charivari, nahe.14 Die deutschsprachige Forschung zur Rügekultur, die inhaltliche große Schnittmengen mit der Historischen Kriminalitätsforschung aufweist, beachtet Schmähschriften jedoch – im Gegensatz zur britischen – entweder nicht oder schließt sie gar explizit von Untersuchungen aus.15
In ihren Betrachtungen unterscheidet RUBLACK persönliche von obrigkeitskritischen Schmähschriften. Besonders letzteren spricht sie eine große Wirkkraft zu, die sich aus ihrer Fähigkeit ergebe, eine „Gegenöffentlichkeit“ zur Selbstrepräsentation der Obrigkeit herzustellen.16 Damit spricht sie den Schmähschriften wie FUCHS eine Sonderrolle zu.17 Ebenfalls auf Pasquille als Form der Obrigkeitskritik und „popular media of protest“18 gehen Andreas GESTRICH, Christian KUHN und Andreas WÜRGLER ein – allerdings aus einer öffentlichkeitsbezogenen Perspektive.19 Dabei verweisen die Arbeiten auf die Wirkmächtigkeit des Mediums sowie eine besondere Sensibilität der Obrigkeiten ihm gegenüber, die vorrangig aus einem von diesen wahrgenommenen Zusammenhang zwischen Schmähschrift und Aufruhr resultiert habe. Nach GESTRICH entstanden handschriftliche Schmähschriften in Württemberg gar ausschließlich innerhalb eines größeren politischen Kontexts.20 Schmähschriften, die keine Obrigkeitskritik ausdrückten und in Konflikten zwischen Untertan:innen ohne offensichtlich politischen Streitgegenstand entstanden, kennt die Forschung zwar, sie trennt sie jedoch strikt von den obrigkeitskritischen, die deutlich im Fokus stehen.21
Eine Ausnahme hinsichtlich der Bedeutung von Schmähschriften im Konfliktaustrag jenseits von Obrigkeitskritik bildet die für diese Arbeit instruktive Studie von Matthias LENTZ zu den „Schmähbriefen und Schandbildern des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit“.22LENTZ erkennt das Problem des mangelnden Praxisbezugs in der rechtshistorisch orientierten Schmähschriftenforschung und setzt ihm eine systematische Untersuchung entgegen, ausgerichtet an einer „Sozialgeschichte des Rechts“.23 Gegenstand sind die von ihm strikt definierten Scheltbriefe als institutionalisierter Rechtsbrauch zur Schuldeinforderung, die er als ein Instrument der Ordnungserhaltung und Konfliktbewältigung identifiziert, das sich der Reziprozität, also dem Eingebundensein des Individuums in ein soziales Netz aus wechselseitigen Rechten und Pflichten, als wichtigstem gesellschaftlichen Regulativ bedient, um säumige Schuldner an ihrer Ehre zu fassen und so zur Räson zu bringen. Die Scheltbriefe werden von LENTZ als ein Element der Selbsthilfe des älteren, genossenschaftlich getragenen Rechts gefasst, das seit dem Spätmittelalter von herrschaftlich ausgeübter Jurisdiktion zurückgedrängt wurde.24 Es war demnach das Ziel der Ersteller der Scheltbriefe, erfahrenes Unrecht als gemeinschädlich zu offenbaren und an die Allgemeinheit zu appellieren, die gute Ordnung wiederherzustellen. Zu diesem Zweck sprachen sie ein Publikum an und ließen eine okkasionelle Öffentlichkeit entstehen. An der konkreten Struktur dieser entstehenden Öffentlichkeit und den Mechanismen ihrer Herstellung ist LENTZ hingegen nicht interessiert.
Seinen Untersuchungsgegenstand grenzt er klar von „unspezifisch schmähende[n] ‚kurze[n] Schreiben‘ jedweden Inhalts“ ab, als deren Merkmale er Anonymität und fehlende Regelhaftigkeit feststellt.25 Derartige Schmähschriften aus anders gelagerten Konfliktkontexten blendet LENTZ aus, da er ihnen einen Ausnahmestatus attestiert und ihren Urheber:innen fehlende Rationalität unterstellt.26 Beide Begründungen scheinen nicht haltbar: Zum einen kann mit Blick auf die große Menge überlieferter Schmähschriften und der unter anderem in der zeitgenössischen Rechtsetzung sichtbar werdenden Relevanz des Themas schwerlich von einem Ausnahmestatus gesprochen werden; zum anderen erscheint es als methodisch problematischer Vorgriff, dem Handeln der historischen Akteur:innen Irrationalität zuzusprechen, ohne sich auf entsprechende Fallstudien stützen zu können. Es erscheint daher durchaus lohnenswert, LENTZ‘ Ergebnisse aufzugreifen und mit Blick auf eine breiter gefasste Praxis des ‚Libellierens‘ weiterzudenken.
1.3Schmähschriften in der Öffentlichkeitsforschung
Die genannten Arbeiten verweisen bereits auf eine Verbindung zwischen der Wirkmacht der Schmähschriften und ihrer Fähigkeit, eine große Anzahl an Personen zu adressieren und so eine Öffentlichkeit herzustellen. Demnach heben ehrbezogene Konflikte, in deren Verlauf Schmähschriften zum Einsatz kamen, die „konstitutive Bedeutung des Öffentlichkeitscharakters der Ehre“ besonders hervor und bieten sich entsprechend an, dem Aufruf von Martin DINGES zu folgen, die Analyse von (lokalen) Öffentlichkeiten in die Untersuchung von Ehrkonflikten miteinzubeziehen.1 Schon SCHMIDT deutet anonyme Schmähschriften als Versuche der Autor:innen – die Anonymität lässt durchaus Spielraum für weibliche Autorinnen, wenngleich quasi ausschließlich Männer zu identifizieren sind –, den vorgebrachten Inhalt unter dem Eindruck einer „neuen Form von Öffentlichkeit“ im 16. Jahrhundert weniger als ihre persönliche Meinung denn als eine Form der vox populi zu präsentieren.2 Diese wegweisenden Anmerkungen zur Rezeption bleiben in seiner Untersuchung jedoch Episode und auch die Öffentlichkeitsforschung hat den Zugang über Schmähschriften bislang erst in Ansätzen genutzt.
Christian KUHN setzt sich intensiv mit politischen, sprich obrigkeitskritischen Pasquillen der beginnenden Frühen Neuzeit auseinander, die eine Gegenöffentlichkeit („counter-public sphere“) entstehen ließen. Diese Gegenöffentlichkeit habe in ihren Funktionen, nämlich Legitimation beziehungsweise Delegitimation politischen Handelns und ‚unabhängige Beobachtung‘, bereits Grundlagen für das Entstehen der bürgerlichen oder politischen Öffentlichkeit in der Zeit der Aufklärung gelegt.3 Dabei verweist KUHN auf die Relevanz von multimedialen Kommunikationswegen und öffentlichen Räumen, ohne allerdings diesbezüglich ins Detail zu gehen. Vergleichbare Aussagen trifft Andreas WÜRGLER, der für das 18. Jahrhundert ebenfalls eine Form politischer Öffentlichkeit konstatiert und in obrigkeitskritischen Schriften Appelle an das Publikum sieht.4 Auch die Forschung zu den britischen libels betrachtet diese vor allem als wichtigen Bestandteil der politischen Welt sowie als Ausdruck einer schon im 16. Jahrhundert relevanten öffentlichen Meinung und eines politischen Bewusstseins der breiten Bevölkerung.5 Mitunter werden sie hier, etwa von Pauline CROFT, durchaus als unmittelbarer Ausdruck dieser öffentlichen Meinung gesehen und mit sozialen Rügebräuchen wie dem Charivari gleichgesetzt.6 Zu einem ähnlichen Befund gelangt aus einer anderen, nämlich literaturwissenschaftlichen Fachrichtung kommend die Forschung zur historisch-politischen Ereignisdichtung.7 Bei den von den Autor:innen bearbeiteten Schmähliedern handelt es sich zumeist um „Propagandaprodukte der politischen Führungsschicht“, der ‚Gemeine Mann‘ hingegen tritt hier kaum je als Autor auf.8 Unter der von ihr zuletzt funktional bestimmten Gattung fasst Kellermann ereignisbezogene Texte des Spätmittelalters und der Reformationszeit, die sich im Rahmen politischer Konfliktkonstellationen gezielt an eine Öffentlichkeit wandten. Diese Vorform der politischen Öffentlichkeit wird hauptsächlich über eine Analyse der Textinhalte herausgearbeitet, Verbreitungswege und Resonanzen geraten selten in den Blick.9
Die konkrete Kommunikationspraxis in Bezug auf schmähende „Zeddel“ um das Jahr 1700 wird von Daniel BELLINGRADT untersucht, wobei er von einem technischen Öffentlichkeitsverständnis im Sinne einer Sphäre verdichteter Kommunikation ausgeht.10 Er zeigt auf, wie Schmähschriften in einer multimedialen Kommunikationssituation Wirkung entfalteten, fokussiert jedoch stark auf einen Kommunikationsweg vom Mündlichen zum Druckschriftlichen:
Im konkreten Beispiel zeigt sich, wie aus der Öffentlichkeit des audiovisuell Wahrgenommenen, des Hören-Sehens, eine Öffentlichkeit des Gerüchts wurde, aus welcher sich „Zeddel“ und vereinzelte Flugdrucke generierten, deren Inhalte dann wiederum von neuen Flugdrucken aufgegriffen wurden; letztendlich „wanderte“ das zunächst audiovisuell wahrgenommene, dann mündlich tradierte, schließlich gedruckt-kommentierte Anliegen in die zeitgenössischen regionalen und reichsweiten Presseperiodika.11
Eine derartige kommunikative ‚Einbahnstraße‘ – die BELLINGRADT auch nicht durchgehend derart holzschnittartig präsentiert – wird dem medialen Zusammenspiel von Schmähschriften und mündlichen Kommunikationsformen allerdings kaum gerecht.12 Starke Wechselwirkungen zwischen libels, anderen hand- und druckschriftlichen Medien und oralen Kommunikationsformen wie dem gesungenen Lied, aber auch Gerücht und Gerede konstatiert Peter FOX in seiner Studie zur britischen Kommunikationssituation, die er als von Mündlichkeit geprägt, aber bereits von Schriftlichkeit durchdrungen beschreibt.13
Mit Blick auf den deutschsprachigen Raum verbleiben hinsichtlich der Verortung von Schmähschriften in der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit drei zentrale Leerstellen: Erstens beziehen sich die bestehenden Untersuchungen beinahe ausschließlich auf die Zeit um und nach 1700. Schmähschriften aus der Zeit vor 1700 wurden bislang kaum systematisch thematisiert.14 Durch die Fokussierung auf politische Großereignisse und Unruhen gerät zweitens die Bedeutung von Öffentlichkeit in alltäglicheren Situationen und individuellen, persönlichen Konflikten zumeist nicht in den Blick. Drittens steht der seit langem ostentativ betonten Multimedialität der frühneuzeitlichen öffentlichen Kommunikation eine starke Betonung der Druckpublizistik entgegen. So will auch BELLINGRADT zwar die gesamte mediale Breite in den Blick nehmen, fokussiert letztlich aber primär auf Druckschriften, erklärt den Druck gar zum Teil der „gemeinsamen definitorischen Klammer“ der Flugpublizistik und ordnet Handschriften deutlich unter.15 Eine an den instruktiven Arbeiten von FOX orientierte Untersuchung der Verbreitung handschriftlicher Schmähschriften unter Beachtung der potentiellen Wechselwirkungen unterschiedlicher Medien und Kommunikationsformen steht noch aus.
1.4Arbeitsdefinition und Fragestellung
Aus den zerstreuten Ansätzen der Beschäftigung mit Schmähschriften ergibt sich die Perspektive der vorliegenden Arbeit: Als category of action (KUHN) zusammengefasst, können die hier untersuchten Schmähschriften als Instrumente des Konfliktaustrags definiert werden, die dazu dienten, eine dritte Instanz in einen bestehenden Konflikt einzubeziehen, um das Gegenüber vor dieser oder mit deren Hilfe herabzusetzen.1 Diese dritte Instanz ist als ein tatsächliches oder imaginiertes Publikum zu denken, das in seiner Struktur und Funktion – so viel kann bereits gesagt werden – als Öffentlichkeit angesprochen werden kann. Die über die Schmähschriften verbreiteten Anschuldigungen oder Beleidigungen müssen dabei nicht zwingend mit dem Thema der ursächlichen Auseinandersetzung korrespondieren, wie dies auch für andere Formen der Beleidigung und Verleumdung festzuhalten ist – zu denken ist beispielsweise an Hexereibezichtigungen, die in ursächlich wirtschaftlichen oder politischen Konflikten instrumentalisiert wurden.2
Derart gefasste Schmähschriften können darüber hinaus als ‚Kommunikative Gattung‘ verstanden werden, wie sie von Thomas LUCKMANN konzipiert und zuerst von DINGES auf unterschiedliche Formen frühneuzeitlicher Ehrhändel angewandt wurde.3 Kommunikative Gattungen bieten den Akteur:innen in bestimmten Situationen konventionalisierte Handlungsmuster. Sie sind „Teil des gesellschaftlichen Wissensvorrats […] im konkreten kommunikativen Handeln typisch erkennbar [und] ermöglich[en] die Voraussagbarkeit des Kommunikationsverhaltens“.4 Wie viele Instrumente des Ehrkampfs sind Schmähschriften damit zugleich individuell und standardisiert: Sie stellen eine in medialer Form, Verbreitung und Aussage situativ zugeschnittene Auswahl aus einem bestehenden Repertoire dar.5 Eine derart kommunikationsfunktionale Betrachtung vermeidet die Engführung einer Gattungszuordnung anhand formaler Aspekte, kommt dem zeitgenössischen Verständnis des Gegenstands als Ursache für die eingangs beschriebene Vielfalt der Begriffe und Phänomene entgegen und bietet zugleich die Basis für eine auf Herabsetzung, Konflikt und Öffentlichkeit bezogene Untersuchung. Der ungelenke Zweizeiler am Haus des Schlossermeisters kann damit ebenso wie das mehrseitige anonyme Pasquill gegen den Stadtrat oder der förmliche Scheltbrief innerhalb eines gemeinsamen Bezugsrahmens analysiert werden.
Die vorgeschlagene Arbeitsdefinition umfasst potentiell auch solche, zumeist gedruckte, theologische oder politische Schriften, die von der Forschung in der Regel als Teil der Streit- oder Kontroversliteratur gefasst werden. Diese sollen in der vorliegenden Arbeit jedoch keine Untersuchung erfahren. Zwar spielten auch in ihnen Herabsetzungen, theologisch-politischer Konflikt und die Einbeziehung einer relevanten Öffentlichkeit eine zentrale Rolle.6 Allerdings waren diese Texte im Gegensatz zu den hier behandelten Schmähschriften zumeist auf einen breiteren thematischen Diskurs, auf die schriftliche Erwiderung und somit den Dialog ausgerichtet. Ihre Autoren, und in nicht wenigen Fällen auch Autorinnen,7 handelten weniger innerhalb einer begrenzt-situativen Konfliktsituation, in denen die Schriften lediglich Mittel zum Zweck waren, sondern vielmehr innerhalb eines gesellschaftsübergreifend relevanten Sachzusammenhanges und – zumindest im Fall der konfessionellen Kontroversliteratur – oft aus einem seelsorgerischen Grundgedanken heraus.8 Auch nahm die Auseinandersetzung in der Sache in den Streitschriften tendenziell mehr Raum ein als die explizite Beleidigung. Damit soll jedoch nicht einer strikten Trennung von sachbezogener Kritik und bloßer Schmähung das Wort geredet werden, die das der Arbeit zugrundeliegende Invektivitätskonzept gerade zu überwinden sucht, indem es Formen invektiver Kommunikation als wichtigen Bestandteil öffentlicher Kritik (nicht nur) in der Frühen Neuzeit betrachtet.9 Schon die eingangs aufgeführten Beispiele von ‚Schmähschriften‘ belegen die Relativität der Beurteilung eines Textes als primär herabsetzend. Allerdings lassen sich die meisten Texte durchaus innerhalb eines breiten Spektrums zwischen rein inhaltlich argumentierenden und direkt über Beschimpfung herabsetzenden Schriften verorten. Bei der vorgenommenen Abgrenzung handelt es sich also um eine äußerst unscharfe Trennung mit großen Grauzonen, die an dieser Stelle auch aus praktischen Gründen vorgenommen wird.10
Die genannte Unterscheidung von konkreten Konfliktsituationen und gesellschaftsübergreifenden Sachzusammenhängen lässt eine in der Forschung hinsichtlich Schmähschriften oft vorgenommene Differenzierung zwischen privaten und politischen beziehungsweise öffentlichen Konflikten anklingen. Inwiefern eine solche Dichotomie für die lokalen Streitfällen entstammenden Schmähschriften dieser Arbeit übernommen werden kann und was dies für den Umgang mit den Kategorien ‚öffentlich‘ und ‚privat‘ in der Vormoderne bedeutet, sollen die Fallstudien zeigen.11
Ausgehend von der vorgenommenen Problematisierung von Gegenstand und Forschungslage sollen die kursächsischen Schmähschriftenfälle des 16. Jahrhunderts im Folgenden anhand zweier zentraler Fragestellungen untersucht werden, um so einen Beitrag zur Ehr- und Konfliktforschung einerseits sowie zur Öffentlichkeitsforschung andererseits, aber auch zur Verbindung beider Richtungen zu leisten: Erstens stellt sich die Frage, welche Funktionen den Schmähschriften im Konfliktaustrag zukamen und welche Wirkung ihr Gebrauch im konkreten Kommunikations- und Handlungskontext zeitigte. Dabei gilt es zu zeigen, wie Schmähschriften sich in die bekannten Dynamiken frühneuzeitlicher Ehrkonflikte einfügten und wie sie sich hinsichtlich Motivationslagen und Auswirkungen von anderen Instrumenten des Konfliktaustrags absetzten. Diesbezüglich ist zu unterscheiden zwischen den Kalkülen der Akteur:innen, also einer intendierten Funktion, und den tatsächlichen Effekten. Hinsichtlich der Intention soll untersucht werden, welcher individueller Strategien sich die Verfasser:innen bedienten, um möglichst effektive ‚Treffer‘ bei ihrem Gegenüber zu erzielen.
Zweitens gilt es, nachdem der besondere Öffentlichkeitsbezug der Schmähschriften bereits betont wurde, danach zu fragen, wie Schmähschriften konkret Öffentlichkeit herstellten, welche Mechanismen in der Kommunikation mit und über Schmähschriften sichtbar werden und welchen Einfluss dies auf die Konfliktdynamik nahm. In den Momenten des ‚Aufglühens‘ von Öffentlichkeit im Schmähschriftenstreit werden neben Auffassungen von Strukturen und Mechanismen öffentlicher Kommunikation auch diesbezügliche Ängste durch die Akteur:innen artikuliert, wodurch die Bedeutung frühneuzeitlicher Öffentlichkeit im Alltag der Menschen greifbar wird.12 Kann für Konflikte insgesamt festgehalten werden, dass sich in ihnen zentrale gesellschaftliche Werte und Normen offenbaren, so ermöglichen es Schmähschriftenstreite, Einsichten in grundlegende und weit verbreitete Öffentlichkeitsvorstellungen zu erhalten.13
2Streit, Ehre, Öffentlichkeit – Perspektiven der Arbeit
2.1Invektivität als Leitperspektive
Die in den Fragestellungen betonte Verbindung von Öffentlichkeit und Ehre wird nahegelegt durch das Konzept der ‚Invektivität‘, das die Leitperspektive bei der Erarbeitung der in dieser Arbeit präsentierten Fallstudien darstellte und daher an dieser Stelle kurz expliziert werden soll.1 Invektivität wird als Grundphänomen menschlicher Vergesellschaftung verstanden und bezeichnet Aspekte von Kommunikation – mündliche, schriftliche und nonverbale –, „die dazu geeignet sind, herabzusetzen, zu verletzen, oder auszugrenzen“.2 Auch situative oder strukturell bedingte Akteurskonstellationen, Machtstrukturen und Ressourcenzuteilungen können als invektiv wahrgenommen werden. Die Effekte von Invektiven sind potentiell destruierender, chaotisierender, dynamisierender, aber auch stabilisierender Art, wobei die produktive Seite herabsetzender Kommunikation der destruktiven gleichwertig zur Seite gestellt wird. Am augenfälligsten erscheinen die produktiven Kräfte im Bereich von Inklusions- und Exklusionsmechanismen, da Invektiven „je nach Konstellation […] dazu angetan [sind], den Kreis von Betroffenen entweder in einer Gruppe zu solidarisieren, die Invektierten in Scham zu vereinzeln oder den Fluss der Interaktionen zu unterbrechen und damit Spielräume für Kreativität, Reflexion, Abweichung oder Protest zu eröffnen.“3 Derartige Mechanismen spielten auch für die Funktion von Schmähschriften und die Intentionen ihrer Urheber:innen eine wichtige Rolle.4 Ein besonderes Augenmerk wird im Folgenden auf die Bildung von Wir-Kollektiven durch Schmähung gelegt, die bei der demonstrativen Formulierung von Gruppeninteressen in vielen Schmähschriften von zentraler Bedeutung war.
Zwei Grundannahmen des Invektivitätskonzepts sind für die vorliegende Arbeit von Bedeutung: Erstens ist davon auszugehen, dass sich die herabsetzende Qualität von Äußerungen und Handlungen vorrangig in der konkreten Kommunikationssituation und in der Anschlusskommunikation manifestiert. Die Intention der Invektierenden sowie Form und Inhalt der Invektiven sind hier zwar relevante, aber nicht alles entscheidende Faktoren im Herabsetzungsgeschehen.5 Diese Bedeutung des sozialen Kontextes legt für die Untersuchung von Herabsetzungen eine Kontext- und Konstellationsanalyse nahe, die entsprechend in den mikrohistorisch ausgerichteten Fallstudien dieser Arbeit vorgenommen wird.6
Damit einher geht zweitens, dass sich invektive Kommunikationsakte nicht allein zwischen Invektierenden und Invektierten, sondern unter Einbezug einer dritten Instanz abspielen.7 Dieses triadische Modell der Herabsetzungssituation liegt auch der bereits gegebenen Schmähschriftendefinition zugrunde. Die dritte Instanz kann als Publikum gefasst werden, vor dem und mit dessen Hilfe die Herabsetzung erfolgt. An dieser Position der Triade werden zudem die gesellschaftlichen Werte und Normen wirkmächtig, auf die sich die intendierte Herabsetzung bezieht, die aber auch zur Beurteilung der Invektierenden selbst herangezogen werden: Für eine ‚gelungene‘ Herabsetzung muss das Publikum einerseits die normativen Grundlagen der Beleidigung teilen (beispielsweise Vorstellungen von einem angemessenem Sexualverhalten bei der Beschimpfung als ‚Hure‘), es darf aber andererseits das Verhalten der Beleidigenden selbst nicht als übermäßig deviant beurteilen (indem es sie zum Beispiel als Störenfriede abtut). Die Rollen der Triade können entsprechend rasch wechseln und Invektierende und Invektierte die Positionen tauschen, wenn die dritte Instanz die ursprüngliche Herabsetzung als unangemessen bewertet und somit gegen die Invektierenden richtet.8 Bei dem abstrakt gedachten Dritten kann es sich um ein real versammeltes, aber auch ein potentiell erreichbares Publikum oder gar eine rein imaginative Größe handeln; es darf somit auch als Öffentlichkeit bezeichnet werden.9 Zugleich widerspricht die Betonung einer dritten Instanz im Streit nicht der Beobachtung, dass Konflikte auch dort eskalieren, wo die Akteur:innen lediglich zu zweit und unter Ausschluss von Zuschauenden agieren.10 Auch in einem solchen Fall ist von einer verinnerlichten, letztlich außerhalb des Individuums liegenden normativen Instanz – quasi einem imaginierten Publikum – auszugehen. Existiert ein realweltliches Publikum, ist dieses nicht als monolithischer Block zu denken, sondern als Vielzahl von Rollen: Als Multiplikatoren, Effekt-vermittelnde Mediatoren und Effekt-gestaltende Moderatoren; konkreter als „passive Rezipienten, resonanzgebende Verstärker oder begeisterte Gefolgschaft, als Schiedsrichter oder Mit-Invektierte“.11 In der Rekonstruktion der Schmähschriftenfälle sind diese Rollen, für die sich auch Klagende, Angeklagte und Richter interessierten, von wesentlicher Bedeutung. Demnach müssen adressierte und erreichte Publika sowie die medialen Aspekte ihrer Involvierung durch die Schmähschriften und unterschiedliche Formen der Anschlusskommunikation ebenso in die Konstellationsanalyse einbezogen werden wie die direkt am Konflikt beteiligten Personen.
Durch diese Berücksichtigung des Publikums und seiner Adressierung steht eine am Invektivitätskonzept orientierte Untersuchung frühneuzeitlicher Schmähschriften gewissermaßen an der Schnittstelle der Forschung zu Ehre einerseits und Öffentlichkeit andererseits.12 Diese Verbindung wurde innerhalb beider Forschungsrichtungen bereits nahegelegt: Besonders prägnant zum einen durch Rudolf SCHLÖGL, der die Öffentlichkeit der Frühen Neuzeit als in besonderer Weise von Konflikten geprägt charakterisiert,13 zum anderen durch Martin DINGES, der seit langem die konstitutive Bedeutung der Öffentlichkeit für das Thema Ehre herausstellt:
Erst die konstitutive Bedeutung des Öffentlichkeitscharakters der Ehre sichert auch deren Erforschbarkeit anhand objektivierbarer äußerer Zeichen. Damit wird die Analyse lokaler Öffentlichkeiten zu einem wichtigen Bestandteil der Analyse von Ehrverletzungen. Ich nenne die geschlechtsspezifische Zusammensetzung ihrer Träger, die Räume der Öffentlichkeit wie Plätze, Nachbarschaften, Brunnen, Kneipen und die Medien wie das Gerücht, das Pasquill oder das Pamphlet.14
2.2Ehre in der frühneuzeitlichen Streitkultur
Den Menschen der Frühen Neuzeit stand eine Vielzahl an Instrumenten des Konfliktaustrags zur Verfügung, die individuell, gemeinschaftlich oder obrigkeitlich sowie institutionalisiert oder informell angewandt wurden.1 Ihr Gebrauch unterlag keiner Entweder-oder-Entscheidung, sondern sie wurden abwechselnd und parallel genutzt.2 Zu diesen Instrumenten zählte der Gang vor Gericht ebenso wie Beschickung und Schlichtung, mehr oder weniger stark ritualisierte Rügebräuche oder Drohung, Beleidigung und Gewalt.3 Auch Schmähschriften im Sinn der gegebenen Arbeitsdefinition stellten einen dieser Pfeile im Köcher der Streitenden dar. In Bezug auf individuelle Konfliktbearbeitungswege ist die Frühe Neuzeit als besonders konflikthaft (aber auch konfliktfähig) beschrieben worden.4 Nach dem wegweisenden Ansatz von Rainer WALZ hatte diese Streitanfälligkeit vor allem zwei Gründe: Die Summenkonstanz der Ressourcen, die zu Neid und Missgunst führte, und die Art der Kommunikation unter Anwesenden, die stark auf Ehre gepolt war.5
Die Feststellung, dass man es bei Ehre mit einem ‚Grundprinzip der Ständegesellschaft‘ (VAN DÜLMEN) zu tun hat, ist ebenso unbestritten wie die Tatsache, dass sich dieses Grundprinzip bis heute gegen wirklich griffige Arbeitsdefinitionen sperrt.6 Grund dieses Problems ist auch ein diffuser Begriffsgebrauch in den Quellen, der unter anderem auf die vielfältigen Dimensionen der Ehre zurückzuführen ist: Zu nennen sind sakrale, genealogische, ständische, berufsbedingte, juristische, ökonomische, politische (im Sinne höfischer Reputation) und verinnerlichte, auf das Gewissen bezogene Dimensionen, außerdem die verwandte Unterscheidung zwischen Ehrlich- und Unehrlichkeit.7 Diese teils widersprüchlichen Ehrbezüge erscheinen verständlicher, wenn man Ehre nicht als feste Größe – zum Beispiel als eine Form symbolischen Kapitals8 – sondern als ‚paradoxen Code‘ (DINGES) versteht, worauf noch zurückzukommen ist. Ein solches analytisches Verständnis verkennt jedoch die Perspektive der Menschen der Frühen Neuzeit, die sich durchaus auf die Ehre als konkretes Gut bezogen. Einen Lösungsansatz bietet die Trennung der Fiktion(en) von Ehre vom Vollzug ehrbezogener Handlungen.9 Auf die Fiktion von Ehre als einer „transzendenten Bezugsgröße“10 haben Historiker:innen zwar keinen unmittelbaren Zugriff, sie war jedoch von größter Bedeutung für die Zeitgenoss:innen des 16. Jahrhunderts. Ehre stand gewissermaßen über allen anderen Kategorien sozialer Positionierung wie Alter, Geschlecht, Wohlstand etc.11 Auch auf Ehre als harten rechtlichen Faktor – hier als Leumund zu bezeichnen – muss an dieser Stelle verwiesen werden, sowie auf die Ehre der Herrschenden, ihre Reputation, die Michael ROHRSCHNEIDER zu den wichtigsten Faktoren frühneuzeitlicher Politik zählt.12
Auf der Vollzugsebene kann Ehre als kommunikatives Regelwerk aufgefasst werden, über das ganz unterschiedliche Inhalte und Ansprüche der Kommunikationsteilnehmenden verhandelt wurden.13 Zentrales Charakteristikum dieses Regelwerks oder Codes ist der Zwang, sich auf den Ehrdiskurs und damit auf eine Verlagerung des Konfliktaustrags auf eine andere Ebene einzulassen.14 Allerdings gilt dies nicht für alle Formen von Ehrhändeln. Ehrkonflikte können nach LUDWIG in Wettkampfspiele, Entgleisungskonflikte und Stellvertreterkonflikte unterschieden werden.15 Während bei Wettkampfspielen und Entgleisungskonflikten keine Transformation von der Sach- auf eine Ehrebene stattfand,16 überführten Stellvertreterkonflikte eine Auseinandersetzung in der Sache in einen diese ersetzenden Streit um die Ehre und boten so „die Möglichkeit, jenen ursprünglichen Konflikt neu zu verhandeln beziehungsweise den Gegner, der dazu unter Umständen sonst nicht bereit gewesen wäre, mit Hilfe einer öffentlichen Beleidigung zu einer Neuverhandlung zu zwingen.“17 Sie sind somit als Form der Konfliktregulierung anzusehen. Mit Blick auf den Verlauf der im Folgenden analysierten schmähschriftenbezogenen Auseinandersetzungen ist hervorzuheben, dass Stellvertreterkonflikte oft nach einer ersten Phase verbaler und physischer Aggression abgebrochen und dann vor Gericht angezeigt wurden.
Wurde ein Sachkonflikt einmal auf eine ehrbezogene und entsprechend emotionsgeladene Ebene verlagert, war eine Rückkehr zur Aushandlung ursprünglich relevanter Diskussionspunkte beinahe unmöglich. Zugleich machte der Verweis auf die gekränkte Ehre eine Erklärung dieser Kränkung zunächst überflüssig, was in Bezug auf den ursprünglichen Sachkonflikt (sofern ein solcher vorlag) eine enorme Komplexitätsreduktion bedeutete.18 Da in der extrem ehrsensiblen Gesellschaft der Frühen Neuzeit potentiell jede Kritik in der Sache als Schmähung und Angriff auf die eigene Person verstanden werden konnte, nahm das kommunikative Regelwerk der Ehre größten Einfluss auf die Entwicklung und Dynamik von vielfältigen Konfliktformen. Dabei war nicht die Steigerung der eigenen Ehre dominierend, sondern die Angst, Ehre zu verlieren oder der Wunsch, dem Gegner entsprechend zu schaden.19 Der vorrangig ‚binären Logik‘ (SCHREINER/SCHWERHOFF) der Ehrverletzung folgend, tasteten die Akteur:innen Kommunikation durchgehend auf Ehrverletzungen ab und waren jederzeit bereit, sich einer solchen zu erwehren – das neben einer Klage üblichste Mittel stellte dabei die Erwiderung oder Retorsion dar, sodass es zu regelrechten Beschimpfungsspiralen kommen konnte.20 Diesbezüglich ist von einer Sonderrolle der Schmähschriften auszugehen, da die eigentlich dringend gebotene Erwiderung durch die Abwesenheit oder Unbekanntheit der Verfasser:innen erschwert oder gar unmöglich gemacht wurde.21 Es stellt sich daher in besonderem Maße die Frage nach den Reaktionsmöglichkeiten der Betroffenen und den Erfolgsaussichten in Abhängigkeit von den ihnen verfügbaren Machtmitteln sowie nach dem Einfluss dieser Sonderrolle auf die Perzeption der Schmähschriften im Vergleich zu anderen Konfliktaustragsmitteln. Bei der Steigerung solcher Ehrkonflikte markierten bestimmte Formen beleidigenden Verhaltens die Überschreitung von Eskalationsstufen.22 Besonders augenfällig wird dies bei Übergängen von verbalen Beleidigungen zur gestischen Androhung physischer Gewalt, etwa durch das Ziehen der Waffen. Die Verhandlung von Ehre vor allem über eine binäre Logik bedeutete also nicht, dass Angriffe nicht unterschiedlich stark wahrgenommen wurden. Im Gegenteil: Die Akteur:innen nutzten spezifische Strategien, um gezielte „Treffer“ bei ihren Gegenübern zu landen.23 Dabei gab es sowohl standesspezifische Ehrverletzungen als auch solche, die auf allgemeingültige Werte und Normen rekurrierten. Für Angriffe auf die Ehre stand ein fixes Instrumentarium an beleidigenden Handlungen, Gesten und Worten zur Verfügung, das aber kreativ und mit großem Handlungsspielraum genutzt wurde; man darf bei aller Regelhaftigkeit daher nicht von rein mechanischen oder zwangsweisen Handlungsverläufen ausgehen.24 Beleidigungen konnten nicht nur zwischen Gleichrangigen ausgetauscht, sondern durchaus auch als Waffe im Kampf der Schwächeren gegen die Stärkeren eingesetzt werden.25 Hinsichtlich der Analyse von Ehrhändeln ist – bei aller Berechenbarkeit – auch ein psychologisches Moment im Sinne einer Ventilfunktion und der Stressverarbeitung zu berücksichtigen, das zu einem nicht geringen Grad zur Unvorhersehbarkeit der Konfliktverläufe beitrug und die interpretatorische Suche nach logischen Handlungsmotiven begrenzt.26 Auf welche Weise die Autor:innen von Schmähschriften ihre Gegenüber gezielt herabsetzten, welche Strategien sie anwandten und auf welche gesellschaftlich geteilten Wissensbestände sie dabei zurückgriffen, ist bislang kaum bekannt.
2.3Zum Verständnis frühneuzeitlicher Öffentlichkeit
„Wir müssen in Zukunft zumindest sagen, von welcher Öffentlichkeit wir sprechen […]!“1
Öffentlichkeit kann getrost als einer der problematischsten, da lang und intensiv diskutierten, Begriffe der Geschichtswissenschaft gelten und bedarf daher in besonderem Maß der expliziten Konzeptualisierung.2 Um einerseits die Bedeutung des Öffentlichkeitsaspekts in den zu untersuchenden Schmähschriftenkonflikten herauszuarbeiten und andererseits auf diese Weise Einsichten in die Herstellung dieser Öffentlichkeit sowie in deren Mechanismen zu gewinnen, sollen zwei Perspektiven auf den Gegenstand eingenommen werden: eine technisch-deskriptive in Anlehnung an die Kommunikations- und Mediengeschichte sowie eine normative, der ein gesellschaftlich-funktionales Verständnis von Öffentlichkeit zugrunde liegt.3
2.3.1Öffentlichkeit als Kommunikationsnetz: Öffentliche Orte und Medien
Aus kommunikationshistorischer Sicht lässt sich Öffentlichkeit zunächst als ein durch einzelne Kommunikationsakte gebildetes Netz1 oder als eine Sphäre2 beschreiben, wobei letzteres den räumlichen Charakter hervorhebt. ‚Öffentlich‘ ist Kommunikation in diesem Zusammenhang, wenn sie nicht intim, sondern in möglichst hohem Grad frei zugänglich ist.3 Dieses Netz lässt sich in den Dimensionen Teilnehmende, Medien, Orte bzw. Räume, Zeiten und Inhalte analysieren.4 Über die Erfassung dieser Dimensionen können Strukturen des Netzes, Mechanismen des Öffentlichmachens und somit auch Strategien derjenigen, die Öffentlichkeit adressierten, sichtbar gemacht werden.
Öffentliche Orte
Öffentliche Orte fungieren gleichsam als Knotenpunkte dieses Kommunikationsnetzes.1 Charakteristischerweise sind sie zugänglich für Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Standes und Geschlechts; an ihnen finden komplexe soziale Austauschbeziehungen, Meinungsbildungsprozesse und eben auch Konflikte statt.2 Auf die öffentlichkeitskonstituierende Bedeutung verweist nicht zuletzt der häufige Quellenbegriff in publico loco, der sich auf Kirchen ebenso beziehen kann wie auf Wirtshäuser, Garküchen, Straßen und Brücken. Ihre Relevanz erhalten diese Orte zum einen durch ihre Symbolkraft, was etwa bei Kirchen, Rathäusern oder herrschaftlichen Residenzen besonders augenfällig wird, zum anderen durch ihre Frequentierung. Letztere hängt stark vom Faktor Zeit ab: Kirchen wurden vor allem zum Hauptgottesdient, Marktplätze zur Marktzeit aufgesucht, was sich entsprechend auch auf die Anzahl von Personen auf Straßen und Brücken auswirkte.
Medien der ‚Anwesenheitsgesellschaft‘
Die Betrachtung der Vielfalt kommunikativer Akte und Medien, des gesamten ‚Medienensembles‘, kann als analytischer Standard der Kommunikationsgeschichte gelten.1 In den Blick geraten somit mündliche, hand- und druckschriftliche, bildliche, gestische sowie – im Folgenden weniger relevant – akustische wie olfaktorische Medien.2 Hinsichtlich der schriftlichen Kommunikation ist für die Frühe Neuzeit, an deren Beginn der Eintritt in die ‚Gutenberg-Galaxie‘ (MCLUHAN) vollzogen wurde, eine starke Fokussierung der Forschung auf Druckschriften und tendenziell eine Vernachlässigung der Manuskriptmedien zu konstatieren.3 Die in dieser Arbeit behandelten Schmähschriften wurden hingegen allesamt handschriftlich verfasst. Somit ergibt sich die Möglichkeit, die Potentiale der Handschrift, die für weite Teile der Frühen Neuzeit das für den Alltag der Menschen entscheidende Medium blieb,4 hinsichtlich der Herstellung und Adressierung von Öffentlichkeit auszuloten.5
Besondere Bedeutung für die frühneuzeitliche Öffentlichkeit kam der Kommunikation unter Anwesenden in Form direkter Interaktion zu.6 Rudolf SCHLÖGL spricht diesbezüglich gar von einer ‚Anwesenheitsgesellschaft‘.7 Als Kennzeichen dieser Kommunikation unter Anwesenden erscheint die Tatsache, dass Sender und Inhalt nicht voneinander zu trennen waren und ersterer sich somit der unmittelbaren Reaktion der Anwesenden und damit einem erhöhten Konsensdruck ausgesetzt sah. Hieraus erklärt sich für SCHLÖGL zugleich der augenscheinlich „agonal[e], polemogen[e] Grundzug“ der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit, in der die Positionen der Kommunikationsteilnehmenden – artikuliert durch Praktiken der Ehre – unmittelbar aufeinanderprallten und über Inklusion und Exklusion verhandelt wurden.8 Dabei hatten diejenigen Akteur:innen das größte Potential zur Durchsetzung ihrer eigenen Anliegen beziehungsweise zur Unterdrückung der öffentlichen Kommunikation ihres Gegenübers, die situativ die größeren Machtmittel einsetzen konnten.9 Schriftlichkeit kam besonders dann, wenn anonym publiziert wurde, eine Sonderrolle in der Anwesenheitsgesellschaft zu, da sie die Entkopplung von Sender und Nachricht ermöglichte: Der Sender konnte sich potentiell der direkten Reaktion seines Gegenübers entziehen.10 Schriftliche Kommunikation ließ sich somit gegen althergebrachte Machtmittel einsetzen, sie entzog sich der Kontrolle darüber, ob gelesen wurde und wer las.11
Gerücht und Gerede
Die große Bedeutung der face to face-Kommunikation in der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit führt bereits zu der Erwartung, dass auch die Schmähschriftenpraxis ihre Wirkung zu nicht unwesentlichen Teilen im „mündlichen Kommunikationsgefüge“1 entfaltete. Im Gegensatz zum Umgang mit Printmedien werden die Erscheinungsformen mündlicher Kommunikation selten konkret benannt und konzeptuell unterfüttert. Die Forschung grenzt die verschiedenen Bestandteile des angesprochenen Kommunikationsgefüges (zumeist bezeichnet mit Gerede, Geschwätz, Gerücht, Klatsch und Tratsch, Geschrei, Gemeine Rede oder Sag u. ä.) unterschiedlich scharf voneinander ab und profiliert sie entsprechend ihrer Erscheinungsform und Dynamik, ihrer Teilnehmerkreise und Funktionen und nicht zuletzt ihres Öffentlichkeitsbezugs. Dabei ist der Wortgebrauch zum einen uneinheitlich, zum anderen werden die verwendeten Begriffe und die zugehörigen Konzepte häufig nicht klar definiert. So unterstreicht die häufige gemeinsame Nennung von ‚Gerücht und Gerede‘ die herausragende Bedeutung beider Kommunikationsformen bei der Konstituierung von Öffentlichkeit.2 Unter Gerede werden entweder die unterschiedlichsten Arten mündlicher Kommunikation subsumiert, oder es erfolgt eine Einordung in einen dynamischen Prozess von aufeinanderfolgenden und sich zuspitzenden Phänomenen, nämlich Gerede – Gerücht – Geschrei, wobei es sich vor allem um die Verdichtung von Kommunikation und Verschiebung vom privaten in den semi-öffentlichen und schließlich öffentlichen Bereich handelt.3 Zudem werden Gerede, Geschrei, Gerücht und andere Begriffe teils synonym gebraucht, was zum einen Spiegel der Quellensprache ist,4 zum anderen jedoch – hier vor allem an der undifferenzierten Verwendung der Begriffe Klatsch, Geschwätz und Gerücht zu erkennen – Ausdruck vielfältiger, uneinheitlicher und sich vermischender Bedeutungsaufladungen in der Alltagssprache.5 Es gilt insgesamt, was der Soziologe Jean-Noël KAPFERER über das Gerücht sagt:
Jeder meint, er könne ein Gerücht erkennen, wenn er [es] mit einem zu tun bekomme, keiner vermag indes, dafür eine zufriedenstellende Definition zu geben. Kurz gesagt, jeder glaubt zwar felsenfest, daß es Gerüchte gibt, doch es besteht keinerlei Übereinstimmung, wo genau die Grenzen zu ziehen sind, an denen dieses Phänomen beginnt und endet.6
An dieser Stelle scheint es daher geraten, einige definitorische und konzeptuelle Überlegungen zu den wichtigsten Formen mündlicher Kommunikation anzustellen und mithin invektive Potentiale derselben auszuloten. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für mündliche Kommunikationsphänomene zu erhalten, nicht aber, diese anschließend im Rahmen der Fallstudien in jedem Fall eindeutig zu identifizieren und streng voneinander abzugrenzen, was weder die Konzepte selbst aufgrund ihrer relativen Unschärfe, noch die Quellen wirklich zulassen. Als zentrale Formen können zum einen das ‚Gerede‘ als Grundform gemeinschaftlicher Kommunikation und zum anderen das ‚Gerücht‘ als dasjenige Phänomen, das den stärksten Öffentlichkeitsbezug aufweist, gelten. Stellt das Gerede gleichsam den schwer einsehbaren Ozean mündlicher Kommunikation dar, so treten die Gerüchte als sichtbare Wellen aus diesem hervor an die Öffentlichkeit.7
Gerede
Das Gerede stellte nicht nur in der Frühen Neuzeit die Grundform alltäglicher Kommunikation dar und kann im neutralen Sinn als „Bereden von alltäglichen Dingen als Form der Wissensweitergabe“1 definiert werden. Es lässt sich weder auf spezifische Themen noch auf bestimmte Kommunikationsteilnehmende beschränken. Jedoch war das Gerede in der Sphäre lokaler Gemeinschaft besonders wirkmächtig, grundlegende Untersuchungen zu seiner Funktion beziehen sich daher auf das Dorf.2 Das Gerede sorgte dafür, dass den Mitgliedern der Gemeinschaft „alle Informationen zugänglich waren, die über die Ehre einer Person bestimmten“ und erfüllte dadurch eine ordnungswahrende Funktion.3 Besonders die Vermittlung sozialer Normen und die diskursive Konstruktion von Delinquenz durch das Gerede werden von der Forschung hervorgehoben.4 Es bereitete gewissermaßen Anzeigen bei der Obrigkeit vor, die entweder persönlich erstattet wurden, oder die entsprechenden Instanzen in Form von Gerücht oder Geschrei erreichten,5 wobei sein zugleich kollektiver wie anonymer Charakter Legitimationskraft barg und Schutz des Einzelnen ermöglichte.6
Als eine Sonderform des Geredes kann der Klatsch (auch abfällig Geschwätz, englisch gossip) gelten, der – im Gegensatz zu Gerede und Gerücht – sehr klare Merkmale und einen besonderen Bezug zur Invektivität aufweist.7 Als ‚Sozialform der diskreten Indiskretion‘ (BERGMANN) bezeichnet Klatsch das Reden über nichtanwesende Dritte, wobei Intimsphäre und Diskretionsnormen verletzt werden. Er bedarf einer bestimmten sozialen Konstellation: Klatschproduzierende, -rezipierende und -objekte müssen sich kennen und Teil der gleichen sozialen Gemeinschaft sein. Das unterscheidet den Klatsch vom Gerede und vom Gerücht, die auch mit Fremden geteilt werden können. Da er vorrangig hinter vorgehaltener Hand kommuniziert wird und idiographische, oft banal erscheinende Themen beinhaltet, weist Klatsch nur einen vergleichsweise geringen Öffentlichkeitsgrad auf.8 Obwohl der Gehalt des Klatsches und seine herabsetzende Wirkung unterschiedlich bewertet werden,9 lässt sich ein großes invektives Potential konstatieren, das aus seinen beiden primären Funktionen resultiert: Zum einen erscheint die Teilnahme am Klatsch als „Markenzeichen der Zugehörigkeit zu face-to-face-communities“.10 Die Art und Weise, in der man mit Personen über Dritte spricht – oder eben nicht –, kann Inklusion aber eben auch Exklusion markieren und vollziehen. Die weitaus größere invektive Wirkung wird potentiell allerdings in Bezug auf die Klatschobjekte erzielt. Auch wenn der Klatsch nicht zwingend einen abwertenden Charakter aufweist, so wird inhaltlich doch zumeist ein Normbruch des Klatschobjekts konstatiert, woraus sich eine entsprechende Herabsetzung desselben ergibt.11 Hiermit ist zugleich die Funktion der sozialen Kontrolle angesprochen, die der Klatsch mit Gerede und Gerücht teilt.
Gerüchte
„Alle sagen es.“ – „Wer ist alle?“ – „Niemand Bestimmtes. Aber es liegt was in der Luft.“1
Das Gerücht nimmt eine besondere Stellung in der (geschichtswissenschaftlichen) Auseinandersetzung mit Formen mündlicher Kommunikation ein. Vergleichbar mit dem Klatsch ist auch der Begriff ‚Gerücht‘ mit vielfältigen Bedeutungsaufladungen versehen und bezeichnet potentiell sowohl die Art der Kommunikation als auch ihren Inhalt.2 Es erscheint lohnenswert, sich diesem konstitutiven Faktor frühneuzeitlicher Öffentlichkeit über zwei verschiedene Zugänge anzunähern: Erstens sollen Ansätze der Gerüchteforschung aufgegriffen werden, die einen gewissen Anspruch auf Allgemeingültigkeit formulieren, um ein grundlegendes Verständnis der Kommunikationsform zu erhalten.3 Zweitens müssen die vorliegenden Erkenntnisse der historischen Forschung zum Phänomen ‚Gerücht‘ Beachtung finden; hier erscheint es aufgrund der genannten Etikettfunktion des Gerüchts notwendig, den Wortgebrauch des 16. Jahrhunderts kurz zu thematisieren, denn ein Gerücht ist auch „[…] das, was man als solches bezeichnet, also eine sich geschichtlich wandelnde Konvention, die ganz verschiedene Phänomene meinen kann.“4
Die Forschung bietet bislang keine allgemeingültige Definition des Gerüchts, ja in vielerlei Hinsicht stellt das Thema noch immer ein weitgehendes Forschungsdesiderat dar.5 Dies verwundert umso mehr, als die große praktische Bedeutung von Gerüchten schon lange bekannt ist; Max GLUCKMANN rechnet sie, gemeinsam mit dem Klatsch, gar unter die „wichtigsten gesellschaftlichen und kulturellen Phänomene“.6 Schon die (scheinbar) grundlegende Frage, ob es sich beim Gerücht um ein Medium handelt oder nicht, sorgt für Streit.7 Im Folgenden soll das Gerücht als prinzipiell medienoffene Kommunikationsform verstanden werden, deren primäres Medium das gesprochene Wort und entsprechend wichtigste Bezugsgröße das Hörensagen ist. Das Gerücht ist jedoch nicht an selbiges gebunden, sondern wird – und das ist mit Blick auf die Funktion der Schmähschriften besonders hervorzuheben – auch im Medium der Handschrift und des Drucks transportiert. So konnte John HUNT für das frühneuzeitliche Rom bereits nachweisen, dass mündlich kommunizierte Gerüchte Eingang in Zeitungen und Schmähschriften fanden, selbige aber wiederum Gerüchte anstoßen konnten, man es also mit intermedialen Wechselwirkungen zu tun hat.8
Theoretische Annährungen an das Gerücht
Im Folgenden wird eine Beschreibung des Phänomens ‚Gerücht‘ über dessen Eigenschaften angestrebt, die der sozial-, medien- und kommunikationswissenschaftlichen, aber zum Teil als Vorgriff bereits der historischen Theoriearbeit entnommen sind. Ein Verständnis dieser Eigenschaften kann helfen, auch die Dynamiken und Funktionen der Kommunikationsform in den Falluntersuchungen zum 16. Jahrhundert besser zu verstehen.
Neben der primären Verbreitung über das Hörensagen wird der kollektive und prozesshafte Charakter des Gerüchts übereinstimmend hervorgehoben. Das Gerücht verbreitet sich demnach kettenhaft ‚von Mund zu Mund‘ und erreicht dabei eine hohe Geschwindigkeit. Die Gerüchtekommunikation beschränkt sich nicht zwingend auf miteinander bekannte Personen oder einzelne Gemeinschaften, wie für Klatsch oder Gerede festgestellt. Sie ist im Gegenteil gerade dazu geeignet, sich besonders weit und über räumliche wie soziale Grenzen hinweg zu bewegen. Die kettenhafte Verbreitung führt zudem zur Anonymität, da man in Bezug auf den „gestaffelten Kommunikationsakt“ des Mündlichen immer nur das letzte Glied der Übertragungskette kennt. Alle vorherigen Kommunikationsteilnehmenden bleiben hinter der anonymen Instanz des ‚man sagt‘ verborgen.1 Ebendiese Instanz dient zugleich zur Legitimation des Gesagten: „[W]as alle sagen, ist noch kein Gerücht, sondern das, von dem man sagt, dass es alle sagen“2 – Gerüchte haben also selbstreferenziellen Charakter. Ihr Kommunikationsinhalt ist im Gegensatz zum Klatsch offen, er kann Personen-, Objekt- oder Ereignisbezug aufweisen.3 Allerdings bedarf das Gerücht, damit es als solches Verbreitung finden kann, der – wenn auch nur subjektiv wahrgenommenen – Relevanz für die Gemeinschaft. Diese Relevanz ergab sich in der Vormoderne oft aus einem impliziten Bezug zum Gemeinen Nutzen, sodass Normüberschreitungen als prädestinierte Gerüchteinhalte erscheinen.4 Andersherum kann der Inhalt im Lauf der Verbreitung seine Gestalt verändern: „Durch subjektive Wahrnehmungen, Missverständnisse und sich anlagernde Vermutungen wandelt sich der Inhalt meist so, dass die zugrundeliegenden gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ängste klarer hervortreten.“5
Eine wichtige Eigenschaft des Gerüchts betrifft dessen Beziehung zur Wahrheit. Dabei kann man Gerüchte nicht per se als kontrafaktisch definieren, wie es in der älteren Forschung häufig geschehen ist.6 Nicht nur stellen sich Gerüchte vielfach als wahr heraus, mehr noch: Erst ihre potentielle Glaubwürdigkeit macht sie interessant. Sie befinden sich in einem Prozess der Wahrheitsüberprüfung, der aus dem Gerücht erst eine Lüge, eine üble Nachrede, oder eben eine wahre Nachricht macht.7 Da diese Prüfung für ein Gerücht immer erst noch aussteht, kann der explizit eingeschränkte Geltungsanspruch als ein charakteristisches Merkmal bezeichnet werden.8 Die Beurteilung des Wahrheitsgehaltes wird dabei jedoch subjektiv durch die einzelnen Kommunikationsteilnehmenden vorgenommen; was für die eine Person ‚bloßes Gerücht‘, also die Unwahrheit ist, nimmt die andere gegebenenfalls als sichere Nachricht wahr.
Gerüchte erfüllen potentiell unterschiedliche Funktionen. Auf der Ebene der kommunizierenden Person können sie unbewusst dem Abbau von Spannungen und Affekten dienen oder aber strategisch-bewusst eingesetzt werden, um einen persönlichen Vorteil zu erzielen – sei es die Diskreditierung von Kontrahent:innen oder die Selbstdarstellung als moralisch überlegen oder gut informiert.9 Beides fördert die Verbreitung von Gerüchten. Auf der Ebene der Gesellschaft wird Gerüchten zudem eine substitutive Funktion zugesprochen. Demnach ersetzen sie als mangelhaft oder fehlend wahrgenommene ‚offizielle‘ Informationen.10 Diese sogenannte Surrogat-These erweist sich allerdings für die historische Forschung als höchst problematisch, da sie sich nur schwer auf vormoderne Öffentlichkeitskonzepte anwenden lässt.11





























