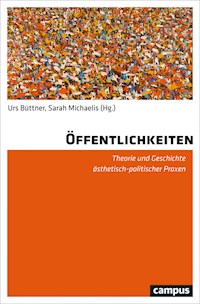
Öffentlichkeiten E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klassischerweise bezeichnet Öffentlichkeit eine Sphäre, in der Menschen Argumente austauschen. Dieser Band hingegen denkt Öffentlichkeiten performativ als gleichermaßen politisch und ästhetisch. Er versammelt historische Fallstudien und theoretische Konzeptionen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Die Fallstudien reichen von ästhetischen Simulationen von Öffentlichkeit über Rhetorikdebatten um 1800 bis zu Zensur in der Gegenwartsliteratur oder Internetaktivismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Urs Büttner, Sarah Michaelis (Hrsg.)
Öffentlichkeiten
Theorie und Geschichte ästhetisch-politischer Praxen
Campus Verlag Frankfurt / New York
Über das Buch
Klassischerweise bezeichnet Öffentlichkeit eine Sphäre, in der Menschen Argumente austauschen. Dieser Band hingegen denkt Öffentlichkeiten performativ als gleichermaßen politisch und ästhetisch. Er versammelt historische Fallstudien und theoretische Konzeptionen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Die Fallstudien reichen von ästhetischen Simulationen von Öffentlichkeit über Rhetorikdebatten um 1800 bis zu Zensur in der Gegenwartsliteratur oder Internetaktivismus.
Vita
Urs Büttner ist wiss. Mitarbeiter am Institut für Germanistik der Heinrich-Heine
Universität Düsseldorf.
Sarah Michaelis arbeitet als Lehrerin am Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg.
Inhalt
Urs Büttner und Sarah Michaelis: Öffentlichkeiten. Praxeologische Perspektiven auf die Ästhetik informeller Politik
Öffentliche Meinung
Kulturelle Öffentlichkeiten
Praxistheorien
Gleichursprünglichkeit
Politische-ästhetische Öffentlichkeiten
Verhältnis von Gegenstand und Methode
Die Beiträge in diesem Band
I. Theoretische Positionen
Harun Maye: Die Öffentliche Meinung. Zur Medientheorie der Gegenaufklärung
Die öffentliche Meinung als Gerücht
Die unsichtbare Hand der öffentlichen Meinung
Der leere Platz des Königs
Markus Wessels: Öffentliche Rede. Rhetorik und Öffentlichkeit von Kant bis Jochmann
Absage an die Rhetorik: Immanuel Kant
Sprechen und Denken: Sprachtheoretische Ansätze in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Verständlichkeit: Aspekte der Oralität und Performativität bei Carl Gustav Jochmann
Oliver Kohns: Der »autoritäre Charakter« und der Verlust von Öffentlichkeit. Eine politische Fiktion des 20. Jahrhunderts
Der ›autoritäre Charakter‹ Horkheimers
Geschichte der Autorität
Der Authoritarian Character, der Feind
Jennifer Pavlik: Öffentlichkeit als Raum ästhetischer Praxis. Zur politischen Ästhetik Hannah Arendts
Freiheit als Sinn des Politischen oder: Hat Politik überhaupt noch einen Sinn?
Handeln als Praxis des In-Erscheinung-Tretens
Die Ausbildung einer ästhetischen Haltung als Bedingung politischer Praxis
Die imaginären Dimensionen des Politischen – Kunst und Kultur als Bedingungen des öffentlichen Raums
Fazit
David D. Kim: Kafkas private Öffentlichkeit. Kritik einer politischen Imagination
Private Öffentlichkeit – öffentliche Privatheit
Die Frage der Ausweglosigkeit
Clemens Pornschlegel: Die kommunistische Hypothese als Idyll. Zum Begriff des Politischen bei Alain Badiou
Vermeintliche Idyllik
Die kommunistische Hypothese
Sarah Michaelis: Vollzugsdenken als Fundament einer ästhetischen Literaturdidaktik
›Private‹ Ästhetiken
›Private‹ Ästhetiken als Grundlegung einer Literaturdidaktik
›Vollzugsmäßige‹ Ästhetik als Grundlegung einer Literaturdidaktik
Michael Hirsch: Ausdruck oder Recht des Volkes – Das Politische oder die Politik?
›Ausdruck‹ anstatt ›Recht‹: Die Formierung von Massen
Figuration und Ausdruck der Gemeinschaft: Zur Ideenpolitik von aktuellem Rechtspopulismus und Linkspopulismus
Das Narrativ des Gesellschaftsvertrags und seine Gemeinschaft: eine egalitäre symbolische Ordnung
Perspektiven fortschrittlicher Narrative
II. Praxisfelder
Patrick Primavesi: Öffentlichkeit als (Selbst-)Inszenierung. Beobachtungsverhältnisse im Theaterdiskurs um 1800
Öffentlich-Werden
Beobachtungsverhältnisse
Streitschriften, Theaterromane und ein Brief
Begegnung des Publikums mit sich selbst
Lisa Bergelt: Dramatische Eigenzeit der Öffentlichkeit in Heinrich Laubes Künstlerdrama Die Karlsschüler
Dramatische Temporalität von Geheimnis und Öffentlichkeit
Öffentlichkeit als Prozesshaftigkeit in Laubes Die Karlsschüler
Vormärzliche Veröffentlichungspraxis als Verzeitlichung des Politischen
Peter Seibert: Künste und ästhetische Geselligkeit – Aspekte von Salonkultur in der Restaurationszeit
Salon als Kunst, Künste im Salon
Musikalische Soireen
Bildende Kunst im Salon der Restaurationszeit
Literarischer Historismus im Salon
Der Salon der Restaurationszeit als Moment ästhetischer Öffentlichkeit
Stefan Tetzlaff: Erzählte Öffentlichkeit nach 1848. Literarischer Realismus und die Semiosphäre der Publizistik
Manipulierte Öffentlichkeit in Arzt und Autor
Verfahrenslogiken erzählter Öffentlichkeit vor und nach 1848
Urs Büttner: Poetik des Sozialen. Heinrich Vogelers Barkenhoff in der Künstlerkolonie Worpswede als Konkrete Utopie
Ästhetik und Politik
Heinrich Vogeler und der Barkenhoff
Konkrete Utopien
David-Christopher Assmann: Öffentlich verfahren. Die Fälle Biller und Herbst revisited
Literarizität
Weißung
Ausgabe
Verfahren
Michael Kämper-van den Boogaart: Der Schulmänner Öffentlichkeiten. Zwei historische Fälle
Fall 1: Fake-Letters an das Archiv
Fall 2: Havensteins Wespennest
Fazit
Emma Holten: »Mich als einen Menschen mit Rechten zu sehen, wäre ein Plus!« Rachepornographie, Gender-Aktivismus im Internet und die Consent-Aktion
Katrin Kreuznacht: Das Zentrum für Politische Schönheit. Ästhetische Praxis und Strukturen des Ungerechten
Künstlerische Praxis als politische Öffentlichkeit: Der Erste europäische Mauerfall
#dietotenkommen – »Wir sind keine Zahlen, wir sind Menschen«
Referenz, Raum und Verfremdung als Spielarten des Ästhetischen
Autorinnen und Autoren
Öffentlichkeiten. Praxeologische Perspektiven auf die Ästhetik informeller Politik
Urs Büttner und Sarah Michaelis
Öffentlichkeiten im heutigen Sinne haben im Westen im Verlauf des 18. Jahrhunderts eigene Praxen und Selbstverständnisse herausgebildet. Das Verständnis von ›öffentlich‹ gewann sein Profil dabei im Zeichen von Gleichheitsvorstellungen, gerichtet gegen Privilegien einer ständischen Herrschaftsordnung. Das lässt sich gut an den Gegenbegriffen zu ›öffentlich‹ ablesen, die in Gebrauch gekommen sind. Die historische Semantik kennt drei solcher Gegenbegriffe: ›geheim‹, ›individuell‹ bzw. ›egoistisch‹ sowie ›privat‹.1 Alle diese Gegenbegriffe legen nichts darauf fest, nicht prinzipiell öffentlich werden zu können. Vielmehr machen sie Vorgaben, was nicht öffentlicher werden soll. Die Unterscheidung zwischen öffentlich und nicht-öffentlich ist somit keine distinkte, ontologische, sondern eine graduelle und normative. Die Gegenbegriffe haben sich zunächst im Zeichen des Schutzes von Öffentlichkeit herausgebildet. Erst später, im Laufe des 19. Jahrhunderts, wurden die Konzepte auch vermehrt im Interesse eines Schutzes vor Öffentlichkeit profiliert.2 Dass es gleich drei Gegenbegriffe gibt, indiziert, dass mehrere Kriterien die normativen Vorgaben steuern: Nicht öffentlicher werden sollen Ansprüche, die sich auf ein Sonderwissen gründen, das einer für andere nicht nachvollziehbaren Herkunft entstammt. Nicht öffentlicher sollen ferner Bestrebungen werden, die auf Sonderinteressen gründen und daher einigen mehr nützen als anderen und sich für die Gesamtheit als nachteilig auswirken könnten. Und nicht öffentlicher werden sollen zuletzt Dinge oder Handlungen, die sich Sonderrechte herausnehmen und damit sittlich Anstoß erregen könnten.3
Dieses Verständnis von ›öffentlich‹ gewann sein Profil im Zuge des Niedergangs des absolutistischen Staats. Der absolutistische Staat gründete in einer territorialen Einheit, die in sich durch asymmetrische Beziehungen zwischen der staatlichen Führung und der Bevölkerung strukturiert war. Diese Asymmetrie prägte gleichermaßen politische, wirtschaftliche, rechtliche und religiöse Beziehungen. In der Bevölkerung sahen die Machthabenden zwar die Grundlage und Bezugsgröße des Staats, schlossen sie aber vom Staat und mithin von eigenen Bestimmungen ihrer Rolle aus. Der Niedergang des Absolutismus gestaltete sich als Schrumpfung des Staats maßgeblich auf den politischen Bereich und als Freisetzung der Bevölkerung für eigenständige Selbstbestimmungen.4
Wenngleich sich in den Institutionen des Staats auch Praxen verdichten, die von einem politischen Selbstverständnis geleitet sind, so lassen sich Staat und Politik doch nicht völlig gleichsetzen. Denn etwa die Steuerbehörde bleibt einer ökonomischen Logik verpflichtet. Dass sich Steuern nicht nur ökonomisch behandeln lassen, sondern etwa im Prozess der Gesetzgebung auch politisch oder bei Vergehen gegen die Steuerpflicht rechtlich, zeigt ferner an, dass jede Art von Praxis sich prinzipiell auf alle Dinge dieser Welt beziehen kann, selbst wenn empirisch bestimmte Kopplungen von Gegenständen und Praxen sicherlich häufiger vorkommen als andere, eben politische Praxen im Staat. Weiter ergibt sich daraus, dass politische Praxen auch jenseits der Institutionen des Staats zu finden sind – nämlich indem sie öffentlich werden. Die Sphäre der staatlichen auf Politik spezialisierten Institutionen steht mithin in einem Wechselspiel mit einem Ensemble von politischen Praxen der Bevölkerung. Dieses Ensemble stützt die Wahldemokratie ab, in der die Bevölkerung im Regelfall nur alle Paar Jahre ereignishaft politisch agiert. Zudem vermitteln diese Praxen die gesetzlich angeleiteten Maßnahmen in den Alltag, etwa durch Organisationen und Interessensverbände. Verschiedene Praxen kompensieren auch dauerhaft Defizite der staatlich institutionalisierten Politik. Sie setzen dort ein, wo die staatliche Politik hinter den normativen Erwartungen in Teilen der Bevölkerung zurückbleibt. Diese Praxen kontrollieren, blockieren und beurteilen die Politik der staatlichen Institutionen und üben so Druck auf sie aus. Sie formieren Korrekturinstanzen oder fungieren als informelle Gegenmacht. Zu ihnen gehören auch Aushandlungsprozesse, die zwischen verschiedenen Interessenlagen vermitteln, Gerechtigkeitsprinzipien klären und nicht zuletzt die Grenzziehungen zwischen Öffentlichem und Nicht-Öffentlichen bestimmen.5 Dieses Feld informeller Demokratie bildet ein weites Terrain, das sich nicht leicht kartieren lässt, da die Übergänge zur professionalisierten Politik fließend sind. Das zeigt sich daran, dass Begriffe wie ›Zivilgesellschaft‹ oder ›soziale Bewegungen‹, die genau diese Übergangszone umreißen, in der Extension ihrer Referenz oft unscharf gebraucht oder umstritten sind.6 Im Folgenden soll versucht werden, und diese Skizze fällt sicherlich etwas schematisch aus, eine übergreifende Perspektive auf dieses Feld informeller politischer Praxen und ihrer Bezüge unter dem Leitbegriff der ›Öffentlichkeiten‹ zu entwickeln.
Das Selbstverständnis der Bevölkerung als Öffentlichkeit gründet darin, dass die Bevölkerung von sich selbst eine sinnliche Erfahrung gewinnt: Die Akteure werden für einander wahrnehmbar und adressierbar. Sie erleben sich inmitten vieler anderer Menschen, die alle in Erscheinung treten.7 Bereits im Akt des Erscheinens wird dabei der inszenatorische Charakter von Selbstbestimmung gesehen und nicht erst darin, dass die Akteure die Öffentlichkeit sprachlich zur ›Öffentlichkeit‹ erklären und genauer reflektieren und explizieren, was eine Öffentlichkeit kennzeichnet. Die Politik nähert sich dadurch, sicher nicht begrifflich, aber phänomenal bis zur Ununterscheidbarkeit der Ästhetik an. Ästhetik muss dabei im umfassenden Sinne von Aisthesis als künstliches Arrangement von Wahrzunehmendem verstanden werden, schließt spezifisch künstlerische Darbietungen also mit ein. Dabei aktualisiert sie Muster höfischer Inszenierungen, in denen die Standeszugehörigkeit als Wesenseigenschaft Ausdrucksqualitäten besaß. Schmuck und Kleidung, genauso die Art des Auftretens und wo und wann sich jemand zeigen durfte, verwiesen auf bestimmte gesellschaftliche Positionen. Die Inszenierung repräsentierte hier also innere Wesensqualitäten. Mit dem Niedergang der Ständegesellschaft des Absolutismus durchlief diese Vorstellung allerdings eine entscheidende Transformation: Nun galt es, sich selbst zu zeigen. Das eigene Selbst wird dabei nicht mehr als feststehende Wesensqualität gedacht, die es in vorgeprägten Formen zu veräußerlichen gilt. Das Selbst muss vielmehr erst hervorgebracht werden und zwar in seiner Gestaltung. Somit tritt das Wesen allererst in seinem Ausdruck hervor.8 In der Weise, wie sich jemand präsentiert, gibt er oder sie sich nun als er oder sie selbst. Die repräsentative Öffentlichkeit wandelte sich im bürgerlichen Zeitalter mithin zu einer präsentativen.
Unter demokratischen Vorzeichen kommt der Bevölkerung legitimatorisch eine Doppelrolle zu: sie ist zugleich Herrscherin und Beherrschte. Faktisch teilen sich diese beiden Rollen jedoch meist institutionell auf und kommen dadurch nicht in Konflikt miteinander. Während in den staatlichen Einrichtungen die Repräsentanten der Bevölkerung das Regierungsgeschäft übernehmen, beschränkt sich der größere Teil der Bevölkerung auf die Rolle der Untertanen. Wenn Teile der Bevölkerung als Öffentlichkeit erscheinen, müssen sie die Doppelrolle jedoch in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit ausagieren. Dies geschieht durch Verhältnisbestimmungen zum Staat und zur Gesamtbevölkerung, die im Rahmen von Gleichheitsvorstellungen gleichermaßen Identifikation und Abgrenzung organisieren müssen. In dieser Zwischenposition aktualisiert die Öffentlichkeit dazu zwei ältere Vorbilder: zum einen das Bild des Marktes, zum anderen die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde.9 Daraus gehen zwei deutlich unterscheidbare Bestimmungen von Öffentlichkeiten hervor, die als öffentliche Meinung und als kulturelle Öffentlichkeit genauer beschrieben werden sollen. Beide bilden Extremformen eines Spektrums von Ausgestaltungen ganz verschiedener Öffentlichkeiten. Empirisch sind deswegen sowohl Mischformen als auch die gegenseitige Abgrenzung der beiden Extremformen zu beobachten.
Beide Ausformungen von Öffentlichkeit lassen sich idealtypisch in der Gegenüberstellung nach fünf Gesichtspunkten charakterisieren: Die unterschiedlichen Vorbilder der Öffentlichkeiten leiten nämlich divergente sozialontologische Bestimmungen des Verhältnisses von Individuum und Kollektiv an. Affin dazu sind jeweils bestimmte Vorstellungen von Sprache. Diese haben wiederum Auswirkungen darauf, welche Begründungslogik von Kritik in beiden Ausformungen von Öffentlichkeit dominant werden konnte. Schließlich konstituieren sich Öffentlichkeiten in einem doppelten Bezug auf den Staat und die Gesamtbevölkerung und nehmen dabei eine Vermittlerfunktion ein. Auch in dieser Verhältnisbestimmung zur staatlichen Sphäre wie zur Gesamtbevölkerung unterscheiden sich die beiden Grundvorstellungen von Öffentlichkeiten. Zuletzt bildet die Trias der Gegenbegriffe zu öffentlich den Maßstab für Ausschlüsse aus der Öffentlichkeit.
Öffentliche Meinung
Bereits in der politischen Theorie der Antike gab es die Idee, dass es abgetrennt von der staatlichen Sphäre eine Sphäre gäbe, die einer ökonomischen Logik verpflichtet sei. Diese Vorstellung griffen politische Theoretiker der Neuzeit wieder auf und identifizierten die ›Gesellschaft‹, unterschieden vom ›Staat‹, weithin mit einer Marktlogik.10 Eine solche Logik muss nicht allein beschränkt bleiben auf den Handel mit Geld und Gütern, sondern kann sich auch auf die Aushandlung von Meinungen beziehen. Geldzahlungen, die der Meinungsmache dienen, dürfen in der öffentlichen Meinung allerdings keinen Einfluss ausüben. Denn die Währung und Ware der öffentlichen Meinung sind Ideen, Meinungen und Vorschläge: Interessen summieren sich dabei wie Kräfte, heben einander auf oder lenken einander nach dem Kräfteparallelogramm um. Und das Urteil der Beteiligten taxiert den Wert verschiedener Vorschläge. Entscheidungen bestimmen sich danach, welche Meinung die größte Nachfrage erreicht.11 Eine solche verallgemeinerte Marktlogik bildet das Ideal der öffentlichen Meinung.
Die Marktlogik der öffentlichen Meinung gründet in einem Individualismus, der große Affinität zu liberalistischen Sozialontologien zeigt. Diese sehen das Individuum als vereinzelt neben anderen Individuen, in sich abgeschlossen und aus sich heraus handelnd an. Kollektive stellen dem Primat des Individuums gegenüber eine abgeleitete Größe dar und formen sich durch das Zusammenwirken oder den willentlichen Zusammenschluss von Individuen.12 Kollektivität aggregiert sich erst durch das Wechselwirken der verschiedenen Interessen und Meinungen oder den willentlichen Zusammenschluss aus gemeinsamen Interessen.
Im Einklang mit diesem Individualismus steht auch das Sprachverständnis der öffentlichen Meinung. Idealerweise sollten sich rein ideelle Gehalte unmittelbar von Kopf zu Kopf vermitteln lassen.13 Da das aber nicht möglich ist, braucht es eine zeichenhafte Repräsentation der Ideen. Diese Repräsentation soll die Ideen möglichst nicht verunreinigen, nichts hinzutun und nichts entfernen, folglich als Medium unauffällig bleiben. Diese Bedingungen erfüllt die Wortsprache, insbesondere in schriftlicher Form, am ehesten. Die öffentliche Meinung bemüht sich also darum, die eigenen Vorschläge möglichst diskursiv zu präsentieren, im Sinne einer logisch nachvollziehbaren Argumentation. Um die Unauffälligkeit der Sprache als Medium zu unterstützen, verfolgt die öffentliche Meinung zudem ein anti-rhetorisches Ideal der Zurückgenommenheit und Schlichtheit. Das Zurücktreten des Ausdrucksmediums lässt, so ihre Vorstellung, die Gehalte hervortreten. Ästhetisch gesehen folgt die öffentliche Meinung in ihrer Politik-Inszenierung mithin einem Ideal der Entsinnlichung.
Der Inszenierung von Diskursivität korrespondiert, wie idealer Weise Kritik geäußert wird. Der Appell der öffentlichen Meinung richtet sich an die Vernunft als ein Vermögen, über das prinzipiell alle Menschen verfügen. Unter der Voraussetzung, dass sich darüber eindeutig befinden lässt, welcher Vorschlag am vernünftigsten ist, begründet es das Ideal eindeutiger Entscheidbarkeit und konsensueller Urteile. Faktisch wirkt der Urteilsmaßstab der Vernünftigkeit jedoch höchst exklusiv.14 Vorschläge als ›unvernünftig‹ zu bezeichnen, disqualifiziert nicht allein sie. Im Wiederholungsfall wirft die Abwertung die grundsätzlichere Frage auf, ob die unvernünftigen Vorschläge nicht auf die mangelnde Fähigkeit zum Gebrauch der Vernunft oder deren gänzliches Fehlen verweisen. In diesem Fall dürfte der Akteur seine Meinung nicht mehr öffentlich kundtun. Zu solchen Ausschlüssen muss es kommen, denn die Vernünftigkeit hat sich nicht als der universelle Maßstab erwiesen, den die öffentliche Meinung sich von ihr erhofft hat. Hinzu kommt, dass verschiedene Logiken wie die politische, die ökonomische, die rechtliche je ihre eigenen Vorstellungen von Vernünftigkeit haben. Das bedeutet, dass es schon historisch zu jener Zeit, als die öffentliche Meinung ihr Selbstverständnis herausbildete, keine Einheit der Vernunft gab. Dies hat zur Folge, dass Vernünftigkeit nicht den universellen Urteilsmaßstab bilden kann, der Konsequenz garantiert.15
Gerade weil der Selbstanspruch auf Vernünftigkeit nicht das leistet, was die öffentliche Meinung sich von ihm erhofft, scheint eine bestimmte ästhetische Inszenierung der Vernünftigkeit unumgänglich. Indem die Wortmeldungen bestrebt sind, entindividualisiert, zeitlos und eindeutig zu wirken, nähern sie sich der Sachlichkeit und Nüchternheit der staatlichen Sprechweisen in Gesetzestexten und Verordnungen an. Die öffentliche Meinung sucht damit nach einer gemeinsamen Sprachebene mit den Akteuren des Staats, um Anschlussfähigkeit zu erreichen und letztlich auf die Beschlüsse des Staats einzuwirken. Weil dies allerdings dem öffentlich präsentierten Selbstbild widerspricht, ist die öffentliche Meinung zugleich bestrebt, ›informelle‹ Gespräche und Lobbyarbeit nicht weiter publik werden zu lassen. In der sprachlichen Inszenierung von Vernünftigkeit liegt zugleich ein eigener Machtanspruch der öffentlichen Meinung, der sie von der staatlichen Sphäre absondert.16 Mit der Vernunft postuliert sie einen Urteilsmaßstab, der beansprucht, den Parteilichkeiten des Staats übergeordnet zu sein. Die öffentlich vorgebrachten Vorschläge beanspruchen in diesem Sinne vernünftig zu sein, insofern sie das weitgehende Ausbleiben von Widerspruch der Gesamtbevölkerung als Zustimmung nach gedanklicher Prüfung und Auslese deuten. Selbst nicht demokratisch legitimierte Staatswesen können es sich daher kaum leisten, die Appelle der öffentlichen Meinung zu ignorieren. Totalitäre Systeme gehen deshalb in Teilen soweit, eine öffentliche Meinung zu simulieren. Zwar wird eine Opposition unterdrückt, doch ist dem Staat daran gelegen, dass im Grunde linientreue Protagonisten öffentlich Verbesserungsvorschläge anbringen. Wenn es in solchen Systemen doch eine wenig machtvolle Opposition wagt, in die Öffentlichkeit zu treten, ist sie oftmals genötigt, eigene Machtansprüche gegenüber der Staatsmacht zu verbergen, will sie nicht mit ihr in Konflikt geraten. Die Notwendigkeit der Verbergung ergibt sich hier daraus, dass die öffentliche Meinung ihre Machtansprüche erhebt, ohne dafür von der Bevölkerung regelrecht legitimiert worden zu sein, was wiederum zur Folge hat, vom Staat nicht vollwertig als politische Institution anerkannt zu werden. Die öffentliche Meinung verfährt dabei so, dass sie den Machtanspruch nicht offen artikuliert, ihn aber performativ dennoch erhebt. Dabei setzt sie auf eine indirekte Strategie, indem sie von ihren eigenen Machtansprüchen abblendet, an allgemeine unstrittige patriotische Werte appelliert und sich stattdessen einzig auf die Inszenierung der Machtfülle des Staats fabriziert. Dabei prägt sie der Inszenierung aus ihrem Machtanspruch heraus eine bestimmte Wertung auf, lenkt die Aufmerksamkeit zugleich aber von sich weg auf den Staat hin. Die öffentliche Meinung versucht dabei zu zeigen, dass die Machtfülle des Staats eigentlich viel größer ist, als dessen Akteure preisgeben wollen. Die Akteure des Staats haben weitaus größere Spielräume der Gesetzgebung und sollten diese ›vernünftiger‹ als im Moment nutzen.
Diese Machtansprüche kann die öffentliche Meinung nur solange erheben, wie ihre Vernünftigkeit selbst nicht in Frage steht. Sie erscheint der öffentlichen Meinung aber als stets bedroht, denn die Gesamtbevölkerung, in deren Namen sie zu sprechen beansprucht, genügt keineswegs als Ganze dem eigenen Vernunftideal. Deswegen wird diskutiert, bestimmte Teile der Gesamtbevölkerung nicht zuzulassen, weil sie ›unvernünftige‹ Sprechpositionen einnehmen. Orientierung für die Ausschlüsse gibt dabei die normative Kriterientrias der Gegenbegriffe zu öffentlich vor: geheim, individuell bzw. egoistisch sowie privat. Beispielsweise ist immer wieder fraglich, ob religiös begründete Argumente, die sich auf prophetische Gaben oder die Offenbarung des Glaubens stützen, zur öffentlichen Meinung zugelassen werden sollten. Genauso sehen viele Kritiker es als disqualifizierend an, von wirtschaftlichen Eigeninteressen gelenkt zu sein. Und bei Kunstaktionen herrscht oft Argwohn, ob sie nicht die Sittlichkeit und zivile Ordnung gefährden.17
Kulturelle Öffentlichkeiten
Um das Verständnis von Öffentlichkeiten als Sphäre der Kultur zu erhellen, ist ein historischer Rückgang auf die christliche Zwei-Reiche-Lehre hilfreich, denn in säkularisierter Form wirken dessen Leitunterscheidungen im Selbstverständnis der kulturellen Öffentlichkeit nach.18 Vor allem im Ausgang von Augustinus sah die christliche Doktrin die Menschen als Untertanen zweier Reiche, als Untertanen eines weltlichen Regiments, zugleich aber auch als Untertanen eines geistlichen Regiments. Die Schwierigkeiten, Diener zweier Herren zu sein, spitzten sich während der Europäischen Glaubenskriege zu, so dass nähere Verhältnisbestimmungen der beiden Reiche zueinander notwendig wurden. Dabei kam es zu zwei grundlegend verschiedenen Auffassungen: Die katholische und lutherische Lesart bestimmten das geistliche Regiment in einer Weise, dass es in seinen Verpflichtungen denen des weltlichen Regiments nicht in die Quere kommen dürfe, sondern neben ihm zu verorten sei. Die reformierte Tradition hingegen profilierte das geistliche Regiment stärker kompensatorisch zum weltlichen Regiment oder in direkter Opposition dazu. In diesen Bestimmungen des geistlichen Regiments sind die drei politischen Positionierungen von kulturellen Öffentlichkeiten präformiert: neben dem Staat, anstelle des Staats und gegen den Staat. Gleichzeitig hatte durch Reformation und Gegenreformation eine Systematisierung der Lebensführung eingesetzt. Leitend war dabei die Vorstellung, dass die sonntägliche Festinszenierung der Gemeinde nur der herausgehobene Höhepunkt eines immerwährenden Gottesdienstes sei. Alle alltäglichen Verrichtungen sollten von dem göttlichen Gebot gelenkt sein und der Verherrlichung Gottes dienen, nicht nur der Feiertag allein. Diese Vorstellung vom Alltag als immerwährendem Gottesdienst ließ sich säkularisiert einfach als Grundmuster auf den Dienst an der Kultur übertragen. Die Heiligkeit der Nation und ihrer Kultur ersetzt dabei die Systemstelle des christlichen Gottes. Aus dieser ritualistischen Tradition wird die Bedeutung ästhetischer Inszenierungen erklärlich.19
Von der christlichen Glaubensvorstellung abgeleitet, verstehen sich die Akteure der kulturellen Öffentlichkeit gleichermaßen als Individuen und als Teil einer Gemeinschaft. Individualität und Kollektivität sind damit sozialontologisch gesehen stets aufeinander verwiesen. Das Individuum ist mithin nicht isoliert und in sich abgeschlossen gedacht, sondern immer bereits in mannigfaltige zwischenmenschliche Beziehungen, Kulturmuster, Traditionen und Wertorientierungen eingebunden. Insofern sind das Individuum und das Kollektiv nicht voneinander zu trennen und in einem solchen Holismus gleichermaßen ontologische Grundgrößen.20
Zu dieser sozialontologischen Fundierung passt das Sprachverständnis. Die kulturellen Öffentlichkeiten gehen davon aus, dass zeichenhafter Ausdruck und Bedeutung sich nicht voneinander ablösen lassen. Die spezifische Gestalt erzeugt erst genau diese Bedeutung und genau diese Bedeutung wäre in keiner anderen Gestalt vermittelbar. Daran knüpft sich auch ein denkbar weiter Sprachbegriff an, der nicht auf Schrift oder Wortsprache limitiert ist, sondern prinzipiell jeglicher Erscheinungsform auch ihre je eigene Bedeutung zugesteht. Prinzipiell gibt es von diesem Sprachbegriff ausgehend keine privilegierten Ausdrucksformen. Doch ziehen auffällige Ausdrucksformen schneller die Aufmerksamkeit auf sich, so dass Rhetorik und Schmuck oftmals zur Steigerung der Expressivität eingesetzt werden. Manchmal aber können auch leise Töne viel wirkungsvoller sein; etwa wenn eine feierliche Stimmung der Andacht beschworen werden soll.
Von der öffentlichen Meinung unterscheiden sich kulturelle Öffentlichkeiten nicht nur im Hinblick auf das Sprachverständnis, sondern auch in der Art und Weise, wie dort Kritik geübt wird. Ausgangspunkt für die Kritik bildet der Umstand, dass sich jedes Erscheinen im öffentlichen Raum von anderen Inszenierungen abhebt. Im Zuge des Abhebens verweist der Ausdruck gleichsam zurück auf den Hintergrund, vor dem er hervortritt und markiert dadurch, dass es immer auch anders geht. Kritisch kann man eine Inszenierung nennen in dem Maße, in dem sie sich nicht nur als bloße Möglichkeit unter vielen anderen zeigt, sondern deutlich als Alternative zu einer, mehreren oder letztlich allen vergleichbaren Praxen auftritt und damit einen normativen Anspruch auf Verbindlichkeit erhebt. Prinzipiell geht der kritische Anspruch mit einer Steigerung der Unterscheidbarkeit einher, wodurch die Chance steigt, einen größeren Adressatenkreis zu erreichen. Die Ausgestaltung führt zu einer spezifischen Begründungslogik der Kritik: kulturelle Öffentlichkeiten begründen ihre Kritik meist immanent.21 Sie zeigen die Inkonsistenz innerhalb eines Praxenverbands oder zwischen Selbstanspruch und Praxis auf. Dabei legt die Kritik Einheitlichkeit, Harmonie und Ganzheit als normative Ideale zugrunde. Da sich die Inkonsistenz prinzipiell aber immer zu verschiedenen Optionen hin auflösen und harmonisieren ließe, muss ein zweites normatives Ideal hinzukommen, das der Authentizität oder Nicht-Entfremdetheit. Die Idee ist dabei, dass Ausdruck und Wesen einander entsprechen sollen, doch zugleich lässt sich das Wesen nur an wesensgemäßen Ausdrucksformen ablesen.22 Diese zirkuläre Begründungslogik ist der Grund, warum die behauptete Authentizität vergleichbar mit dem Vernünftigkeitskriterium der öffentlichen Meinung oft mit großem Aufwand erst inszeniert oder wenigstens behauptet werden muss. Dem Authentizitätskriterium fehlt also ein Bezugspunkt und damit die Eindeutigkeit, die es verspricht.23
Der Tendenz nach suchen kulturelle Öffentlichkeiten deutlich stärker die Distanz zum Staat als die öffentliche Meinung. Ihre Staatsferne gestaltet sich dabei innerhalb eines breiten Spektrums an Positionen: von der Kritik an Defiziten der Eigenlogiken institutionalisierter Politik bis zum Wunsch nach gänzlicher Abschaffung des Staats. In diesem breiten Spektrum deutet sich bereits an, dass die politische Rolle, die der Bevölkerung zugedacht wird, von der Vielzahl an kulturellen Öffentlichkeiten höchst unterschiedlich bestimmt wird.
Eine kulturelle Öffentlichkeit neben dem Staat wird ihren Ausdruck im Rahmen der vom Staat garantierten Freiheits- und Persönlichkeitsrechte gestalten. Dabei zeigen sich jedoch schnell die Schwierigkeiten einer Politik, die fast ausschließlich auf der Inszenierung der Bevölkerung aufbaut, der deliberative Momente der Entscheidungsfindung weitgehend fehlen: Lebensstilen und Moden ist zwar ein normativer Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit beigelegt. Dadurch überwiegen die kollektivierenden Momente dieser Praxen und die Spielräume für Individualisierungen bleiben eng bemessen. Doch führt dies dazu, dass sich die Grenzen ihrer Fähigkeit zur Kollektivierung dort zeigen, wo die Spielräume zur Individualisierung nicht mehr ausreichend scheinen. Wenn bestimmte Ausdrucksformen von immer größeren Teilen der Bevölkerung übernommen werden und damit Mainstream werden, werden sich an den Rändern in der Regel neue Distinktionsformen von Lebensstilen ausprägen und Moden veralten. Der Anspruch dieser Öffentlichkeiten, Erscheinungsraum der Gesamtbevölkerung zu sein, lässt sich also kaum erfüllen.
Öffentlichkeiten anstelle des Staats inszenieren diesen Bezug als Abgrenzungsgestus. Sie artikulieren ihren Machtanspruch, dem freilich die Legitimation fehlt, indem sie veranschaulichen, dass die Machtfülle des Staats kleiner ist, als dieser beansprucht.24 Entweder erklären sie, der Staat bleibe hinter seinen Regulierungsansprüchen zurück oder in von Seite des Staats deregulierten Bereichen ergäben sich Probleme der Freiheitsrechte, sozialer Ungleichheit oder der Integration. Dabei verfolgen diese Öffentlichkeiten zwei unterschiedliche Strategien. Indem sie auf bestimmte Probleme aufmerksam machen, versuchen sie eine Diskussion über ihre Aktionen in der Bevölkerung und letztlich auch innerhalb der gesetzgebenden Institutionen des Staats anzuregen. Bleibt der Staat dauerhaft untätig, können an die Stelle fehlender staatlicher Lösungen auch Formen der Selbstorganisation der Bevölkerung treten. Öffentlichkeitswirksam inszeniert werden diese oftmals unter staatlicher Ägide weitergeführt. Die Probleme der Kollektivität stellen sich hier kaum, da meist nur kleine Bevölkerungsgruppen als Akteure handeln. Diesen Öffentlichkeiten droht eher die Gefahr, dass ihr Repräsentationsanspruch als überzogen gilt. Dies kann von Staatsseite zu ihrer Unterdrückung führen von Seiten der Bevölkerung zu mangelnder Rückendeckung.
Wenn Öffentlichkeiten, als Fürsprecher gesellschaftlicher Selbstorganisation, erklären, nur ›unpolitisch‹ sein zu wollen, wird der Staat darin meist eine politische Geste sehen, ihm die Geltungssphäre seiner Macht streitig zu machen. Ihrem Selbstverständnis nach als gegen den Staat gerichtet würden sie sehr wohl zustimmen, die Macht des Staats limitieren zu wollen, zugleich aber darauf beharren, dass an dessen Stelle etwas anderes als Politik treten solle. Gegenüber totalitären oder autoritären Regimen, aber auch bei unterstellten Repräsentationsdefiziten des Parlamentarismus bedeutet Selbstorganisation oft den Wunsch nach größerer Teilhabe an der Herrschaft, meist mit dem Fluchtpunkt, die eigenen Interessen innerhalb der staatlichen Organisationen stärker berücksichtigt zu finden. Beispiele hierfür bilden die Freiheitsbewegungen des 19. Jahrhunderts. Gegenüber parlamentarischen Demokratien bildet oft eine primär staatszersetzende Agenda das Leitbild. Zu denken wäre hier etwa an populistische Bewegungen. Einige sehen einen weitgehend unregulierten Markt als Mittel der Wahl, Entscheidungen zu organisieren. Andere sehen radikaldemokratische oder anarchistische Organisationsformen als die bessere Alternative zum Staat. Dritte befürworten Gemeinschaftsmodelle, die im Einzelnen korporatistische, kommunitaristische oder sozialistische Züge annehmen können. Dass auch diese Öffentlichkeiten über keine etablierten Verfahren der Willensbildung verfügen, kann sich von Vorteil erweisen, denn es erlaubt eine größere Flexibilität als die behäbigen, routinierten Verfahren des Staats. Oftmals erweist es sich jedoch als Problem, dass jedes mögliche Verfahren selbst leicht in Frage gestellt werden kann. Und nicht nur hier zeigt sich, dass es oftmals sehr viel leichter ist, Einhelligkeit darüber herzustellen, was abzulehnen ist, als sich auf einen Gegenvorschlag zu einigen. Daher läuft die Konstitution dieser Öffentlichkeiten stets Gefahr, zur bloßen Ästhetisierung des Werts wahrer Politik gegenüber der aus ihrer Sicht verfehlten Politik des Staats zu geraten. Insofern geht es manchen Öffentlichkeiten auch nur darum, sich in ihrer Fundamentalopposition gegen den Staat einzurichten und zu dessen Erosion beizutragen, ohne sich über Alternativen ganz im Klaren zu sein. Letztlich wird sich die Konstruktivität von kulturellen Öffentlichkeiten daran messen lassen, inwieweit es ihnen allein um symbolische Inszenierungen geht und in welchem Maß sie auch über die Symbolik hinaus instrumentell in ihren Praxen veränderte Gestaltungsformen der Organisation der Bevölkerung gestalten können.25
Kulturelle Öffentlichkeiten formulieren niederschwelligere Zugangskriterien als die öffentliche Meinung und wirken dadurch integrativer. Jedoch auch sie produzieren Ausschlüsse. Auch hier sind die drei Gegenbegriffe leitend. Im Zusammenhang fake news, alternative facts und Propaganda wurde länger darüber diskutiert, wie mit solchen öffentlichen Inszenierungen umgegangen werden müsse. Dürfe also wirklich jede Meinungsäußerung, gleich welcher obskuren Quelle sie entstamme, verbreitet werden oder müssten Multiplikatoren wie die Medien diese stoppen oder zumindest als unseriös markieren. Ein anderes Ausschlusskriterium kommt zum Tragen, wenn kulturelle Öffentlichkeiten zwar mit Gleichheitsansprüchen und allgemeiner Zugänglichkeit auftreten, faktisch jedoch weit größeren Ausschlüssen unterliegen, als ihr Anspruch dies formuliert. Vor allem Frauen oder people of color sehen gesellschaftliche Ungleichheiten in mangelnden Zugängen zur Öffentlichkeit reproduziert und prangern fehlende Repräsentation an. Insbesondere bei Formen des politischen Aktivismus und künstlerischen Inszenierungen erweist es sich zuletzt oftmals als schmaler Grad zwischen spektakulären Inszenierungen, die große Aufmerksamkeit erregen, und deren Schmähung als geschmacklos, skandalös oder ekelerregend, letztlich deren Verbot. Manches müsse privat bleiben.
Praxistheorien
Die bisherige Systematisierung verschiedener Öffentlichkeiten nahm ihren Ausgangspunkt beim Selbstverständnis verschiedener Praxisformen. Diese Selbstverständnisse werden in eigenen Reflexionspraxen expliziert, bilden aber auch unausgesprochen den Hintergrund, der ihre Praxen idealiter anleitet.26 Insofern bisher also sowohl Selbstanspruch der Öffentlichkeiten als auch ihre Erscheinung in Zeit und Raum als gleichberechtigte Handlungen untersucht wurden, wurde bereits der praxeologische Ansatz verwendet, der für den gesamten Band leitend ist. Praxistheoretische Ansätze sind in unterschiedlichen Denktraditionen entstanden und werden erst heute durch die Sozialwissenschaften in einer Theoriefamilie zusammengefasst: Die älteste Traditionsline bildet zweifellos die Rhetorik, die, ausgehend von Studien zum anthropologisch bedingten Ausdrucksvermögen des Menschen, nach Möglichkeiten des gezielten Symbolgebrauchs im Interesse von Wirkungssteigerung suchte. Nach dem Ende der alten Rhetorik um 1800 stellen Wiederbelebungen im 20. Jahrhundert die zentrale Referenz dar. Vor allem Arbeiten im Anschluss an Kenneth Burke, der dem Symbolischen Interaktionismus nahesteht, sind hier einschlägig.27 Eine weitere Traditionslinie schreibt sich von Überlegungen zur Inszenierung von Festen und dem Theater her. Diese Diskussionen knüpften sich im 20. Jahrhundert vor allem an die Begriffe ›Theatralität‹ und ›Performativität‹.28 Eine letzte Traditionsline läuft über die ›Objektivierung‹ des Idealismus und den Pragmatismus, die ein gesteigertes Interesse an der Alltäglichkeit sozialer Lebensbedingungen entwickeln. Im 20. Jahrhundert bilden dabei vor allem Heideggers phänomenologischer Ansatz und Wittgensteins Spätphilosophie die beiden Bezugspositionen für neuere Entwürfe.29 All diese Theorietraditionen bestehen eigenständig fort und konnten in den Sozialwissenschaften seit den 1980er Jahren verschiedene Forschungsfelder etablieren. Neben der Organisationsforschung zählen dazu die Wissenschafts- und Techniksoziologie, Gender Studies, Medienforschung sowie Lebensstilanalysen.30 Die neuere sozialwissenschaftliche Diskussion bündelt Ansätze, die aus diesen Traditionslinien hervorgegangen sind unter dem Namen Praxistheorien. Obwohl diese zentrale Grundannahmen teilen, setzten sie im Einzelnen unterschiedliche Akzente und nehmen sich einander oft nicht oder nur eklektizistisch wechselseitig zu Kenntnis. Der Begriff der Praxistheorien hat damit eine heuristische Funktion. Er führt verwandte Forschungsansätze zusammen und macht sie einem Vergleich zugänglich, um so letztlich eine variantenreiche und differenzierte praxistheoretische Theorie und Methodik zu entwickeln.
Als gemeinsamen Nenner fassen praxistheoretische Theorien und Methoden die Lebenswelt als Bündel veränderlicher und interdependenter Praxen auf. Daraus leitet sich auch ihre epistemologische Selbstverortung ab. So betrachteten Praxistheorien den eigenen Beobachtungsstandpunkt nicht als extern, sondern situieren sich innerhalb eben der Lebenswelt, die sie untersuchen. Sie verstehen sich als eine Praxis unter anderen, wodurch sie selbst zum Gegenstand von Forschung und Kritik werden können. Ziel ist es dabei, Selbstverständlichkeiten und Scheinprobleme aufzudecken und die eigene Vorgehensweise ständig weiterzuentwickeln. Wenn dieser Band sich an Praxistheorien orientiert, verpflichtet er sich also nicht auf einen bestimmten theoretischen und methodischen Ansatz, sondern auf Reflexivität und Flexibilität der eigenen Forschung. Dadurch wird es möglich, der Verschiedenheit der hier behandelten Untersuchungsgegenstände Rechnung zu tragen. Die Einzelstudien können folglich ganz verschiedene Gestalten von Öffentlichkeiten in den Blick nehmen.
Darüber hinaus besteht eine genuine Beziehung zwischen Praxistheorien und Öffentlichkeiten. Denn erstere begreifen Praxen stets als ›öffentlich‹. Öffentlich meint dabei, dass sich Praxen als sinnlich wahrnehmbare Verkörperungen von Bedeutung in einer Sphäre geteilter Aufmerksamkeit präsentieren.31 Diese Definition umfasst drei Dimensionen: Erstens konstatieren Praxistheorien, dass Öffentlichkeiten über die Interaktion zwischen Akteuren entstehen. Dies kann vom impliziten Teilen bestimmter Einsichten und Überzeugungen bis hin zu einer konkreten Kooperation oder Abgrenzung reichen. Daraus resultiert auch, dass Praxen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erscheinen können. Insgesamt stellen Öffentlichkeiten für die Praxistheorie also Sphären geteilter Aufmerksamkeit dar. In diesem Sinne lässt sich auch das wissenschaftliche Vorgehen selbst als eine öffentliche soziale Praxis beschreiben, da Beobachtung und Deutung auf geteilten Begriffen und Bedeutungsbezügen beruhen.32 Zweitens fasst die Praxistheorie ihre Gegenstände als verkörperte Bedeutung auf. Öffentlichkeiten haben demnach eine materielle Basis, die für die Handelnden unmittelbar Sinn ergibt. Sie werden konstituiert, indem Menschen bestimmte Artefakte, materielle Umgebungen, Körper, Symbole und Medien wahrnehmen, gebrauchen, bearbeiten, über sie sprechen oder zu ihnen Einstellungen und Emotionen entwickeln. Sinn meint dabei ein inkorporiertes Wissen, ein knowing how, das die Akteure meist nur schwer explizieren können. Methodisch geben die Praxistheorien deswegen Beobachtung und Beschreibung den Vorzug vor Befragungsverfahren.33 Drittens betonen Praxistheorien die sinnliche Wahrnehmbarkeit von Öffentlichkeiten. ›Wahrnehmbar‹ darf dabei allerdings nicht mit ›offensichtlich‹ verwechselt werden. So sind Öffentlichkeiten zwar ein den Sinnen zugänglicher Gegenstand, allerdings ist ihre Beobachtung immer methodisch zugerichtet und damit nicht allumfassend. Zugleich können Beschreibungstechniken aber auch komplexe Bezüge zwischen verschiedenen Praxen herausstellen, die unmittelbar nicht beobachtbar sind. Auf eine allgemeine praxeologische Methodologie verzichten Praxistheorien dabei jedoch. Für ihr Ziel, Öffentlichkeiten detailliert und möglichst gegenstandsangemessen zu erfassen, ist es nämlich wichtig, die Prämissen der Beobachtung ständig kritisch zu hinterfragen und regelmäßig anzupassen. Dies gelingt, indem sie eine Situation aus verschiedenen räumlichen und zeitlichen Abständen sowie teilnehmender oder distanzierender Perspektive heraus beobachten. Hinzu kommen Beschreibungstechniken wie De- und Rekontextualisierungen, exploratives Vergleichen oder Verfremdung, die die Perspektivenvielfalt unterstützen. Die so erzeugten facettenreichen und vielleicht sogar widersprüchlichen Forschungsergebnisse erweitern, relativieren und korrigieren sich gegenseitig.34
Insgesamt ergeben sich damit zwei besondere Stärken einer praxistheoretischen Behandlung von Öffentlichkeiten: Erstens besteht eine direkte Verbindung zwischen Gegenstand und Theorie, da Praxistheorien soziale Praxen untersuchen, die sie als ›öffentlich‹ auffassen. Zweitens verstehen sich Praxistheorien selbst als öffentliche soziale Praxen, wodurch Reflexivität und Multiperspektivität zu wesentlichen Leitlinien ihrer Forschung werden. Dies macht sie zu einem gleichermaßen selbstkritischen und erkenntnismächtigen Instrument, das auch komplexe Gegenstände zu beschreiben versteht. Über das Wechselspiel verschiedenster Akteure, Orte, Artefakte, Medien und Kontexte lassen sich so verschiedene Öffentlichkeiten voneinander unterscheiden. Dabei verzichten Praxistheorien auf einen Kollektivsingular. Vielmehr denken sie Öffentlichkeiten stets im Plural, weil jede von ihnen durch ein spezifisches Bündel veränderlicher und interdependenter Praxen erzeugt wird.35
Gleichursprünglichkeit
An dieser Stelle soll nachholend genauer expliziert werden, inwiefern die eingangs vorgenommene Rekonstruktion der Selbstverständnisse von öffentlicher Meinung und kulturellen Öffentlichkeiten praxistheoretisch angeleitet war. Dafür wird exemplarisch vorgeführt, wie eine praxistheoretische Methode Multiperspektivität und Reflexivität erzeugen kann. Angeleitet wird diese Methode durch eine theoretische Prämisse, die sich als Gleichursprünglichkeit fassen lässt. Dabei handelt es sich um eine Denkfigur, die zwei dichotome Begriffe, die zur Beschreibung einer bestimmten Praxis dienen, auf derselben Begründungsebene situiert, das heißt, gleichermaßen als Ursprung eines Phänomens auffasst. Die vormalige Dichotomie wird also umgeformt, indem beide Begriffe als gleichberechtigte und notwendig aufeinander bezogene Annahmen eingesetzt werden. Entsprechend prägen sie im komplexen Wechselverhältnis alle von ihnen abgeleiteten Vorstellungen. Die vermeintliche Unvereinbarkeit der beiden Begriffe ist dabei gerade die Stärke des praxistheoretischen Konzepts. Sie zwingt die Forscherin, ein und dasselbe Phänomen von zwei Seiten her zu betrachten. In diesem Sinne eröffnet Gleichursprünglichkeit Multiperspektivität.
Für eine Anwendung dieser Methode wird die obige praxistheoretische Definition, nach der Öffentlichkeiten sinnlich wahrnehmbare Verkörperungen von Bedeutung in einer Sphäre geteilter Aufmerksamkeit sind, in drei Gleichursprünglichkeiten überführt: Damit erscheinen Öffentlichkeiten in ihrer Sphäre geteilter Aufmerksamkeit erstens als gleichursprünglich individuell und kollektiv fundiert. Zweitens werden sie als Verkörperungen von Bedeutung und damit gleichursprünglich als zeichenhafter Ausdruck und Bedeutung aufgefasst. Drittens sind Öffentlichkeiten für die Praxistheorien zwar sinnlich wahrnehmbar und sinnhaft, allerdings nicht als unmittelbare Gegebenheit. Vielmehr speist sich ihre Beobachtung aus der Gleichursprünglichsetzung direkt wahrnehmbarer Handlungen und nur mittelbar wahrnehmbarer Bedeutungsbezüge. Im Folgenden soll diese Konzeptualisierung von Öffentlichkeiten mit den Selbstbeschreibungen der öffentlichen Meinung und der kulturellen Öffentlichkeiten abgeglichen werden. Dabei wird die Reihenfolge der drei Gleichursprünglichkeiten beibehalten.
Das Selbstverständnis der öffentlichen Meinung bestimmt das Verhältnis von Individuum und Kollektiv als einen Zusammenschluss vieler gleichartiger Einzelner. Die Grundannahme der prinzipiellen Vernünftigkeit aller Menschen dient dabei als Einheitsformel, die eine Arena eröffnet, in der verschiedene Interessen miteinander konkurrieren und sich unter der Maßgabe der Vernunft schließlich zu einem vermeintlich Ganzen komplettieren. In einer solchen einseitigen Verbindungslogik bleiben jedoch vielfältige Wechselwirkungen zwischen Individuum und Kollektiv verborgen. Hier zeigt sich die Stärke der Praxistheorien, deren Multiperspektivität ein Missverhältnis zwischen theoretischem Anspruch und realen Praxen der öffentlichen Meinung aufzeigen kann. So bewirkt die Einheitsformel der Vernünftigkeit nicht etwa den Einschluss aller, sondern vielmehr gravierende Ausschlüsse Einzelner, da geheimes, individuelles oder egoistisches Handeln gleich als prinzipielle Wesensungleichheit ausgelegt werden muss. Zu undifferenziert erscheint unter praxistheoretischen Vorzeichen auch die klare Grenze, die die öffentliche Meinung zwischen sich und dem Staat zu ziehen versucht. So muss sie in bestimmten Situationen durchaus die Nähe zum Staat suchen, um in informellen Gesprächen ihre Interessen zu vertreten und ihre Einflusssphäre auszubauen. Derartige blinde Flecken zeigen sich allerdings erst aus praxistheoretischer Perspektive, die Individuum und Kollektiv gleichursprünglich setzt. Sprachlich bietet sich hierfür die Subjunktion ›indem‹ an: Indem viele Einzelne in geteilter Aufmerksam vielschichtige komplementäre sowie widerstreitende Handlungen vollführen, erzeugen sie kollektive öffentliche Praxen. Oder andersherum: Indem Kollektive verschiedene Handlungen in geteilten Aufmerksamkeiten bündeln, also auf eine gemeinsame materielle Basis beziehen und gemeinsamen Einstellungen und Zielen unterstellen, verorten sie Akteure in verschiedenen Öffentlichkeiten. Die ›Indem‹-Verknüpfung verschränkt hier zwei Perspektiven ineinander: Einmal steht die unendliche Komplexität interdependenter Handlungen und einmal die Voraussetzungen für die erfolgreiche Kollektivierung im Fokus. In jedem Fall aber werden Abhängigkeit und Veränderlichkeit der beiden Perspektiven betont. Eine Öffentlichkeit stellt entsprechend kein unverrückbares Ganzes, sondern ein unentwegtes Wechselspiel von Individualisierung und Kollektivierung dar. Beide Perspektiven sind dabei notwendig, weil eine theoretische Beschreibung die phänomenale Fülle unserer Erfahrungswelt niemals vollständig einfangen kann und deswegen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden sollte.
Während die öffentliche Meinung sich selbst aus einem sozialontologischen Individualismus heraus versteht, stellen Individuum und Kollektiv für die kulturellen Öffentlichkeiten gleichermaßen Ausgangs- und Zielpunkt ihrer Konstituierung dar. Sie stehen einer praxistheoretischen Gleichursprünglichsetzung damit sehr nahe, wodurch sich Übereinstimmungen in der Selbstbeschreibung der kulturellen Öffentlichkeiten und der Fremdbeschreibung durch die Praxistheorien ergeben. Beide betrachten Öffentlichkeiten nämlich als Vielfalt unterschiedlicher Gruppierungen. Diese gewinnen ihren inneren Zusammenhalt durch geteilte Praxen, die sich wiederum von Praxen anderer Öffentlichkeiten abgrenzen. Dabei konstituieren sich kulturelle Öffentlichkeiten wegen des Fehlens deliberativer Momente der Entscheidungsfindung eher als Bottom-up-Bewegungen. Ihre Praxen bilden sie über die Koordination einiger mit einigen aus. Gleichursprünglich ist jeder Einzelne aber auch in kollektive Bedeutungsbezüge, wie sprachliche, soziale, weltanschauliche, konfessionelle, institutionelle Verbundenheiten verstrickt, die sich ebenfalls in den Praxen niederschlagen und Querverbindungen zwischen ihnen schaffen.36 So beeinflussen sich, entstehen und zerfallen ohne Unterlass verschiedene Öffentlichkeiten mit und ohne Schnittmengen. Diese kollektive Dynamik wird durch Prozesse auf individueller Ebene noch verschärft. Denn Akteure sind sich ihrer selbst nicht vollkommen durchsichtig. Vor allem der Eindruck, den sie auf ihr Gegenüber machen, ist ihnen entzogen.37 Und da sie sich selbst nicht mit den Augen des Anderen sehen können, entstehen unerwartete Reaktionen: Akteure lernen überraschend voneinander oder stoßen sich vor den Kopf. In jedem Fall entsteht eine Eigendynamik, die sich mit der Anzahl der Teilnehmenden exponentiell verstärkt und die dafür sorgt, dass Praxen nicht einfach wiederholt, sondern in jedem Vollzug auch verändert werden.38 Um dieses ständige Wechselspiel aus äußerer Beeinflussung, innerer Veränderung, Entstehung und Zerfall einzudämmen, setzen kulturelle Öffentlichkeiten den normativen Maßstabe der Authentizität ein. Dieser ermöglicht es ihnen, ihre Praxen als ›richtige‹ Praxen zu stabilisieren. Genau an dieser Stelle entsteht nun aber ein Unterschied zwischen der Selbst- und Fremdbeschreibung kultureller Öffentlichkeiten. Denn für Praxistheorien ist eine solche Essentialisierung nicht haltbar. Stattdessen halten sie an einer gegenseitigen Durchdringung und mangelnden Steuer- und Vorhersagbarkeit der Entwicklung öffentlicher Praxen fest.
Im Selbstverständnis der öffentlichen Meinung werden Ausdruck und Bedeutung strikt voneinander getrennt. Damit stellt der sprachliche Ausdruck ein Werkzeug zum Ideenaustausch dar, das stets Gefahr läuft, diese Ideen zu verfälschen oder zu überdecken. Hieraus leitet sich eine Präferenz für unauffällige Kommunikationsmittel wie eine schmucklose und rein pragmatisch orientierte Schriftsprache ab. Vergleicht man diesen Anspruch mit einer praxistheoretischen Bestimmung von Bedeutungserzeugung, zeigen sich jedoch Verkürzungen. Denn die öffentliche Meinung blendet die materielle Basis von Bedeutung aus. Gleichursprünglich gedacht ergibt sich nämlich: Indem ein Bedeutungsträger benutzt wird, wird eine bestimmte bedeutungsvolle Situation erzeugt. Oder andersherum: Indem ein Bedeutungsträger Bedeutung verkörpert, präsentiert er sich in seiner bestimmten Beschaffenheit und Beziehung zu anderen Bedeutungsträgern. Reine Diskursivität kann es aus praxistheoretischer Perspektive entsprechend nicht geben. Und auch die Vorstellung von überlegenen Darstellungsformen im Sinne eines besonderen Bedeutungsreichtums oder materieller Unmittelbarkeit entfällt. So gesehen werden Ausdrucksformen nur unscheinbar bzw. leicht verständlich, indem sie häufig verwendet werden und darüber einen großen Nutzerkreis generieren. Beispielsweise erschließt sich ein um Objektivität bemühter Text, der Passivkonstruktionen und Nominalisierungen nutzt, einem ungeübten Leser keinesfalls widerstandslos. Stattdessen erzeugt er, und zwar entgegen dem Selbstverständnis der öffentlichen Meinung, eine Nähe zu Gesetzestexten und Verordnungen des Staats. Praxistheoretisch betrachtet erscheint es dann auch nicht mehr als Widerspruch, wenn sich die öffentliche Meinung ungeachtet ihres Ausdrucksideals doch auch emotionalisierter und überdeterminierter Darstellungsformen bedient. Denn auch dabei handelt es sich lediglich um verkörperte Bedeutung, konkret um die Verkörperung eines gewissen Abstands von staatlichen Praxen. Für eine praxistheoretische Beobachtung und Beschreibung von Öffentlichkeiten ergibt sich damit ein deutlich breiterer Gegenstandbereich als ihn das Selbstverständnis der öffentlichen Meinung zulässt. So müssen über wortsprachliche Äußerungen hinaus auch klingende Stimmen, bewegte Körper, eingenommene Plätze und Gebäude, verwendete Technologien sowie Medien zur Erfassung und Übertragung von Öffentlichkeiten untersucht werden.39
Dagegen umfasst das plurale Selbstverständnis kultureller Öffentlichkeiten diese Aspekte durchaus. Grund hierfür ist ihre Gleichursprünglichsetzung von Ausdruck und Bedeutung. Kulturelle Öffentlichkeiten wissen also darum, dass sie mit Räumen, Gegenständen und Körpern Bedeutungen erzeugen. Entsprechend vielgestaltig fallen ihre Praxen aus. Allerdings zeigt sich in einer praxistheoretischen Gesamtschau auch hier eine Kluft zwischen theoretischem Anspruch und konkreter Praxis. Denn kulturelle Öffentlichkeiten geben expressiven Formen der Bedeutungserzeugung den Vorrang gegenüber diskursiven, weil erstere als effektvoller gelten. Ihrer materiellen Seite wird dabei eine unmittelbare Überzeugungskraft zugestanden, die keiner Ausdeutung bedarf. Praxistheoretisch betrachtet entspricht dies, analog zur Kritik an der öffentlichen Meinung, einer Dichotomisierung von Ausdruck und Bedeutung. Denn eine Praxis ist aus praxistheoretischer Perspektive nicht ihrem Wesen nach besonders effektvoll oder nicht, sondern nur mit Bezug auf andere Praxen. Entsprechend rührt die große Wirksamkeit von Performances, Demonstrationen, Besetzungen usw. lediglich daher, dass sie sich von den nüchternen, wortsprachlich geprägten Ausdrucksformen abheben, die die Gesamtheit öffentlicher Praxen dominieren.
Die öffentliche Meinung versteht sich selbst als einen Erscheinungsraum, in dem die Akteure füreinander uneingeschränkt wahrnehmbar sind. Dabei ist der Zugang zum Erscheinungsraum prinzipiell jedem gestattet, der vernünftig handelt. Alles, was dagegen geheim, individuell oder egoistisch ist, gilt als nicht öffentlich relevant oder sogar als einer vernünftigen Öffentlichkeit abträglich. Aus einer praxistheoretischen Perspektive heraus lassen sich in diesem Selbstverständnis der öffentlichen Meinung erneut blinde Flecken erkennen. So ist die Trennung zwischen öffentlich und nicht öffentlich bzw. zwischen wahrnehmbar und nicht wahrnehmbar keine naturgemäße Grenze, die sich entlang von Vernunft und Gemeinnützigkeit zieht. Vielmehr bestimmen die Praxen darüber, was unmittelbarer oder nur mittelbarer Teil des Erscheinungsraums ist. Dies zeigt sich auch im Kalkül der öffentlichen Meinung. Während diese nämlich gerne ihre Vernünftigkeit und Eigenständigkeit betont, lässt sie die Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen lieber unerwähnt. Dass sie zusätzlich dem Staat eine Verschleierung der eigenen Machtfülle vorwirft, wirkt da geradezu paradox. Um diese widersprüchlichen Tendenzen praxistheoretisch zu erfassen, bietet es sich an, gleichursprünglich nach direkt wahrnehmbaren Handlungen und nur mittelbar wahrnehmbaren Bedeutungsbezügen Ausschau zu halten: Indem also Akteure unmittelbar und mittelbar wahrnehmbare Bedeutung erzeugen, spannen sie Öffentlichkeiten auf. Oder anders herum gedacht: Indem Praxen als öffentlich erscheinen, machen sie Akteure unmittelbar und mittelbar füreinander wahrnehmbar. Folglich sind Praxen immer für irgendjemanden wahrnehmbar. Praxistheoretisch gedacht kommt damit auch jeder Handlung eine mehr oder weniger öffentliche Bedeutung zu. Denn selbst die private Lektüre eines Buches steht noch im Zusammenhang einer sichtbaren und zugänglichen geteilten Praxis der Deutung und Kritik. Oder die Wirksamkeit einer öffentlichen Rede kann wesentlich dadurch geprägt sein, wie viel Zuspruch und Handlungsbereitschaft sie bei einem privaten Publikum bewirkt.40 Eine feste Grenze zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Praxen kann eine praxistheoretische Beschreibungen deswegen nicht ziehen, sie muss für jede Situation neu bestimmt werden.
Im Selbstverständnis kultureller Öffentlichkeiten ist diese Übergängigkeit zumindest teilweise verankert. Wahrnehmbarkeit gilt dabei als das Resultat von Differenz und zwar untereinander sowie zum Staat. Entsprechend streben kulturelle Öffentlichkeiten eine größtmögliche Aufmerksamkeit an, indem sie sich in ihren Praxen von anderen abheben. Die Wahrnehmbarkeit aufgrund einer großen Akteurszahl gilt dagegen als potentiell verdächtig. Als zu groß erscheint dann die Gefahr, Mainstream zu werden. Denn im Verständnis kultureller Öffentlichkeiten ist dieser durch seine vereinheitlichten Praxen von einem Authentizitätsanspruch zu weit entfremdet. Privatheit und Authentizität werden also miteinander assoziiert. Dies steht im Widerspruch zur Fremdbeschreibung durch die Praxistheorien. Nach dieser sind öffentliche oder private Praxen weder ›authentisch‹ noch ›unauthentisch‹ bzw. ›gut‹ oder ›schlecht‹. Öffentliche Praxen sind einfach mehr oder weniger sichtbar. Praxistheorien arbeiten demnach rein deskriptiv, das heißt, sie schätzen Einflussbereiche und Vernetzungsgrade von Praxen ab, ohne diese zu bewerten.
Insgesamt gibt die hier angewendete Gleichurspünglichsetzung verschiedene inhaltliche Leitlinien für eine praxistheoretische Öffentlichkeitsforschung vor: Erstens betont die Methode die Dynamik von Öffentlichkeiten. Wenn diese nämlich im Plural gedacht werden, zeigen sie sich als ein Wechselspiel von Individualisierung und Kollektivierung, Entstehung und Zerfall. Zweitens gerät die Komplexität öffentlicher Bedeutungserzeugung in den Blick. So müssen nicht nur ganz unterschiedliche materielle Bedeutungsträger, sondern auch die gegenseitige Bezugnahme von Öffentlichkeiten betrachtet werden. Drittens zeigt sich, dass eine feste Grenzziehung zwischen öffentlich und nicht öffentlich nicht möglich ist, sie muss immer wieder aufs Neue ausgehandelt werden.
Politische-ästhetische Öffentlichkeiten
In den Selbstverständnissen der öffentlichen Meinung und der kulturellen Öffentlichkeiten wurde eine Korrelation zwischen dem Begriff der Öffentlichkeit und zwei anderen Begriffen, nämlich ›Politik‹ und ›Ästhetik‹, hergestellt. Diese soll hier näher ausgefaltet werden, weil sie eine weitere Leitlinie praxistheoretischer Öffentlichkeitsforschung vorbereitet.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Begriff der ›Öffentlichkeiten‹ mit den Attributen ›politisch‹ und ›ästhetisch‹ in Beziehung zu setzen. Erstens besteht eine definitorische Verbindung über die Gegenstandsbereiche bestimmter Praxen. Widmet sich eine öffentliche Praxis nämlich der Organisation von Macht, der Verteilung von Plätzen und Gütern sowie der Legitimierung von Organisation und Verteilung, gilt sie als ›politisch‹.41 Ist eine öffentliche Praxis dagegen im Bereich der Kunst oder des Kulturbetriebs situiert, wird sie als ›ästhetisch‹ aufgefasst. Aufgabe von Praxistheorien kann es dann sein, diese Praxen in ihren spezifischen Gegenstandbezügen zu beobachten und zu beschreiben. Dabei geraten notwendig immer wieder Momente in den Blick, die sich nicht in einen der beiden typischen Gegenstandbereiche einfügen. Beispielsweise appellieren Politiker bzw. politische Aktivisten durchaus an eine genaue Wahrnehmung sowie Gefühle ihrer Adressaten und produzieren in ihren Reden und programmatischen Texten Mehrdeutigkeiten.42 Darüber hinaus können kreativ-schöpferische Tätigkeiten in der Kunst sehr wohl Verteilungsungerechtigkeiten oder Legitimitätsprobleme anprangern. Praxistheoretisch sollten also auch Überschneidungen zwischen den beiden Gegenstandsbereichen und ihren Praxen untersucht werden, die eine enge Definition der Attribute ›politisch‹ und ›ästhetisch‹ herausfordern.
Neben dieser gehaltlichen Bestimmung ist aber auch eine Untersuchung ästhetischer und politischer Öffentlichkeiten denkbar, die Fragen des Gegenstandsbereichs von Praxen übersteigt. Diese hat zugleich emphatischeren Charakter, weil sie die beiden Attribute als Wertbegriffe einsetzt. Ästhetisch und politisch bezeichnen dabei eine besondere Vollzugsweise von Praxen. Genauer gesagt, handelt es sich um Praxen, die sich durch eine starke Reflexivität und eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung ihrer jeweiligen Gegenstände und Kontexte auszeichnen. Als Gegenbegriffe können unhinterfragte und habitualisierte Praxen betrachtet werden. Anders als diese wirken ästhetische und politische Praxen ereignishaft und leiten Wendepunkte oder Neuanfänge öffentlicher Bewegungen ein. Deswegen stellen sie besondere Anlässe zur Beschreibung von Öffentlichkeiten dar. Für eine solche vollzugsmäßige Bestimmung politischer Praxen lassen sich gleich mehrere Vertreterinnen und Vertreter anführen, die den Neuen Philosophien des Politischen zugeordnet werden können.43 Exemplarisch sollen hier Judith Butler und Jacque Rancière herausgegriffen und diskutiert werden, da sie, genau wie dieser Band, einen emphatischen Politikbegriff vertreten, der politisches Handeln auch außerhalb der staatlichen Sphäre sucht. Darüber hinaus zeichnet sie eine Wachheit für die Vielgestaltigkeit, also die aisthetische Seite, politischer Praxen sowie die politische Bedeutung öffentlicher Inszenierungen, aus, die sich in diesem Maße bei anderen Theoretikern und Theoretikerinnen nicht finden lässt. Es ist folglich diese besondere Verknüpfung von Politik und Ästhetik, die sie als Bezugsgröße für die folgenden Überlegungen empfiehlt. Obwohl sich die Ansätze von Butler und Rancière im Einzelnen auch unterschieden, sollen sie im Folgenden in integraler Perspektive betrachtet werden, das Hauptaugenmerk also auf ihre Gemeinsamkeiten gelegt werden.
Laut Butler besteht der Gegenstandsbereich der Politik im Herstellen von Gleichheit. Dieses ist Bedingung, Eigenart und Ziel politischer Praxen.44 Damit steht sie dem Selbstverständnis kultureller Öffentlichkeiten sehr nahe, geht jedoch theoretisch noch über dieses hinaus. Laut Butler darf Gleichheit nämlich nicht als ein invariabler Zustand betrachtet werden, der die Gesamtheit aller Menschen einschließt. Vielmehr ist dieser unmöglich, da jeder Einschluss von konkreten Akteuren notwendig den Ausschluss konkreter anderer produziert. Und sei es nur durch die eigene Selbstbestimmung, die andere Gruppen oder Völker ausgrenzt. Deswegen muss die Politik verstehen, »dass es nur durch eine Veränderung des Verhältnisses zwischen den Anerkennbaren und den Nichtanerkennbaren überhaupt möglich ist […] Gleichheit zu verstehen und anzustreben«.45 Gleichheit ist folglich ein unabschließbarer Prozess, der gleichursprünglich das Ein- und Ausschließen von Akteuren bedeutet. Wer sich für Gleichheit interessiert, muss also sehr genau beobachten, wer in einer Situation anerkannt bzw. nicht anerkannt wird. Letztlich strebt politisches Handeln somit Gleichheit an, ohne sie jemals zu erreichen.
Ähnlich wie Butler versteht auch Jaques Rancière Politik als »die Aktivität, die als Prinzip die Gleichheit hat«, wobei diese »Gleichheit aus Gleichheit und Ungleichheit« besteht.46 Gleichheit ist also »kein Gegebenes, das die Politik einer Anwendung zuführt […]. Sie ist nur eine Voraussetzung, die in den Praktiken, die sie ins Werk setzen, erkannt werden muss.« Folglich muss Gleichheit ins Werk gesetzt, erkannt, das heißt gelebt werden.47 Und Politik erreicht dies, indem sie »einen Körper von dem Ort entfernt, der ihm zugeordnet war oder die Bestimmung eines Ortes ändert; sie lässt sehen, was keinen Ort hatte gesehen zu werden, lässt eine Rede hören, die nur als Lärm gehört wurde.«48 Folgt man der Begriffsbestimmung von Rancière und Butler, zeigen sich Öffentlichkeiten als politisch, indem sie Bedeutung immer wieder aufs Neue aushandeln. Ganz wesentlich gehört dazu die Entscheidung, wer Teil eines Erscheinungsraumes ist bzw. wer nicht sowie wem darüber bestimmte Rechte zukommen bzw. verweigert werden. Dazu gehört die Umgestaltung und Neuverteilung von Räumen und Ressourcen und das Brechen von Tabus. Politische Öffentlichkeiten im vollzugsmäßigen Sinne leisten dies.
Diesen Grundgedanken der Unerreichbarkeit von Gleichheit verbindet Rancière jedoch nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Ästhetik.49 Diese ist für ihn »ein allgemeines Regime der Sichtbarkeit und Verständlichkeit der Kunst«, dem er »die zugleich materielle und symbolische Einrichtung einer bestimmten Raumzeit, einer Aussetzung der gewöhnlichen Formen sinnlicher Erfahrung« zutraut.50 Kunst ist also nur Kunst, indem sie auf besondere Art und Weise für jemanden sichtbar und verständlich wird. Und mit besonders ist hier gemeint, dass sie dazu in der Lage ist,
»eine Neueinteilung des materiellen und symbolischen Raumes zu vollziehen. Gerade darin rührt die Kunst an die Politik. Die Politik ist nämlich […] die Gestaltung eines spezifischen Raumes, die Abtrennung einer besonderen Sphäre der Erfahrung, von Objekten, die als gemeinsam und einer gemeinsamen Entscheidung bedürfend angesehen werden, von Subjekten, die als fähig anerkannt werden, diese Objekte zu bestimmen und darüber zu argumentieren. Ich habe anderswo zu zeigen versucht, inwieweit die Politik gerade der Konflikt über das Dasein dieses Raumes ist.«51
Ranciére nähert Politik und Ästhetik hier einander so sehr an, dass es schwer fällt, einen Unterschied zwischen beiden zu sehen. Zwar unterscheiden sich beide in ihrem Gegenstandsbereich: Der Politik geht es um Gerechtigkeit und der Ästhetik um Kunst. Viel bedeutender als diese Differenz ist jedoch ihre Gemeinsamkeit. Beide zeichnen sich nämlich durch eine bestimmte Vollzugsweise aus, die Gewohnheiten überwindet und Bedeutungen neu ordnet. Oder in Rancières Worten: Sowohl in der Politik als auch der Ästhetik geht es immer um einen Konflikt. In diesem emphatischen Sinne sind politische und ästhetische Praxen also intensive Aushandlungsprozesse, die eine besondere Aufmerksamkeit für Mitwirkende, Gegenstände und Kontexte aufbringen. Entsprechend versuchen sie nicht einfach, alt hergebrachte Praxen zu wiederholen. Sie erneuern Praxen, indem in ihnen gerade das in Frage steht, was als selbstverständlich galt. Damit stellen politische und ästhetische Praxen seltene Ausnahmesituationen dar,52 in denen sich Öffentlichkeiten neu erfinden. Entsprechend wird in ihnen explizit, was auch für jede andere öffentliche Praxis gilt: Gleichheit, also eine Inklusion aller Akteure in einen umfassenden Erscheinungsraum, ist nicht möglich. Denn für den Zugang zu Öffentlichkeiten bedarf es immer eines gewissen Grundkapitals, über das nicht alle Akteure verfügen: Gesundheit, finanzielle Mittel, Bildung, Ansehen, Zugang zu Medien, Zutritt zu Räumen…53
Für die Öffentlichkeitsforschung bedeutet dies, dass sie den Erscheinungsraum der Öffentlichkeit immer in seiner Wechselwirkung mit dem Nicht-Sagbaren, Nicht-Sichtbaren und Nicht-Zugänglichen betrachten muss. Damit offenbart sich zugleich eine weitere Leitlinie praxistheoretischer Forschung: Diese hat stets eine ethische Dimension. Denn auch die wissenschaftliche Beschreibung bestimmter Praxen und Akteure nimmt anderen Praxen und Akteuren ihre Sichtbarkeit. Auch Forschung nimmt also Teil am Ringen um Gleichheit.
Verhältnis von Gegenstand und Methode
Am Ende der Bestimmung ästhetischer und politischer Öffentlichkeiten offenbarte sich die ethische Dimension praxistheoretischer Forschung: Die Beschreibung bestimmter Praxen impliziert notwendig den Ausschluss anderer Praxen. Diese Herausforderung ist nicht zu umgehen. Allerdings wird sie verschärft, wenn unhinterfragte Selbstverständlichkeiten und Scheinprobleme der Forschung dafür sorgen, dass die öffentliche Sichtbarkeit bestimmter Akteure, Handlungen und Räume systematisch beeinträchtigt wird.54 Eine ständige Selbsthinterfragung erscheint den Praxistheorien deswegen unverzichtbar. Teil einer solchen reflexiven Forschungspraxis kann es sein, das spezifische Verhältnis zwischen Methode und Gegenstand zu hinterfragen. So zeigte der Vergleich von praxistheoretischer Fremdbeschreibung und Selbstbeschreibung der öffentlichen Meinung bzw. der kulturellen Öffentlichkeiten jeweils eigene Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten. Aus diesen unterschiedlichen Gegenstandsrelationen resultieren wiederum eigene Möglichkeiten und Grenzen der praxistheoretischen Erforschung von öffentlicher Meinung und kulturellen Öffentlichkeiten. Diese sollen hier abschließend kurz erörtert werden.
Insgesamt zeigte das Selbstverständnis der öffentlichen Meinung die größten Differenzen zur praxistheoretischen Fremdbeschreibung. Dieser Abstand sorgt dafür, dass eine praxistheoretische Beschreibung hier eine weitgehend kritische Funktion einnimmt. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass die öffentliche Meinung vornehmlich den verbalsprachlichen Anteilen ihrer Praxen Beachtung schenkt und damit wesentliche Teile der Bedeutungskonstitution übersieht. Oder es wurde deutlich, dass sie entgegen ihrem Anspruch einer vollständigen Integration aller Vernünftigen bestimmte Akteure radikal ausschließt. Praxistheorien können hier also ergänzend und dekonstruktiv wirken.
Komplexer ist dagegen das Verhältnis zwischen den Praxistheorien und der Selbstbeschreibung der kulturellen Öffentlichkeiten. Dieses wird nämlich in verschiedenen Abstufen sowohl durch Ähnlichkeiten als auch Unähnlichkeiten bestimmt. Zu letzteren zählen beispielsweise das Gütekriterium der Authentizität oder die Bevorzugung expressiver Praxen. Diese führen aus praxistheoretischer Sicht, wie oben erläutert, zu blinden Flecken sowie Inkonsequenzen in der praktischen Umsetzung der postulierten Ansprüche kultureller Öffentlichkeiten. Daneben finden sich allerdings auch deutliche Parallelen, beispielsweise in der Beschreibung von Sprache oder dem Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Eine praxistheoretische Betrachtung erkennt sich hier in ihrem Gegenstand teilweise wieder. Dadurch entsteht die Gefahr, die Selbstbeschreibung kultureller Öffentlichkeiten unhinterfragt zu übernehmen. Übereinstimmungen zwischen Methode und Gegenstand können also verdeckend wirken. Sie verlangen besondere Obacht. Eine kurze Beispielanalyse soll dies veranschaulichen: Praxistheorien hegen, wegen ihrer theoretischen Behauptung der Einmaligkeit einer jeden Praxis, eine gewisse Sympathie für Bewegungen, die sich über Bottom-up-Prozesse konstituieren. Diese lassen sich nämlich besonders dicht beobachten, weil sie sich nicht von vermeintlich überzeitlichen Prinzipien ableiten. Kulturelle Öffentlichkeiten behaupten von sich, genau diesem Modell von Bottom-up-Prozessen zu folgen. Entsprechend besteht eine deutliche Affinität zwischen Praxistheorie und dem Gegenstand der kulturellen Öffentlichkeiten. Allerdings darf eine ausgewogene praxistheoretische Beschreibung hier nicht stehen bleiben. Über den Zuspruch für flexible Bottom-up-Prozesse hinaus müssen auch Nachteile solcher Aushandlungsprozesse beschrieben werden. So muss eine praxistheoretische Beschreibung kultureller Öffentlichkeiten auch berücksichtigen, dass die Konkurrenz vieler kleinerer Gruppen die Umsetzung von Projekten verzögern und ihre Institutionalisierung gefährden kann. Es ist somit nur plausibel, auch die Vorteile einer gegenteiligen Top-down-Logik in Betracht zu ziehen. Und nicht nur plausibel – in einer konsequenten praxistheoretischen Herangehensweise wäre es sogar notwendig, Praxen von beiden Seiten, das heißt, gleichursprünglich als Kollektivierung und Individualisierung zu betrachten.
Die Beispielanalyse zeigte, wie verlockend es ist, bei einer partiellen Übereinstimmung von Methode und Gegenstand den Anspruch auf eine breite Beschreibung fallen zu lassen. Gerade im Hinblick auf Akteure mit kompatiblen Selbstverständnissen müssen Praxistheorien deswegen selbstkritisch arbeiten. Allerdings leistet diese Problematik nicht einem Wechsel der Methode Vorschub. Vielmehr führt sie zu dem Hinweis, einfach das konsequent umzusetzen, was die praxistheoretische Theorie fordert, nämlich Multiperspektivität und Reflexivität. Dabei kann auch der Vergleich so diametral unterschiedlicher Gegenstände wie der öffentlichen Meinung und der kulturellen Öffentlichkeiten helfen.
Die Beiträge in diesem Band
Diese Vorüberlegungen zeigen, welches Spektrum an Phänomenen sich unter der Bezeichnung Politisch-ästhetische Öffentlichkeiten in Theorie und Geschichte fassen und auf Basis eines praxistheoretischen Zugangs auch beschreiben lassen. Die Beiträge des Bandes gliedern sich in zwei Teile: eine erste Sektion zu theoretischen Positionen und eine zweite zu Praxisfeldern.
Der Beitrag von Harun Maye, der die erste Sektion eröffnet, entdeckt sowohl in Joseph de Maistres gegenaufklärerischen Betrachtungen über Frankreich als auch in Christian Garves Ausführungen zur öffentlichen Meinung Spuren einer frühen praxistheoretischen Medientheorie der Politik. In dieser Lesart bereiten beide Autoren eine Erweiterung des Kerngedankens der Theatrokratie vor. So ergänzen sie die Kritik am inszenatorischen Charakter von Politik um die Einsicht, dass Politik gerade dieser Inszenierung bedarf, um überhaupt wirken zu können.
In seinem Artikel zeichnet Markus Wessels eine bisher wenig beachtete Entwicklungslinie des Öffentlichkeitsbegriffs um 1800 nach. Nach der Ablehnung der Rhetorik und damit der öffentlichen Rede durch Kant nimmt diese Entwicklungslinie ihren Ausgang in der zeitgenössischen Sprachtheorie. Deren Gleichsetzung von Denken und Sprechen, die als performative Theorie avant la lettre gedeutet werden kann, führt bei Carl Gustav Jochmann zu einer Aufwertung der öffentlichen Rede. Denn nur diese fördere eine für alle verständliche Sprache, die wiederum Voraussetzung einer Öffentlichkeit sei. Wessels zeigt, wie das ehemals rhetorische Ideal der claritas bei Jochmann gleichermaßen zum Ursprung als auch zum Vollzug von Öffentlichkeit avanciert.
Oliver Kohns zeichnet die zentralen Linien einer Geschichte des Konzepts des ›autoritären Charakters‹ vom 17. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nach. In dieser tritt Autorität beispielsweise als Kompensation einer passiven unaufgeklärten Masse oder auch als potentiell bedrohliche psychische Disposition fremder Nationalitäten auf. Beide Bestimmungen, als vermittelnde Kategorien zwischen gesellschaftlicher Struktur und individueller Psyche, haben dabei großen heuristischen Wert für die Beschreibung von Öffentlichkeiten.
Jennifer Pavlik rekonstruiert in ihrem Artikel Hannah Arendts Politik-Begriff im Sinne einer durch Handlungen erzeugten Freiheit jedes Einzelnen. Zugleich muss das politische Handeln im öffentlichen Raum, d. h. in der Begegnung mit anderen, stattfinden. Politik und Öffentlichkeit werden damit aufs engste miteinander verknüpft. Aber auch der Begriff des Ästhetischen spielt für Arendt eine zentrale Rolle. So stellt das ästhetische Handeln als ›uninteressiertes Weltinteresse‹, das Abstand von Zweck-Mittel-Relationen nimmt, die Voraussetzung für eine offene Begegnung und damit die politische Öffentlichkeit dar.
David D. Kim liest Kafkas Roman Der Prozeß als Ausdruck komplexer Öffentlichkeitsimaginationen. Traditionelle Deutungsansätze werden dabei auf die von Kafka vorgeführte Grenzaufweichung zwischen privaten Angelegenheiten und öffentlichen Problemen beziehungsweise zwischen Gesellschaftsvertrag und Staatsgewalt bezogen. Diese bedroht die Lebensbedingungen von Kafkas Figuren und kann als ein Grundzug in seiner Diagnose moderner Gesellschaften betrachtet werden kann. Aber nicht nur in Kafkas Roman, sondern auch in autobiographischen Zeugnissen findet Kim Hinweise auf die untersuchten Öffentlichkeitsimaginationen. Kafkas Schreiben gilt ihm damit einerseits als Spiegel moderner Identitätsprobleme und andererseits als Akt moderner Selbst(er)findung.
Clemens Pornschlegel rekonstruiert den idealistischen Politik-Begriff, den der französische Philosoph Alain Badiou in einem emphatischen Artikel über den arabischen Frühling zugrunde legt. Durch eine Kontrastierung mit Kleists Das Erdbeben in Chili zeigt Pornschlegel die Zerbrechlichkeit sowie die blinden Flecken in Badious Idylle von Klassen- und Herrschaftsfreiheit auf dem Tahir-Platz auf. Nicht nur dass Badiou die Unterschiedlichkeit der politischen Akteure verkennt, zugleich zeichnet er einen Zustand nach, der nicht die Vollendung, sondern das Ende jeglicher politischen Praxis bedeuten würde und der damit nicht mit politischen Mitteln auf Dauer gestellt werden kann.
Sarah Michaelis rekonstruiert die Grundannahmen der Ästhetiken Hans-Ulrich Gumbrechts und Martin Seels, um zu überprüfen ob sich diese als Fundament einer ästhetischen Literaturdidaktik eignen. Dabei zeigt sich, dass beide Ästhetiken die ästhetische Wahrnehmung innerhalb des Subjekts verorten und sie damit zu einer ›Privatsache‹ machen. Diesem Ansatz stellt Michaelis eine praxistheoretische Ästhetik gegenüber, die gerade die Einbindung in eine geteilte Erfahrungswelt betont und damit anschlussfähig ist an literaturdidaktische Konzepte. Da eine praxistheoretische Ästhetik ästhetische und nicht-ästhetische Handlungen als ein Kontinuum auffasst, ermöglicht sie zudem eine gegenseitige Belebung von literaturdidaktischer Ästhetik und Theorie.
In seinem Beitrag wirft Michael Hirsch einen ernüchternden Blick auf den von den Neuen Philosophien des Politischen emphatisch vertretenen Begriff des Politischen. Hirsch kennzeichnet das ›Politische‹ als vor-, anti- oder postdemokratischen Ästhetizismus, dem es um Fragen der Identität von Gemeinschaften und des symbolischen Ausdrucks, nicht aber um die Durchsetzung eines Rechts gehe, das die Freiheit und Gleichheit aller Mitglieder der Gemeinschaft sichere. Von hier aus zeigt Hirsch, dass sowohl der aktuelle rechte als auch linke Populismus mit seinen sachfernen skandalisierenden oder resignativen Diskursen Strategien nutzt, die dem Konzept des ›Politischen‹ nahestehen. Als positive und zukunftsweisende Alternative zur sachfernen Spielart des ›Politischen‹ rehabilitiert Hirsch eine radikaldemokratische Politik, deren Gesetzgebungsfunktion eine Sicherung der sozialen sowie der materiellen Basis von Gemeinschaften ermögliche.
Mit dem Artikel von Patrick Primavesi wird die Sektion Praxisfelder eröffnet. Hier rekonstruiert er anhand exemplarischer Analysen von Diderot, Lessing, Rousseau, Goethe und August Wilhelm Schlegel die doppelte Perspektive des Theaterdiskurses um 1800. Einerseits stand die begrenzte Einflusssphäre des zeitgenössischen Theaters im Vergleich zur Antike in der Kritik. Andererseits wurde Theater aber als Form einer unmittelbaren Öffentlichkeit gefeiert, auch wenn diese nach der frühen Neuzeit zunehmend verloren ging. Öffentlichkeit fasst Primavesi dabei als Medium der Selbstinszenierung und Selbstbeobachtung der bürgerlichen Gesellschaft auf, womit er ein bis heute nachwirkendes Wechselverhältnis zwischen der Öffentlichkeit des Theaters und der Theatralität des Öffentlichen reflektiert.
Am Beispiel von Heinrich Laubes 1846 erschienenen Schauspiel Die Karlsschüler führt Lisa Bergelt vor, wie Theaterbühne und -texte des Vormärz zum Ort eines öffentlichen politischen Diskurses werden. Indem nämlich die Entscheidungsfindung absoluter Herrscher für ein Theater- bzw. Lesepublikum wahrnehmbar gemacht wird, verliert diese ihre spezifische Zeitlichkeit einer plötzlichen und unhinterfragbaren Eingebung von höherer Stelle. Die intransparente Herrschaftspraxis wird damit dekonstruiert und einer öffentlichen Wertung zugänglich gemacht. Anhand von dramatischen Paratexten zeichnet Bergelt außerdem Laubes Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Zensurpraxis nach, die er in ihrer Zeitlichkeit und Intransparenz als analog zur absolutistischen Herrschaft auffasst.
In seinem Artikel historisiert und konkretisiert Peter Seibert Habermas’





























