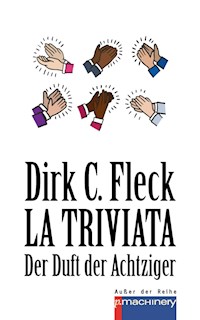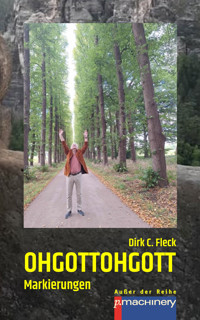
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Einordnung von OHGOTTOHGOTT THEMATISCHE ANSPRACHE: Es geht um die gesellschaftliche Gemengelage – von digitaler Zerstreuung bis zu real gelebten Auswirkungen von Krieg, Klima und Zusammenbruch. FORM & WIRKUNG: Kurze Essays und aphoristische Einwürfe, unterlegt mit Zitaten großer Denker, sollen wachrütteln und zugleich Trost spenden. RELEVANZ: Fleck verbindet klassische Weisheiten mit heutiger Krisendiskussion – ideal für Leser:innen, die nach Reflexion in bewegten Zeiten suchen. FAZIT: OHGOTTOHGOTT ist ein pointiertes, poetisch essayistisches Werk von Dirk C. Fleck, das Tabus bricht – mit existenzieller Wucht, literarischem Anspruch und inspirierenden Zitaten. Wer seine früheren Essays mag (z. B. »66 Notes«, »Gefleckte Diamanten«), findet hier eine noch zugespitztere, dringlicher klingende Stimme. QUELLE: ChatGPT
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirk C. Fleck
Ohgottohgott
Markierungen
Außer der Reihe 104
Dirk C. Fleck
OHGOTTOHGOTT
Markierungen
Außer der Reihe 104
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2025
p.machinery Michael Haitel
Die Urheberrechtsinhaber behalten sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
Titelfoto: Marina Silalahi
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Softcover-Ausgabe: 978 3 95765 473 1
ISBN der Hardcover-Ausgabe: 978 3 95765 474 8
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 683 4
Einordnung von OHGOTTOHGOTT
Thematische Ansprache: Es geht um die gesellschaftliche Gemengelage – von digitaler Zerstreuung bis zu real gelebten Auswirkungen von Krieg, Klima und Zusammenbruch.
Form & Wirkung: Kurze Essays und aphoristische Einwürfe, unterlegt mit Zitaten großer Denker, sollen wachrütteln und zugleich Trost spenden.
Relevanz: Fleck verbindet klassische Weisheiten mit heutiger Krisendiskussion – ideal für Leser und Leserinnen, die nach Reflexion in bewegten Zeiten suchen.
Fazit: OHGOTTOHGOTT ist ein pointiertes, poetisch essayistisches Werk von DirkC.Fleck, das Tabus bricht – mit existenzieller Wucht, literarischem Anspruch und inspirierenden Zitaten. Wer seine früheren Essays mag (z.B. 66 Notes, Gefleckte Diamanten), findet hier eine noch zugespitztere, dringlicher klingende Stimme.
Quelle: ChatGPT
Dieses Buch trägt einen merkwürdigen Titel, ich weiß. Trotzdem hoffe ich, dass ihr den kleinen Stoßseufzer vernehmen könnt, der in ihm mitschwingt. In OHGOTTOHGOTT sind 62 Arbeiten aus den letzten zwei Jahren versammelt, die das gesellschaftliche Terrain unserer Tage markieren – mit allen Befindlichkeiten, denen wir in dieser vom Wahnsinn geprägten Zeit ausgesetzt sind. Zwischen den Arbeiten befinden sich aktuelle Gedanken und Betrachtungen. Gewürzt sind diese »Zwischentöne« mit Zitaten herausragender Persönlichkeiten. Ich habe bewusst darauf verzichtet, die Menschen hinter den Zitaten vorzustellen. Wer sie nicht kennt und mehr über sie wissen möchte, sollte sich selbst informieren. Das verbindet …
Dirk C. Fleck
im Oktober 2025
Eine letzte Bitte hätte ich noch
Im Traum – für Träume kann man nichts – erschien mir Gott, und ich bat ihn, er möge binnen einer Woche alle töten, die ein bestimmtes Maß an Lüge überschreiten, ein Maß, das ich ihn festzulegen bat, und er sprach zu mir, geh und spreche es aus, denn alle sollen noch wenden können, indem sie die Lüge binnen einer Woche aufgeben; doch sie werden nicht hören, glaub mir, so sagte er weiter, und ich sagte, sie werden nicht hören und vielleicht solltest du deshalb konkreter werden, lieber Gott, und alle töten, die bei Spiegel, Welt und TAZ und FAZ und Süddeutscher und sämtlichen medialen Unter- und Nebengruppen, bei der NZZ, bei allen Tages- und Nachtanzeigern, beim Standard, bei BILD, bei der Madsack-Gruppe und bei t-online und allen anderen Kriegsportalen der Ströer-Gruppe, solltest alle töten, die bei ARD und ZDF und sämtlichen Landesablegern arbeiten und ihren Lohn da verdienen, alle töten, die in diesem medialen Schlachtfeld, Journalismus genannt, mitfeuern und mitgeifern und ihrer Niedertracht freien Lauf lassen, alle töten, die das lesen und sehen und mitfeuern und mitgeifern, alle töten, die binnen einer Woche auch nur einen Cent noch überweisen an diese Instrumente der Niedertracht und der Geistvernichtung, alle töten, die in irgendeiner Partei, namentlich bei Grünen, Christ-, Sozial- und Freien Demokraten, eingeschrieben sind, da Beiträge bezahlen, in Parlamenten sitzen oder als Minister das Lager in Windeseile reimplementieren, sollst alle töten, die binnen einer Woche nicht abkehren, zurücktreten, austreten, abtreten, sämtliche Zahlungen stornieren, Einzugsverfahren tilgen und die Adressaten auf die Sperrliste setzen, sollst alle töten und enteignen, die ihre lügenverzerrte Fresse noch vor eine öffentlich-rechtliche Kamera halten, sollst alle Konzern- und BlackRock-Manager töten und alle, die – und sei es an einem lausigen Faden bloß – mit der EU verhängt sind, sollst alle Adelsgeschlechter töten und ihrer Güter enteignen, das Gut des Albrecht- und von der Leyen-Clans bei Hannover zuallererst, und du solltest darüber hinaus alle Kabarettisten und Künstler töten, die der Macht zusprechen, alle Sänger und Schauspieler, die sedieren, so bat ich Gott im Traum, und ich bat, wohl wissend, getötet wird keiner, er solle endlich sämtliche Richter und Staatsanwälte und Justizangestellte, die bei der Gesinnungsjustiz mittaten und mittun, und alle, welche die Gesinnungsrichter und Staatsanwälte in die Positionen gehievt, und alle töten, welche – mehr Roboter denn Mensch – auf Demonstranten losgegangen, diese an Wände geknallt, mit Füßen getreten, sie von hinten zu Boden gerammt, Fäuste in ihre Därme geschlagen, und er solle all die töten, die in bester Stalinmanier Arztpraxen überfallen oder solche Überfälle beklatscht, alle töten und enteignen, die Gewaltorgien zu Berlin und anderswo mitgetragen, die Lügen verbreitet, Inszenierungen geplant und sich bereichert, und am Ende alle, die zu den Verbrechen dieser unserer westlichen Demokratien und dieser unserer westlichen Zivilisation geschwiegen haben und weiterhin schweigen, einfach nur schweigen und ihrer Arbeit nachgehen, zur Ermordung Magufulis schweigen und zur jahrzehntlangen Folterung von Julien Assange durch die freien und liberalen Demokratien schweigen, die alle, lieber Gott, mögest du binnen einer Woche töten, so spreche ich, in Traum und Trance, und wir wussten beide, wie still es würde im ganzen Lande und auf der Welt, von der sechsten bis zur neunten Stunde und weit darüber hinaus, wie still an jenem Morgen, nachdem Gott den Blitz gezückt gegen all jene, für die ich den Blitz erbeten, denn sie werden nicht hören, niemals. Und ich bat ihn abermals, da er doch der Gott des Alten Testaments sei, er möge, da sie nicht hören, sie nicht verschonen und binnen einer Woche die Hauptstädte jener besonders widerwärtigen Kriegsrauschregimes mit besonders vielen Stephan-Bandera-Verehrern auf Ministersesseln, er möge diese Hauptstädte und alles, was da kreucht und fleucht, da er ja eben der Gott aus dem Alten Testament sei, vom Erdboden tilgen, er möge London, Warschau, Berlin, Oslo, Helsinki, Washington samt Silicon Valley und alle philanthropischen Stiftungen samt Moral und alle, die in irgendeiner Form verknüpft seien mit WEF, WHO, GAVI, DARPA, mit Tavistock und der Digitalisierung überhaupt und dem QR-Code, er möge alle Institute des Kapitals und am Ende das Kapital selbst tilgen mit einem einzigen weltumspannenden Blitz, und ich stellte mir vor, in Traum und Trance, wie da, wo Berlin einst lag, stattlich und feist, in der Landschaft schon bald ein riesiges dampfendes Loch bloß noch wär und sonst rein gar nichts, ebenso da, wo London war und das Silicon Valley, und es tat mir, im Traum, so unendlich gut wie mir seit bald Jahren nichts mehr gut getan, dieser übrig gebliebene Dampf, da, wo einst die Baerböcke und Fäsers und Habecke und Lauterbäche ihre Widerwärtigkeiten aufgespannt und ihren Faschismus verbreitet, dieser Friede an gleicher Stelle nun, er würde mich überwältigen, ich wusste es, obgleich ich nicht wusste, ob dies nun sein Traum war oder ich seinen Traum träumte, und wissend, dass auch dies das Glück nicht sein konnte, dieses Töten, es kann dies das Glück nicht sein, aber eines ist klar: zu erreichen wäre es nur über eine Monstrosität, denn nur eine Monstrosität kann die Monstrosität tilgen, nur über ein Unglück der höheren Dimension wird es das Glück geben und in Tränen endlich schlief ich ein und erwachte erst wieder, als die Welt, grell erleuchtet von einem Blitz, in Flammen stand.
Aus »Raffen Sterben Trance« von Teer Sandmann
Man gerät mit der Zeit in ein Fahrwasser, das einen mal ruhig, mal reißend und manchmal überschäumend dem Ziel zuträgt. Jetzt muss alle Aufmerksamkeit dem Strom gelten. Jeder Kontakt zu Menschen stört die Navigationsfähigkeit. Die Musik, die in uns bereits zum klingen gekommen ist, kann sich nicht weiter entfalten, wenn man in einen Dialog gezwungen wird oder auch nur antworten soll.
Man wird nicht als Mensch geboren, man muss Mensch werden.
Oskar Kokoschka
Schein-Zeiten
An alle Menschen über fünfzig, denen bewusst wird oder schon bewusst geworden ist, dass sie früher oder später durch Materialermüdung dahin gerafft werden. Das ist ein Naturgesetz, da beißt keine Maus einen Faden ab. Über diesen, wie über andere dumme Sprüche haben wir zu unseren Schein-Zeiten gelacht. Schein-Zeiten, das waren jene Jahre, in denen wir hätten scheinen können, in denen unser inneres Licht den Weg weisen wollte. Wir durften an der Liebe schnuppern und zogen zurück, mehrmals taten wir das, bis wir aufgegeben wurden, um als Moleküle im Sauerteig der Bewusstlosigkeit Karriere zu machen, entweder als bedeutungsloser Loser oder als elitäre Arschgeige.
Die Melange aus Losern und Arschgeigen, die unserer Gesellschaft Struktur verleiht, ist für jene Menschen, die für ihre verwundeten Seelen SOS funken, während die Gischt aus Ignoranz und Dummheit ihnen ins Gesicht peitscht, unerträglich. Im Endeffekt bleibt ihnen nur, sich auf den Atem zu konzentrieren, Zug für Zug. Und sollte sich irgendwo ein Ausgang zeigen, nichts wie durch. Ich bin sicher, dass es unter euch einige gibt, die verstehen, wovon ich rede.
In seiner letzten Stunde saß Goethe bei verdunkeltem Fenster im Lehnstuhl, trank ein Glas Wein und schrieb mit dem Zeigefinger der rechten Hand etwas in die Luft, bevor er entschlief, »geisteskräftig und liebevoll bis zum letzten Hauche im drei und achtzigsten Lebensjahre«, wie es in seiner Todesanzeige hieß. Was mag der Mann in die Luft geschrieben haben? Wir werden es nie erfahren. Vielleicht vertraute er der Nachwelt noch schnell die Weltenformel an. Ein Schatz, den niemand heben darf und den er deshalb unter ätherischen Hieroglyphen versteckte. Vielleicht war es ein entzücktes »AH« oder »OH«. Er war nicht mehr bei sich, kann doch sein. Er musste sich nicht mehr mühen, es passierte von ganz allein, dass er zu einem mit allem verbundenen Wesen wurde, das sich endlich zu Hause fühlte. Kann doch sein.
Das wäre dann die wahre Befreiung. All die Zeit hinter uns, als wir versunken waren im Schlamm von Ehrgeiz, Meinung, Eitelkeit, Angst und Vorurteil würde sich verflüchtigen wie eine Wolke am Himmel. Mit der Zeit geraten wir in ein Fahrwasser, das uns mal ruhig, mal reißend und manchmal überschäumend dem Ziel zuträgt. Jetzt muss alle Aufmerksamkeit dem Strom gelten. Jeder Außenkontakt stört die Navigationsfähigkeit. Die Musik, die in uns bereits zum Klingen gekommen ist, kann sich nicht weiter entfalten, wenn wir immer wieder in einen Dialog gezwungen werden oder auch nur Antwort geben sollen.
Der grandiose Dichter Charles Baudelaire (Die Blumen des Bösen) gab seinem Überdruss an menschlicher Gesellschaft drastisch und unmissverständlich Ausdruck:
»Ich bin nicht in der Verfassung für all das da draußen. Ich habe kein Verlangen zu demonstrieren, zu überraschen, zu amüsieren oder jemanden zu überzeugen. Nichts zu wissen, nichts zu lehren, nichts zu wollen, nichts und niemandem eine Bedeutung zu geben. Zu schlafen und noch mehr zu schlafen, nur danach steht mir der Sinn.«
Ich blättere in alten Adressbüchern und fühle einen zarten Fliederschmerz beim Andenken an diese Menschen, um die ich mich nie gekümmert habe. Die Seele hätte keinen Regenbogen, wenn die Augen ohne Tränen wären, sagen die Lakota Sioux. Und Thomas Mann fragt, ob aus dem Weltfest des Todes, dass die Menschheit seit jeher auf der Erde feiert, jemals die Liebe steigen wird.
Seien wir ehrlich, wir leben unter lauter Todeskandidaten und ernähren uns aus dem geistigen Nachlass Verstorbener. Von Rainer Maria Rilke zum Beispiel, den zu zitieren mir jedes Mal Schauer über den Rücken jagt. In seinem Gedicht »Abschied« heißt es zum Schluss:
So lass uns Abschied nehmen wie zwei Sterne
durch jenes Übermaß von Nacht getrennt,
das eine Nähe ist, die sich an Ferne
erprobt und an dem Fernsten sich erkennt.
Das ist majestätische Lyrik, da durfte jemand auf gottgegebener Poesie surfen. Für Rilke ist Gott der Atem des Universums, der alles durchdringt und in jedem Moment unmittelbar erlebbar ist. Kennt Gott Rilke? Weiß er um die Traurigkeit eines Poeten, kümmert er sich um diese Leute oder hat er Besseres zu tun? Wie zum Beispiel eine aus der Balance geratene Galaxie wieder einzugliedern in den kosmischen Reigen. Man weiß es nicht. Vielleicht hat Goethe es gewusst, als ihm ein »AH« oder ein »OH« aus dem nackten Finger glitt.
Meine Gedanken wiegen manchmal zu schwer für die Sätze, die sie ins Außen transportieren sollen.
Ich werde immer auf der Seite derer sein, die nichts haben und denen nicht einmal erlaubt ist, dieses Nichts in Frieden zu genießen.
Federico Garcia Lorca
Wo kommen die denn her?
Kaum tauchen wir in einen Traum, begegnen uns Legionen von Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Man findet sich beispielsweise in einer Stadt wieder, an Kreuzungen, in Fußgängerzonen, in Restaurants und Cafés. Die Menschen haben klar erkennbare Gesichter, wie im richtigen Leben. Sie benehmen sich wie im richtigen Leben, jeder auf seine Art. WO KOMMEN SIE HER?! Wir sind diesen Wesen nie zuvor begegnet. Oder doch? Nein, nicht in diesem Leben. Also: Wo kommen sie her, die Traumfiguren in ihren Autos, im Kaufhaus, am Würstchenstand, die Paare und Passanten, die Gehetzten und Lachenden, die Bettler und die feinen Leute mit den Sektgläsern in der Hand, die einem sogar manchmal zuprosten? Keine Ahnung, aber jedes ihrer Gesichter ist bis ins Detail ausgeprägt. Die Traumwelt präsentiert sich so vielschichtig und real, wie wir die Welt auch im Wachzustand erleben.
Aber die Frage bleibt: Wo kommen all die Menschen her, die als Statisten durch unsere Träume geistern? Handelt es sich um Wesen, die vor uns hier zu Gast waren und nun anstehen, um wieder geboren zu werden, damit sie ihre Lektion zu Ende lernen? Eine Lektion, die unterbrochen wurde durch Kriege und Krankheiten, durch Mord und Selbstmord oder weil einfach nur die Herzen im Überlebenskampf stumpf und empathielos geworden waren. Herzen, die den eigentlichen Sinn des Lebens nicht mehr begreifen und greifen konnten. Und dieser Sinn, daran glaube ich fest, besteht darin, das Ego zu zertrümmern und zu verstehen, was Liebe meint. LIEBE – der Feinstoff, der die Welt im Innersten zusammen hält. Nur wer das verstanden hat, wird davon befreit, sich erneut in diesen gigantischen Wartesaal zu begeben, aus dem sich unsere Traumfiguren rekrutieren. Wäre eine Erklärung. Muss aber nicht so sein.
Keine Vorstellung mehr von sich zu haben, nicht mehr verhaftet zu sein durch Verstand und Intellekt, zu leben, was man im Kern ist, nämlich ein mit allem verbundenes Wesen, welches sich zu Hause FÜHLT – das ist die wahre Befreiung. All die Zeit hinter uns, als wir Schatten eines Schattens waren, versunken im Schlamm von Ehrgeiz, Meinung, Eitelkeit, Angst und Vorurteil, verflüchtigt sich, wie eine Wolke am Himmel.
Ein System, welches von Machtgier, Hinterhältigkeit, Unmenschlichkeit, Verlogenheit und Arroganz durchseucht ist – wird aus diesem Weltfest des Todes einmal die Liebe steigen?
Thomas Mann
Betrachtungen eines hemmungslosen Romantikers
Leonard Cohen brachte es auf den Punkt: »Es gibt keine Erklärung für die gesammelten Schweinereien um uns herum. Die einzige Möglichkeit, einigermaßen ungeschoren davon zu kommen, ist zu sagen: ›Ich verstehe von dem Mist nicht das Geringste – Halleluja!‹« Diese Textsammlung aus den letzten vierzig Jahren ist den Frauen gewidmet. Halleluja! In Zeiten des ungenierten Treibens eines seelenlosen, kriegsgeilen Politikerpacks tut es vielleicht gut, kurz auszuspannen und sich den Betrachtungen eines hemmungslosen Romantikers hinzugeben.
Es gäbe so viel zu sagen über Frauen. Über Frauen und Jahreszeiten, über Frauen mit Hund, über arme und reiche Frauen, über Frauen, die sich aus dem Gespinst dunkler Begegnungen lösen, über schwangere Frauen, über Frauen, die auf ihrer Hochzeit im Garten heimlich den Geliebten verführen, über die Frauen von Helsinki, über Frauen, die zu souveräner Trauer finden, wenn die Schwester sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, über Frauen am Mikrofon, über lesbische Frauen, über Frauen, deren Augen auf zerknitterten Schwarz-Weiß-Fotos strahlen, als könnte nichts und niemand ihnen etwas anhaben.
Deine Abwesenheit füllt mein Leben aus. Ich kann dich denken hören.
Es gibt Momente in meinem Leben, da scheint die ganze Welt nur aus dir zu bestehen. Du bist mein Brennglas, durch das ich den Weltenzauber betrachten darf.
In ihrer Gegenwart hatte ich das Gefühl, als würde ich meine Nase in das letzte Stück unberührter, duftender Erde stecken, wo noch Keime des wahren Friedens schlummern.
Aber dann sitze ich neben dir und wünschte, ich wäre unsichtbar wie der Wind, der dir in die Haare weht und deine Lippen kühlt.
Jede Geste von dir, jedes Wort besitzt die Anmut einer wilden Blume, die sich selbst genügt.
Da ist sie wieder, die Poetin mit dem Sack voller glitzernder, abgesegneter Worte, die so zart, zauberhaft und diskret die Weisheit des Universums berühren. Ich habe das Gefühl, als würden mich Milliarden Partikel eines Sonnensturms treffen. Es ist so viel Einsicht in deinen Worten, durchsetzt mit schmerzhaften Schreien, ausgestoßen auf der harten Matratze der Hilflosigkeit. Du hast etwas sehr Pflanzliches an dir. Du atmest anders, speicherst anders, sonderst anders ab.
Ihre gigantische Wortplastik, diese Verstrickung mit der Wahrheit. Das Bemühen, alles zu fassen, alles zu berühren, jeden Gedanken einzubinden – all das erinnert mich an Ruderschläge auf einem Meer ohne Grenzen.
Ich fühlte mich ein wenig überfordert von ihrer Schönheit. Sie war mit einem Licht gepudert, das jenseits aller Sonnen seinen Ausgang nimmt. Gleich am ersten Abend fragte ich sie, ob sie für mich Modell stehen möchte. Sie war einverstanden. Als ich Papier und Bleistift zur Hand nahm, gerann sie zu einer Statue der Anmut, vor der ich einen Fehlversuch nach dem anderen zerknüllte.
Ich wusste nicht, wovor ich mehr Angst haben sollte: dass sie verschwunden war, wenn ich aufwachte, oder dass sie noch neben mir lag.
Selbst die anmutigsten Hoffnungsträgerinnen der Liebe rücken vorschnell in die Pläneschmiede ein, diesem großen Wartesaal der Ratlosen.
Nichts macht Frauen trauriger als das Wissen um den Verlust ihrer Blüte. Wer als Mann glaubt, diesem verborgenen Schmerz gewachsen zu sein, überschätzt sich.
Manche Frauen bewegen sich in ihren Körpern, als würden sie das Lebenselixier in einer Schale spazieren tragen.
Frauen lieben es, wohlwollend bemerkt zu werden. Ihre Seele errötet dabei.
Der Voyeur meiner Prägung hat keine Erwartungen oder Vorlieben, denen er geifernd nachhängt. Er besitzt einen sicheren Instinkt für die Schönheit der Schöpfung, die sich vorübergehend auf alles und jeden zu legen vermag. Er ist davon überzeugt, dass es einen immergrünen Vorrat an Gesten gibt, die uns wie Winde umschmeicheln.
Eine magische Aura umgibt nur Frauen, die sich im Zustand der reinen Unschuld befinden, die sich in Harmonie mit der Schöpfung wissen, die auf fantastische Weise neugierig sind, die keine Schuldzuweisungen treffen und sich nicht strategisch durchs Leben schlagen. Auf sie fällt ein Licht, das nicht von jedem wahrgenommen wird, was ihnen aber egal ist. Erst wenn sie sich der Wirkung auf andere bewusst werden und sich die Eitelkeit ihrer Unschuld bemächtigt, ist es vorbei mit der von wem auch immer verliehenen Zauberkraft. Schnipp, einfach so.
Ein Vergötterer, und ich zähle mich durchaus dazu, ist im Grunde genommen ein Egoist, der das Dickicht zwischenmenschlicher Beziehungen meidet, weil er sich nicht in Missverständnissen und trivialen Auseinandersetzungen verheddern möchte, die in unserer sogenannten Realität zum Standardprogramm zwischen den Geschlechtern zu gehören scheinen.
Er konnte sich auf ihr Urteil verlassen. Sobald sie etwas in seinen Texten nicht verstand, wandelte er es um, feilte daran oder verwarf es, bis sie entzückt war. Mit einer Ausnahme: wenn es um Frauen ging …
In ihrer Gegenwart werde ich meiner Worte beraubt. Sie erscheinen mir lächerlich in dem Bemühen, die Essenz zu beschreiben, den Geschmack, den Duft, die Anmut, mit der jede Sekunde spielerisch um sich wirft.
Ich fand ein Foto im Internet, es zeigt eine Frau, die bei geschlossenen Augen Violine spielt, während ihr die Tränen übers Gesicht laufen.
Im Schweigen, das die Verkrampfung verloren hat, bin ich sicher. Eine Jolle im sanften Wellentanz. Aber schon jeder Blick und jedes Wort, gar jedes Lachen fühlt sich an, als hebe sich die See. Fehlt nur noch eine Umarmung und wir werden von den Brechern an die schroffen Felsen gedrückt. Verletzungsgefahr!
Ich denke an dich wie ein Fallender ohne Grund, manchmal auch wie ein Golfball in Erwartung des Eisens.
Selten kreisen die Gedanken intensiver um die Liebe, als wenn sich eine Frau die Fingernägel betrachtet.
An ihrer Seite wich die Banalität des Alltags einem kindlichen Erstaunen und alle Ironie, die ich seit Jahren bemühte, um der Dummheit unter Menschen zu begegnen, verursachte nur noch Schuldgefühle. Der Sarkast, der sich zuvor bequem die Welt gedeutet hatte, war auf fantastische Weise entwaffnet worden.
Der Schienenblick, mit dem Mädchen leicht errötend den Blicken ihrer Bewunderer begegnen. Ein Klassiker unter den Gesten, aber seit Ewigkeiten im Besitz der jungen Generation.
Ich liebe dich!, brüllte er vom Balkon und stemmte sich mit aller Macht gegen das Haus, wollte es verschieben, dorthin, wo nicht Abschied war.
Der Mann stand vom Tisch auf und sie griff nach seiner Hand wie nach einem Rettungsring.
Ich hole mein weißes Dinnerjacket aus dem Schrank, schaue von der Terrasse eines südamerikanischen Strandcafés aufs offene Meer hinaus und lasse die Eiswürfel zu dezenten Rumbaklängen im Glas klimpern. Irgendwann werde ich mich umdrehen. Dann steht sie da. Lasziv lächelnd, in einem berauschenden Seidenkleid, das sich der Abendbrise an die Schenkel schmiegt.
Mit dem Wortfriedhof will ich jener Vokabeln und Begriffe gedenken, die sich im deutschen Sprachgebrauch aus unterschiedlichsten Gründen erschöpft haben. Sie lassen sich nicht mehr benutzen. Sie wurden gemordet, denunziert, diskriminiert oder der Lächerlichkeit preisgegeben. Manche haben vor dem Zeitgeist kapituliert, andere sind im Dienste sich wandelnder Werte und Erkenntnisse untergegangen oder waren einfach nur zu schwach, um sich zu behaupten. Der Friedhof der Worte erinnert daran, dass die Sprache ein organisches Wesen ist. Wenn man ihm genügend Poesie zuführt, regeneriert es sich selbst – gleich einem Baum unter dem ausschließlichen Einfluss von Licht und Wasser.
Hunde und Menschen, Katzen und Helden, Flöhe und Genies spielen »Wir existieren und denken uns nichts dabei« unter der großen Stille der Gestirne.
Fernando Pessoa
Obszön, hässlich und laut – alles zu grob hier …
Der ungarische Schriftsteller Péter Nádas (82) hat fünf Jahre gebraucht, um sich nach einer Nahtoderfahrung wieder zurechtzufinden. In seinem Buch »Der eigene Tod« beschreibt er, wie es sich anfühlt, wenn man gewaltsam ins Leben zurückgeholt wird. Was die Ärzte als Erfolg verzeichneten, war für den »Geretteten« nichts als eine kratzende Pein, als würde er wieder in eine alte, längst abgelegte rostige Rüstung gezwängt. »Es geht einen nichts mehr etwas an«, schreibt Nádas, »weder die Dinge, noch die anderen Menschen, weder das eigene Wissen noch die eigene Lebensgeschichte. Ich konnte nicht mehr auf die Straße gehen. Alles war obszön. Auch die Menschen waren obszön, auch die Gegenstände. Alles war unglaublich hässlich, alles hat mich gestört. Es war zu laut, zu grob. Wir geben einander keine Zeit, wir hören einander nicht zu. Ich bin nie richtig zurückgekehrt.« Péter Nádas lebt heute fernab von Trubel und Hektik in einem kleinen Dorf im Nordwesten Ungarns.
Über die jenseitige Welt, die er kurz betreten durfte, macht er keine Angaben. In der Dokumentation »Grenzerfahrung Nahtod« des ORF sagt er lediglich: »Gott ist leider ein peinlicher Irrtum, seine Verkörperung ist ein Irrtum. Aber die Schöpfungskraft ist kein Irrtum.« Weiter hinaus traut er sich nicht. Nicht mit Worten.
Die Ohnmacht der Worte muss auch Stefan Lampe erfahren. Immer noch. Dabei ist die Sprache sein Berufswerkzeug, Lampe predigt Gottes Wort von der Kanzel. Vor zwanzig Jahren erlitt er einen Autounfall, der ihn für wenige Sekunden aus der Welt schleuderte und immer noch sprachlos macht. Aus der Welt? Welcher Welt? Wir kennen den berühmten Holzstich »Wanderer am Weltenrand« des französischen Astronomen Flammarion, der einen Mann zeigt, der durch das mit Sternen bestückte Firmament verzückt ins NICHTS starrt. Dieses NICHTS lebt, intensiver, als wir es uns vorzustellen vermögen. Die Crux ist, dass es sich dem Verstand und damit selbst der Sprachakrobatik eines katholischen Pfarrers entzieht.
»Ich bin als Theologe zwar ein Mann des Wortes, aber hier strecke ich meine Waffen«, gestand Stefan Lampe in einem Gespräch mit Thanatos TV. »Es ist unmöglich, mit den armen Worten des Diesseits zu beschreiben, was ich in einer völlig zeitlosen Schau erfahren habe. Nur so viel: Es war eine unbedingte Zugabe von ICH. ICH plus unendlich mehr.« Und dann sagte er diesen Satz, den sich all jene, die ihre Nahtoderfahrung in den sozialen Netzwerken spektakulär ausschmücken und damit entzaubern, unbedingt merken sollten: »TRAU DICH, DEM UNVERWORTBAREN RAUM ZU GEBEN. Mit dem Denken kommt man da nicht hinterher.« Unverwortbar – großartig. Der Prediger aus der beschaulichen Gemeinde Wohldenberg bei Hildesheim fügte noch etwas hinzu, was mich persönlich sehr berührt hat: »Ich habe die Verbundenheit gesehen. Es gibt nichts, was ich tue, das nicht in Verbindung steht mit allem.«
Aber zurück zu dem eingangs erwähnten Péter Nádas und seiner neu gewonnenen Weltsicht. Obszön, hässlich, laut und grob, das ist in der Tat der Sud, der übrig bleibt, wenn man die gesellschaftspolitische Debatte unserer Tage und den Umgang der Menschen miteinander einmal kräftig durchsiebt. Es bleibt immer beim Grobschnitt, der voller Sprachverwirrungen und Missverständnisse ist, in dem die manipulativen Kräfte aus Medien und Politik ein ganzes Volk »kriegsverwendungsfähig« impfen, in dem das Denunziantentum per Gesetz hoffähig wird und die niedrigste Intelligenzstufe für höchste Ämter qualifiziert, gepaart mit Skrupellosigkeit und Korruptionsbereitschaft. Unser Wertekanon ist unter einer Flut obszöner politischer Statements begraben. Frieden ist igitt. Und die Liebe, die unser Leben laut Einstein doch im Innersten zusammenhält? Die Liebe wurde von der Unterhaltungsindustrie gemeuchelt, bis sie sich nur noch als pornografische Hülle mit affigem Augenaufschlag darzustellen vermochte. Wir erleben einen geschlechtslosen Faschismus im rosa Kleidchen – wo man hinschaut und hinhört. Ekelhaft und grob.
Bremen Hbf, nachmittags um halb drei. Wie viele unförmige Kreaturen kann das Auge nehmen, bevor es Hilfe suchend in den Himmel starrt? Monsterärsche über X-Beinen, Hängebäuche, die im vorübergehen mit weiteren Pommes gemästet werden, tätowierte Waden und herab baumelnde Wurmfortsätze, Hälse, dicker als die darauf sitzenden Köpfe – und das alles in breiter Phalanx auf dich zukommend, feiste Kinder hinter sich herziehend, dich rempelnd verschlingend … Dabei wollte ich nur meinen Zug auf Gleis 9 erreichen (»Heute ca. 45 Minuten später«). Sie sprechen. Sie sprechen unentwegt. Sie sprechen laut. Sie benutzen meine Worte, mindestens zwölf davon, Okay, gebongt, von denen mache ich ohnehin keinen Gebrauch. Jedenfalls hätte es einer überirdischen Anstrengung bedurft, diesen verbrannten Seelen an diesem Tag mein Mitgefühl zu geben. Es war der Tag, an dem Sinéad O’Connor starb.
Es gibt keine Antwort. Es wird keine Antwort geben. Es hat niemals eine Antwort gegeben. Das ist die Antwort.
Gertrude Stein
Alles eine Frage der Zeit
In keinem Land der Welt gibt es pro Einwohner mehr Uhren im öffentlichen Raum als in Deutschland. Was sagt uns das? Dass es zu unseren Grundbedürfnissen gehört, immer zu wissen, was die Stunde geschlagen hat? Wohl kaum. Dass wir ohne die permanente zeitliche Verortung unsere Orientierung verlieren? Ich weiß es nicht. Welche Orientierung gäbe es denn zu verlieren? Es würde ja bedeuten, dass wir ein Ziel hätten, dass wir wüssten, wohin die Reise gehen soll.
Was also könnte der Grund dafür sein, dass wir Menschen die von unseren Sinnen ganz anders wahrgenommene Wirklichkeit unter einem Zeitraster von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren ersticken, sie sozusagen in ein DIN-Format pressen, in eine Einheitsnorm, die dem wilden Treiben des Lebens nicht ansatzweise gerecht wird. Jedes Lebewesen, das mit uns diesen Planeten teilt, hat mit der Zeit »nichts am Hut«. Ein Vogel kommt nie zu spät, ein Baum hat keine Termine, dem Biber ist es egal, wie alt er ist. Warum glauben wir Menschen so unerschütterlich daran, dass Zeit eine konstante Größe ist, während unter den Zifferblättern ein Ozean unterschiedlichster Ereignisse und Empfindungen brodelt, die uns in jedem Moment bestätigen, was der griechische Philosoph Heraklit (520–460 v. Chr.) in der populären Kurzformel panta rhei (»Alles fließt«) zusammengefasst hat: »Man steigt niemals zweimal in denselben Fluss.«
Und tatsächlich ist das Zeitempfinden eines jeden Menschen einzigartig und in keiner Weise mit dem eines anderen Menschen vergleichbar. Für jemanden, der auf dem elektrischen Stuhl schmort, fühlt sich eine Minute anders an als für jemanden, der währenddessen vor dem Fernseher dreimal in eine Tüte Chips greift. Wenn zwei nebeneinandersitzende Fußballfans dasselbe Spiel sehen, wobei der eine den Abpfiff herbeisehnt, weil sein Team mit einem Tor in Front liegt, während dem anderen die Nachspielzeit nicht lang genug sein kann, ist das Zeitempfinden der beiden zwar aufregend, aber in keiner Weise miteinander vergleichbar. Das gilt für alles, das gilt für jeden, das gilt immer.
Die Uhren suggerieren uns, dass das Leben linear verläuft. Daran glauben wir, daran halten wir fest, damit lässt sich alles berechnen und steuern, was unsere Gesellschaft braucht, um funktionieren zu können. Unsere Kultur (kann man überhaupt noch von einer solchen sprechen?) kennt keine Geheimnisse mehr. Der französische Dramatiker Antonin Artaud (1896–1948) unternahm 1936 eine Reise nach Mexiko, wo er einige Monate bei den Tarahumara-Indianern lebte. In seinem Buch »Revolutionäre Botschaften«, das er anschließend schrieb, kommt er zu dem Schluss: »Mehr noch als Wissen stachelt Nichtwissen an. Das Nichtwissen, aber ein erleuchtetes und bewusstes Nichtwissen, ist der Zement der Wahrheit«. Wow! Dann lasst uns doch mal eine Kelle bewusstes Nichtwissen auf die Wahrheitsplastik klatschen.
Die Zeit ist kein Bindfaden, auf dem die Daten unserer Geschichte aufgereiht werden. Die Zeit ist eine Kugel.Wenn eine Seele nach einem neuen Körper angelt, kann sie die Zeit betreten, wo sie will. Ich persönlich mag die Zeit nicht. Sie ist ein Parasit, sie braucht den materiellen Nachschub, damit sie überhaupt sichtbar wird. Zeit hängt den Körpern und Dingen wie eine Würgeschlange um den Hals. Im Meer der unendlichen Möglichkeiten, wie die Quantenphysik das allumfassende Ganze nennt, in dem alles gespeichert ist, was jemals von irgendeiner Kreatur gedacht oder gefühlt wurde oder noch gedacht oder gefühlt werden wird, spielt sie keine Rolle, nicht die geringste.
Der Tipp an meine Zeitgenossen lautet daher: Schaut nicht auf die Uhr, sondern schaut euch um. Schaut genau hin, denn bald gibt es euch nicht mehr. Nicht in dieser Form. Dann ist die Chance dahin, eure Seele mit purer irdischer Schönheit zu füttern und damit euch selbst. Denn eines ist klar: Ihr lebt nicht in eurem Körper, euer Körper lebt und stirbt in euch. Und was er an Sinneseindrücken liefert, bestimmt die Leichtigkeit eures jetzigen und zukünftigen Seins.
Epilog in Stichworten: Zeitabschnitt, Zeitachse, Zeitalter, Zeitansage, Zeitarbeit, Zeitdokument, Zeitdruck, Zeiteinheit, Zeitenwende, Zeitfahren, Zeitgeist, Zeitgeschäft, Zeitgeschmack, Zeitgewinn, zeitlos, Zeitlupe, Zeitnehmer, Zeitnot, Zeitpunkt, Zeitraffer, Zeitrahmen, Zeitrechnung, Zeitspanne, Zeitstudie, Zeitvertreib, Zeitzeuge, Zeitzone, keine Zeit haben, kommt Zeit, kommt Rat, zeitgenössisch, zeitgemäß, zeitgeschichtlich, zeitgleich, zeitlebens, deine Zeit ist gekommen.
Alles eine Frage der Zeit …
Hinter jedem Licht steht das Dunkel, jedes Licht ist auf Schwarz gemalt. Seltsamerweise sind es die strahlendsten, klarsten Tage, durch die das Schwarz am intensivsten wahrzunehmen ist.
Ich durchlebe jetzt so unendlich viel, kann kaum darüber sprechen. Mich selbst finde ich jeden Tag unwichtiger. Wie fremd und einsam komm’ ich mir manchmal vor! Mein ganzes Leben ist ein großes Heimweh.
Gustav Mahler
Unsere Sprache ist zur Giftmülldeponie verkommen
In meinem Buch »Gefleckte Diamanten« sind Gedanken und Aphorismen aus den letzten vierzig Jahren versammelt. Ich habe sie in vierzehn Kategorien unterteilt. Eine dieser Kategorien trägt den Titel »Literatur«. Hier eine Auswahl:
Schriftsteller, die erkannt haben, dass Worte Versteller sind, Sichtblenden vor der Wahrheit sozusagen, die dafür plädieren, Worte schlicht und sinnvoll einzusetzen, anstatt sie in der Schlacht um die unumstößliche Wahrheit zu verheizen, solche Schriftsteller spüren die Magie des Lebens in jedem Moment.
Die Texte, in denen Peter Handke die »ersten Male« besang, diese poetische Rührung, die auch noch das Banalste auflädt, wenn es nur dies ist: eine neue Erfahrung, ein Anfang.
In den letzten dreißig Jahren, in denen ich immer wieder zu den Schriften von Prentice Mulford gegriffen habe, ist mir kein Mensch begegnet, der diesen Mann kannte. Auf Facebook stieß ich nun auf eine Seite, die seinen Namen trägt. Auf ihr fand ich folgenden großartigen Text: »Alle wilden Geschöpfe haben in ihren natürlichen Lebensbedingungen eine Art Seligkeit, denn sie sind wahre Ausdrucksformen des großen Unbekannten, das wir in Ermangelung eines besseren Wortes das unendliche Bewusstsein nennen wollen. In der wahnsinnigen, jubelnden Ekstase des Liebesschreis, mit der der große Vogel einsam in der Morgendämmerung über die Tannen hin nach einer Unbekannten ruft, ist seines Lebens Schönheit, Wahrheit und Glück, wie es gleichermaßen der unvergleichliche Sprung für die Wildkatze ist, mit dem sie, ein Dämon der Anmut, ihm den Jubelruf in der Kehle durchbeißt. Wo aber ist diese Wahrheit und Anmut, wenn der Mensch sein Geselchtes mit Bier hinunter schwemmt? Dann nähert sich sein Ausdruck in ganz verdächtigem Maße dem Geschöpf, in das er den starken, mutigen Eber verzüchtet, verschweinzt hat, denn das Schwein ist Menschenwerk und zeigt so recht, was aus einer Wahrheit wird, die er in seine Finger bekommt. Die ebenmäßige, starkbeschwingte, sich selbst erhaltende Wildgans ist eine Wahrheit: ist einer der Ausdrücke des unendlichen Bewusstseins. Die watschelnde, hilflose, flügellahme, leberkranke, geschoppte Gans ist das, was von einer Wahrheit übrig bleibt, wenn der Mensch dazu kommt.«
Unsere Kommunikation beschränkt sich auf einen abgegriffenen Bodensatz an Vokabeln, der permanent in Aufruhr ist und jeden reinen Gedanken trübt. Die Sprache ist längst zur geistigen Giftmülldeponie verkommen, in ihr lagert das kulturelle Elend unserer Zeit.