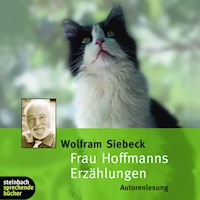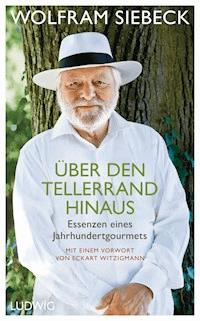19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Wolfram Siebecks Herz schlug für die guten Dinge des Lebens. Sein unbeirrbarer Sinn für wahren Genuss hatte etwas Verschwenderisches und angenehm Unvernünftiges. Lässig und weltmännisch half er den Deutschen dabei, ihren Geschmack zu verfeinern. Dabei wurde er selbst zum Idealtyp des Genussmenschen und fand zu seinem unverwechselbaren Stil, der ihm als Kolumnist Millionen Leser bescherte – meist treue und begeisterte, doch auch verärgerte, wenn ein Urteil mal wieder streng und um einer guten Pointe willen gepfeffert ausfiel.Erstmals sind nun Siebecks späte Lebenserinnerungen zu lesen, in denen sich sein humorvoller Biss mit alterskluger Selbstironie verbindet. Das Manuskript fand seine Frau Barbara in einer Truhe in ihrer gemeinsamen Wohnung auf Schloss Mahlberg wieder. So unverblümt hatte Siebeck nie zuvor über seine Eltern, über die NSDAP-Karriere seines Vaters oder über seine Jugend im Nationalsozialismus geschrieben. Er schildert seinen Werdegang – vom Schildermaler und Zeichner in der Nachkriegszeit mit Umwegen über Jazz und Avantgarde-Kino, über seine ungeplante Selbstfindung als Schreiber bis zu den Freuden und Tücken des Alterns. Nicht zuletzt sind seine Memoiren eine sinnliche Verneigung vor seinem langjährigen Wohnsitz in der Provence und dem kulinarischen Sehnsuchtsziel Frankreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolfram Siebeck
Ohne Reue und Rezept
Mein Leben für den guten Geschmack
Mit Nachworten von Barbara Siebeck und Vincent Klink
Schöffling & Co.
Inhalt
Vorwort
Provence 1
Mein Vater war kein Architekt
Provence 2
Hummer und Jazz
Widdersberg, andere Wohnorte und Frau Hoffmann
Vom Schildermaler zum Pressezeichner
Vom Zeichner zum Schreiber
Trockene Mauern und trockene Weine
Provence 3
Vom Schreiber zum Gourmetkritiker
Provence 4
Paris
Wien
Provence 5
Über Kochkonsumenten und andere prominente Kaliber
Über das Alter 1
Provence 6
Über das Alter 2
Provence 7
Das Manuskript in der Truhe
Ein Nachwort von Barbara Siebeck
Wolfram Siebeck, mein Kompass zum guten Kochen
Ein Nachwort von Vincent Klink
Vorwort
Wer will denn in dieser Zeit schon wissen, wie eine Gänseleber schmeckt?, fragte Barbara, als ich ihr den Beginn dieses Buches ankündigte.
Dabei hatte ich gar nicht vor, diesen spezifischen Geschmack aufs Neue zu beschreiben. Aber erstens erwarten viele Leser von mir nichts anderes, und zweitens ist die Beschreibung einer Terrine von der gestopften Gänseleber in Deutschland immer noch ein Thema, das Frau M. aus Berlin wütend an ihren Laptop treibt. Sie und ihre ebenfalls wütenden Freundinnen in Empörung zu versetzen, war Zeit meines Lebens ein Ansporn für mich.
Darüber hinaus geht es mir in diesem Buch aber nicht um Erregung privater Ärgernisse, sondern lediglich um die Lücken, die ich in meinen Erinnerungen entdeckt habe. Und die stören keinen so sehr wie mich selbst.
Deshalb habe ich dieses Buch zu meinem Amüsement geschrieben. Wie überhaupt die meisten Ereignisse meines Lebens Produkte meiner Lebenslust waren.
Man kann auch von Genusssucht sprechen und es oberflächlich nennen. Aber wer da leugnet, dass die interessantesten Dinge auf der Oberfläche unseres Lebens zu entdecken sind, soll sich dorthin verziehen, wo der Morast am tiefsten und die Gedanken am dunkelsten sind. Er wird sich nicht in schlechter Gesellschaft befinden.
Beide Lokalitäten habe ich stets zu vermeiden gesucht. So entging ich der Suche deutscher Feuilletons nach dem Tiefsinn und der Bedeutungsschwere.
Auch die bisweilen nicht chronologische Form dieses Textes hat keine andere Bedeutung als die, jene pedantische Reihenfolge zu verhindern, wie sie bei Kochrezepten notwendig ist.
Mahlberg, im Sommer 2009
Provence 1
Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts machte der geniale Robert Gernhardt die Entdeckung, dass Gott die Deutschen auf die Erde geschickt hat, damit sie mediterrane Trockenmauern restaurieren.
Wer würde dieser klugen Einsicht widersprechen? Lobbyisten der Betonindustrie könnten anderer Meinung sein, okay. Ich jedenfalls folge dem aktuellen Trend zu Spätbekenntnissen und gestehe: Ja, ich habe es auch getan. Meterlange Trockenmauern gehen auf mein Konto, beziehungsweise sie gingen davon ab.
Man kann sie in der Provence besichtigen – also nicht in der Toskana, wo Gernhardt trocken mauerte –, sondern im Land der sonnenbeschienenen Lavendelfelder, wo Franzosen wohnen und irgendwo hinterm südlichen Horizont das blaue Mittelmeer schlapp an die Küste rollt.
Wie es dazu kam, dass ich ein Maurer wurde, soll hier zur Warnung für folgende Generationen erzählt werden. Übrigens darf man diese Berufsbezeichnung nicht wörtlich nehmen. Ich bin ebenso wenig ein Maurer, wie Gernhardt einer war. Wenn wir die uns von Gott aufgetragene Pflicht erfüllt haben, dann eher indirekt: Wir haben mauern lassen. In meinem Fall bin ich vom göttlichen Auftrag sogar so weit abgewichen, dass ich Trockenmauern nicht restauriert habe; es waren gar keine Mauern da, die hätten restauriert werden können. Ich habe nagelneue Trockenmauern in die alte Landschaft bauen lassen. Und das kam so:
Als ich eines Tages in Spendierlaune war, habe ich diese Immobilie gekauft. Ein Grundstück in einer Sackgasse am Dorfrand von knapp über 3500 Quadratmetern, auf dem sich zwei Gebäude befanden. Alte Steinhäuser natürlich. Welcher kultivierte Deutsche hätte in der Provence etwas anderes gekauft als alte, reparaturbedürftige Mas, wie Bauernhäuser hier genannt werden? Mas, mit dem verheißungsvollen Adjektiv »provenzalisches« Mas versehen, löst im germanischen Großstädter das ebenso klare wie falsche Bild von Arkadien aus. Hat man je einen stolzen Zweithausbesitzer sagen hören: »Ich besitze ein Mas auf Rügen?« War je eine Immobilienanzeige erfolgreich, die ein »Mas am Atlantik« anbot? Auch bei uns im Elsass ist das Wort Mas völlig ungebräuchlich.
Eigentlich sollten die Wörter ›bei uns‹, wie im vorigen Satz verwendet, ebenfalls ungebräuchlich sein. Denn das Elsass gehört uns gar nicht; wir wohnen nicht einmal dort. Aber wir können es sehen, wenn wir aus den westlichen Fenstern unserer Burg nach dem Verkehr auf der A5 Ausschau halten: Die Hügelkette am Horizont sind die Vogesen. Vor den Vogesen liegen die bekannten elsässischen Weindörfer mit den bekannten elsässischen Restaurants und Weinstuben, welche wir oft besucht und Flammkuchen gegessen haben, sodass die sprachliche Besitzergreifung entschuldbar sein müsste. Uns schien es jedenfalls logisch, nach der elsässischen auch die provenzalische Küche zu erforschen.
Deshalb kaufte ich diese Klitsche nördlich von Orange und östlich von Montélimar. Verglichen mit dem Elsass, hat diese Region den Nachteil, dass es dort keine bemerkenswerten Restaurants und keine interessanten Weingüter gibt.
Als routinierter Trinker habe ich immer behauptet, dass es sich nur dort gut leben lässt, wo Wein angebaut wird. Wenn ich jedoch den höchsten Punkt meiner Immobilie erklimme und hinunter in die Ebene schaue, sehe ich keinen einzigen Rebstock. Weil hier kein Wein wächst, sondern nur Knoblauch (nicht schlecht), Tomaten (na ja) und vor allem Mais (entsetzlich).
Warum Deutsche und andere Nordeuropäer unbedingt kaputte, alte Bauernhäuser kaufen und restaurieren müssen, hat, abgesehen von der göttlichen Bestimmung, seinen Grund in den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts. Damals zogen des Königs stolze Reiter durchs Land und legten alles in Trümmer, was einen protestantischen Geruch hatte. Das waren vor allem Burgen und Schlösser des ungehorsamen Adels. Wie sich der protestantische Geruch – abgesehen vom fehlenden Weihrauch – von den damals üblichen Gerüchen unterschied, lässt sich nur vermuten. Die lieben Haus- und Nutztiere haben jedenfalls zu allen Zeiten auf den Bettvorlegern der Landbevölkerung ihre Duftmarken hinterlassen, egal ob die Betten nun hinter meterdicken Mauern oder dünnem Fachwerk standen.
Die viehischen Duftmarken sind es allerdings nicht, die ein provenzalisches Mas in den Augen der Nordeuropäer so begehrlich machen. Sondern der Umstand, dass die zerstörten Burgen und Schlösser das Baumaterial für die Schaf- und Schweineställe der Bauern lieferten. Es war nämlich keine Seltenheit, dass sie in den feudalen Trümmern, die sie für ihren Neubau durchwühlten, manchen schönen Kaminaufsatz fanden oder eine gotische Wendeltreppe aus edlem Stein. Kunstvoll behauene Fenstereinfassungen liegen sogar noch heute unter freiem Himmel auf den Lagerplätzen der Händler herum. Dort haben wir Bauherren nach alten Fliesen gesucht, nach ovalen Fenstern, Ochsenaugen genannt, oder anderen dekorativen Trümmern, für die wir, im Gegensatz zu den Bauern vor einem halben Jahrtausend, Wucherpreise zahlen mussten.
Wenn es so weit ist, hat jeder Ausländer das französische Handwerk auf die eine oder andere Weise schon so stark subventionieren müssen, dass er vor den geforderten Preisen kaum noch zurückschreckt.
Manches Mas, das der Reisende zwischen Olivenhainen und Lavendelfeldern entdeckt, entlockt ihm Neidgefühle und Bewunderung. Sie sind dermaßen aufwendig und geschmackvoll restauriert, dass kein Zweifel aufkommt: hier verbringen schweizerische oder deutsche Freiberufler ihre Ferien.
So etwas hatte ich natürlich auch im Hinterkopf, als ich den ersten Spatenstich tun ließ (wobei zu berücksichtigen ist, dass Spaten heute durch brutale Bagger ersetzt werden).
Mein Vater war kein Architekt
Das Bauhandwerk hatte in meinem Leben eine nur marginale Bedeutung. Mein Vater wollte als junger Mensch Architekt werden. Dazu glaubte er sich berufen, weil er eine Begabung für akkurates Zeichnen hatte.
Unter seiner Stilrichtung muss man sich das vorstellen, was als Hitlers Aquarelle auf den Kunstmärkten des ausgehenden 20. Jahrhunderts eine kleine Rolle spielte, welche nur wegen des berüchtigten Namens überhaupt ins Rollen kam. Neben dem oft gehörten Seufzer meiner Zeitgenossen, »Hätten sie ihm doch nur die Aufnahme in die Wiener Kunstakademie nicht verweigert!«, konzentrierten sich um den Namen des verkrachten Kunstmalers nur Verwünschungen und Erinnerungen der übelsten Art. Den schlechten Ruf hat er sich fleißig verdient (um das fällige Wort ›redlich‹ zu vermeiden).
Bei meinem Vater bin ich nicht sicher, ob ihm das Studium der Architektur besser bekommen wäre als die Berufung zum Erben des Borbecker Pressezentrums.
Der Vater meines Vaters besaß vor dem Ersten Weltkrieg eine Druckerei und war Herausgeber einer Zeitung. Die Druckerei stand in Essen-Borbeck (wo mein Vater geboren wurde), und die Zeitung, die er druckte, hieß Borbecker Anzeiger oder so ähnlich. Ich habe meinen Großvater und meine Großmutter väterlicherseits nie kennengelernt, beide waren längst tot, als ich geboren wurde. Vom Druckereibesitzer wusste ich nichts Wesentliches, außer der von meinem Vater stolz kolportierten Tatsache, dass mein Großvater seiner Frau jeden Tag ein Goldstück für den Haushalt gab, sowie der Anekdote, dass Opa sich mit seinem Bruder zerstritten hatte, weil der, ein Kommerzienrat, den Drucker durch einen Diener empfangen ließ.
Dass ich nicht der Konzernchef eines Druckereiimperiums mit Privatjet bin und ein paar tausend Angestellte entlassen kann, geht auf das Konto meines Vaters. Als mein Großvater sich nach dem Ersten Weltkrieg nach Bad Ems zurückzog und den Betrieb meinem Vater und dessen Bruder Robert übergab, dauerte es nicht lange, und die Firma Siebeck war pleite.
Wie die beiden Brüder ihre Karriere und meine Zukunft so schnell ruinieren konnten, ist ein Geheimnis geblieben. Gewisse Indizien wie vergilbte Fotos im Familienalbum und der Frack im Kleiderschrank lassen auf ein sorgloses Leben der angehenden Industriellen schließen.
Grundsätzlich aber ist von meiner Familiengeschichte jener Jahre verdächtig wenig bekannt. Onkel Robert wurde Verkäufer bei Mercedes in Leipzig, wo er sich bald auf vereister Landstraße den Hals brach. Wieso Autoverkäufer? Wieso in Leipzig?
Seine Witwe, Tante Gusti, tauchte sogar häufig bei meiner Mutter auf. Trotzdem wusste ich von ihr und meinem Onkel nichts, außer dass sie zum zweiten Mal Witwe geworden war, nachdem sie einen Mühlheimer Stadtrat der Zentrumspartei geheiratet hatte. Mir kam es vor, als trüge sie immer einen Silberfuchs um den Hals. Jedoch gab sie auch durch andere Details sowie durch eine rücksichtslos laute Sprechweise zu erkennen, dass sie sich einer vornehmen Gesellschaftsklasse zugehörig fühlte. Sie war wahrscheinlich die einzige Hitlergegnerin, die unsere Wohnung je betreten hat. Sie konnte den Nazis nicht vergeben, dass sie ihren konservativen Gatten vorzeitig in Rente geschickt hatten, und besuchte uns immer nur, wenn mein Vater nicht im Haus war, und ihr der Anblick seines Parteiabzeichens erspart blieb, das er am Revers trug.
Solche Erinnerungen werfen nur einzelne Schlaglichter in eine Dunkelheit, welche ansonsten wichtige Einzelheiten im Leben meiner Eltern verbirgt. Wann und wo haben sie sich kennengelernt? Womit verdiente mein Vater das Geld für die gutbürgerlich eingerichteten Wohnungen meiner frühen Kindheit? Und warum wurden die Wohnungen so oft gewechselt?
Bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich in mindestens sechs Wohnungen in vier Städten des Ruhrgebiets gewohnt. Die schönste Erinnerung habe ich an Bochum-Langendreer, wo mein Vater auf einer Zeche ein Büro der Firma Raab Karcher leitete. Wir bewohnten eine bescheidene Villa im Schatten der Kühltürme, in der sich das Büro befand, von wo aus mein Vater mit Kohle beladene Lastwagen zu Händlern in die umliegende Region schickte. Meine größte Freude war es, diese Transporte zu begleiten. Und zwar saß ich links neben dem Fahrer an der Tür, weil der Beifahrersitz von dessen Bruder besetzt war.
Die beiden transportierten außerdem mit einem kleinen Opel Blitz Kohle zur Kundschaft, aber in dem war für den Sohn des Chefs kein Platz. So lernte ich meine damalige Heimat auf der verschlissenen Lederbank eines 3,5-Tonners kennen. Auf meine spätere Liebe zu schnellen Autos hatte das jedoch keinen Einfluss. Es existierte noch ein einachsiger Pferdekarren für den Transport von Kohle, dessen Gaul ich jedes Mal bedauerte, wenn ich mit ansehen musste, wie er ausrutschte und in die Knie ging, wenn er den vollbeladenen Karren in Bewegung setzen sollte. Dadurch entwickelte ich, als ich, meinem Alter gemäß, den Fliegen noch die Flügel ausriss, bereits jenes Mitgefühl für die größeren Geschöpfe unseres Erdballs, das wir Empathie nennen.
In Langendreer gehörte zum Wohnhaus auch ein großer Gemüsegarten mit einem Hühnerstall. Ich war damals sechs Jahre alt und fand es schauerlich und faszinierend zugleich, wenn ein Huhn geschlachtet wurde. Und zwar war es nicht der Moment, wenn mein Vater dem Huhn mit der Axt den Kopf abschlug, vor dem ich mich gruselte, sondern vor dem kopflosen Huhn, das manchmal, Blut verspritzend und Flügel schlagend, über den Boden torkelte.
Die meisten meiner Schulfreunde waren Kinder von Bergleuten. Sie nahmen mich oft mit zu sich nach Hause, wo ich zum Mittagessen bleiben musste. Es gab fast immer eingelegte grüne Bohnen mit Speck und Birnen, die ich verabscheute. Man roch diese Armenspeise schon beim Betreten ihrer Häuser. Aber diese Kinder konnten Zinnsoldaten gießen und hatten auch sonst so ganz andere Interessen als ich. Vor allem aber hatten sie auch Schweine.
An jedes Haus der Bergarbeitersiedlung war ein Stall angebaut, in dem die Familien ein Schwein hielten. War es dick und fett, wurde geschlachtet. Das war ein Fest für die ganze Nachbarschaft, die sich dazu versammelte. Wir genossen es sehr, wenn die Sau am Strick in den Hof geführt wurde, und warteten atemlos auf das Quieken, den dumpfen Schlag mit dem Holzhammer und dann das Ausbluten. Dann wurde das Schwein auf eine Leiter gebunden und sein Bauch aufgeschlitzt, während ein Waschkessel mit kochendem Wasser bereitstand, in dem die ersten Teile des guten Tieres landeten. Wie alle Kinder beobachtete ich das Gemetzel mit großem Interesse, aber geschmeckt hat mir das Kesselfleisch nie.
Das alles spielte sich in einer kleinbürgerlichen Atmosphäre ab, in der die Erwachsenen die Qualität der Rügenwalder Teewurst diskutierten, während ich versuchte, zu meinen Zigarettenbildern zurückzukehren, die Karl Mays spannende Geschichten aus dem Wilden Westen oder dem Land der Skipetaren illustrierten. Es existierten auch Serien wie »Bilder deutscher Geschichte« oder Standarten und Fahnen aus einer Zeit, als die Landsknechte noch mit dem zweihändigen Langschwert aufeinander losgingen.
Diese Bilder waren sogar lehrreich. Wenn ich heute in Berliner Museen zwischen großformatigen Ölschinken mit Szenen aus den Freiheitskriegen herumwandere oder Prinz Louis Ferdinand im Galopp bei der für ihn tödlichen Attacke bewundere, sage ich mir »Kenne ich schon« und erinnere mich an das Bildchen und seine Legende, die mir die Lieblingszigaretten meines Vaters vermittelt hatten.
Nicht anders bei Menzels Gemälde mit der Ansprache Friedrichs des Großen vor der Schlacht von Leuthen, die außerdem den Schauspieler Otto Gebühr in seiner Rolle als Friedericus Rex wieder vor meinen Augen auferstehen lässt. Für ein Kind mit Fantasie kann eine Ansicht, und sei sie noch so beiläufig, wie ein Samenkorn im Wüstensand sein, das vielleicht erst nach einem halben Jahrhundert zu keimen beginnt. Citizen Kane und sein Rosebud-Schlitten sind eine treffende Metapher dafür.
Die Episode als Kohlehändler in Langendreer war die letzte bürgerliche Station meines Vaters, bevor er Angestellter bei der NSDAP in Bochum wurde. Womit er seine Familie ganz früher ernährte, weiß ich nicht. Sein Werdegang vom bankrotten Verleger zum Bankkaufmann liegt völlig im Dunkeln, weil das alles vor meiner Geburt geschah. Ich weiß überhaupt wenig über die Vergangenheit meines Vaters. Er ist mit meiner Mutter und mir im Raum Essen-Bochum immer wieder umgezogen, bis ich elf Jahre alt war und er am Horizont des »Tausendjährigen Reiches« verschwand. Über diese mangelnde Sesshaftigkeit wurde kein Wort verloren. Meine Großmutter, die oft kam, um ihre Tochter zu besuchen und aus ihrem Missfallen gegenüber ihrem Schwiegersohn keinen Hehl machte, deutete an, dass er sich hatte etwas zuschulden kommen lassen. Doch hätte das bei einem Bankangestellten nicht nur den Wohnungswechsel zur Folge gehabt, sondern gewiss auch andere, folgenreiche Konsequenzen. Davon konnte jedoch keine Rede sein.
Ich bin erst viel später dahintergekommen, warum er so häufig die Tapeten wechselte. Er besaß einfach nicht die für einen Angestellten notwendige Biegsamkeit. Er war ein Dickkopf, ein Besserwisser, der sich von seinen Vorgesetzten nichts sagen ließ, weshalb sie sich bemühten, ihn bei Gelegenheit wieder loszuwerden.
Gewisse Allüren werden ihn auch nicht zusätzlich beliebt gemacht haben. So steckte in seiner Westentasche ein randloses Monokel, das er sich manchmal ins Auge klemmte. Überdies trug er Maßanzüge, die im Angestelltenmilieu damals zwar nicht so ungewöhnlich sein mochten wie heute, aber auch nicht als Geste der Anpassung verstanden werden konnten.
Eine Zeit lang war er Bankbeamter und verspürte antisemitische Aufwallungen, wenn er aus Galizien zugewanderten Juden Geld auszahlen oder gutschreiben musste. Das bekannte er freimütig aber erst, als er bereits Angestellter bei der NSDAP war. Womit er dort den Tag verbrachte, danach habe ich nie gefragt. Fragen Kinder überhaupt, was ihre Eltern treiben, wenn sie ins Büro gehen? Offenbar ahnen Kinder, dass es keine Heldentaten sind, mit denen sie die Arbeitszeit totschlagen. Allenfalls erfahren sie durch häusliche Unterhaltungen, dass es da jemanden gibt, der dem Vater im Büro Böses will, der ihn schikaniert und alles ablehnt, was der Vater (oder die Mutter) an Verbesserungsvorschlägen zum Nutzen der Firma gemacht hat.
Doch grundsätzlich interessieren sich Kinder nicht für den Ärger, den ihre Eltern mit anderen Erwachsenen haben, und für Niederlagen schon gar nicht. Deshalb interessierte ich mich auch nicht für das, was mein Vater in seinem Büro, dem Gauheimstättenamt, tat.
Auch was sonst alles in den Jahren vor und nach meiner Geburt geschah, weiß ich kaum. Ich weiß überhaupt wenig über die Frühzeit der Ehe von Walter und Alma Siebeck.
Merkwürdigerweise weiß ich auch über meine Mutter kaum mehr, obwohl ich doch bis zu ihrem Tod bei ihr wohnte. Ehemalige Schulfreunde versichern mir, sie sei eine sehr vornehme Frau gewesen. Zweifellos hatte sie keine Ähnlichkeit mit dem kleinbürgerlichen Typ Mutter, dem die Nachbarskinder ihre glücklichen Kindheiten verdankten. Ihre Lebensweise war die einer privilegierten Dame, die zu krank war, um normale häusliche Arbeiten zu erledigen. Selbstverständlich kochte sie für meinen Vater (so lange der zur Familie gehörte) und für mich.
Zum Putzen hatten wir immer ein Dienstmädchen. Aber wer die Einkäufe erledigte, weiß ich nicht. Später, als die Wohnung meiner Großmutter in Essen bei einem Fliegerangriff zerstört wurde, zog Oma in unsere Bochumer Wohnung und übernahm schließlich alle Arbeiten, zu denen meine Mutter immer weniger imstande war. Sie lag meistens auf der Chaiselongue und las, was man damals schöngeistige Literatur nannte (Jakob Wassermann, Hermann Hesse, John Knittel, Dostojewskij, Mirko Jelusich, Bruno Brehm); sie legte Patiencen und studierte die Ephemeriden. Sie schrieb auch viele Briefe an andere »Mottenbrüder«, die sie in den Sanatorien kennengelernt hatte, wo sie immer wieder einen oder mehrere Monate verbrachte.
Die Mutter meiner Mutter war eine sehr einfache Frau, die wahrscheinlich nie ein Buch gelesen hatte. Sie stammte aus Ostpreußen, aus Pillupönen, Kreis Stallupönen (an diese kuriosen Ortsnamen erinnere ich mich noch heute), wo weitere Verwandte lebten, die wir, es war noch vor Kriegsbeginn, gemeinsam besuchten. Dort gab es viel Landwirtschaft und große Pferde, vor denen ich mich fürchtete. Es existierte auch eine Tante Elfi, die kaum älter war als ich und später, direkt nach Kriegsende, einen englischen Soldaten heiratete, der dann als Reuters-Korrespondent in allen Gegenden der Welt arbeitete. Ihn umgab nichts von dem Glamour, der den Fleet-Street-Typen anhaftete, wie sie Evelyn Waugh beschrieb. Erst als alter Pensionär verhielt er sich leicht exzentrisch: Er hatte seine Erlebnisse in Afrika, Moskau und Berlin in zwei selbstverlegten Autobiografien drucken lassen. Davon hatte er ständig einige Exemplare im Reisegepäck und bot sie allen Menschen zum Kauf an, die er traf. Ob das in England an Tankstellen war, auf Bahnhöfen in Deutschland oder wo sonst er auftauchte. Vor seinem Angebot, die aufgezeichneten Berufsjahre eines Reuters-Korrespondenten zu kaufen, war kein Reisender sicher, der das Glück hatte, mit diesem freundlichen Engländer ein unverbindliches Gespräch zu beginnen.
Dass meine Mutter mit ihrer ostpreußischen Verwandtschaft irgendeine Ähnlichkeit hatte, halte ich für ausgeschlossen. Zu Beginn der zwanziger Jahre muss sie ein flotter Teenager gewesen sein. Später, als moribunde Hausfrau, legte sie großen Wert auf Maniküre, vielleicht, um die Aufmerksamkeit auf ihre schönen Hände zu lenken oder weil ihre Fingernägel unerbittlich danach verlangten. Umso rätselhafter ist mir ihre Abstammung von diesen bäuerischen Menschen. Von ihrem Vater weiß ich nur, dass er Gutzeit hieß und kurz nach ihrer Geburt an einem Darmverschluss starb. Ich glaube, er war ein Tischler, aber nicht einmal da bin ich mir sicher. Schließlich wohnten einige Ableger dieser Familie in Berlin und wanderten bei Kriegsende sofort nach Texas aus.
Die Mutter meiner Mutter, Oma Köller, brachte sich und ihre Tochter über ein Jahrzehnt mit Schneiderarbeiten durch die Turbulenzen der Zeit. Wie es aussieht, verfügten junge Mütter damals über wenig Illusionen, dafür aber über praktische Fähigkeiten, mit denen sich BAföG und andere Staatsknete ersetzen ließen.
Meine eklatante Unkenntnis der eigenen Familie hat ihre Ursache vermutlich in dem Hochmut meines Vaters gegenüber seiner Umgebung. Er hatte noch zwei Schwestern, die es aber nicht wagten, uns zu besuchen. Seine Abneigung gegen alle, die zur Verwandtschaft gehörten, war ebenso notorisch wie einzigartig. Sie verhinderte auch die in anderen Familien üblichen Zusammenkünfte an größeren Festtagen. Unnatürlich ist sie offenbar nicht. Ich habe oft bei Haustieren beobachtet, wie sie ihre eigenen Kinder und Geschwister mit hartnäckiger Wut aus dem Haus trieben und erst Ruhe gaben, als diese für immer verschwunden waren.
Was also meine großartige Herkunft angeht, so bin ich auf Indizien angewiesen.
Als hauptberuflicher Parteigenosse durfte sich mein Vater nicht mit Vermutungen begnügen. Er war verpflichtet, seine arische Herkunft nachzuweisen. Dafür opferte er einen großen Teil seiner freien Zeit, indem er mit Kirchenämtern und städtischen Archiven korrespondierte, von denen er den Nachweis erbat, dass irgendein Thüringer Musikant des frühen 19. Jahrhunderts, in dem er einen Verwandten vermutete, arischer Herkunft gewesen sei.
Diese absurde »Ahnenforschung« war letztlich eine einzige Portoverschwendung. Denn der Parteigenosse Siebeck beendete sie abrupt, als er auf eine Urgroßtante traf, welche den undeutschen Namen Jely trug. Er zeigte mir eine Galerie von Porträts die er gezeichnet hatte. Davon ist mir ein Mann in Erinnerung geblieben, den er »Radek Zobelsohn« nannte. Wahrscheinlich war der damals bereits von Stalin liquidiert worden.
Die »Tante Jely« sorgte eine Zeit lang noch für einige scheinbar riskante Witze in der Familie; ich hatte aber nie den Eindruck, dass ihre unerwünschte Entdeckung meinen Vater beunruhigt hätte.
Da war noch dieser Frack im Kleiderschrank.
Das elegante Kleidungsstück, über dessen soziale Bedeutung ich mir so wenig Gedanken machte wie über die daneben hängende, nur selten getragene NS-Uniform, benutzte meine Mutter zu einer Mythenbildung. An einem Silvesterabend – ich war damals nicht älter als neun Jahre – zog ich den Frack an, der mir natürlich viel zu groß war. Meine Mutter fotografierte mich in dieser Verkleidung, während ich ein Sektglas in der Hand hielt und mir der Zylinder meines Vaters auf den Ohren saß. Es war jedoch nicht das lächerliche Foto eines Knaben in einer viel zu großen Festkleidung, welches zum Familienmythos wurde, sondern meine nicht unintelligente Antwort auf die Frage meiner Mutter, was ich mir denn für mein späteres Leben wünschte: »Spitze Gläser, schöne Mädchen«, gestand ich.
Das genügte meiner entzückten Mutter, um in der Nachbarschaft stolz zu erzählen, wie sich ihr einziger Sohn seine Zukunft vorstellte. Damals stand der Zweite Weltkrieg kurz bevor, und mein Vater war auf dem Sprung, seine Fähigkeiten als Architekt in den Dienst der großdeutschen Raubzüge zu stellen.
Er war natürlich kein Architekt, und schon lange kein Bankbeamter mehr, sondern Angestellter in der Naziverwaltung, wo er im sogenannten Gauheimstättenamt tatsächlich mit so etwas wie sozialem Wohnungsbau zu tun hatte. Im Familienkreis brüstete er sich damit, die Volksbadewanne erfunden zu haben. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, eine Sitzbadewanne, zweifellos raumsparend; aber warum durfte das Volk in einer Badewanne nur sitzen, nicht liegen?
Es ist zu vermuten, dass weitere Erfindungen meines Vaters von ähnlicher Nützlichkeit zum Ruhm des »Tausendjährigen Reiches« beigetragen haben. Seine letzte konnte ich bewundern, als ich ihn nach dem Krieg in seinem neuen Leben besuchte. Es handelte sich um eine geschickt zurechtgebogene Büroklammer, welche in eine Streichholzschachtel passte und mit der sich, wenn man die Dose öffnete, eine Zigarette festklemmen ließ. »Klein, aber oho!«, kommentierte er sein Werk. Wahrscheinlich wollte er die lächerliche Konstruktion unter diesem Namen vermarkten und hatte im selben Moment das Plakat mit dem Markennamen vor Augen wie ich: auf gelbem Grund fett in Sütterlin geschrieben, schwungvoll unterstrichen und mit Ausrufezeichen versehen. Für ihn mochte es eine vielversprechende Vision sein; ich fand es grässlich. Jedenfalls enthüllte sie einen weiteren Charakterzug meines Vaters: seinen leichtfertigen Optimismus.
Wie weit der für die Aktivitäten des Parteigenossen Siebeck verantwortlich war, kann ich nicht abschätzen. Ich weiß auch kaum, in welcher Weise er den Nazis nützlich war. Er nahm am Reichsparteitag in Nürnberg teil, an jenem Massenspektakel, das durch Leni Riefenstahl weltberühmt wurde. Von dort schickte er eine Ansichtskarte, die mich sehr befremdete. Nicht wegen der vielen Unterschriften von seinen NS-Kameraden, die lediglich von bierseliger Geselligkeit kündeten, sondern weil er die an mich adressierte Ansicht von Nürnberger Fachwerkhäusern (»An Pimpf Wölfi Siebeck«) mit dem ungewohnten Gruß »Heil Hitler, Dein Papa« beendete.
Sein vergleichsweise idyllisches Arbeitsverhältnis änderte sich sofort nach der Besetzung Polens durch deutsches Militär. Mein Vater wurde als ziviler Angestellter nach Posen versetzt.
Persönliche Erinnerung haben wir alle. Nicht nur unsere bekennenden Großautoren, die nicht müde werden, sich beim Zwiebelschälen an ihre Jugend zu erinnern. Auch wir Jüngeren, die wir vom Zweiten Weltkrieg nicht loskommen, weil unsere Alten darin mehr oder weniger unangenehm verwickelt waren, kauen auf dieser Epoche herum wie Hunde auf alten Knochen.
Wer je seine Mutter ratlos durchs Haus hat laufen sehen, die nicht wusste, wohin mit Mein Kampf und Der Mythus des 20. Jahrhunderts und sich mit nervösen Fingern bemühte, die silbernen und goldenen Aufnäher von Vaters Uniform abzutrennen – von der Hakenkreuzfahne ganz zu schweigen –, während auf der Straße die demokratische Gesinnung versuchte, mit den amerikanischen Panzern Schritt zu halten; wer diese Sternstunde deutscher Geschichte erlebt hat und darüber nicht in seinen Erinnerungen berichtet, der verweigert sich dem Unterhaltungsbedürfnis unserer Zeit.
So hat sich meines Wissens niemand Gedanken darüber gemacht, was mit den Abermillionen von Fahnenhaltern geschehen ist, die praktisch unter jedem Fenster Deutschlands angebracht waren. Irgendeine Fabrik muss darauf spezialisiert gewesen sein und mit den kurzen Rohren viel Geld verdient haben. Doch kaum war der Krieg vorbei, verschwanden diese Halter spurlos von den Hauswänden.
Zur Besetzungsliste der Mitläufer, Teilschuldigen, Wegseher und Helfershelfer gesellen sich neuerdings die Widerständler. Da darf auch die Familie Siebeck nicht fehlen, unter deren brauner Oberfläche (mein Vater) die Bereitschaft zum Widerstand glomm, wie ein Schwelbrand unterm Teufelsmoor. Er entzündete sich schließlich an dem von Hitler verordneten Eintopfsonntag.
Zur Einsparung von Devisen und überhaupt zu Verhinderung undeutscher Schlemmerei hatte der Vegetarier auf dem Obersalzberg seine Volksgenossen aufgerufen, dem aufwendigen Sonntagsbraten abzuschwören und sich stattdessen mit einem Eintopf zufriedenzugeben. Dieser Eintopfsonntag spielte eine nur kurze Rolle in den letzten Jahren vor dem Beginn des Krieges.
Man darf die Identifikation der Deutschen mit ihrem geliebten Führer nicht überschätzen. Wer es sich leisten konnte, finanziell oder weil er Bezugsquellen für die knapp gewordenen Lebensmittel hatte, folgte dem Aufruf zur Askese keineswegs.
Auch nicht die Bewohner des Hauses Freigrafendamm 11, wo die Familie Siebeck im zweiten Stock eines Häuserblocks der Neuen Heimat zur Miete wohnte. Kann sein, dass meine Mutter ein- oder zweimal eine Erbsensuppe mit Speck gekocht hat, diese völkische Alternative zur Rindsroulade. Aber da ich ein schlecht essendes Kind war (nichts von dem, was meine Mutter kochte, hat mir geschmeckt), lebte sie in ständiger Sorge, ich könnte nicht groß und stark werden, und nahm Rücksicht auf meine Idiosynkrasien, wo es nur möglich war. Also wurde die Erbsensuppe mit Speck gestrichen. Zwangsernährt wurde ich nur mit Lebertran, von dem ich täglich einen Löffel bei zugehaltener Nase schlucken musste.
Leider wusste ich damals noch nicht, was ich heute weiß, sonst hätte ich meine Mutter belehren können, dass halb rohe Zwiebelstücke im durchgedrehten Spinat von einer sensiblen Zunge als ekelhaft empfunden werden. Jedenfalls war eine Familie, die mit einem derart anspruchsvollen Kind gesegnet war, in Zeiten des Eintopfsonntags ungenügend angepasst, mochte auch der Familienvater das Parteiabzeichen am Revers tragen.
Zum Repertoire der Eintopfsonntage gehörte neben der Erbsensuppe auch das Gulasch. Ein anständiges Gulasch, sollte man meinen, wäre auch einem verwöhnten Bengel zuzumuten, solange es kein Pferdegulasch ist. Natürlich war es damals kein Pferdegulasch, weil der deutsche Mensch keine Pferde aß. Diese Angewohnheit hatten nur rassisch minderwertige Völker. Dabei gab es damals noch viele Pferde im Straßenbild der deutschen Städte, sogar über den Freigrafendamm zogen Milchbauern, Lumpensammler und Kartoffelhändler mit ihren Karren. Und vor diese Karren waren Pferde gespannt. Aber im Eintopf der Familie Siebeck landeten sie nie. Viel später erfuhr ich, dass man aus Pferdefleisch ein sehr gutes Gulasch und auch erstklassige Schmorbraten zubereiten kann. Aber damals delektierten sich die Volksgenossen lieber an der arischen Steckrübe, als dass sie ein delikates Fohlenfilet auftischten. Daran hat sich seitdem wenig geändert, was verwunderlich ist angesichts der Aufgeschlossenheit der Deutschen gegenüber fremden Küchen. Aber eher essen sie mit Stäbchen ein höllisch scharfes Stück Tiefseetang, als einzusehen, dass ein Stück vom Pferd nicht weiter vom Schweinebraten entfernt ist als die Lammkeule, welche erstaunlich widerstandslos Eingang gefunden hat in unsere Sonntagsküchen.
Übrigens war es mit dem nur gelegentlich an Sonntagen gekochten Eintopf seit dem Ausbruch des Krieges sofort vorbei. Wenn sie uns das tägliche Leben schon durch Verdunkelung, rationierte Lebensmittel und nächtliche Fliegeralarme erschwerten, so mochte meine Mutter gedacht haben, dann werden wir nicht auch noch freiwillig auf unsere bescheidenen Freuden verzichten. Zu denen eben auch der Sonntagsbraten gehörte. Und, wie es sich für die Nachfahren Wotans und Thors gehört, die Buttercremetorte. Da diese, wie jeder Anhänger der alten Schreibweise weiß, vor allem aus »guter Butter« bestand, wie es damals im Unterschied zur Margarine hieß, waren die Zutaten für diesen kulinarischen Gipfel der deutschen Bürgerküche nur schwer zu finden. Denn die pro Kopf der braunen Bevölkerung zugeteilte Menge an »guter Butter« betrug gegen Ende des Krieges nicht mehr als 62,5 Gramm pro Woche. Ein skandalöser Zustand, wie meine Mutter fand, der die Ernährungslage in den großdeutschen Gefangenenlagern und KZs nicht bekannt war.
Meinem Vater dürften dagegen aufgrund seiner parteipolitischen Stellung auf dem Außenposten in Posen viele diesbezügliche Details vertraut gewesen sein. Obwohl ja sogar höchste NS-Chargen vom millionenfachen Morden rings um sie herum nichts wussten, wie sich nach dem Krieg herausstellte.
Sein Büro in Posen war ein kleiner, villenähnlicher Neubau, weder herrschaftlich noch sonst wie eindrucksvoll. Außer meinem Vater schien dort niemand zu wohnen. Von dort aus half er seiner Partei bei deren Raubzügen in der polnischen Industrie. Im Titel seines Büros wurde deutlich, worauf er es abgesehen hatte. Es ähnelte der fünfzig Jahre später gegründeten Treuhand der Bundesrepublik. Mit »Steine und Erden« hatte seine Arbeit zu tun, was, so viel begriff ich immerhin, bedeutete, dass er Torfwerke und Ziegeleien verwaltete, die bisher polnische Besitzer hatten.
Ich habe meinen Vater in Posen zwei- oder dreimal in den Schulferien besucht, entdeckte an ihm aber bestenfalls eine Veränderung zum Wohlleben, das im Gegensatz zu seinen früher geäußerten NS-Parolen stand. Er ging mit mir in gute Restaurants, wo ich mich jedes mal derart mit Pfifferlingen vollstopfte, dass ich auf der Stelle Durchfall bekam.
Er verkehrte damals in einer volksdeutschen Familie, die ein Kaufhaus mit einer Maßschneiderei besaß, wo mir mehrere Anzüge mit kurzen Hosen angefertigt wurden. Mit einer der flotten Töchter – stark geschminkt, extravagante Kleider, Raucherinnen – hatte er ein Verhältnis, was mir nicht verborgen blieb. Diese Familie besaß auch ein größeres Gut auf dem Lande mit einem eigenen See, von dem mir nur die eindrucksvolle Mückenpopulation in Erinnerung geblieben ist. Ein dort ständig wohnendes Familienmitglied betätigte sich als Maler, was zur Folge hatte, dass seine Bilder in dichten Reihen an den Wänden der langen Flure hingen. Ich erinnere mich nur an eines, das einen blonden Trommler in meinem Alter darstellte. Er trug eine HJ-Uniform und symbolisierte für mich alles, was mir an dieser heroischen Zeit missfiel.
Nun gehörte ich keineswegs zu jenen Jugendlichen, die schon als Zehnjährige den mörderischen Kern des Nationalsozialismus erkannt hatten. Mein Missfallen an der Nazidiktatur beruhte auf dem schlechten Gewissen, zu dem mir meine kindliche Dusseligkeit verhalf; ethische Motive kann ich nicht geltend machen.
Mein Vater hatte mich unnötigerweise ein Jahr zu früh beim Jungvolk angemeldet. Das war die Kinderabteilung der Hitlerjugend, der jeder deutsche Junge ab zehn Jahren angehören musste. Um uns den Abschied vom Indianerspielen leicht zu machen, bekamen wir eine Uniform: braunes Hemd, schwarzes Halstuch, Schulterriemen, Koppel und das später auf dem Schwarzmarkt hoch gehandelte Fahrtenmesser.
Schon als Zehnjähriger missfiel mir an der Naziideologie die Tendenz, aus mir, dem Individuum, eine Volksgemeinschaft zu machen. Als Hitlerjunge, wie wir genannt wurden, sträubte ich mich gegen den befohlenen Gleichschritt der Kolonne (»Siebeck, du stolperst ja daher, als wenn eine Ziege auf die Trommel kackt!«), ich fand das gemeinschaftliche Singen lächerlich, zumal ich viele der Liedertexte nicht verstand. Was, zum Beispiel, waren »engelatsche Reiter«? Bei den »Heimabenden«, die wir auf Anordnung der HJ-Führung regelmäßig abhielten, ödeten mich die ideologisch interpretierten Mythen nicht zuletzt deshalb an, weil ich zu Hause bereits alles gelesen hatte, was mit den Germanen, den Nibelungen und Beowulf zu tun hatte. Darauf aufbauende Paramythen langweilten mich ebenso wie die zum wiederholten Male erzählten Balladen vom Heldentod Horst Wessels oder Leo Schlageters. Meine zeitgenössischen Helden waren Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi. Schon bei Winnetous Tod hatte ich mich gefragt, warum der edle Apache unbedingt noch Christ werden musste, bevor er seine rote Seele aushauchte. Diese Skepsis verdankte ich dem Parteigenossen Walter Siebeck, der mir durch einen Kirchenaustritt den Religionsunterricht erspart hatte. Er ersparte mir überhaupt vieles, indem er durch seine Abberufung ins besetzte Polen als mein Erzieher ausfiel.
Nach kurzer Mitgliedschaft wurde ich Hordenführer. Mein Vater, der seine Nase gern in alles steckte, sprach eines Tages mit dem Bochumer Jungbannführer über mich.
Ich nehme an, er wollte sich wichtig tun und fragte nach meinem Verhalten in der braunen Gemeinschaft, ob ich mich bei den Geländespielen auch brav prügelte und beim Singen nicht unangenehm auffiel. Der Bannführer, wahrscheinlich mehr mit seiner Pubertät beschäftigt als sich für die anonymen Pimpfe zu interessieren, wusste natürlich nichts von mir. Da ich aber einen eifrigen Parteigenossen zum Vater hatte, ließ er mich kurz danach in seine Dienststelle kommen und fragte mich leutselig nach meinem Befinden.
Ich sei bereits Hordenführer, berichtete ich ihm stolz. Darauf stellte er mir die so folgenschwere Frage: »Ernannt oder bestätigt?«
Hätte ich die Hände nicht an die Hosennaht gepresst, wie sich das gehörte, wenn man einem Führer gegenüberstand, ich hätte verzweifelt auf meinen Fingernägeln gekaut. Denn ich hatte keine Ahnung, dass es da einen Unterschied gab. Also antwortete ich blindlings: »Bestätigt!«
»Und warum trägst du dann keinen Winkel an der Uniform?«
Ich stotterte etwas wie: »Weiß nicht, wo man ihn kaufen kann«, und das Blut schoss mir ins Gesicht.
Da griff der Jungbannführer triumphierend in eine Schublade seines Schreibtisches und förderte einen Hordenführer-Winkel zutage, ein rundes, schwarzes Stück Stoff mit einem silbernen Winkel. Er überreichte ihn mir, als wäre es das Eiserne Kreuz, und ich verließ hackenschlagend sein Büro.
Ich hatte nichts eiliger zu tun, als meine Mutter zu bitten, mir den Winkel aufs Braunhemd zu nähen. Als ich beim nächsten Pimpfentreff mit dem Winkel auftauchte, staunte die Bande sehr. Woher ich den denn habe, wollten alle wissen. Meine Antwort »Vom Jungbannführer persönlich!« genügte jedoch, um weitere Fragen der ungläubigen Kameraden zu verhindern.
Erst im Laufe der Zeit ging mir auf, dass ich mich in meiner Ahnungslosigkeit mit einem falschen Dienstgrad schmückte. Ich war innerhalb der NS-Jugendorganisation ein Hochstapler. Das daraus erwachende schlechte Gewissen verwandelte sich in ein permanentes Unbehagen gegenüber dem NS-Staat.
Einmal nahm mein Vater mich in seinem Dienstmercedes mit auf eine Rundreise durch das besetzte Polen. Er besuchte mehrere Ziegeleien, deren Überführung in deutschen Besitz zu seinen Aufgaben gehörte. Die Reise führte unter anderem nach Lodz, wo er auf eine entfernte Häuseransammlung deutete und sie als Getto bezeichnete. Dann machte er noch einige hämische Bemerkungen über die Juden, und damit endete seine Einführung in den Mythos des Dritten Reichs. Es ist anzunehmen, dass ihn das feudale Leben als Besatzer vom spartanischen Stil der Nationalsozialisten weit genug entfernt hatte, um die Kanonen-statt-Butter-Parolen nicht mehr sehr ernst zu nehmen.