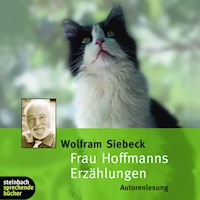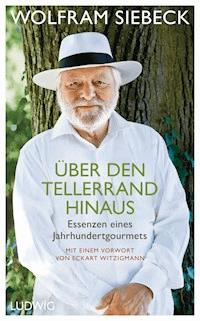
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Er war der Vorkoster der Nation, ein unermüdlicher Streiter für den guten Geschmack: Wenn Wolfram Siebeck stilsicher sein Schreibmesser wetzte und zum Angriff blies auf Fast Food, Fertiggerichte und nicht artgerechte Tierhaltung, blieb manch einem der Bissen im Halse stecken. Sein scharfer Ton, sein leiser Spott, aber auch seine wunderbare Ironie – dafür wurde Siebeck von Köchen und Genießern gleichermaßen heiß geliebt und hoch geachtet.
Seine ganze Meisterschaft erweist sich in diesen Texten aus seinem Nachlass: Ein von ihm selbst komponiertes, doch zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichtes Buchprojekt. In den 83 brillanten Miniaturen rund ums Kochen, Essen und Genießen leuchtet ein letztes Mal Siebecks Haltung und Philosophie auf: von A wie al dente über K wie Küchenradio und T wie Trinkgeld bis W wie Werkzeug. Durchgehend pikant gewürzt mit Illustrationen von Isabel Klett und abgeschmeckt mit einem Vorwort von Eckart Witzigmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
WOLFRAM SIEBECK
ÜBER DEN
TELLERRAND
HINAUS
Essenzen eines
Jahrhundertgourmets
Mit einem Vorwort von Eckart Witzigmann
Illustriert von Isabel Klett
Ein letzter Gruß aus der Küche
Er war der Vorkoster der Nation, ein unermüdlicher Streiter für den guten Geschmack: Wenn Wolfram Siebeck stilsicher sein Schreibmesser wetzte und zum Angriff blies auf Fast Food, Fertiggerichte und nicht artgerechte Tierhaltung, blieb manch einem der Bissen im Halse stecken. Sein scharfer Ton, sein leiser Spott, aber auch seine wunderbare Ironie – dafür wurde Siebeck von Köchen und Genießern gleichermaßen heiß geliebt und hoch geachtet.
Seine ganze Meisterschaft erweist sich in diesen Texten aus seinem Nachlass: Ein von ihm selbst komponiertes, doch zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlichtes Buchprojekt. In den 83 brillanten Miniaturen rund ums Kochen, Essen und Genießen leuchtet ein letztes Mal Siebecks Haltung und Philosophie auf: von A wie al dente über K wie Küchenradio und T wie Trinkgeld bis W wie Werkzeug. Durchgehend pikant gewürzt mit Illustrationen von Isabel Klett und abgeschmeckt mit einem Vorwort von Eckart Witzigmann.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Dieses Buch wurde von Wolfram Siebeck noch zu Lebzeiten selbst komponiert. Es handelt sich um ein Fundstück aus seinem Nachlass mit Texten, die noch nie zuvor veröffentlicht wurden.
Copyright © 2018
by Ludwig Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Johann Lankes, München
Umschlaggestaltung und Innenlayout: Eisele Grafik·Design, München
Umschlagsfoto: seasons.agency / Jalag / Holz, Michael
Illustrationen: Isabel Klett, Barcelona
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22379-3V001
www.ludwig-verlag.de
VORWORT VON ECKART WITZIGMANN
Vor langer, langer Zeit, als die Menschen sich ihre Druckerzeugnisse noch am Kiosk holten oder regelmäßig von der Post nach Hause liefern ließen und kein TV-Sender, Blogger, keine sozialen Netzwerke oder anonymisierte Foren uns alle ausnahmslos mit gesicherten Ahnungen aus der Welt des Herdes terrorisierten, zu jener Zeit also begann Wolfram Siebeck seinen Lesern die Botschaft von der hohen Qualität des Essens zu verkünden. Ende der 1950er-Jahre, als er im »Twen« die ersten Kolumnen zu Papier brachte, hatte man in deutschen Landen andere Sorgen, als über die Garzeit zu schwadronieren. Keine 15 Jahre nach Kriegsende standen Sattwerden, Wiederaufbau und Italienurlaub auf der Agenda, der Toast Hawaii von Clemens Wilmenrod war die Spitze der Kulinarik in Deutschland. Unerschrocken und unnachgiebig schrieb Wolfram Siebeck dagegen an, er war quasi ein Prototyp des Rufers in der Wüste.
Als ich 1971 im Tantris den Herd einschaltete, prallte mir trotz zehnjähriger Siebeck-Missionierung ebenfalls Unverständnis und Kopfschütteln entgegen. Obwohl Kreuzritter Wolfram zwischenzeitlich von einigen anderen Kampfgefährten wie Gert von Paczensky, Klaus Besser oder Wolfgang Menge begleitet wurde, die kulinarische Diaspora war nur sehr schwer flächendeckend zu bekehren. Meine Kollegen und ich hatten permanenten Gegenwind, die uns wohlgesinnten Kulinarik-Propagandisten feuerten zwar aus vielerlei Rohren, die frohen Botschaften verhallten jedoch meist ungehört. Der Guerillakrieg dauerte noch einige Jahre, aber langsam registrierte man erste Geländegewinne. Wolfram Siebeck vermittelte wie ein Metternich zwischen Gast und Gastronomie, er schonte weder Freund noch Feind, es ging ihm ausschließlich um die Sache. Er wurde zum Vorkoster der Nation und verschaffte uns Köchen eine mediale Bühne, er transportierte die Gerichte und Gerüche hinaus in die Lande, unermüdlich und unerbittlich.
Die gastro-journalistischen Missionare von einst sind mit dem Tod von Wolfram Siebeck allesamt Teil der Historie geworden. Gegenwärtig fühlen sich ganze Heerscharen von mitteilungsfreudigen Menschen berufen, der staunenden Umwelt ihre Sachkenntnis aufzuzwingen. Aber nur wenige der Berufenen sind tatsächlich auserwählt. Dazu gehört, allen voran, Jürgen Dollase, der nicht nur weiß, worüber er spricht, sondern das auch sehr profund begründen kann.
Vom anfänglichen Nebeneinander entwickelte sich zwischen Wolfram Siebeck und mir im Laufe der Jahre ein respektvolles Miteinander. Seinen Wunsch, doch auch die Hohen-Koch-Priester Frankreichs kennenzulernen, erfüllte ich ihm gerne und erinnere mich an filmreife Begegnungen mit Paul Bocuse oder Louis Outhier. Quasi durch die Hintertür musste die dortige Kochelite zur Kenntnis nehmen, dass im Nachbarland nicht nur auf den Tellern eine Zeitenwende stattgefunden hatte, sondern darüber auch kompetent und unterhaltsam berichtet wurde.
Wolfram Siebeck schuf ein sehr spezifisches Verhältnis zwischen Koch und Kritiker. Wir haben durch und mit ihm gelernt, mit Kritik umzugehen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, sich ihr zu stellen, heftige Meinungsverschiedenheiten inklusive. Zu seinem strategischen Nachlass gehört die wunderbare Zeile: »Nicht alle Autoren, die übers Kochen schreiben, können kochen. Meistens können sie nicht einmal schreiben ...« Und das beherrschte er wie wenig andere, ob er über »40 Côtes d’agneau und kein Coq« schrieb oder auf sehr subtile Weise das Wesen eines Porsche 911 beschrieb.
Am 10. Januar 1976, laut Wolfram Siebeck genau um 10.08 Uhr, stand ich in der Tantris-Küche und diskutierte mit ihm über mein Kalbsbries »Rumohr«. Das hatte ich Carl Friedrich von Rumohr gewidmet, einem freigeistigen und feinsinnigen Gastrosophen zu Zeiten Goethes, der mit seinem 1822 erschienenen Werk »Der Geist der Kochkunst« eine Art Urvater der Gastro-Journaille war. Ich hatte damals keine Ahnung, dass dieses Gericht im Laufe der Jahre zu einer meiner meistbeachteten Kreationen werden sollte, neudeutsch zu einem »Signature Dish«. 32 Jahre später, zum 80. Geburtstag Siebecks, kochte ich nochmals zu seinen Ehren mein Kalbsbries »Rumohr« in Berlin für ihn. In langen Jahren zuvor herrschte Funkstille zwischen uns, ich hatte mich von ihm nicht fair behandelt gefühlt, und wir gingen uns höflich aus dem Weg.
Ich war glücklich über unsere späte Versöhnung, denn losgelöst von unseren ungelösten Petitessen, haben Köche und Gäste diesem visionären Journalisten viel zu verdanken. Ich bitte um Nachsicht für die nachfolgende schreckliche Floskel, aber er hat im wahrsten Sinn des Wortes »über den Tellerrand hinaus gesehen«. Ihn interessierten nicht nur die fachgerechte Zubereitung und der perfekte Geschmack, ihm ging es auch stets um den Weg dorthin. Und da war häufig des Sängers Höflichkeit vergessen; um seine Leser für ein Thema zu sensibilisieren, schreckte er auch nie vor einer Überdosis Satire, Polemik oder Sarkasmus zurück.
Ihm ging es immer, und das war unser gemeinsames Band, um höchste Qualität. Und auf dem Weg dorthin attackierte er alle Hindernisse: Mit Leidenschaft kämpfte er gegen Fast Food, Fertiggerichte, Massentierhaltung und Discounter. »Twen«, »Stern«, »Der Feinschmecker«, »Die Zeit«, »Süddeutsche Zeitung« und eine stattliche Anzahl von Büchern waren sein Podium. Ihm ging es nicht um die kurzfristig journalistisch erzeugte Aufmerksamkeit, ihm ging es um ideologische Nachhaltigkeit bei allen Themen über Essen und Trinken.
Immer an seiner Seite dabei war Gattin Barbara, die Dirigentin innerhalb des Siebeck’schen Kosmos. Klug, weitsichtig, charmant und konsequent stand sie ihrer besseren Hälfte zur Seite.
Die vorliegende Auswahl gibt einen beeindruckenden Überblick über sein Schaffen aus den letzten Jahren. Damit meine ich nicht nur die Rezepte, die für eine bestimmte Art zu kochen beispielhaft sind, sondern auch die Aufzählung von – mitunter schon überholten – Moden in der Küche wie etwa die »Molekularküche«, die Erklärung von Begriffen wie »al dente«, »à point« oder »Naturanalog«, die Notizen zu den »Drinks« oder den »Geschmacksverstärkern«, die häufig satirisch überspitzten Anmerkungen, die beispielsweise von der »Damenkarte« über das »Frühstück« und »Galadiner« bis hin zum »Terroir« reichen, und die Fingerzeige zu allen Bereichen wie etwa den »Küchenmessern« oder dem »Trinkgeld«, dem »Mangalitza«-Schwein oder dem »Wagyu«-Rind sowie zu allen anderen Ebenen, die für einen interessierten Leser und Gast von Interesse sind.
Im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit habe ich viele Komplimente erhalten. Eines davon wurde besonders häufig zitiert. Es stammt von Wolfram Siebeck: Er teilte die deutsche Kochlandschaft in eine Zeit vor mir und eine Zeit nach mir ein. Ich gestehe, ich fühle mich bis heute damit geehrt. Jetzt aber kann ich meinem geschätzten Weggefährten nur noch traurig hinterherrufen: Nun beginnt die Zeit nach Wolfram Siebeck.
Vielen Dank, Wolfram Siebeck!
Die zivilisierte Menschheit ist von einem Bazillus befallen, der sie zwingt, ständig den abgedroschenen Satz »Der Mensch ist, was er isst«, vor sich hin zu brabbeln. Was lernen wir dadurch? Nichts lernen wir, was wir nicht schon immer gewusst haben. Wer Austern schlürft und Poulardenbeine nagt, ist auf keinen Fall arm, so viel ist klar. Ebenso eindeutig ist der soziale Status eines Menschen, für den ein Stück trockenes Brot die Erfüllung seiner Träume ist.
Der Rest der Erkenntnisse besteht aus der Beherrschung der notwendigen Kochtechniken sowie aus der unvermeidlichen Akzeptanz jener Regeln, die nicht nur die Technik, sondern auch die Manieren in der Küche betreffen. Über beide wird in diesem Buch gesprochen.
Dennoch handelt es sich bei diesem Band nicht um ein Lexikon der Kulinarik, auch nicht um eine Sammlung von Rezepten. Der Leser findet hier Rezepte, aber ich habe sie unter den Unmengen von Möglichkeiten, ein Essen zu kochen, willkürlich ausgesucht. Sie sind aus meiner Sicht beispielhaft für einen gewissen Bereich der Kochkunst oder für einen Kochstil oder lediglich typisch für gewisse Moden in der Küche.
Andere Stichworte betreffen das Verhalten der Konsumenten angesichts des Warenangebots, dort finden Sie subjektive Ratschläge und Meinungen zum Konsum, wie er mit dem Kochen zwangsläufig verbunden ist. Manche Einlassungen sind eher unterhaltsam, manche satirisch gemeint. Aber ausnahmslos alle sind das Resultat von Beobachtungen und Erfahrungen, die ich im Laufe eines halben Jahrhunderts gemacht habe.
Küchen-ABC
Aberglaube
al dente
à point
Babylon
Basta Pasta
BIO
Currywurst
Damenkarte
Dresscode
Drinks
Elektroquirl
Eros
Fisch braten
Fische
Foie gras
Forelle
Fortschritt
Frühstück
Fusion Cuisine
Galadiner
Gänsebraten
Geflügel
Geschmacksverstärker
Geschnetzeltes
Gläser
Grillen
Hallo
Hausmannskost
Himmel und Erde
Hitze
Hochzeitstag
Induktion
Innereien
Kalter Wein
Kartoffeln
Käse
Kindergeburtstag
Knoblauch
Kochlöffel,Kochwein,Kochsalz
Konserve
Korken
Kräuter
Küchenhilfe
Küchenmesser
Küchenradio
Kürbis
LarousseGastronomique
Lauch
Luxus
Mangalitza
Mehlschwitze
MesserundGabel
Module
Molekulares
Mörser
Mülltrennung
Naturanalog
Öl
Pfannen
Pfeffer
Picknick
Pizza
Pommesfrites
RaucheninderKüche?
Reis
Reservierungen
Risotto
Saucenfonds
Schäume
Schutzpatron
Senf
Starköche
Tafelmusik
TaubenundWachteln
Terroir
Tischkinder
Trinkgeld
Unvergessliche Momente
Vorräte
Wagyu
WennderChef zumEssenkommt
Werkzeug
Glücklichsein
ABERGLAUBE
Unsere Nation ist reich an Märchen, Mythen, Sagen und bunter Folklore. Sie gehören nicht weniger zu unserer Identität als die Männer, die furchtlosen Brandstifter, Erfinder, Plünderer, Folterknechte und Groß-Denker, die sich zu allen Zeiten so wirkungsvoll in unsere Geschichte eingemischt haben.
Abergläubisch sind wir nur in geringem Maße. Zwar gibt es Autofahrer, die unbedingt einer schwarzen Katze ausweichen müssen und dabei deutsche Fichten abwracken. Auch Hausfrauen hat man gesehen, die an einem 13. das Bett nicht verlassen, wenn dieser 13. auf einen Freitag fällt.
In unseren Küchen gedeiht der Aberglaube jedoch mit voller Kraft wie Radieschen in Tschernobyl. Da ist beispielsweise die irrige Überzeugung einiger Mütter von minderjährigen Söhnen, die glauben, dass ein mitgekochter Silberlöffel einer Speise das Gift entzieht. Entstanden ist dieser Aberglaube, als eine pilzkundige Nonne im damaligen Nordwestfalen eine große Pfanne mit Wiesenchampignons aufs Feuer stellte, einen silbernen Teelöffel dazugab und behauptete, die Champignons seien Knollenblätterpilze. Davon aß sie eine anständige Portion vor den Augen der versammelten Heiden, ohne Schaden zu nehmen. Mit diesem Trick wollte sie die gaffenden Kinder zum Christentum bekehren.
Knollenblätterpilze haben eine große Ähnlichkeit mit hochstieligen Champignons, weshalb sie mit diesen leicht verwechselt werden. Jedes westfälische Kind wusste davon und wurde von der Großmutter vor dem Verzehr der Knollenblätterpilze gewarnt; denn die sind tödlich giftig. Diesen Umstand machte sich auch Hermann der Cherusker zunutze, indem er seine römischen Besatzer in den Teutoburger Wald zum Pilzesammeln schickte, mit dem Resultat, dass die Römer sich im Jahre 9 nach Christus dort die Seelen aus dem Leib kotzten. (Das Ereignis wurde später durch deutschnationale Historiker umgeschrieben und noch in unseren Tagen als Vernichtungsschlacht gefeiert.)
Der mitgekochte Silberlöffel gehört jedenfalls zum Küchenaberglauben.
Ebenfalls mit Pilzen in Verbindung gebracht wird die Warnung, ein Pilzgericht vom Vortag dürfe nicht wieder warm gemacht werden. Die gleiche Falschmeldung wird über Spinat verbreitet.
Beide Gemüse kann man unbesorgt aufwärmen. Das schadet weder den Pilzen noch dem grünen Kinderschreck. Und auch der menschliche Verdauungstrakt wird dadurch nicht negativ beeinflusst.
Das Vorurteil gegen das Aufwärmen stammt aus den Zeiten, als die Hausfrauen keine Kühlmöglichkeit hatten. Da war die Wahrscheinlichkeit, dass ein fertig gekochtes Gericht über Nacht sauer wurde oder schimmelte, sehr groß. Seit ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach zur Grundausstattung jeder Küche gehört, sind solche Befürchtungen obsolet. Eben: Aberglaube.
Ebenfalls lächerlich ist die Anweisung alter Köchinnen, einen Kuchenteig dürfe man immer nur in einer Richtung schlagen bzw. rühren. Dabei mag Esoterisches im Spiel gewesen sein, sogar Quacksalberei ist nicht auszuschließen. Einen vernünftigen Grund für das Rechtsherum- oder Linksherumdrehen gibt es nur für Walzertänzer, nicht aber für kuchenrührende Köchinnen.
AL DENTE
Dieser italienische Begriff beinhaltet ein folgenreiches Missverständnis. Während er im Heimatland des Nudelkochens nur bedeutete, dass eine gare Nudel nicht matschig sein dürfe, folgerten unsere Pasta-Aficionados daraus, Spaghetti müssten halb roh gegessen werden. Und sie störten sich nicht daran, dass eine halb rohe Nudel mehlig schmeckt. Nicht genug, dass sie bei uns in jedem Italiener an der Ecke halb roh serviert werden, der Begriff weitete sich aus wie die Schweinegrippe. Vor allem Gemüse wurden davon befallen.
Ich vergesse nie die Szene, als mir Louis Outhier damals in seinem Restaurant »L’ Oasis« in La Napoule (1954–1988) an der Côte-d’Azur seinen Abscheu vor der neuen Mode demonstrierte. Er spießte eine dünne »haricot vert« an einem Ende mit der Gabel von meinem Teller und hielt mir seine Beute vors Gesicht. Die Bohne machte einen höflichen Bückling nach unten: »So müssen Bohnen gekocht sein, wenn sie Geschmack haben sollen. Aber nicht halb roh al dente!«
Der Meister hatte natürlich recht. Trotzdem sind auch heute noch die meisten Böhnchen nicht gar; sie bleiben starr und schmecken grasig. Wie alle Gemüse, die ihre Existenz der al-dente-Mode verdanken. Es mag ja Zeitgenossen geben, die den Geschmack von Gras über alles schätzen, sogar unter den Köchen. Ich habe aber auch den Verdacht, dass in den meisten Küchen das Kochen von Gemüse den Minderbegabten anvertraut wird, die sich nur auf eine Regel konzentrieren können, die man ihnen eingebläut hat: »Nichts zu lange kochen; wir müssen Strom sparen!«
À POINT
Mit »auf den Punkt genau« ist dieser französische Begriff artig übersetzt. Und was da so genau getroffen wurde, ist der Garzustand eines essbaren Produkts. Meistens handelt es sich dabei um ein Stück mageren Rindfleischs, bei dem das punktgenaue Garen über Lob und Tadel, über Genuss oder Enttäuschung entscheidet.
Auch Fische unterliegen diesem Urteil, sowie allerlei andere Speisen, bei denen die Garzeit der alles entscheidende Maßstab ist. Man kann es so einfach formulieren, dass theoretisch niemand, der diese Urregel begriffen hat, jemals wieder einen trockenen Braten aus der Pfanne heben sollte.
Das, was den meisten Hausfrauen und -männern als das größte Hindernis auf dem Weg zum gelungenen Braten erscheint, ist die Erkenntnis, dass der Weg zur Perfektion nur einen Fingerdruck breit ist.
Wir alle haben in unseren Anfängen ein exzellentes Stück Fleisch in die Pfanne gelegt und gefürchtet, vor dieser Herausforderung zu versagen. Das ist normal.
Denn in dem Kochbuch stand: pro Seite acht Minuten braten. Oder zehn Minuten, oder viel weniger. Mit der Zeit und der Zahl der missglückten Steaks haben wir dann gelernt, dass Zeitangaben fahrlässig sind. Kein Steak gleicht dem anderen derart, dass für alle eine einheitliche Bratzeit gültig wäre. Entscheidend ist allein die Qualität des Fleischs. Das heißt: sein Alter und die Zeit, die es in einem Kühlraum abhängen durfte. Wenn man das weiß und auch die Herkunft des Rinds kennt, dann müsste es möglich sein, das Steak mit einer präzisen Zeitangabe perfekt zu braten.
Nur: diese Daten weiß niemand. Deshalb sind präzise Angaben (das gilt auch für Maße und Gewichte) praktisch nie möglich außer beim Backen.
Um beim Beispiel eines Fleischstücks zu bleiben: Nehmen wir an, es sei sorgfältig pariert (= von Haut, Fett und Sehnen befreit).
Ich salze und pfeffere es von einer Seite, mit der ich es in die heiße Pfanne lege, in welcher ich Butter geschmolzen oder Öl zum Dampfen gebracht habe.
Das Braten in Butter funktioniert nur bei Fischen und weißem Fleisch wie Huhn oder Kalb. Es zwingt mich, die Hitze von Anfang sehr niedrig zu halten, weil sonst die Butter verbrennt. Verbrannte, also dunkelbraune Butter ist bei Steaks der größte anzunehmende Unfall und kann nur repariert werden, indem ich das Fleisch aus der Pfanne hebe, die qualmende Butter wegschütte und neue Butter in die abgekühlte Pfanne gebe. In diesem Fall muss ich abschätzen können, wie viel von dem Salz und Pfeffer mit im Ausguss gelandet ist, und sofort nachwürzen.
Die braune Kruste bei gebratenem Fleisch ist ein Mythos, von bayerischen Köhlern in die Welt gesetzt. Wo sie erreicht wird, handelt es sich entweder um einen Schweinsbraten für acht Personen, oder um ein zu trocken gebratenes Rippenstück. Das gleiche Phänomen erleben wir bei Bratfischen (Grill!). Beides ist ein Beweis für handwerkliches Versagen.
Es gilt also, das Stück in der Pfanne bei ganz geringer Hitze anzubraten. Das frustriert viele Männer, die es lieben, wenn es in der Pfanne zischt und spritzt wie in der Steinzeit. Sie lieben Vollgas und delektieren sich am Brandgeschmack.
Doch die vorsichtige Hausfrau beginnt das Braten ihres Steaks sehr vorsichtig. Wenn es hellbraun ist, salzt und pfeffert sie und dreht das Stück Fleisch herum. Dabei wird ihr auffallen, dass es innen noch sehr weich, also noch ziemlich blutig ist. Das freut sie. Sie brät bei schwacher Hitze weiter und macht von Zeit zu Zeit die Fingerprobe: Sie drückt mit dem Finger leicht aufs Fleisch. Das muss sich eben so leicht eindrücken lassen. Denn wenn das nicht mehr gelingt, ist es bereits ruiniert. Das heißt durchgebraten und innen hellgrau bis dunkelgrau. Ohne einen Tropfen Saft, ohne Geschmack und Kraft!
Was ihr der Druck mit dem Finger sagt, hat sie spätestens beim dritten Filet gelernt. Es ist, als habe der Finger Augen, mit denen er ins Fleischinnere sehen könnte. Dort darf es nicht mehr dunkelrot sein; das hieße halb roh, und beim Anschnitt flösse kostbarer Saft auf den Teller.
Der richtige Zustand ist auf halbem Weg zwischen fest und wabbelig erreicht. Dabei – um das noch einmal zu sagen – spielt der Hitzegrad keine Rolle. Gar wird Fleisch so oder so.
BABYLON
Die durch den Turmbau zu Babel hervorgerufene Sprachverwirrung unter den Menschen wird allgemein als dummes, ungutes Ereignis dargestellt, das die Menschen verursacht haben, weil sie sich nicht einigen konnten.
Ich halte sie für einen Segen. Denn nur so konnte eine Einheitsgesellschaft verhindert werden; nur so entstanden so viele unterschiedliche Kulturen an allen Ecken unserer Erde und machten sie bunt und interessant. Eine allen Menschen gemeinsame Zivilisation hingegen wäre ein Albtraum. Jede Metropole und jede Kleinstadt wäre ein Klon von Las Vegas geworden; vielleicht auch von Kiew oder Glasgow.
Allerdings hätten wir keine Verständigungsschwierigkeiten, weil wir alle nur eine Einheitssprache sprächen. Eine Welt voll YouTube-Bewohner – das würde die weltweite Onlinekommunikation zweifellos verbessern.
Ja.
Die Globalisierung, wie sie sich die Börsianer erträumen, wäre Wirklichkeit. Verbotsschilder und Spearmintreklame würden von jedermann gelesen werden, und kein Hobbykoch hätte Schwierigkeiten, Rezepte aus einem Kochbuch der österreichischen Küche nachzukochen.
Letzteres ist in unserer Gegenwart leider nicht ganz leicht, wenn man auch nicht, wie beim Lesen einer französischen Speisekarte, gleich ein Sprachstudium absolviert haben muss, um mit den fremden Vokabeln klarzukommen. Durch die Beliebtheit der österreichischen Küche bei deutschen Konsumenten weiß wahrscheinlich jeder, dass Erdäpfel mit Kartoffeln zu übersetzen sind. Aber es gibt noch mehr, zum Teil geheimnisvolle Bezeichnungen, die ich hier aufzählen möchte:
Beiried
Entrecôte
Beisl
Gasthaus, Kneipe
Beuschel
Lunge
Blunz(e)n
Blutwurst
Bummerlsalat
Eissalat
Dag
100 g
Dampfl
Vorteig mit Hefe
Deka
10 g
Dirndl
Kornelkirsche
Doppler
Weinflasche mit 2 l Inhalt
Dotter
Eigelb
Duttelkalb
Milchkalb
Eierschwammerl
Pfifferlinge
Einbrenn
Mehlschwitze
Erdäpfel
Kartoffeln
Fadl
junges Ferkel
Faschiertes
Gehacktes
Feinspitz
Gourmet
Fisolen
grüne Bohnen
Fleckerln
quadratisch geschnittene Teigstücke
Fledermaus
Rindfleisch vom Kreuzbein
Fleischlaberl
Frikadelle
Germ
Hefe
Geselchtes
Geräuchertes
Göderl, Goder
Schweinekinn
G‘spritzter
Weinschorle
Häuptelsalat
Kopfsalat
Heidenmehl
Buchweizenmehl
Hendl
Huhn
Herrenpilz
Steinpilz
Holler
Holunder
Indian
Truthahn
Kalbsvögerl
Roulade von der Kalbshaxe
Karfiol
Blumenkohl
Karotte
Möhre
Kas
Käse
Kipfler
festkochende Kartoffelsorte
Kohlsprossen
Rosenkohl
Kraut
Weißkohl
Kren
Meerrettich
Kronfleisch
Zwerchfell vom Rind
Kukuruz
Mais
Marillen
Aprikosen
Mehlspeise
Dessert auf Mehlbasis
Obers
süße Sahne
Papperl
feine Speise
Paradeiser
Tomate
Pfiff
kleines Bier
Powidl
Pflaumenmus
Presswurst
Schwartemagen
Rein, Reindl
flacher Kochtopf
Ribisel
Johannisbeere
Rollgerste
Graupen
Rote Rübe
Rote Bete
Rotkraut
Rotkohl
Sauerrahm
saure Sahne
Schlagobers
Schlagsahne
Schwammerl
Pilze
Schwarte
Haut
Semmel
Brötchen
Semmelbrösel
Paniermehl
Tafelspitz
in Brühe gekochtes Rindfleisch
Topfen
Quark
Vogerlsalat
Feldsalat
Weichseln
Sauerkirschen
Mit der Kenntnis dieser Vokabeln sollte ein neugieriger Esser gut durch die österreichische Gastronomie gelangen.
BASTA PASTA
Die deutsche Küche besteht aus Nudeln. Basta.
So könnte man die leidige Diskussion, was die deutsche Küche sei, ein für alle Mal beenden. Tatsächlich wird kein Film gedreht, in dem die Familie (die überforderte Mutter, der versagende Vater, die aufmüpfige Tochter, der pubertierende Sohn und das superkluge, aber eigensinnige Kind) nicht in der Wohnküche sitzt und Spaghetti isst. Was für einige Kritiker als infantile Essgewohnheit angeprangert wurde, hat sich zum Lieblingsessen der Europäer gemausert.
Diese Tatsache ist ebenso unumstößlich wie unerklärlich. Denn ein Teller Spaghetti befriedigt wirklich nur infantile Bedürfnisse (man muss nicht kauen und kann hemmungslos süßliches Ketchup vertilgen), ohne andere Vorzüge zu haben. Eine Nudel aus Wasser und Hartweizengrieß hat keinerlei Charakter, deswegen man sie lieben könnte. Also sind es die banalen Saucen, denen die schlabbernde Gesellschaft verfallen ist.
Das ist nicht viel, um eine hochzivilisierte Bevölkerung in Euphorie zu versetzen. Aber wir waren immer ein bescheidenes Volk, haben uns sogar mit Steckrüben begnügt. Damit verglichen sind Nudeln ein Fortschritt.
BIO
Drei Buchstaben, die unsere Essgewohnheiten veränderten. Sie haben Synonyme wie Öko, Slowfood, Nachhaltigkeit, Naturschutz und andere Begriffe, die nicht unbedingt identisch sind, aber im Grunde dasselbe meinen: natürlich produzierte Lebensmittel, ohne chemische Zusätze, ohne Pflanzengifte und Unkrautvernichter, ohne Schädlingsbekämpfung, ohne Wachstumshormone, ohne Schadstoffe im Boden zu hinterlassen, ohne Flüsse und Meere zu vergiften – kurzum Lebensmittel in einer Reinheit, wie sie nicht einmal in der Theorie möglich sind.
Zu verdanken haben wir die BIO-Welle einerseits einer rot-grünen Regierung, die sich als bisher einzige des Umweltthemas angenommen hat (trotz heftigen Widerstands der schwarz-gelben Opposition), andererseits verdanken wir sie der Rücksichtslosigkeit der Nahrungsmittelindustrie, die einen Lebensmittelskandal nach dem anderen auslöste, weil sie aus Profitgier immer schlechtere Produkte herstellte, deren Minderwertigkeit oft die Grenze zur Gesundheitsschädigung überschritt.
Der deutsche Verbraucher steht nicht unbedingt in dem Ruf, der Delikatesse seiner Speisen großen Wert beizumessen; aber seine Gesundheit liegt ihm sehr am Herzen. So erkannte er schnell die Vorteile der BIO-Produkte für seinen Organismus und verhalf der BIO-Welle zu einem unerwarteten Erfolg.
So erfreulich diese Entwicklung auch ist, bedeutet sie keineswegs eine Hinwendung der Deutschen zu genussvollerem Essen. Eher entschließen sie sich – nach den gesundheitlichen Aspekten – aus ideologischen Gründen (Tier- und Umweltschutz) zur BIO-Nahrung, als dass sie nach einer Rohmilchbutter suchten, weil sie deren Geschmack einer handelsüblichen Butter vorziehen.