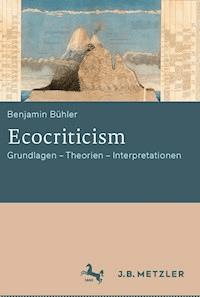32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition transcript
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der politischen Ökologie ist seit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert ein »Regierungswissen« eingeschrieben, das Regieren vor allem als Regulieren konzipiert. Im Anschluss an Michel Foucault lässt sich daher von einer ökologischen Gouvernementalität sprechen - ein Gegenprogramm zur neoliberalen Gouvernementalität und der politischen Ökonomie. Diese Regierungsform macht Probleme wie globale Erwärmung, Ressourcenknappheit oder Umweltverschmutzung zu Regulativen politischen Handelns und organisiert dieses Handeln nach ökologischen Prinzipien. Aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive untersucht Benjamin Bühler diese Prinzipien anhand von Romanen und naturwissenschaftlichen Abhandlungen, Theorien zur Landschaftsarchitektur und zum Design, Zukunftsfiktionen und Demokratietheorien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Ähnliche
Der politischen Ökologie ist seit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert ein »Regierungswissen« eingeschrieben, das Regieren vor allem als Regulieren konzipiert. Im Anschluss an Michel Foucault lässt sich daher von einer ökologischen Gouvernementalität sprechen – ein Gegenprogramm zur neoliberalen Gouvernementalität und der politischen Ökonomie. Diese Regierungsform macht Probleme wie globale Erwärmung, Ressourcenknappheit oder Umweltverschmutzung zu Regulativen politischen Handelns und organisiert dieses Handeln nach ökologischen Prinzipien.
Aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive untersucht Benjamin Bühler diese Prinzipien anhand von Romanen und naturwissenschaftlichen Abhandlungen, Theorien zur Landschaftsarchitektur und zum Design, Zukunftsfiktionen und Demokratietheorien.
Benjamin Bühler (PD Dr.), geb. 1970, lehrt als Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität Konstanz. Er war von 2011 bis 2017 Heisenberg-Stipendiat und von 2014 bis 2017 (gemeinsam mit Stefan Willer) Leiter des Projekts »Sicherheit und Zukunft. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Security Studies« am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Literatur und Prognostik, Kulturgeschichte der frühen Neuzeit, die Wissensgeschichte des Lebens und die politische Ökologie.
Benjamin Bühler
Ökologische Gouvernementalität
Zur Geschichte einer Regierungsform
Dieses Buch wurde gefördert mit Mitteln des im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder eingerichteten Exzellenzclusters »Kulturelle Grundlagen von Integration« der Universität Konstanz.
Ich danke Lena Kugler für ihre Unterstützung und kritische Lektüre.
Für das gründliche Korrektorat danke ich Eltje Böttcher, für die umfängliche Betreuung durch den Verlag Anke Poppen und Michael Volkmer.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook transcript Verlag, Bielefeld 2018
© transcript Verlag, Bielefeld 2018
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Konvertierung: Michael Rauscher, Bielefeld
Print-ISBN: 978-3-8376-4470-8
PDF-ISBN: 978-3-8394-4470-2
ePUB-ISBN: 978-3-7328-4470-8
https://doi.org/10.14361/9783839444702
http://www.transcript-verlag.de
Inhalt
Einleitung
I. Ökologische Gouvernementalität
1. Protoökologische Modelle
2. Vernetzung und Regulation
3. Komplexe Ökosysteme und autoritäre Politik
4. Zukunft der Bevölkerung
5. Umweltkrise und sozialer Wandel
II. Konstellationen politischen Wissens
1. Nahrung: Landwirtschaft und Bevölkerung
2. Energie: Sonne und Kohle
3. Konfliktressourcen: Ausbeutung und Gewalt
4. Recycling: Praxis und Modell
III. Regieren als Regulieren
1. Raumschiff Erde
2. Künstliche Klimata: Treibhäuser und Raumstationen
3. Terraforming: Planetarische Technik und Science-Fiction
4. Biosphäre und Anthropozän
IV. Wohnen
1. In der Umwelt wohnen
2. Buckminster R. Fuller: Mobiles Wohnen und Umweltkontrolle
3. Ian McHarg: Landschaft als Akteur
4. Umweltgifte
V. Widerstand im Zeichen der Ökologie
1. Resilienz
2. T.C. Boyles literarische Typologie des/der Umweltaktivist*in
VI. Politische Ökologie und Demokratie
1. Ökodiktatur!?
2. Antidemokratische Rhetorik und Narrative
3. Unbestimmtheit und Zukunftsoffenheit: Leforts Theorie der Demokratie
4. Politik als Streit: Mouffes Theorie des Agonismus
Literaturverzeichnis
Einleitung
Der Biochemiker und Verfasser mehrerer populärwissenschaftlicher Werke zu systemischem und vernetztem Denken Frederic Vester entwickelte Ende der 1970er Jahre das Umwelt-Simulationsspiel Ökolopoly. In diesem Brettspiel bilden die Spieler die Regierung im Land »Kybernetien« und haben die Aufgabe, einen »Gleichgewichtszustand mit möglichst hoher Lebensqualität« zu erreichen.[1] Dafür investieren sie Aktionspunkte in die Bereiche Sanierung, Produktion, Aufklärung, Lebensqualität und Vermehrungsrate, die durch nicht-lineare mathematische Beziehungen miteinander verbunden sind, das heißt, jede Entscheidung zieht »eine Kette von Wirkungen und Rückwirkungen nach sich«.[2] Wer zum Beispiel vor allem in Sanierung investiert, um die Umweltbelastung zu senken, erhält schnell ein zu hohes Bevölkerungswachstum mit sinkender Lebensqualität; wer das Bevölkerungswachstum dagegen zu stark senkt, erhält im nächsten Regierungsjahr weniger Investitionsmittel, also Aktionspunkte, die die Spieler einsetzen können. Erschwerend kommt hinzu, dass immer nach fünf Spieljahren eine Ereigniskarte gezogen wird, die die Situation in Kybernetien positiv oder negativ ändert, z.B. gelangen durch einen Unfall in einer Chemiefabrik Gifte in die Umwelt, man entdeckt ein neues energiesparendes Verfahren zur Aluminiumgewinnung oder es bricht in einem Land, das wichtige Rohstoffe liefert, ein Bürgerkrieg aus.
Vester geht es mit dem Spiel um das Einüben kybernetischen Denkens, das die wechselseitigen Abhängigkeiten der Elemente eines komplexen Systems miteinbezieht. Der von ihm entworfene »Papiercomputer«[3] soll die dynamischen Beziehungen zwischen diesen Elementen sowie die zeitverzögerten Auswirkungen und Nebenwirkungen getroffener Entscheidungen erfahrbar machen. Das Spiel bietet eine Fülle an Variationsmöglichkeiten: Man kann die Ausgangsbedingungen unterschiedlich definieren – Kybernetien kann ein bevölkerungsarmes Industrieland oder ein Entwicklungsland mit großem Bevölkerungswachstum sein –, die Spieler können bestimmte Rollen einnehmen (Staatschef, Minister, Experten, Lobbyisten), oder man ändert die mathematischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Bereichen.
Das Spiel führt vor, dass sich ›Ökologie‹ nicht auf allein eine naturwissenschaftliche Teildisziplin oder ein einzelnes soziales System bezieht. Ökologische Probleme zeichnen sich vielmehr durch ihre grenzüberschreitende Dimension aus: Umweltverschmutzungen und Industrieunfälle betreffen auch Nachbarstaaten, und die Auslagerung von Produktionsanlagen in Länder mit geringeren Umweltauflagen und Löhnen wird als Verschiebung ökologischer und sozialer Kosten sichtbar gemacht. Aber auch in zeitlicher Hinsicht sprengt die Ökologie die Grenzen, denn die Folgen heutiger Entscheidungen und Handlungen für die Zukunft, insbesondere für die nachfolgenden Generationen, müssen heute schon berücksichtigt werden.
Und weil im Feld der Ökologie unterschiedlichste Aspekte miteinander verknüpft sind und in Wechselwirkung zueinander stehen, sind Wissenschaften wie die Biologie, Physik und Ökonomie ebenso relevant wie rechtliche und ethische Fragen, Imaginationen einer gewünschten Zukunft und Simulationen einer Postwachstums-Gesellschaft, reale Unfälle und in der Umwelt gelagerte Giftstoffe, Institutionen und politische Bewegungen, Ideologien und symbolische Repräsentationen, Formen des Konsums und des Konsumverzichts, Praktiken des Wiederverwertens und des ökologischen Designs.
Die verschiedenen Dimensionen der Ökologie haben ihr notwendiges Korrelat auf der methodischen Ebene. Schon in einem Essay aus dem Jahr 1973 bezeichnet Hans Magnus Enzensberger die politische Ökologie als eine »hybride Disziplin, in der natur- und sozialwissenschaftliche Kategorien und Methoden nebeneinander her angewandt werden müssen«.[4] Der Ökologe Ludwig Trepl spricht von ihrem »methodisch und ideologisch hybriden und ambivalenten Charakter«,[5] nach Niklas Luhmann gibt es kein gesellschaftliches Subsystem Ökologie, sondern allein mit der Ökologie verbundene Interferenzen zu gesellschaftlichen Funktionssystemen wie Ökonomie, Politik, Recht oder Wissenschaft,[6] und Félix Guattari entwickelt eine Ökosophie, die soziale, mentale und Umwelt-Ökologie unterscheidet.[7] Aufgrund dieses hybriden Charakters der ›Ökologie‹, ihrer Verortung zwischen den sozialen Systemen, der Verknüpfung von Normen, Realem und Imaginärem sowie der Verschränkung von unterschiedlichen Wissens- und politischen Handlungsformen wird im Folgenden der Begriff ›politische Ökologie‹ verwendet.[8] Dabei handelt es sich nicht nur um einen Diskurs, sondern um ein ›Dispositiv‹ im Sinne Michel Foucaults, denn die politische Ökologie konstituiert sich durch diskursive, materielle und institutionelle Faktoren.[9]
Die Nähe zwischen Ökonomie und Ökologie ist schon mit Blick auf die Vorsilbe evident, was im Folgenden auch immer wieder deutlich werden wird. Der Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt allerdings auf der im 19. Jahrhundert entstehenden Differenz zwischen einer (neo-)liberal organisierten ökonomischen und einer auf Steuerung angelegten ökologischen Rationalität. Die Bandbreite reicht von diametral entgegengesetzten Positionen – gemäß der einen sollen sich die Märkte selbst regulieren, gemäß der anderen muss zentral eingegriffen werden – bis zu engen Verbindungen, so etwa im Konzept einer ökologischen Ökonomie.[10]
Kern des Dispositivs ›politische Ökologie‹ ist das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Wissen und Politik. Im Zentrum steht im Folgenden die Spezifität der ökologischen Regierungsform, also einer Weise des Regierens, die zum einen ökologische Probleme wie globale Erwärmung, Ressourcenknappheit oder Umweltverschmutzung zu Regulativen politischen Handelns macht und zum anderen dieses Handeln nach ökologischen Prinzipien und Konzepten organisiert. Mit dem Konzept der ökologischen Gouvernementalität wird das ökologische Regieren, das den Aspekt des Regulierens in den Vordergrund stellt und sich von neoliberalen Diskursen und Praktiken abzugrenzen versucht, historisch untersucht.
›Ökologisches Wissen‹ lässt sich nicht auf die biologische Teildisziplin reduzieren, hier ist vielmehr erstens der interdisziplinäre Verbund der Umweltwissenschaften gemeint, also auch Geologie, Geophysik, Meteorologie usw., sowie zweitens das in verschiedenen sozialen Bereichen, in Essays und Ratgebern, populärwissenschaftlichen Werken und Dokumentationen, Romanen und Filmen zirkulierende Wissen von der Umwelt. Die materiellen und symbolischen Dimensionen der politischen Ökologie lassen sich mit der Unterscheidung ›Politik/Politisches‹ untersuchen:[11] Mit dem Ausdruck ›Politik‹ bezeichnet der französische Philosoph Claude Lefort ein Subsystem innerhalb der Gesellschaft: Die Politik ergibt sich aus der Abgrenzung von dem, was nicht politisch ist, also ökonomisch, sozial, rechtlich, ästhetisch o.a. Mit Lefort wären demnach Bereiche wie die Umweltpolitik oder ökologische Ökonomie der Politik zuzuordnen, die zwar in andere Bereiche wie die Wirtschaft, den Städtebau oder den Verkehr eingreifen, gleichwohl aber ein eingegrenztes politisches Terrain besetzen. Das ›Politische‹ nimmt dagegen das »In-Form-Setzen des menschlichen Miteinanderseins« bzw. das »Prinzip der Institution des Sozialen« in den Blick.[12] Dieses In-Form-Setzen geschieht, indem sich eine Gesellschaft über »zahllose Zeichen« eine »quasi-Repräsentation ihrer selbst gibt«.[13] Repräsentation meint hier nicht eine bloße Abbildung, sondern einen performativen Vorgang, denn sie bringt das, was sie repräsentiert, hervor.[14] In diesem Sinn leistet Vesters Spiel Repräsentationen unterschiedlicher Gesellschaftsformen, nämlich solche, die Umweltbewusstsein und Bildung fördern, und solche, die auf Wirtschaftswachstum und Gewinnmaximierung setzen. Die verschiedenen in einer Gesellschaft verhandelten ›quasi-Repräsentationen‹ befinden sich damit in einem Streit um die hegemoniale Position.
Die Verbindung von Materiellem und Repräsentationen – und damit auch die zwischen der Politik und dem Politischem – ist ein zentrales Kennzeichen der politischen Ökologie. Denn auf der einen Seite müssen komplexe Beziehungsgefüge, Ganzheiten wie ›die Erde‹ oder Zukunftsszenarien allererst dargestellt werden, auf der anderen Seite hat es die Ökologie mit realen Dingen und Prozessen zu tun, mit Umweltgiften, verfügbarem Trinkwasser oder dem Schmelzen von alpinen Gletschern. Auf beiden Ebenen sind ökologische Phänomene immer schon vernetzte Phänomene, wofür sich exemplarisch Jussi Parikkas Konzept der »Geologie der Medien« anführen lässt. Parikka geht den Verbindungen zwischen Medien wie Smartphones oder Laptops und der geophysikalischen Natur nach, womit er Materialien wie Nickel, Kupfer oder ›Seltene Erden‹, Verfahren der Abfallentsorgung und des Recyclings zum Gegenstand der Medienwissenschaft macht. Den Ausdruck ›Geologie‹ gebraucht Parikka aufgrund der zeitlichen und räumlichen Erstreckung eines solchen Medienmaterialismus: Es dauert Millionen von Jahren, bis sich Rohstoffe wie Kohle oder Erdöl bilden, umgekehrt bleiben Plastikmüll und Brennstoffstäbe noch Millionen von Jahren erhalten; die Materialien, die man für die Herstellung von Kondensatoren, Superlegierungen oder medizinischen Implantaten benötigt, bewegen sich dabei über den gesamten Globus, so wird zum Beispiel Coltan in Afrika gewonnen, in China verarbeitet und in Europa verkauft. Parikka verweist aber auch auf die politische Ökonomie industrieller und postindustrieller Produktion oder die globale Erwärmung und schreibt seine ›Geologie der Medien‹ damit in eine »ecological agenda« ein.[15]
Es ist eine zentrale These dieser Arbeit, dass der Ökologie seit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert ein ›Regierungswissen‹[16] eingeschrieben ist, wobei Regieren als Regulieren konzipiert wird. In der Entstehungsphase der Ökologie als einer biologischen Teildisziplin steht zwar die Regulation von ›Pflanzen-‹ oder ›Lebensgemeinschaften‹ im Vordergrund, doch aufgrund der Einwirkungen menschlicher Tätigkeiten auf diese Verbünde oder Biozönosen bzw. Ökosysteme stehen auch stets politische Fragen im Raum. Es geht hierbei also nicht um einen Analogieschluss zwischen biologischen und sozialen Systemen, wie es etwa bei der prominenten Metapher des ›Staats-‹ oder ›Gesellschaftskörpers‹ der Fall ist, denn der Mensch ist immer schon ein Bestandteil ökologischer Systeme, wenn auch einer, der diese Systeme massiv verändert. ›Regulation‹ wird somit nicht bloß von pflanzlichen oder tierischen Populationen auf die menschliche Bevölkerung übertragen, denn aus der Perspektive der Ökologie macht es überhaupt keinen Sinn, pflanzliche und tierische Populationen und menschliche Bevölkerungen voneinander zu trennen.
Wenn Regieren als Regulieren konzipiert wird, kommen insbesondere demokratische Grundprinzipien immer wieder auf den Prüfstand. Denn in einer solchen Konzeption geht es um die Funktionsweise komplexer Systeme und weniger um die öffentliche Diskussion politischer Fragen oder Wahlentscheidungen. Das ›In-Form-Setzen des Sozialen‹ kann sich dann in Akten des Verwaltens und im Rahmen der Bürokratie abspielen. Das gilt vor allem, wenn der Fluchtpunkt der politischen Ökologie das zukünftige Überleben der Spezies Mensch ist, das durch die vom Menschen selbst verursachte Zerstörung seiner Lebensgrundlagen in Gefahr gerät. In dieser apokalyptischen Logik geht es erklärtermaßen nur noch um das Überleben, weshalb die Faktizität Vorrang vor einer Politik des ›Unvernehmens‹ erhält und der Experte zum politischen Entscheider wird.[17]
Der Philosoph Jacques Rancière beschreibt die Transformation der Politik in eine technokratische Expertenregierung als Zustand einer Postdemokratie,[18] in der jeglicher Konflikt verschwinde und eine Gesellschaft entstehe, die berechenbar und repräsentierbar sei: Das »in der Form seiner statistischen Reduktion anwesende Volk ist zum Erkenntnisobjekt und zum Objekt der Vorhersage geworden, das Erscheinung und deren Polemiken verabschiedet hat«.[19] Im Rahmen eines solchen Systems gibt es nach Rancière keinen »Streithandel« mehr, die Konflikte sind vielmehr in Probleme transformiert, die objektiviert und technisch gelöst werden. An die Stelle des Konflikts treten Verrechtlichungen, Expertenpraktiken, Meinungsforschung und damit ökonomische Notwendigkeiten und Rechtsregeln, die politisch nicht verhandelbar sind. Die Postdemokratie ist somit nicht ein gesellschaftlicher Zustand, sondern eine »Regierungsweise«,[20] die bestimmt wird durch objektive Notwendigkeiten.
Rancière bezieht seine Überlegungen zwar nicht (oder nur ansatzweise) auf ökologische Probleme, genau sie bilden aber den zentralen Gegenstand aktueller Diskussionen, was insbesondere das Verhältnis von Experten und politischen Entscheidern betrifft. Denn Themen wie globale Erwärmung, das Schwinden der Biodiversität oder technische Möglichkeiten regenerativer Energien lassen sich nicht ohne Expertenwissen diskutieren und entscheiden. Im besten Fall würden, so der Klimaforscher Mike Hulme, Politik und Wissenschaft gemeinsam Ziele und ihre Umsetzungsmöglichkeiten formulieren, die Öffentlichkeit in diese Prozesse miteinzubeziehen, um sich etwa über die verschiedenen Risiken einer globalen Erwärmung zu verständigen und zu diskutieren, welche Risiken eine Gesellschaft eingehen möchte.[21] Dieser Fall ist jedoch nicht die Regel: Entweder wird vielmehr die Wissenschaft misstrauisch beäugt oder gar zum Gegenstand von Verschwörungstheorien, so bezeichnete der amerikanische Präsident Donald Trump den Klimawandel als eine Erfindung Chinas.[22] Oder aber die Wissenschaft erscheint als nicht hinterfragbare Instanz, und Experten werden zu Problemlösern, die allerdings dazu neigen, gesundheitliche, ethische oder soziale Aspekte auszublenden, wie etwa die Folgen von gentechnisch verändertem Saatgut in Indien zeigen, zu dem zusätzlich teurer Dünger und Pestizide eingekauft werden müssen, was die Landwirte angesichts der Weltmarktpreise (zum Beispiel für Baumwolle) und insbesondere nach einem Jahr mit niedrigen Erträgen in die Verschuldung treibt.[23] Sowohl das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft als auch ihre Erhebung zur letztgültigen Wahrheitsinstanz unterminieren ihren unbestreitbar wichtigen Ort in einer demokratischen Gesellschaft.
Dem Soziologen Armin Nassehi zufolge wird von der Wissenschaft erwartet, uns mit »evidenzbasiertem, nachprüfbarem, interessefrei erzeugtem und möglichst objektivem Wissen« zu versorgen. Doch die Wissenschaft kann die »Eindeutigkeitserwartung« nicht erfüllen, sie liefert nach Nassehi keine Handreichung für politisches Entscheiden oder unternehmerische Strategien. Vielmehr sei die große Stärke der Wissenschaft, »Fragen zu stellen, die man ohne sie nicht hätte. Und sosehr solche selbstgewählten Fragen bei der politischen oder ökonomischen Entscheidungsfindung helfen mögen – am Ende muss politisch oder unternehmerisch entschieden werden, also nach den Erfolgsbedingungen dieser jeweiligen Bereiche«. Gleichwohl liefere die Wissenschaft einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen Problemen, denn sie biete einen »Raum der Abweichungsverstärkung«, prämiere »Versuche, die Dinge anders als zuvor zu denken« und versorge die Gesellschaft mit den richtigen Fragen.[24]
Die heutige Lage stellt sich allerdings oftmals anders dar: Zwar folgt aus »Fakten keine Politik«, wie der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers formuliert,[25] und mit dem Klimaforscher Mike Hulme kann man hervorheben, dass sich gute Forschung, insbesondere Klimawandelforschung, durch den Umgang mit Ungewissheit auszeichnet,[26] aber die Politik bleibt gerade nicht in ihren systemtheoretisch vorgesehenen Grenzen, sondern betreibt ständige Grenzüberschreitungen, indem sie politische Entscheidungen auf nicht-politische Institutionen wie Wissenschaft, Recht oder Ökonomie auslagert, was zu einer Schwächung demokratischer Prinzipien führt. Der Grund für die Aushöhlung der Demokratie liegt aber noch tiefer, nämlich in der spezifischen Beschaffenheit demokratischer Systeme und der sämtliche räumliche und zeitliche Grenzen sprengenden ökologischen Probleme, wie der Soziologe Ingolfur Blühdorn ausführt:[27]
Nach Blühdorn sind Demokratien auf menschliche Akteure fixiert, was automatisch mit einer Ausgrenzung von Pflanzen, Tieren oder auch Landschaften einhergeht. Sie sind auf Mehrheitsentscheidungen ausgerichtet – die Mehrheit entscheidet aber nicht unbedingt ökologisch sinnvoll. Demokratien leben von ihrer Kompromissbereitschaft und zeichnen sich durch langsame und ressourcenaufwendige Verfahren aus. Schließlich sind Demokratien emanzipatorisch ausgerichtet, was sie für Beschränkungen ungeeignet macht. Andere Problembereiche sind nach Blühdorn modernisierungsbedingt, so seien etwa demokratische Gesellschaften durch die Globalisierung und gesellschaftlichen Differenzierungen überfordert, weshalb das politisch Verhandelbare immer enger definiert werde: Zahlreiche Felder würden aus Effizienz-Gründen Expertenkommissionen, Gerichten oder Regulierungsbehörden überlassen, was zur Entpolitisierung vormals politischer Bereiche führe. Dennoch diagnostiziert Blühdorn kein Ende, sondern einen »Formwandel« der Demokratie, worunter er die Gleichzeitigkeit von Erosion und Radikalisierung demokratischer Wertvorstellungen versteht.[28]
Die angeführten demokratieskeptischen Argumente verweisen auf die Dringlichkeit politischen Handelns, das als ein intervenierendes Regulieren erscheint. Zwar hat das neoliberale Programm eines freien Spiels der Marktkräfte längst schon die Umweltpolitik erreicht: Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht jedoch die politische Rationalität eines steuernden Eingreifens in die sozialen und ökologischen Systeme, weshalb die politische Ökologie, so die zweite zentrale These der folgenden Ausführungen, ein Gegenprogramm zur von Michel Foucault beschriebenen Gouvernementalität darstellt.
Mit dem Begriff ›Gouvernementalität‹ beschreibt Foucault einen im 18. Jahrhundert erscheinenden Machttypus, der als »Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die politische Ökonomie und als wesentliches Instrument die Sicherheitsdispositive hat«.[29] Gouvernementalität verweist »auf unterschiedliche Handlungsformen und Praxisfelder, die in vielfältiger Weise auf die Lenkung und Leitung von Individuen und Kollektiven zielen«.[30] Der Leitfaden von Foucaults Arbeit in diesem Zusammenhang ist, wie Thomas Lemke ausführt, der »Begriff der Regierung«, der Formen politischer Regierung mit Techniken des Selbstregierens verknüpft und eine systematische Untersuchung der Beziehungen zwischen Machttechniken und Wissensformen erlaubt.[31] Dabei zeigt Foucault in seinen Vorlesungen zur Geschichte dieses Machttypus auf, dass und wie das Prinzip der »ökonomischen Regierung« zur dominanten Regierungsform in der Moderne wurde[32] – von seinen Anfängen im 18. Jahrhundert bis zum Neoliberalismus des 20. Jahrhunderts.
Das Erscheinen der ›Bevölkerung‹ markiert für Foucault ein zentrales Datum in dieser Geschichte, da damit erstens die Familie nicht mehr das Modell für die »Regierungskunst« abgibt.[33] Zweitens ändert sich das Ziel der Regierung: Es geht nach Foucault nicht mehr um die Erhaltung der Stellung des Souveräns und seines Territoriums, sondern um die Regulation der Bevölkerung, ihrer Größe, Struktur, Gesundheit u.a., weshalb die Statistik zu einem zentralen Instrument der Regierung wird. Daraus folgt ein dritter Aspekt: Beobachtungen und Wissen über die Bevölkerung sind nun wesentliche Bedingungen des Regierens. Foucault spricht vom »Regierungswissen«, das untrennbar verbunden sei mit der »Bildung eines Wissens über all die Vorgänge, die sich im weiten Sinne um die Bevölkerung drehen, nämlich über genau das, was man die ›Ökonomie‹ nennt«.[34] Daher erscheint mit der ›Bevölkerung‹ die Wissensform ›politische Ökonomie‹, der es um die Erfassung des vielfältigen Geflechts zwischen Bevölkerung, Territorium und Reichtum geht. Zugleich entsteht ein für das Regieren charakteristischer »Interventionstyp, nämlich die Intervention auf dem Feld der Ökonomie und der Bevölkerung«.[35]
Die im 19. Jahrhundert entstehende politische Ökologie ließe sich als Teilbereich einer solchen Gouvernementalität verstehen, denn auch ihr Objekt ist die Bevölkerung und auch ihr Ziel ist die Regulierung der Bevölkerung, wofür sie spezifisches Wissen erwerben und Formen der Fremd- sowie Selbststeuerung hervorbringen muss. Allerdings unterscheidet sie sich auch grundlegend von Foucaults Modell, weshalb es gerechtfertigt ist, von einer spezifischen ökologischen Gouvernementalität zu sprechen. Erstens ändert sich die Form der Leitwissenschaft: Grundlage ist nicht die politische Ökonomie, sondern die Ökologie stellt Konzepte, Begriffe, Modelle und Theorien bereit, auf deren Grundlage sich ein ökologisches Regierungswissen bilden kann. Bereits in der Entstehungsphase der wissenschaftlichen Ökologie geht es darum, Wissen bereitzustellen über die Eigenschaften, die Struktur und Dynamik von kollektiven Lebensformen, Populationen bzw. Bevölkerungen, damit man sie regulieren kann.
Zweitens ist der Neoliberalismus in den westlichen Industriestaaten zum hegemonialen Diskurs geworden. Der ›Rückzug des Staates‹ und die ›Dominanz des Marktes‹ bestimmen das gegenwärtige politische Programm.[36] Dagegen werden ökologische Ideen entweder in den neoliberalen Diskursen integriert, wie der Emissionsrechtehandel oder die freiwillige Selbstverpflichtung von Industrieunternehmen exemplarisch zeigen, oder die ökologischen Regierungsformen bleiben partikulare Erscheinungen, die aber mit dem Anspruch auftreten, die gesamte Gesellschaft und den gesamten Staat nach ökologischen Prinzipien zu organisieren, weshalb die Fiktion eine wichtige Aussageform der politischen Ökologie bildet. Hier liegt auch der Einsatzpunkt einer literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit der politischen Ökologie, ihr Gegenstand reicht nämlich von der Funktionsweise und Wirkung von Metaphern wie ›Pflanzengemeinschaft‹, ›Ökosystem‹ oder ›Raumschiff Erde‹ über die Semantik von Räumen wie ›Wildnis‹, ›Landschaft‹ oder ›Großstadt‹, Fortschritts-, Untergangs- oder Regressionsnarrativen, Gattungen wie Naturlyrik, nature writing oder Science-Fiction bis zu Imaginationen alternativer Gesellschaften oder gar extraterrestrischer Zivilisationen.[37]
Das »multilineare Ensemble«[38] ›politische Ökologie‹ bildet den Gegenstand der folgenden Ausführungen. Zuerst wird sie als Gegenmodell zur ökonomisch fundierten Gouvernementalität analysiert, der zweite Teil untersucht dann am Beispiel von Bevölkerung und Ernährung, Energie, Konfliktressourcen sowie Recycling historische Konstellationen politischen Wissens. Der dritte Abschnitt geht dem Konzept ›Regieren als Regulieren‹ nach, die Beispiele reichen vom Gewächshaus bis zum Terraforming ganzer Planeten, während sich der vierte Teil mit dem ›Wohnen‹ als ökologischem Grundbegriff beschäftigt. Der fünfte Abschnitt untersucht die Konzeption einer Widerstandskraft von Ökosystemen sowie der Figur des/der ökologischen Aktivist*in. Zum Schluss wird noch einmal das Verhältnis von politischer Ökologie und Demokratie beleuchtet.
Anmerkungen
1 | Vester, Frederic, Umweltspiel Ökolopoly. Erweiterte Anleitung mit Funktionsbeschreibung, Ravensburg 1984, S. 3. Für den Hinweis auf dieses Spiel danke ich Anne Neubert und Andi Womelsdorf.
2 | Ebd., S. 4.
3 | Ebd., S. 3.
4 | Enzensberger, Hans Magnus, »Zur Kritik der politischen Ökologie«, in: Kursbuch 33 (1973), S. 1–42, hier S. 1.
5 | Trepl, Ludwig, Geschichte der Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Zehn Vorlesungen, Frankfurt a.M. 1987, S. 226.
6 | Luhmann, Niklas, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Wiesbaden 1986.
7 | Guattari, Félix, Die drei Ökologien, übers. von Alec A. Scherer, überarb. von Gwendolin Engels [1989], 2. vollst. überarb. Aufl., Wien 2012.
8 | Der Begriff ›politische Ökologie‹ kann auf eine längere Tradition in unterschiedlichen Disziplinen zurückblicken. Dabei zeichnet er sich, wie Piers Blaikie in seinem Forschungsüberblick »A Review of Political Ecology. Issues, Epistemology and Analytical Narratives«, in: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 43, 3–4 (1999), S. 131–147 schreibt, nicht durch Kohärenz und Fokus aus, zumal man die Arbeiten in diesem Feld auch der Umwelt-Soziologie, -Anthropologie, -Ökonomie oder -Politikwissenschaft zuordnen könnte. Politische Ökologie ist nach Blaikie keine Theorie, vielmehr ermöglicht sie als ›Emblem‹ die Kommunikation und Entwicklung neuer Modelle für das Verständnis alternativer Konstruktionen der Natur und Kritik an ungleichen Machtverhältnissen über disziplinäre Grenzen hinweg. Einen guten Überblick zu diesem Forschungsfeld bieten: Bryant, Raymond L. (Hg.), The International Handbook of Political Ecology, Cheltenham, UK/Northampton, MA 2015; Perreault, Tom/Bridge, Gavin/McCarthy, James (Hg.), The Routledge Handbook of Political Ecology, Abingdon, Oxon/New York 2015.
9 | Nach Foucault ist ein Dispositiv eine heterogene Gesamtheit, bestehend aus »Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen, kurz, Gesagtes ebenso wie Ungesagtes«. Foucault geht es hierbei insbesondere um die »Verbindung«, die zwischen diesen heterogenen Elementen bestehen könne. Foucault, Michel, »Das Spiel des Michel Foucault. Gespräch mit D. Colas u.a.« [1977], übers. von Hans Dieter Gondek, in: ders., Schriften 3: 1976–1979, hg. von Daniel Defert und François Ewald, Frankfurt a.M. 2003, S. 391–430, hier S. 392f.
10 | Vgl. z.B. Costanza, Robert, An Introduction to Ecological Economics, Boca Raton, Florida, 2. Aufl. 2015.
11 | Zur Geschichte dieser Unterscheidung und verschiedenen Theorien des Politischem vgl. Marchart, Oliver, Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, Frankfurt a.M. 2010; Bröckling, Ulrich (Hg.), Das Politische denken. Zeitgenössische Positionen, Bielefeld 2010; Hebekus, Uwe/Völker, Jan, Neue Philosophien des Politischen zur Einführung, Hamburg 2012.
12 | Lefort, Claude, Fortdauer des Theologisch-Politischen?, übers. von Hans Scheulen und Ariane Cuvelier, Wien 1999, S. 37 und S. 49.
13 | Ebd., 39.
14 | Ebd., S. 37, vgl. dazu: Hebekus/Völker, Neue Philosophien des Politischen, a.a.O., S. 68.
15 | Parikka, Jussi, Geology of Media, Minneapolis 2015, S. 5.
16 | Zum Begriff ›Regierungswissen‹ vgl. Foucault, Michel, Geschichte der Gouvernementalität I. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am Collége de France 1977–1978, hg. von Michel Sennelart, übers. von Claudia Brede-Konersmann und Jürgen Schröder, Frankfurt a.M. 2004, S. 159.
17 | Vgl. Rancière, Jacques, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, übers. von Richard Steurer, Frankfurt a.M. 2002.
18 | Den Ausdruch ›Postdemokratie‹ prägte Colin Crouch, eine seiner zentralen Thesen lautet: »Während die demokratischen Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind (und heute sogar in vielerlei Hinsicht weiter ausgebaut werden), entwickeln sich politische Verfahren und die Regierungen zunehmend in eine Richtung zurück, die typisch war für vordemokratische Zeiten: Der Einfluss privilegierter Eliten nimmt zu, in der Folge ist das egalitäre Projekt zunehmend mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert«. Crouch, Colin, Postdemokratie, Frankfurt a.M. 2008, S. 13.
19 | Rancière, Jacques, »Demokratie und Postdemokratie«, übers. von Rado Riha, in: Riha, Rado (Hg.), Politik der Wahrheit, Wien 1997, S. 94–122, hier S. 110.
20 | Ebd., S. 116.
21 | Vgl. dazu: Hulme, Mike, Why we Disagree about Climate Change. Understanding Controversy, Inaction and Opportunity, Cambridge u.a. 2009, S. 99–105.
22 | Am 06. November 2012 twitterte Trump: »The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive«.
23 | Vgl. z.B. den Dokumentarfilm Bitter Seeds (GB 2011) von Micha X. Peled. Inzwischen hat die indische Regierung Gegenmaßnahmen unternommen, um das Monopol des Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto, er kontrolliert 90 Prozent des Baumwollmarktes in Indien, zu brechen, indem sie u.a. die Lizenzgebühr senken. Vgl. Schreier, Doro, »Indien: Monsanto geht es an den Kragen«, abrufbar unter: https://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Indien-Monsanto-geht-es-in-an-den-Kragen (letzter Zugriff: 15.02.2018).
24 | Nassehi, Armin, »Zu Fakten gibt es oft eine Alternative«, in: FAZ 28.06.2017, abrufbar unter: http://plus.faz.net/geisteswissenschaften/2017-06-28/rvriwxfvriu3usxsijrwnmf/ (letzter Zugriff: 15.02.2018).
25 | Möllers, Christoph, »Wir die Bürger(lichen)«, in: Merkur 71, 818 (Juli 2017), S. 5–16, hier S. 14.
26 | »Far from being able to eliminate uncertainty, science – especially climate change science – is most useful to society when it finds good ways of recognizing, managing and communicating uncertainty«. Hulme, Why we Disagree about Climate Change, a.a.O., S. 82.
27 | Zum Folgenden: Blühdorn, Ingolfur, »Nachhaltigkeit und postdemokratische Wende. Zum Wechselspiel von Demokratiekrise und Umweltkrise«, in: Vorgänge 49, 2 (2010), S. 44–54, hier S. 47f.
28 | Blühdorn, Ingolfur, Simulative Demokratie. Neue Politik nach der postdemokratischen Wende, Berlin 2013, S. 44.
29 | Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, a.a.O., S. 162.
30 | Lemke, Thomas, »Gouvernementalität«, in: Kammler, Clemens/Parr, Rolf/Schneider, Ulrich Johannes (Hg.), Foucault Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2014, S. 260–263, hier S. 260.
31 | Ebd., S. 261. Vgl. dazu ausführlich: Lemke, Thomas, Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität, Hamburg 1997.
32 | Die »Kunst des Regierens ist gerade die Kunst, die Macht in der Form und nach dem Muster der Ökonomie auszuüben«. Foucault, Geschichte der Gouvernementalität, a.a.O., S. 144.
33 | Ebd., S. 156f.
34 | Ebd., S. 159.
35 | Ebd.
36 | Bröckling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas, »Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einführung«, in: dies. (Hg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt a.M. 2000, S. 7–40, hier S. 26.
37 | Vgl. Bühler, Benjamin, Ecocriticism. Grundlagen – Theorien – Interpretationen, Stuttgart 2016.
38 | Deleuze, Gilles, »Was ist ein Dispositiv?«, übers. von Hans-Dieter Gondek, in: Ewald, François/Waldenfels, Bernhard (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, Frankfurt a.M. 1991, S. 153–162, hier S. 153.
I. Ökologische Gouvernementalität
1. Protoökologische Modelle
Die Ansätze einer protoökologischen Gouvernementalität lassen sich bereits im 18. Jahrhundert ausmachen, was nicht überraschend ist: Politische Ökonomie und politische Ökologie entstehen aus demselben Bedingungsgefüge, nämlich aus der Regierung und Regulierung der Bevölkerung auf Grundlage wissenschaftlicher Aussageformen. Veranschaulichen lässt sich die Beziehung zwischen ökonomischen und ökologischen Aussageformen anhand der Geschichte des Holzes und insbesondere an dem in diesem Rahmen erfundenen Konzept der Nachhaltigkeit.
Nach Joachim Radkau ist die Geschichte des Stoffes ›Holz‹ zwar nicht durchgängig als hemmungslose Ausbeutung verlaufen, denn die Angst vor ›Holznot‹ in der frühen Neuzeit habe auch immer wieder zu einer den Bestand erhaltenden Nutzung, zu Forstordnungen und technischen Neuerungen wie der Verwendung von Holzabfällen geführt.[1] Allerdings führten die Verwendung von Bau- und Brennholz, der Holzverbrauch im Schiffbau sowie in Salinen und Montanindustrien zur Verknappung von Holz, so dass im 18. Jahrhundert Klagen über Holzmangel zu einem populären Motiv wurden.[2] Nach Radkau handelte es sich im 18. Jahrhundert jedoch weniger um eine ökologische als vielmehr um eine institutionelle Krise: Die Forst- und Holzämter waren durch die Vielfalt der Holznutzer überfordert, die Preise für Holz stiegen, seit es einen Marktpreis erhalten hatte, und das Transportwesen erreichte die Grenzen seiner Kapazitäten.[3] Zur ›Holznot‹ gehörte jedoch auch, dass nicht alle gleichermaßen betroffen waren: Vor allem die arme Bevölkerung hatte unter ihr zu leiden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kopplung des Holzverbrauchs an die technische Entwicklung, das betrifft den Verbrauch von Holz im Verlauf der industriellen Entwicklung genauso wie effektivere Nutzungen, mit denen der Wirkungsgrad gesteigert werden konnte, oder schließlich die Umstellung auf Kohle als Brennstoff, die im 18. Jahrhundert begann.[4]
Vor diesem Hintergrund wird die Begrenztheit der Ressource ›Holz‹ zum Thema diverser Abhandlungen – man könnte auch sagen: Aufgrund seines Mangels wird ›Holz‹ zu einem zentralen Akteur im ökonomischen Diskurs. So setzt John Evelyns Abhandlung Sylva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber in His Majesty’s Dominions aus dem Jahr 1662 mit der Befürchtung ein, durch die Holznot könne es zu einer Schwächung, gar Auflösung der englischen Nation kommen. Die offensichtliche Methode, die hier Abhilfe schaffe, sei Säen und Anpflanzen, wobei man die Sorten verwenden müsse, die vielseitig verwendungsfähig seien, wie Eiche, Ulme, Buche, Esche u.a.[5] ›Bäume‹ bzw. ›Holz‹ konstituieren damit die, wie Ulrich Grober in seiner Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit formuliert, Ethik einer vorausschauenden Gesellschaft, denn man pflanze die Bäume, damit auch die Nachwelt versorgt sein werde.[6] Es gab jedoch auch andere Strategien: Die Engländer verlagerten die Ausbeutung der Wälder in ihre Kolonien, aus denen sie Holz importierten, ersetzten das Holz aber auch durch Kohle, die zum zentralen Akteur der Industrialisierung werden sollte.[7]
In diesem Kontext entstand das Konzept der ›Nachhaltigkeit‹, das spätestens seit dem Brundtland-Bericht den Leitbegriff der ökologischen Modernisierung bildet.[8] Geprägt hat den Begriff der Oberberghauptmann Carl von Carlowitz in seinem Werk Sylvicultura oeconomica (1713), die berühmte Stelle lautet: »Wird derhalben die groeste Kunst, Wissenschaft, Fleiß, und Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen, wie eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen, daß es eine continuirliche bestaendige und nachhaltende Nutzung gebe, weiln es eine unentbehrliche Sache ist, ohnewelche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.«[9] Carlowitz’ Abhandlung steht im Kontext des Kameralismus und lässt sich damit auch in die Geschichte der Gouvernementalität einordnen. Denn vom Holz hängt die Ernährung, die Erstellung von Gebäuden, Handel sowie Gewerbe und damit die »Wohlfart des Landes« ab.[10] Auch den in der Gegenwart noch unsichtbaren zukünftigen Schaden bezieht er mit ein: Denn wenn die Waldungen ruiniert seien, dann blieben die Einkünfte auf unendliche Jahre hinaus zurück, und »das Cammer=Wesen wird dadurch gaentzlich erschoepffet, daß also unter gleichen scheinbaren Profit ein unersetzlicher Schade liege«.[11] Die »Schonung« und »conservation« des Holzes[12] müsse demnach zum Leitprinzip einer vorsorgenden Regierung werden. Kann somit François Quesnays Formel der ›ökonomischen Regierung‹ mit Foucault als Grundlage der politischen Ökonomie gelten,[13] so Carlowitz’ Formel der ›conservation‹ als Grundlage der politischen Ökologie.
Indem Carlowitz die Technik des Konservierens konkreter Objekte auf die Bewahrung einer knappen Ressource überträgt, schreibt sich seine Abhandlung in einen protoökologischen Diskurs ein, der sowohl die gegenwärtige als auch zukünftige Begrenztheit und Knappheit von Ressourcen berücksichtigt, auf spezifische Wissensformen wie die Forstwissenschaft oder Techniken wie die Papierherstellung rekurriert und über Konzepte wie ›conservation‹ einen gegen eine pure Naturbeherrschung und -ausbeutung gerichteten kontrahegemonialen Diskurs zumindest ansatzweise entwickelt. Damit steht er keineswegs allein. Zum Beispiel entwickelt der Jurist Justus Claproth in seiner Abhandlung Eine Erfindung aus gedrucktem Papier wiederum neues Papier zu machen, und die Druckerfarbe völlig heraus zu waschen (1774) ähnliche Ideen, allerdings nicht in Bezug auf die Knappheit von Holz, sondern von ›Lumpen‹, die im Zuge der frühneuzeitlichen Mechanisierung der Papierherstellung zu einer knappen Ressource wurden.[14] Schon im späten 15. Jahrhundert stellte man die Ausfuhr der so genannten ›Hadern‹[15] unter Strafe, Grenzkontrollen sollten Schmuggel verhindern, Papiermühlen benötigten eine Konzession für das Sammeln von Lumpen, und Preußen zwang im Jahr 1756 die Lumpensammler zum Mitführen eines Lumpenpasses. Claproth wollte dem bestehenden und sich seiner Ansicht nach in Zukunft verschärfenden Lumpen-Mangel zuvorkommen, indem er für die Wiederverwendung des bedruckten Papiers plädierte, das man bisher nur für die Herstellung von Pappe verwendet hatte – folgerichtig war seine Abhandlung auf ›recyceltem‹ Papier gedruckt. Dabei dachte auch Claproth gewinnorientiert: Mit den neuen Verfahren der Papiergewinnung aus Papier könnten unbrauchbare Bücher nicht nur den Mangel an Lumpen ersetzen, sie erhielten auch noch als Ausschussware einen ökonomischen Wert.
Während Carlowitz und Claproth ökonomisch denken, kommt es im 19. Jahrhundert zu einer Gegenüberstellung von Ökonomie und Ökologie. Zugespitzt findet sich die Etablierung einer ›ökologischen‹ Position im Werk Henry David Thoreaus, dem »patron saint« des amerikanischen »environmental writing«.[16] Kein anderer Autor der Literaturgeschichte amerikanischer Subkultur steht, so Lawrence Buell, »for nature in both the scholarly and the popular mind«.[17]
In seinen Aufzeichnungen Walden; or, Life in the Woods (1854) hält er der politischen Ökonomie eine economy of living entgegen, die den praktischen Umgang mit Dingen betont. So schreibt Thoreau über das Studium an der Universität: »Even the poor student studies and is taught only political economy, while that economy of living […] is not sincerely professed in our colleges. The consequence is, that while he is reading Adam Smith, Ricardo, and Say, he runs his father in debt irretrievably.«[18] Thoreau sieht in der universitären Ausbildung eine Kluft zwischen dem, was gelernt werden sollte, nämlich der Umgang mit praktischen Dingen, und einem Buchwissen, das sich selbst unterminiert, wenn der Student der Ökonomie seinen Vater in die Schulden treibt. Letzteres ist jedoch nicht nur eine ironische Pointe, denn mit der politischen Ökonomie und ihren namentlich genannten Gründern bringt Thoreau seine Gesellschaftskritik auf den Punkt. Der arbeitende Mensch habe nicht Zeit, er selbst zu sein, er müsse vielmehr wie eine Maschine funktionieren, damit seine Arbeit nicht an Marktwert verliere. Somit aber werde er zum Sklaven seiner eigenen Arbeit und seinem beständigen Streben nach feinerer Kleidung und größeren Häusern, nach Luxus und Überfluss. Thoreau zielt somit auf das Verhalten des Einzelnen, der im Arbeitsprozess seine Individualität verliert. Dagegen setzt Thoreau eine economy of living. Die Alternative zum ›arbeitenden‹ Menschen ist für ihn der ›lebende‹ Mensch, nämlich derjenige, der sich nur um die necessaries of life kümmert, also um Nahrung, Obdach, Kleidung und Heizung: »I learned from my two years’ experience that […] a man may use as simple a diet as the animals, and yet retain health and strength.«[19] Der Mensch wird damit zwar nicht zum Tier, das Tier aber in seiner naturgemäßen und einfachen Lebensweisezum Vorbild des Menschen.[20]
Thoreaus Experiment, über zwei Jahre alleine am Walden Pond zu leben, führt auch den doppelten Aspekt des Regierens vor: Es handelt sich um einen Selbstversuch, mit dem Thoreau zeigen möchte, dass und wie man ein einfaches, unabhängiges, großmütiges und vertrauenswürdiges Leben führen kann.[21] Daher sei das Leben, das die meisten Menschen führten, keineswegs unvermeidlich, was sie aber erst erkennen müssten: Der Mensch sei ein »slave and prisoner of his own opinion of himself, a fame won by his own deeds«.[22] Mit seinem Bericht, der ausdrücklich in der ersten Person verfasst ist, möchte er eine Alternative schaffen: Das praktische Leben in der Natur kann nach Thoreau ein anderes Selbstbild erzeugen und aus den hierbei ausgeübten Techniken des Selbst könnte ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur entstehen, woran Umweltaktivisten vor allem seit den 1970er Jahren auch in praktischer Hinsicht anknüpften.
2. Vernetzung und Regulation
Während Thoreau das Konzept eines ökologischen Regierungswissens auf dem Feld der Literatur entwickelt, haben Biologen den Konflikt zwischen ökonomischer und ökologischer Rationalität an konkreten Objekten herausgearbeitet. Der Leitgedanke der Ökologie bestand von Anfang an in der Vernetzung der Lebewesen, woraus resultiert, dass bereits geringfügige Eingriffe in die biologischen Zusammenhänge weitreichende Wirkungen haben. In seinem für die Limnologie und Ökologie wegweisenden Aufsatz The Lake as a Microcosm (1887) untersucht der Zoologe Stephen A. Forbes die Beziehungen zwischen den Lebewesen eines Sees, der sich nach Forbes als Forschungsobjekt besonders gut eignet, da in ihm ein weitaus vollständigeres und unabhängigeres Gleichgewicht des organischen Lebens besteht als auf einem gleichwertigen Stück Land. Der See forme eine kleine Welt in sich: »[…] a microcosm within which all the elemental forces are at work and the play of life goes on in full, but on so small a scale as to bring it easily within the mental grasp«.[23] Aufgrund dieser Geschlossenheit könne man nicht eine Spezies im See für sich allein betrachten. Denn was immer auch mit den Individuen einer Art geschehe, habe Auswirkungen auf die gesamte »assemblage«, weshalb Forbes von der »sensibility« eines solchen organischen Komplexes spricht. Beschäftige man sich zum Beispiel mit dem Schwarzbarsch, müsse man auch die Organismen beobachten, von denen seine Existenz abhänge, damit aber auch deren Existenzbedingungen berücksichtigen. Ebenfalls müssten die Konkurrenten des Schwarzbarschs und das gesamte System der mit ihnen aufgerufenen Bedingungen in die Forschung einbezogen werden. Und nicht zuletzt bezieht Forbes den Menschen als Faktor mit ein, wenn auch nur in negativer Weise. Er untersuche nämlich bewusst die Seen in Illinois, die geschützt seien »from the filth and poison of towns and manufactories by which the running waters of the state are yearly more deeply defiled«.[24]
Bei Forbes zeigt sich ein zweiter Leitgedanke der Ökologie: Die Beziehungen zwischen den Lebewesen sind zwar stabil, solange sie sich in einem Gleichgewicht befinden, sobald es jedoch zu gravierenden Störungen kommt, kann das System zusammenbrechen. Über die Idee des Gleichgewichts ließe sich die Geschichte der Ökologie bis in die Antike zurückführen, allerdings leistet erst die Naturgeschichte eine Beschreibung der Vielfalt der Natur.[25] Nach Trepl verwendet wahrscheinlich der Physikotheologe William Derham erstmals den Begriff ›Gleichgewicht‹ im Jahr 1713 in einem (proto-)ökologischen Zusammenhang, wobei für ihn die Harmonie der Natur der göttlichen Schöpfung zu verdanken ist.[26] Ausgearbeitet hat dieses Konzept aber Carl von Linné in seiner Abhandlung Oeconomia Naturae (1749), in der er schreibt: »Unter den Oeconomien der Natur verstehet man des höchsten Schöpfers weise Anordnung der natürlichen Dinge, vermöge der sie zur Hervorbringung der gemeinschaftlichen Zwecke und zur Leistung eines wechselseitigen Nutzens geschickt sind.«[27] Jedes Lebewesen nimmt nach Linné einen bestimmten Platz in der Ordnung der Natur ein: Die einen Pflanzen sind kälteempfindlich und leben in den Tropen, die anderen gedeihen in der Kälte Sibiriens. Dementsprechend sind die Beziehungen zwischen den Organismen eingerichtet, jede Art diene einer anderen Art, indem sie für ihren eigenen Lebensunterhalt sorge. So leben auf Pflanzen Baumläuse, die von bestimmten Fliegen gefressen werden, von denen sich Hornissen und Wespen ernähren, die von kleinen Vögeln gejagt werden, welche von Falken verfolgt werden.
Wie Donald Worster in seiner Ideengeschichte der Ökologie aufzeigt, vereint der Ausdruck ›Ökonomie‹ bei Linné unterschiedliche Begriffstraditionen. Abgeleitet von dem griechischen Wort oikos bezieht sich Ökonomie auf die Einrichtung des Haushaltes, seine Leitung und Organisation; in der theologischen Tradition verweist oeconomia auf die göttliche Fügung, im 17. Jahrhundert bezog sich der Ausdruck häufig auf die göttliche Regierung der natürlichen Welt. Im 18. Jahrhundert nahm der Ausdruck nach Worster diese unterschiedlichen Linien auf und bezeichnete die rationale Ordnung der Natur als ein interagierendes Ganzes.[28] Dabei ermöglichte gerade die Ambivalenz des Begriffs ›Ökonomie der Natur‹, d.h. seine religiösen und säkularen Dimensionen, erstere zu kappen. Insofern legte Linné mit seiner Beschreibung der Beziehungen der Organismen die Grundlage für »alle späteren naturwissenschaftlichen Forschungen«.[29]
Die Leitkonzepte ›Vernetzung der Lebewesen‹ und ›Gleichgewicht‹ sind entscheidende Grundlagen für die Konzeption ökologischer Gouvernementalität, was sich exemplarisch an der Arbeit Die Auster und die Austernwirthschaft, die der Zoologe Karl August Möbius im Jahr 1877 veröffentlichte, aufzeigen lässt. In dieser Auftragsarbeit sollte Möbius die Möglichkeiten einer künstlichen Austernzucht an der deutschen Küste überprüfen. Denn der Ertrag der einst reichen Austernbänke hatte seit den 1850er Jahren weltweit abgenommen, woran auch die künstlich angelegten Austernbänke nichts änderten. Der Grund für die Abnahme der Bestände liegt nach Möbius vor allem in den neuen Verkehrs- und Vertriebsmöglichkeiten. Denn Dampfschiffe und Eisenbahnen ermöglichten die Verbreitung von Austern im Binnenland, was wiederum die Nachfrage nach Austern stark erhöhte.[30] Möbius’ Abhandlung zeigt somit am Beispiel der Austernbänke die Folgen des Modernisierungsprozesses auf, so wird die Eisenbahn zum entscheidenden Faktor: »Während vor der Zeit der Eisenbahnen die fallenden Marktpreise die Austernfischerei zu Gunsten eines guten Bestandes der Bänke regulirten, reizten in dem Zeitalter der Eisenbahnen die immer höher gehenden Austernpreise die Fischer dazu, ihre Bänke zu erschöpfen.«[31] Möbius’ biologische Untersuchung geht somit von dem ökonomischen Befund aus, dass die freien Regeln des Marktes – mit der steigenden Nachfrage steigen die Preise – zu einer »schonungslos[en]« Befischung führten, bis sich die Austernbänke nicht mehr ausreichend regenerieren konnten.[32] Eine ›gute‹ Austernwirtschaft dagegen habe ihr Ziel darin, »in ihrem Gebiete einen möglichst hohen Ertrag auf die Dauer zu gewinnen«.[33]