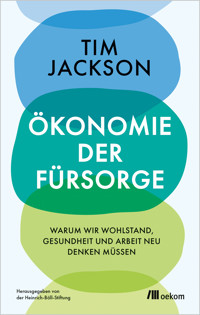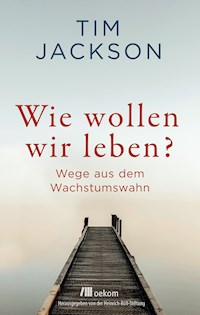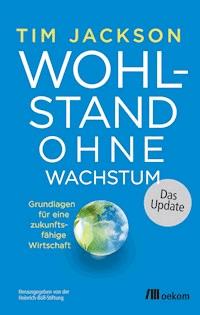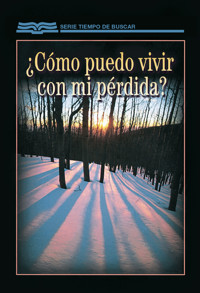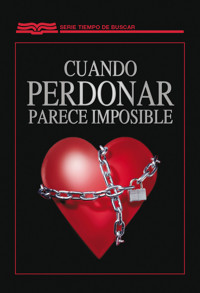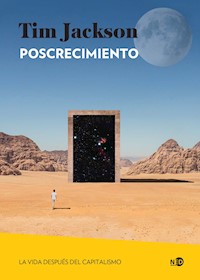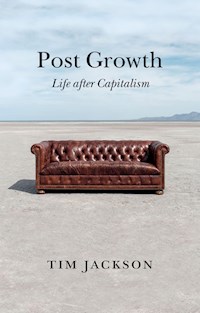Inhalt
Vorwort von Maja Göpel
Vorwort der Herausgeber
Prolog
In welchem wir zum ersten Mal der Göttin Cura begegnen, uns mit ihrer Rolle in der römischen (und griechischen) Kosmologie vertraut machen – und lernen, dem Patriarchat zu misstrauen.
Kapitel 1 Der Weg zur Hölle
In welchem wir mit zwei entscheidenden Thesen bekannt gemacht werden: dass es bei Wohlstand in erster Linie um Gesundheit geht und nicht um Reichtum; und dass sich die Wirtschaft von daher an Fürsorge orientieren sollte und nicht am Wachstum. Auch wird in diesem Kapitel deutlich, dass nichts jemals so einfach ist.
Kapitel 2 Euphoria
In welchem wir lernen, zwischen dem Bewahren der Gesundheit, der Vermeidung von Schmerzen und dem Streben nach Vergnügen zu unterscheiden. Über die fragwürdigen Heilmethoden des 19. Jahrhunderts bis zur Opioid-Krise des 21. Jahrhunderts erkunden wir, wie Profitstreben unser rastloses Verlangen nach Euphorie zu einer ausgemachten Waffe schmiedete.
Kapitel 3 Vitalzeichen
In welchem uns die Freude am Eisschwimmen die Weisheit des Körpers nahebringt – die Fähigkeit, unser eigenes »inneres Milieu« zu regulieren; und in welchem wir erfahren, was passiert, wenn diese Fähigkeit gestört wird, sei es zeitweilig (wie es in der Natur der Fall ist) oder systematisch (wie es tendenziell unter den Bedingungen des Kapitalismus geschieht).
Kapitel 4 Ein Mythos namens Care
In welchem wir über das wahre Wesen von Care nachdenken, nicht im Sinne einer moralischen Verfügung, sondern als restaurative und stärkende Kraft: als zentrales Ordnungsprinzip, das für organisches Leben so unerlässlich ist, dass es tief in unseren Instinkten verwurzelt ist; und in welchem wir zu erforschen beginnen, warum dieses Prinzip durch ökonomische Interessen immer wieder außer Kraft gesetzt wird.
Kapitel 5 Der Welten Lohn
In welchem wir den Geburtsort eines Traums besuchen und erfahren, wie die Vision universeller Gesundheitsversorgung den Wohlfahrtsstaat inspirierte; und in welchem wir lernen, was passierte, als dieser Traum dem gnadenlosen Licht des Markts und zunehmenden globalen Krankheitslasten ausgesetzt wurde.
Kapitel 6 Passerelle
In welchem wir zu verstehen beginnen, wie uns das Prinzip der Fürsorge helfen kann, eine tragfähige Alternative zur Verlockung des ewigen Wachstums zu formulieren: eine Ökonomie, die mit den Grenzen eines endlichen Planeten vereinbar ist, die dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit entspricht und dem menschlichen Wohlbefinden wesentlich besser dient.
Kapitel 7 Bittere Wahrheiten
In welchem uns die Geschichte und Epidemiologie von Diabetes Einblicke in eine »Pandemie« chronischer Zivilisationskrankheiten gewährt, die mittlerweile unsere Gesundheitssysteme zu überschwemmen und die Staatskasse aus den Angeln zu heben droht; und in welchem wir uns mit dem Kampf zwischen dem Schutz der globalen Gesundheit und dem Streben nach wirtschaftlichem Wachstum auseinandersetzen.
Kapitel 8 Lost Generation
In welchem die morgendliche Dämmerung über der Pariser Skyline die mitunter widersprüchlichen Forderungen unseres körperlichen und psychischen Wohlbefindens veranschaulicht. Gertrude Steins »Lost Generation« und Florence Nightingales Lebensweg bilden kontrastreiche Kulissen für die »Food Wars«, die heute unsere Gesundheit zu gefährden drohen.
Kapitel 9 Care in den Zeiten der Cholera
In welchem wir in den geschützten Wassern des Chichester Hafengebiets dem Kolibakterium (Escherichia coli) begegnen und die Geschichte der Kanalisation von den Cholera-Ausbrüchen des 19. Jahrhunderts bis zum Behördenversagen der Gegenwart nachzeichnen. Hygiene, Darmgesundheit und soziale Reformen stützen allesamt die kuriose Idee, dass Krankheit selbst eine Form der Fürsorge ist.
Kapitel 10 Pathogenese
In welchem sich der Revierkampf zwischen zwei französischen Chemikern zu einer Glaubensspaltung im Kern der Medizinwissenschaften auswächst – einem Zerwürfnis zwischen zwei unterschiedlichen Ansichten darüber, wie Krankheit zu bekämpfen sei; und in welchem wir erfahren, wie der Kapitalismus selbst zum Schiedsrichter bei diesem Disput wurde – und letztlich die Seite bevorzugte, die mehr Profit generiert.
Kapitel 11 Der Tod und das Mädchen
In welchem wir dem Ökonomen William Baumol auf der Straße nach Stonehenge begegnen und ergründen, warum Computer immer billiger werden, die Gesundheitsversorgung dagegen nicht. Mithilfe der Philosophin Hannah Arendt und der antiken Götter der Heilung entschlüsseln wir die strukturellen Kräfte des Kapitalismus, die das Prinzip der Fürsorge untergraben.
Kapitel 12 Fuck the Patriarchy
In welchem uns die Romane von Daphne du Maurier, die Geschichte vormoderner Hexenjagden und das wunderliche Phänomen Barbenheimer helfen, das belastete Verhältnis zwischen Geschlecht, Gewalt und Fürsorge zu entwirren; und in welchem wir uns endlich der verzerrten Logik des Patriarchats stellen.
Kapitel 13 Land’s End
In welchem die zerklüftete Küste Cornwalls den Schlüssel zu einem dauerhaften Rätsel bereithält, und wir zu erkennen beginnen, wie unsere eigene Existenzangst das Potenzial zur Zerstörung der Welt schafft. Die Konfrontation zwischen Fürsorge und Gewalt erfährt eine teilweise Lösung durch die Aufgabe, mit unserer eigenen Sterblichkeit ins Reine zu kommen.
Kapitel 14 Jenga
In welchem wir die wichtigsten Argumentationsstränge zusammenführen und daraus die Konturen der Ökonomie der Fürsorge skizzieren – nicht als Teilsektor des gewohnten Geschäftsablaufs oder als Schauplatz von Sonderansprüchen, sondern als kraftvolle Vision mit dem Potenzial, unser Verständnis von gemeinsamem Wohlstand zu erneuern und eine echte Verfassung von Wohlbefinden herbeizuführen.
Kapitel 15 Die rote Pille
In welchem wir die Frage »Was soll man machen?« in Angriff nehmen, das lange Erbe politischer Programmatiken erkunden und verschiedene Formen von Fürsorge zusammenführen: als Grundprinzip, als Investition, als offene Schuld, als politische Maßnahme zur Klimagerechtigkeit, als Freiheit und als neues Fundament für kulturellen Bedeutungsgehalt.
Dank
Anmerkungen
Literatur
Über den Autor
Vorwort der Herausgeber
»Wir sind im eisernen Käfig des Konsumismus gefangen, aber diesen Käfig haben wir uns selbst gebaut. Wir sind im Wachstumsmythos eingeschlossen, aber der Schlüssel wurde in unseren Köpfen geschmiedet. Unsere Existenz ist physisch und materiell begrenzt, aber in unseren Seelen lebt eine Kreativität, die uns befreien kann, um gemeinsam ein gutes und sinnvolles Leben zu führen.«
So hatte Tim Jackson 2021 seine Erkenntnisse in seinem Buch Wie wollen wir leben? zusammengefasst. Damit beschrieb er die Zwangslage, in die uns das kapitalistische Wirtschaften im 21. Jahrhundert gebracht hat, und benannte die Werkzeuge für die notwendige grundlegende Veränderung: das Tun und Denken, die Kreativität der Menschen.
Sein neues Buch Die Ökonomie der Fürsorge hat Tim Jackson weitgehend während der Coronapandemie geschrieben. Darin führt er uns auf einer intellektuellen und persönlichen Reise zu neuen Erkenntnisquellen, mit denen er genauer beschreibt, was eine Postwachstumsökonomie leisten muss und was ihr im Wege steht.
Kurzgefasst: Ihre wesentliche Aufgabe liegt nicht in der nachhaltigen Produktion von Dingen oder Wohlstand, sondern darin, ein umfassendes Wohlbefinden, das sich aus der körperlichen, seelischen, sozialen Gesundheit der Menschen und des Planeten ergibt, zu gewährleisten. Dafür muss die Wirtschaft nicht nur den Wachstumszwang überwinden, sondern die Fürsorge für den Menschen in all ihren Formen ins Zentrum stellen, also die Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung der Gesundheit. Diese Aufgabe umfasst auch den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vor den zerstörerischen Auswirkungen des Ressourcenhungers, der auch ein »grünes« Wachstum begleitet. Ein gesunder Planet und gesunde Menschen – das gehört zusammen.
Was steht der Gewährleistung dieses umfassenden Wohlergehens im Wege? Um diese Frage zu beantworten, befasst sich Jackson mit Theorien von Krankheit und Gesundheit im 19. Jahrhundert, mit der Entdeckung von Keimen als Ursache von Infektionskrankheiten und der Entstehung der modernen Medizin und Pharmakologie, die die Naturheilkunde und die Hygiene- und Lebensreformbewegung an den Rand drängen. Die moderne Medizin besiegt die Infektionskrankheiten, die sich mit der industriellen Revolution und der Urbanisierung massiv verbreitet hatten; das ist eine große Leistung.
Heute beansprucht die Behandlung von chronischen Zivilisationskrankheiten aber etwa 75 Prozent der Gesundheitsbudgets in den alten Industrieländern. Die pharmakologische Behandlung fokussiert auf die Symptome wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und lässt die Ursachen – unter anderem falsche Ernährung, zu wenig Bewegung – unberührt. Denn mit der Zunahme dieser Erkrankungen lassen sich gute, wachsende Geschäfte machen.
Das Gesundheitssystem wird dysfunktional.
Das zeigt auch ein weiterer Befund: Gerade unter dem Eindruck der Pandemie und der abendlichen öffentlichen Applausrunden, die es für Pflegekräfte und Ärzt*innen an so vielen Orten gegeben hat, fragt Jackson, warum es nicht gelingt, diese unersetzlichen Kräfte angemessen zu bezahlen. Und ihnen die Zeit zu geben, die eine menschengerechte Pflege erfordert, von kranken, alten oder ganz jungen Menschen. Schon vor der Pandemie waren die Reallöhne der britischen Krankenpfleger*innen seit 2010 um 20 Prozent gesunken – und nach einem zweijährigen Arbeitskonflikt, dem allerersten Streik im britischen Gesundheitswesen überhaupt, wurde nur eine Erhöhung von 5 Prozent erreicht. Wegen der auch kriegsbedingten Inflation waren die Krankenpfleger*innen damit schlechter gestellt als zum Ende der Pandemie.
Die ökonomischen Gründe für die niedrigen Löhne im Bereich der menschlichen Fürsorge hat Jackson in seinen früheren Werken benannt: Hier lassen sich keine höheren Löhne durch Produktivitätsgewinne erzielen, wie in der Produktion oder im Finanzwesen. Fürsorge erfordert menschliche Aufmerksamkeit und Zeit. Wenn sie fehlt, macht sich das sofort in der schlechteren Qualität der Ergebnisse bemerkbar. Der dafür gezahlte Lohn erscheint somit als reiner Kostenfaktor; Profite können nur steigen, wenn Löhne fallen.
Nun aber bohrt Jackson tiefer, weil ein großer Teil der Fürsorge- und Pflegearbeit nicht nur schlecht, sondern überhaupt nicht bezahlt wird. Weil diese Arbeit vor allem von Frauen geleistet wird. Und weil es im Gesundheitswesen eine klare Hierarchie zwischen wissenschaftlich gebildeten Ärzt*innen und in der Regel weiblichen, untergeordneten Pflegekräften gibt.
Und so kommt Jackson zum zweiten großen neuen Thema seiner Analyse: einer fulminanten Kritik des Patriarchats, das er verantwortlich macht für die Verunglimpfung der Fürsorge. »Fuck the patriarchy«, so zitiert er Taylor Swift zustimmend und führt uns in die reiche feministische Literatur zur Fürsorge: zu den als Hexen verfolgten Heilerinnen, zur Care-Ethik und zu der anthropologischen Einsicht, dass die patriarchale Dominanzgesellschaft, in denen Männer einander und die Frauen unterwerfen, fast überall partnerschaftlich organisierte Gesellschaften unterworfen hat, die auf Respekt und Gegenseitigkeit beruhen und oft matrilinear strukturiert waren. Jackson betont: Nicht das Matriarchat steht dem Patriarchat gegenüber, sondern eine auf Partnerschaft und Kooperation der Geschlechter setzende Gesellschaftsform. Und noch heute, bei allem Fortschritt auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter, sind Frauen in der Wirtschaft und der Politik weitgehend einflusslos.
Das Patriarchat muss also abgewickelt werden, wenn der Übergang zu einer Ökonomie der Fürsorge gelingen soll. Nur so kann die gesellschaftliche und individuelle Gewalt als Nemesis der Fürsorge unter Kontrolle gebracht werden.
Das sind starke Aussagen. Um sie verständlich zu machen, wählt Jackson Formen der Erzählung, die an die physischen Orte des Schreibens anknüpfen, an eigenes Erleben und eigene Krankheiten, um Hypothesen und Erklärungen zu verdeutlichen. Er führt uns ins 19. Jahrhundert, in die Entstehungszeit des industriellen Kapitalismus, der modernen Medizin und Pharmakologie, und er zeichnet die verschiedenen Wellen des Feminismus nach, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat.
Er beschließt das Buch mit einem Kapitel, das auflistet, welche Erkenntnisse wir festhalten und welche Reformvorhaben progressive Regierungen angehen können – in der Steuer- und Fiskalpolitik, für die Stärkung vorbeugender Gesundheitsmaßnahmen, für den Umbau der Wirtschaft insgesamt und der Ernährungs- und Energiewirtschaft im Besonderen, um den Übergang von einer Wachstums- zu einer Care-Ökonomie selbst behutsam zu gestalten und das Klimaschutzpotenzial, das in diesem Umbau steckt, bekannt zu machen und zu nutzen.
Der gesamte Facettenreichtum der Postwachstumsökonomie und -gesellschaft, der in diesem Buch dargestellt wird, zeigt die Größe der vor uns liegenden Aufgabe, aber auch den neuartigen, nichtmateriellen gesellschaftlichen Reichtum, den sie bieten wird.
Das Buch knüpft an viele empirische Analysen an, die an Tim Jacksons Forschungszentrum entstanden sind und deren Themen uns in der Heinrich-Böll-Stiftung schon lange beschäftigen, vor allem mit Blick auf eine klimagerechte und biodiversitätsbewahrende Umgestaltung unserer Agrar- und Ernährungssysteme, die den Hunger verringert und die Gesundheit befördert, und auf die Nutzung feministischer Ansätze, um Gesellschaften freier, selbstbestimmter, egalitärer und offener zu gestalten.
Dieses Buch ist eine lohnende Lektüre, die wie jeder engagierte streitbare Text hin und wieder auch zum Widerspruch reizt. Wer an einer lebenswerten Zukunft interessiert ist, sollte sich auf die Reise begeben, zu der Tim Jackson erneut einlädt.
Berlin, im Januar 2025
Imme Scholz, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung
Prolog
What was I made for?
Billie Eilish, 20231
Am Anfang war Chaos. Die Erde war leer und bar jeder Gestalt. Und Finsternis lag über dem Antlitz der Tiefe.
Nach einer Weile wurde das Ganze etwas einsam. Also gestattete Chaos, dass Terra sich formen durfte. Terra war die Mutter von Saturn und die Großmutter von Jupiter. Sie war schlicht die Mutter von allem – jedenfalls in der römischen Mythologie. Und in der griechischen auch, nur hieß sie dort Gaia. Aber das ist eine andere Geschichte. Beziehungsweise die gleiche Geschichte, nur in einer anderen Sprache. So ist es ja meistens.
Wie auch immer: Dank Terra tummelte sich schon bald eine ganze Sippe von Göttern und Göttinnen auf dem Olymp. Den Großteil ihrer Zeit verbrachten sie damit, sich um die Macht zu zoffen. Typisch Familie eben. Das trieb Terra in den Wahnsinn und machte sie, um ehrlich zu sein, ganz schön fertig.
Also beschloss sie, immer wenn sie Zeit hatte, mit ihrer Freundin abzuhängen – der Göttin Cura. Zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, finden wir sie meistens zusammen unten am Fluss beim Chillen. Und während Terra sich ihr nachmittägliches Nickerchen gönnte, saß Cura vergnügt daneben und spielte gedankenverloren im Matsch herum.
Unzählige Äonen später praktizierte der Psychologe Carl Jung etwas ganz Ähnliches. Das würde ihm beim Denken helfen, beteuerte er. Die Neurowissenschaften beglaubigen das heutzutage. Zwanglose spielerische Betätigung stimuliert das parasympathische Nervensystem, das den Körper zur Ruhe und Verdauung anregt. Und ja: Auch den kreativen Prozess kann es fördern. Alles in allem also eine feine Sache.
Damals schien Cura das alles instinktiv gewusst zu haben. Wahrscheinlich, weil es zu der Zeit weniger zu erinnern gab. Also waren auch weniger Dinge in Vergessenheit geraten. Seitdem haben wir so ziemlich alles vergessen. Es ist erstaunlich, wie viel zu vergessen möglich ist, wenn man sich so vieles zu merken versucht. Aber andererseits: Ohne dieses ganze Vergessen gäbe es auch kaum Bedarf, etwas zu lernen. Oder Bedarf an Büchern, wenn man sich’s überlegt. Was würden wir dann bloß alle machen? Stimmt's?
Egal. Das ist alles bloß Vorgeplänkel. Hier kommt die eigentliche Geschichte.
Eines Tages, während ihrer postprandialen kreativen Auszeit, stellt Cura fest, dass es ihr gelungen war, etwas Seltsames und Ungewöhnliches aus dem Matsch zu formen: eine kleine, leblose Figur, die ein bisschen wie sie selbst aussieht.
»Wow«, denkt sie sich. »Wär’ es nicht cool, wenn sie sich bewegen könnte und sprechen und Bücher schreiben und so?« Allein, da sie nicht über die Fähigkeit gebietet, dem Lehmklumpen Leben einzuhauchen, beschließt sie, Jupiter zu bitten, das für sie zu erledigen.
Nun muss man wissen: Der große Mann ist ein furchteinflößender Typ. Obwohl er eigentlich bloß ein Enkelkind ist. Sohn von Saturn. Enkel von Terra. Gott in dritter Generation. Oder vierter Generation, wenn wir Chaos mitzählen. Allerdings: Zufällig hat er im Himmel das Sagen. Und er herrscht über den Donner. Und das gibt ihm das Recht, ein ausgemachter Fiesling zu sein. So hat es jedenfalls den Anschein.
Er hat bereits seinen alten Herrn (Saturn) in Rente geschickt und ist zum höchsten Gott aufgestiegen. Der Oberboss. CEO der Götterwelt. Und dabei wird es auch bleiben, bis das Christentum daherkommt und ihn vom Thron stößt.
Aber irgendwie hatte Jupiter schon immer eine Schwäche für Cura. Als sie ihn also bittet, dem Figürchen Leben einzuhauchen, lächelt er milde.
»Aber ja, gewiss, meine Liebe«, sagt er. Und hält inne. »Vorausgesetzt …«
(Man hüte sich vor dem Patriarchat. Da lauert immer irgendwo ein »vorausgesetzt …«.)
»Vorausgesetzt was?« will Cura wissen.
»Nun, ich bin es, der ihm Leben einhaucht«, sagt Jupiter.
»Ihr. Das ist eine Sie«, korrigiert ihn Cura. »Kein Er.«
»Also bestimme ich den Namen.«
»Kommt nicht in die Tüte«, protestiert Cura.
»Na schön – kein Name, kein Einhauchen«, blafft Jupiter zurück und wendet sich zum Gehen.
»Nein, warte. Warte!« ruft ihm Cura hinterher. »Terra! Terra! Sag’ ihm, dass er warten soll! Lass ihn nicht gehen!«
»Was ist denn jetzt schon wieder?« stöhnt Terra noch halb verschlafen. Kommen die nie ohne mich klar? Wenigstens für einen Moment? Trotzdem ruft sie Jupiter zurück. Denn auch sie hat für Cura ein Herz. Und als Cura ihr erzählt, was vorgefallen ist, sagt Terra:
»Wer hat dir diesen Schlamm gegeben?«
»Ähm … du?«
»Ich?«
»Du hast gesagt, ich könnte damit spielen.«
»Dann sollte sie auch meinen Namen bekommen«, entscheidet Terra.
»Siehst du!« sagt Cura triumphierend zu Jupiter. »Ich habe dir doch gesagt, es ist eine Sie!«
»Gib’ mir das Ding«, knurrt Jupiter und greift sich die Kreatur. »Ich werde ihr ein bisschen Feuer einhauchen.« Und er pustet heftig in den Mund der tönernen Figur.
»Nicht Feuer«, ruft Cura. »Leben!«
»Erledigt.« Jupiter lacht. »Hallöchen, mein kleines Ich«, sagt er.
»Es dreht sich nicht immer bloß um dich!« sagt Cura und schnappt ihm das noch ganz benommene Figürchen aus der Hand.
»Mein Atem. Mein Name«, sagt Jupiter.
»Auf gar keinen Fall!«
Als Terra erkennt, dass sich die beiden niemals einig werden würden, schlägt sie vor, Saturn zu fragen, der, welch glücklicher Zufall, gerade des Weges kommt.
Nun ist Saturn einer von der coolen Sorte. Gott für praktisch alles, worauf es ankommt, zum Beispiel Ackerbau, und Zeit, und Partys feiern. Und nebenbei ist er auch jemand, der die Reife und Ausgeglichenheit besitzt, Leute und Situationen richtig einzuschätzen. Genau die Sorte Anführer, die dann zugunsten eines machiavellistischen Tyrannen übergangen wird. Aber nicht zum ersten Mal ist Saturn angesichts einer kniffligen Aufgabe die beste Wahl.
»Ihr Körper gehört Terra, denn du bist diejenige, die das Erdreich gegeben hat«, sagt er zu seiner Mutter. »Du bekommst sie zurück, wenn sie stirbt.«
»Ihr Geist gehört Jupiter, denn du bist derjenige, der ihr Leben eingehaucht hat«, sagt er zu seinem Sohn. »Du bekommst ihn zurück, wenn sie stirbt.«
»Und was ist mit mir?« jammert Cura, einigermaßen bestürzt ob des Fortgangs der Dinge.
»Du, meine Liebe, kümmerst dich nach Kräften um sie, solange ihr beide leben mögt.«
»Echt jetzt?!«
»Du sollst sie lieben und in Ehren halten.«
»Bis ans Ende der Zeit!«
»In guten wie in schlechten Tagen.«
»Ich bin ja so glücklich!«
»Bis dass der Tod euch grausam scheidet.«
»Ich danke dir, Saturn! Danke!« sagt Cura.
Und mit diesen Worten gehen sie alle wieder ihrer Wege und den eigenen Geschäften nach. Was im Einzelnen bedeutet: Terra legt sich kurz aufs Ohr, Jupiter entfacht irgendwo einen Sturm, und Saturn macht sich auf den Weg nach Hause, um nach seinen Weinreben zu schauen. Und in dem Moment fällt es Cura siedend heiß ein.
»Halt, wartet. Wartet!« ruft sie. »Wir haben ihr noch keinen Namen gegeben!«
Aber da sind alle schon weg. Beziehungsweise haben sich aufs Ohr gelegt. Außer Hörweite. Nächste Baustelle.
»Oh je« sagt Cura. »Na gut.«
Und wendet sich an die kleine Figur, die nun blinzelt und voller Verwunderung die Welt um sich herum bestaunt. Was mach’ ich hier? What was I made for?
»Wie ist dein Name, meine Kleine?« fragt Cura sie zärtlich.
»Barbie«, sagt das Figürchen. »Mein Name ist Barbie.«
Der Mythos der Cura, nach Gaius Julius Hyginus
(ziemlich lange nach Gaius Julius Hyginus)2
Kapitel 1
Der Weg zur Hölle
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Anonym1
Meine Aufgabe war nicht weiter schwierig. Dachte ich jedenfalls. Ich machte mich gerade an die Arbeit dieses Buchs, als die Welt anfing, sich von der Corona-Pandemie zu erholen. Voller Zuversicht, nicht allzu lange dafür zu brauchen. Ich hatte ein robustes Narrativ und eine solide Hintergrundgeschichte. Die Hauptfiguren waren mir bereits vertraut. Und ganz ehrlich: Das Konzept des Buchs ist ziemlich leicht zu vermitteln.
Es gibt zwei zentrale Thesen. Sie sind ziemlich offenkundig miteinander verbunden. Die erste besagt, dass menschlicher Wohlstand, bei Lichte besehen, in erster Linie mit Gesundheit zu tun hat, nicht mit Reichtum. Deswegen sollte sich, zweitens, die Wirtschaft zuallererst um Care in all ihren Formen kümmern, anstatt – wie bisher – auf unablässiges Wachstum zu setzen.*)
Das ist eigentlich schon alles.
Meine Reise zu diesen beiden Thesen begann vor langer Zeit. Vielleicht sogar schon in der Kindheit. In jüngerer Vergangenheit geht sie auf Überlegungen zur Natur menschlichen Wohlstands zurück. Und insbesondere auf die Frage, was Wohlstand überhaupt bedeuten kann, wenn wir auf einem einsamen Felsbrocken irgendwo im galaktischen Nirgendwo leben, der mit einer Geschwindigkeit von einer Million Meilen pro Stunde durchs Universum rauscht.2
Was bedeutet es für uns, auf einem kleinen, blauen (und endlichen) Planeten gut zu leben?
Täuschend einfach, die Frage. Es wird allerdings recht schnell klar, dass es sich in Wirklichkeit um eine ziemlich komplexe Frage handelt, zu deren Beantwortung es vermutlich eines gewissen Maßes an Psychologie bedarf. Vielleicht braucht es noch eine Portion Soziologie. Ein bisschen Geschichte kann auch nicht schaden. Und Wirtschaftswissenschaften, versteht sich. Wie der Buchtitel sachte andeutet, haben wir es hier zumindest teilweise mit einem Buch über Ökonomie zu tun.
Das heißt nicht, dass es mit statistischen Daten oder Gleichungen vollgepackt sein muss. Für mich ist es nicht das, was Ökonomie ausmacht. Natürlich muss man sich manchmal mit Daten die Hände schmutzig machen. Und ab und an ist eine kleine konzeptionelle Analyse definitiv angebracht. Aber zuerst und vor allem sehe ich die Wirtschaftswissenschaften als eine Art Linse, durch die wir begreifen, wie wir die Gesellschaft im Streben nach Gemeinwohl organisieren können. Ökonomie ist das Studium von Antworten auf meine »täuschend einfache« Frage.
Diese Frage verlangt auch ein wenig Aufmerksamkeit für die Philosophie. In alten Zeiten galt das als selbstverständlich. Die Wirtschaftswissenschaften waren ursprünglich Teil der Philosophie. Später entwickelten Ökonomen dann eine aufwendige Disziplin, die nur von wenigen verstanden wurde. Oft nicht einmal von Ökonomen selbst. Und meiner Meinung nach ist das ein Rezept für den Untergang. Nicht zu wissen, wie man die Gesellschaft organisiert – oder noch schlimmer: einen kleinen Zirkel von Leuten zu küren, die einem (in einer Sprache, die man nicht versteht) erklären, wie sie es angeblich am besten für einen erledigen –, das ist eine Katastrophe, die nur darauf wartet einzutreten. Etwas, das es zu vermeiden gilt. Um jeden Preis.
Ökonomie der Fürsorge ist also ein Buch über Wirtschaft für Menschen, die nicht unbedingt Wirtschaftswissenschaftler sind. Es richtet sich sowohl an diejenigen, die Wirtschaftswissenschaften nicht mögen, als auch an jene, die sie spannend finden. Es ist für Leute geschrieben, die das Fach Wirtschaft in der Schule gehasst haben, so wie ich, aber auch für solche, deren Lieblingsfach es war. Es ist ein Buch für alle, die das Gefühl haben, dass Wirtschaftswissenschaft mit ihnen (und ihrem Leben) nichts zu tun hat, und für diejenigen, die merken, dass das wohl doch der Fall ist, und es vielleicht eine gute Idee wäre, etwas mehr darüber zu erfahren.
Kurz gesagt: Sie brauchen keinen BWL- oder VWL-Abschluss, um dieses Buch zu lesen. Sie brauchen ja keine Qualifikation dafür, sich für die Ökonomie der Fürsorge zu interessieren. Fürsorgliches Interesse als solches genügt vollkommen. Natürlich hat das nicht jeder. Aber höchstwahrscheinlich haben die Leute, die sich nicht dafür interessieren, das Buch gar nicht erst in die Hand genommen. Und falls doch, können sie ihre Meinung ja immer noch ändern.
Man muss auch kein Experte in Sachen Pflege sein. Wenn wir das Konzept »Wohlstand als Gesundheit« ernst nehmen, dann besteht unsere Aufgabe, wie ich ausführen werde, nicht nur darin, in bestimmte Wirtschaftssektoren einzutauchen, denen wir, mehr oder weniger willkürlich, den Begriff »Care« als Etikett verpassen. Die Care-Ökonomie ist kein eigenständiger Sektor. Es ist nicht das irgendwie wünschenswerte Sahnehäubchen auf dem Wirtschaftskuchen. Mein Punkt hier ist ein anderer. Was ich sage, ist Folgendes: Da es bei Wohlstand in erster Linie um Gesundheit geht, sollte sich die Wirtschaft immer und überall um Fürsorge drehen. Wenn ich von der Care-Ökonomie spreche, dann meine ich damit Wirtschaft als Care. Das ist mein Plädoyer.
Der Zustand von Wohlbefinden
Es liegt auf der Hand, dass ich erst einmal ein paar Begriffe definieren muss. Zunächst muss klar werden, was genau ich mit Gesundheit meine, und was mit Care. Es ist aber relativ einfach, praktikable Definitionen für diese beiden Konzepte zu finden.
Glücklicherweise hat die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation – WHO) bereits gute Vorarbeit geleistet. Schon im Jahr 1948, bei ihrer Gründung, definierte sie Gesundheit als »ein[en] Zustand von vollständigem physischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet«. Vielleicht würden wir heutzutage auch das Wohlbefinden des Planeten in diese Definition miteinbeziehen. Es ist schwer vorstellbar, wie wir den Rest dieser Auflistung auf einem kranken Planeten hinbekommen sollen. Aber davon abgesehen ist es eine Definition, die sich eindeutig über die Zeit bewährt hat. Und als Ausgangspunkt reicht das.3
Was den Begriff »Care« angeht, wird es schon ein bisschen kniffliger. Ich neige seit jeher zu einer Formulierung, die auf die amerikanischen Autorinnen Berenice Fisher und Joan Tronto zurückgeht. Sie definieren Care als »eine Tätigkeit, die alles umfasst, was wir tun, um unsere ›Welt‹ zu bewahren, fortzuführen und zu reparieren, damit wir in ihr so gut wie möglich leben können«. Das scheint mir breit genug gefasst zu sein, um alle – oder doch die meisten – Dinge einzuschließen, die wir meinen, wenn wir von Fürsorge sprechen.4
Betreuung der Kinder. Pflege der Alten. Versorgung von Kranken und Schwachen. Verantwortung für unsere Familie. Engagement für unsere Gemeinschaft. Sorgen für unser Zuhause. Achtsamkeit für die materiellen Grundlagen des Lebens selbst. Und natürlich gehört dazu auch der pflegliche Umgang mit dem Planeten, der uns am Leben hält. Der Schutz des Klimas. Der schonende Umgang mit Grund und Boden. Behutsamkeit mit den Weltmeeren. Care für unsere »Welt«.
Wenn wir ins Detail gehen, müssen diese Ausgangsdefinitionen möglicherweise noch etwas angepasst werden. Vor allem, wenn wir der spezifischen Dynamik von Gesundheit oder den einzelnen Aspekten von Fürsorge gerecht werden wollen. Dimensionen, die ich noch weiter ausarbeiten muss, um Sie auf die Reise mitzunehmen. Aber für den Moment funktionieren sie und sind gut genug, Ihnen eine Vorstellung von dem zu vermitteln, worauf ich hinauswill.
In gewisser Weise ist mein Standpunkt ziemlich klar – fast schon tautologisch. Wenn es bei Care darum geht, Wohlbefinden zu wahren und zu fördern, sollte die Wirtschaft selbstverständlich genau darauf ausgelegt sein. Was denn sonst? Auf der anderen Seite ist es nicht zu übersehen, dass die wirtschaftliche Praxis weit entfernt ist von diesen Ansprüchen. Jedenfalls die meiste Zeit. Es gibt also definitiv Spielraum, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Abgesehen davon ist mein Anliegen jedoch ganz einfach. Oder sagen wir: unverfänglich. Nichts ist jemals ganz einfach. Es schien alles sehr überschaubar. Das Buch war bereits in Sichtweite. Ich vereinbarte einen Abgabetermin mit dem Verlag. Ich handelte eine kurze Auszeit von meinem Job aus. Und Ende 2021 beschlossen meine Partnerin Linda und ich, ein kleines Cottage im ländlichen Wales zu mieten, wo ich in Sachen Lektüre einiges nachholen und mit dem eigentlichen Schreiben beginnen konnte.
Drei Dinge passierten mehr oder weniger gleichzeitig.
Das unsichtbare Herz
Die erste und vielleicht vorhersehbarste Sache – offensichtlich, wenn ich nur einen oder zwei Augenblicke darüber nachgedacht hätte – war, dass ich ohne gültigen Ausweis in einem fremden Land festsaß. Ich meine nicht Wales. Das ist noch immer Teil der britischen Inseln. Nein, mein Gestrandetsein war metaphorischer Natur.
The Care Economy**) war ein guter Titel. Kurz, schlicht, auf den Punkt gebracht. Er erschien mir ein angemessen inklusives Label zu sein, unter dem ich mein Projekt vorantreiben konnte. Aber meine Lektüre bestätigte sofort etwas ganz und gar Offensichtliches. Es war nicht mein Label. Es war nicht mein Land. Das Terrain hatten Pioniere vor mir bereits ausgiebig beackert. Und diese Pioniere waren fast ausschließlich Pionierinnen.
Es waren Frauen, die die Bedeutung und das Wesen von Care in den Mittelpunkt gerückt haben. Frauen, die auf die miese Behandlung der Menschen hingewiesen haben, die Care-Arbeit leisten. Frauen, die eine ganze Disziplin der feministischen Ökonomie entwickelt haben, die auf der zentralen Rolle der Fürsorge im menschlichen Leben aufbaut.
Und das kommt kein bisschen überraschend. Bis zum heutigen Tag wird der Großteil der Care-Arbeit, die wir als solche bezeichnen, von Frauen erbracht. Es war also unvermeidlich, dass es Frauen waren, die sich darauf spezialisierten, Care zu verstehen, die damit verbundenen Herausforderungen zu erforschen und die grundlegend geschlechtsspezifische Natur von Fürsorge aufzudecken.
Ich plädiere keineswegs dafür, diese Art der Arbeitsteilung einfach als gegeben hinzunehmen. Das sollten wir auf keinen Fall. Allerdings ist unter Ökonomen, wie ich behaupten würde, die geschlechtsspezifische Befangenheit sogar noch ausgeprägter. Männliche Wirtschaftswissenschaftler beschäftigen sich ununterbrochen mit ökonomischer Effizienz. Mit Produktivität. Mit Technologie. Mit Investitionen. Und ganz besonders mit Wirtschaftswachstum. Endlose Regalmeter Bücher wurden über Wirtschaftswachstum geschrieben.
Diese männlichen Ökonomen haben auch jede Menge Zeit damit verbracht, Lobgesänge auf Adam Smiths »unsichtbare Hand« zu halten. Das ist jene mythische Kraft, die ja angeblich dank der Magie marktwirtschaftlicher Mechanismen kleinlich-egoistische Interessen in Gemeinwohl verwandelt. Was sie jedoch kläglich unerforscht gelassen haben, ist, was die US-amerikanische feministische Ökonomin Nancy Folbre das »unsichtbare Herz« der Gesellschaft genannt hat. Noch heute sorgt die größtenteils unterbezahlte – und unbezahlte – Arbeit von Frauen dafür, dass dieses Herz nicht aufhört zu schlagen. Es wäre wirklich nutzlos, über die Care-Ökonomie zu schreiben, ohne diese grundlegende Wahrheit anzuerkennen.5
Das war mir schon immer klar – auf intellektueller Ebene zumindest. Aber ich hatte nicht wirklich verstanden, was das bedeuten könnte, bis ich mich auf die Landschaft eingelassen habe. Was es für das Projekt bedeutete. Oder auch für mich persönlich, als Verfechter von etwas, das ich »Ökonomie der Fürsorge« nennen möchte. Oder überhaupt – würde ich sagen – für mich als Mann.
Ich hatte noch gar nicht mit dem Schreiben begonnen, da konnte ich schon die Rezensionen vor mir sehen. Ich hätte sie glatt selbst schreiben können. »Wirtschaftswissenschaftler (weiß, männlich) übt sich im Mansplaining von Care.« Na super. Genau, was der Arzt verordnet hat. Aber die Schuld daran hatte ich mir selbst zuzuschreiben. In meinen schweren, männlichen Ökonomen-Stiefeln war ich ins Land des unsichtbaren Herzens aufgebrochen – mit allerbesten Absichten, ganz bestimmt. Aber ohne einen Blick auf mein Schuhwerk zu werfen.
Andererseits wurde mir klar, dass ich von klein auf in diese Trennung hineingewachsen war. Bis zu einem gewissen Grad sind wir alle davon betroffen. Daran führt kein Weg vorbei. Bestimmt spielt es für die Perspektive, die ich einnehme, eine Rolle. Aber das entzieht der Sache als solcher ja nicht den Boden. Erkennen wir es einfach von vornherein an. »Wohlstand als Gesundheit« bleibt trotzdem ein kraftvolles Konzept. Und »Wirtschaft als Fürsorge« ist die offensichtliche Schlussfolgerung daraus. Wenn sich die Care-Ökonomie »gegendert« anfühlt, liegt es wahrscheinlich daran, dass sie es ist. Warum sollte es für mich ein Hindernis darstellen, ein Mann zu sein?
Und wenn doch, dann ist es eben so. Ich bin schon früher auf die Nase gefallen. Ist gar nicht so lange her. Ziemlich wortwörtlich sogar.
Nutze die Schwierigkeit
Kurz vor der besagten Reise nach Wales nahmen wir einen kleinen schwarz-weißen Kater in Pflege. Nur für ein paar Wochen, solange seine Besitzerin verreist war. Anfangs versteckte er sich hinterm Sofa. Fest und eisern. Ganz allmählich traute er sich dann doch immer mal aus seinem Versteck hervor. In der Regel unangekündigt. Und manchmal auch mit halsbrecherischer Geschwindigkeit.
Bei einer dieser Gelegenheiten sah ich aus dem Augenwinkel kurz etwas Weißes aufblitzen, und dann kam mir auch schon der Fußboden entgegen. Ich versuchte instinktiv, nicht auf das Kätzchen zu treten, fiel etwas ungeschickt und knallte mit dem Fuß gegen den Türrahmen. Der Katze ging es bestens. Sie war längst über alle Berge. Auch der Türrahmen hatte keinen Schaden genommen. Das konnte man von meinem Fuß leider nicht sagen.
Ein gebrochener Zeh ist kein Weltuntergang. Schon klar. Es ist noch nicht mal der Anfang vom Ende der Welt. Brüche verheilen meist innerhalb von sechs bis acht Wochen. Allerdings können Verletzungen des Gewebes auch mal länger anhalten. So wie hier. Und wenn es nicht verheilt, kann es manchmal auch ein Zeichen dafür sein, dass etwas anderes nicht stimmt. So wie hier. Im Laufe des nächsten Jahres wurde der Schmerz in meinem Zeh zu einem Schmerz im Fuß und dann zu einem noch stärkeren Schmerz in der Hüfte. Irgendwann hatte ich Schmerzen auf meiner ganzen rechten Körperhälfte. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für gutes Schreiben.
Der Schauspieler Michael Caine hat eine Geschichte auf Lager, die genau zu dieser Art von Situation passt. Als junger Mann probte er eine Szene, bei der er durch eine Tür auf die Bühne kommt, um mitten in den Streit eines Ehepaars zu platzen. Einmal hatte es der Schauspieler, der den Ehemann spielte, irgendwie geschafft, einen Stuhl umzuschmeißen, der nun genau den Eingang versperrte, durch den Caine kommen sollte. Der Jungmime steckte seinen Kopf durch die Tür und fragte den Regisseur, was er nun machen solle.
»Mach was draus«, kam die Antwort.
»Was meinen Sie damit?« fragte Caine.
»Nutze die Schwierigkeit«, sagte der Regisseur. »Wenn es eine Komödie ist, stolpere drüber. Wenn es ein Drama ist, schnapp dir den Stuhl und hau ihn kurz und klein.« Und ich nehme mal an, wenn es ein Buch über die Care-Ökonomie ist, schau’ dir die Sache ganz genau an und überlege scharf, was das alles inmitten deiner Schreibpläne zu suchen hat. Dieser spezielle Stuhl – in meinem Fall also die Katze – sollte mich an einige unbequeme Wahrheiten über meine eigene Gesundheit erinnern. Und an einige harte Fakten über die Care-Ökonomie. Dazu gehörte zweifellos auch eine beunruhigende Lektion über die Beziehung zwischen Care und Zeit.
Care bringt Zeit durcheinander. Sie wirft unsere Pläne über den Haufen. Herausforderungen tauchen ohne Vorwarnung auf. Aufgaben verändern sich und entwickeln sich weiter. Zeit als solche ergibt keinen Sinn mehr. Care gehört »in die Welt der Kairos-Zeit«, wie die Sozialreformerin Hilary Cottam zu bedenken gibt. Sie fällt unter eine Form der Zeit, die durch Fluss und Verbindung gemessen wird. Anders als die »Chronos-Zeit«, die wir in Minuten und Fristen messen. In der Logik von Care, schreibt die Philosophin Annemarie Mol, »windet und wandelt sich die Zeit«. In diesem Sinne ähnelt es dem Schreiben sehr. Ein Ort, an dem die Uhren langsamer gehen. Oder schneller. Oder rückwärts. Und manchmal gehen sie gar nicht mehr.6
Ich fand diese Einsicht schon immer faszinierend. Aber vielleicht hätte ich mich gar nicht weiter damit beschäftigt, wenn der Stuhl nicht gewesen wäre. Die Katze. Der Zeh. Was ich sagen will, ist, dass das Buch definitiv eine andere Form angenommen hat, als es ursprünglich konzipiert war. Fast ein bisschen wie mein Zeh. Der sieht jetzt auch anders aus und hat bis heute einen ausgeprägten Knick.
Luxusprobleme, höre ich Sie schon grummeln. Und vielleicht haben Sie recht. Es gibt Schlimmeres. Viel, viel Schlimmeres, wie sich herausstellt. Kaum zwei Monate nach meinem kleinen Unfall veränderte sich schon wieder alles. Für uns alle. Und für den gesamten Kontext dieses Buchs.
Gute Absichten
Im Winter 2021, als wir in Richtung Wales aufbrachen, lebte die Welt noch immer im Schatten der Pandemie. Omikron und Delta waren weniger tödlich als frühere Varianten. Aber sie erinnerten uns trotzdem an die Fragilität menschlicher Gesundheit. An die zentrale Bedeutung von Care für unser Leben. Und an den gesellschaftlichen Wert all derer, die Care-Arbeit leisten. Wir würden uns nach der Pandemie verändern, weil wir endlich verstanden haben, worauf es wirklich ankommt. Wir haben unsere Lehren gezogen, und sie würden ganz bestimmt ihren Weg in die Regierungspolitik finden.
Die US-Regierung hatte ihre Absichten schon früh signalisiert. Die Biden-Administration stellte ihr ambitioniertes Gesetzesvorhaben »Build Back Better« erstmals im April 2021 vor. Die gewaltige Summe von 3,5 Billionen Dollar sollte in den Aufschwung nach der Pandemie fließen. Das Geld würde dazu dienen, die öffentliche Infrastruktur zu verbessern, den Klimawandel zu bekämpfen und die Reichweite lebenswichtiger Care-Leistungen auf immer mehr Menschen auszudehnen. Finanziert werden sollte das Ganze zum Teil durch höhere Steuern für Großunternehmen und Reiche. Die Vision bestand darin, eine bessere Gesellschaft für alle zu schaffen, wenn sich der Sturm des Coronavirus endlich gelegt hatte.7
Der Gesetzesentwurf wurde im November 2021 vom Repräsentantenhaus verabschiedet. Im Senat wurde es jedoch gleich wieder aus der Bahn geworfen, als ein einzelner Demokrat berühmterweise seine Unterstützung verweigerte. Senator Joe Manchin hielt es für zu teuer. Das Land könne es sich nicht leisten, dafür zu bezahlen, meinte er. Es brachte nichts, darauf hinzuweisen, dass man es sich nicht leisten könne, nicht dafür zu bezahlen. Versuche, einen Kompromiss auszuhandeln, scheiterten. Und in den ersten Monaten des Jahres 2022 waren die Verhandlungen mehr oder weniger in eine Sackgasse geraten. Genau zu dieser Zeit nahm das Weltgeschehen eine neue und viel düsterere Färbung an. Raus aus dem Regen von Covid und rein in die Traufe des militärisch-industriellen Komplexes.8
Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein und eskalierte damit einen Konflikt, der seit fast einem Jahrzehnt am Rande Europas – und am Rande der politischen Aufmerksamkeit – vor sich hingeköchelt hatte. Als wir an jenem Dienstagmorgen die Nachrichten hörten, waren die russischen Truppen bereits in Sichtweite der ukrainischen Hauptstadt. Kommentatoren erwarteten eine baldige Kapitulation der Regierung von Wolodymyr Selenskyi. Noch vor Sonnenuntergang würden Panzer durch das Zentrum Kiews rollen, hieß es.
Sechs Millionen Flüchtlinge und über eine halbe Million Todesopfer später wirken diese frühen Vorhersagen naiv, lächerlich geradezu, wenn es nicht alles so tragisch wäre. Niemand hatte mit dem erbitterten Widerstand einer belagerten Nation gerechnet. Die Entschlossenheit der NATO, ein Land zu bewaffnen, das im Kampf gegen einen gemeinsamen Feind als Verbündeter galt, hatte so auch niemand vorhergesehen. Hier ging es nicht allein um die Ukraine, wurde uns gesagt. Es ginge um die Demokratie. Um Freiheit. Es sei eine Schlacht um die Seele Europas. Ein Kampf um den Geist der westlichen Welt. Die NATO-Verbündeten würden alles Notwendige tun, um die freie Welt vor der Autokratie zu bewahren. Auch wenn das bedeutete, »Build Back Better« auf die lange Bank zu schieben.9
Was man dafür jetzt brauchte, war natürlich Geld. In den ersten beiden Kriegsjahren stellte der Westen der Ukraine über 400 Milliarden Dollar an militärischer und finanzieller Hilfe zur Verfügung – mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt des belagerten Landes. Man tröstete sich damit (oder redete sich ein), dass es die Sache wert sei, Russland habe ja ebenso viel, wenn nicht mehr, durch Militärausgaben und den Verlust von Finanzkapital eingebüßt. An die 1 Billion Dollar insgesamt. All das wegen fehlender Diplomatie. Und doch wirken diese Beträge noch winzig, verglichen mit den Folgewirkungen für die Weltwirtschaft.10
Die Sanktionen gegen Russland trieben Öl- und Gaspreise auf Rekordhöhen. Lebenshaltungskosten gingen durch die Decke. Die Budgets der Durchschnittshaushalte gerieten ins Kreuzfeuer. Regierungen standen jetzt im Scheinwerferlicht. Ihr Drehbuch stammte aus einer anderen ökonomischen Ära. Einer Zeit, in der billiges Geld große Probleme tatsächlich zu lösen vermochte. Der Trick hatte sich während der Pandemie noch als praktisch erwiesen. Nun sah die Lage anders aus: Hohe Verschuldung, geringes Wachstum, steigende Inflation und hohe Zinsen ließen allmählich Panik aufkommen. »Stagflation« war das Letzte, was man gebrauchen konnte. Doch plötzlich starrten wir in genau diesen Gewehrlauf. Eine neue Realität war angebrochen.11
Die guten Vorsätze für die Zeit nach der Pandemie verblassten rasch. Build Back Better wurde auf ein wesentlich schlankeres, effizienteres, strenger fokussiertes fiskalisches Instrument reduziert. Der Inflation Reduction Act, der nur noch ein Drittel des ursprünglichen Gesetzesentwurfs wert war, wurde schließlich im August 2022 in Kraft gesetzt. Der neue Schwerpunkt galt nun der Bekämpfung von Inflation, Investitionen in die heimische Energieerzeugung und dem Abbau des Staatsdefizits. Das waren nun einmal die neuen Prioritäten des Tages. Die Sorge um und für die Menschen und den Planeten musste warten. Wir waren, wie es Chris Rea in seinem Rock-Klassiker Road to Hell aus dem Jahr 1989 beschreibt, auf den Weg zur Hölle geraten.
Der Weg zur Hölle
Die Dinge ändern sich. Natürlich tun sie das. Aber hier ging es nicht nur um Veränderung. Es ging ganz sicherlich nicht nur um neue und härtere wirtschaftliche Bedingungen. Es war noch etwas anderes im Gange. Angesichts der Brutalität und Unsicherheit, die der Krieg entfesselte, drohte der bloße Gedanke an einen fürsorglichen Umgang miteinander oberflächlich, geradezu lächerlich zu wirken. Bestenfalls ein überflüssiger Luxus. Schlimmstenfalls eine tödliche Ablenkung.
Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als bewaffnete Kämpfer der Hamas am 7. Oktober 2023 in israelisches Staatsgebiet eindrangen. Über 1000 Menschen wurden getötet, etwa 250 verschleppt. Das Blutbad jenes Tages wurde jedoch schnell durch das Ausmaß und die Grausamkeit der Vergeltungsmaßnahmen in den Schatten gestellt. Das israelische Militär überzog Gaza mit unerbittlichen Bombardements. Der Großteil des Gazastreifens wurde in Schutt und Asche gelegt. Mehr als eine Million Menschen wurden vertrieben. Zehntausende Zivilisten kamen zu Tode. Fast die Hälfte der anfänglichen Opfer waren Kinder. UN-Beobachtern zufolge starb zeitweise alle zehn Minuten ein Kind im Gazastreifen.12
Es hätte ein Moment für globale Führerschaft sein sollen. Politiker aus dem Westen hätten sich für einen Waffenstillstand starkmachen können. Für Friedensverhandlungen. Sie hätten einen Schritt zurücktreten können vom Abgrund der Instabilität. Stattdessen billigten und förderten sie Militärhilfe für Israel, genau wie sie es in der Ukraine getan hatten. Und anstatt der Diplomatie den Vorrang zu geben, begannen sie, die Kriegsrhetorik zu verschärfen. Verteidigungsbudgets waren seit dem Ende des Kalten Krieges zurückgegangen. Doch nun sahen die Falken ihre Stunde gekommen. Die Tragödie vor Ort wurde beiseitegeschoben. Stattdessen ertönte der schrille Ruf nach mehr Militärausgaben.
Und schon bald kamen Forderungen nach der Wiedereinführung einer Art Wehrpflicht hinzu. Verpflichtender Militärdienst für junge Männer und Frauen. Wir leben in einer zunehmend instabilen Welt, lautete der fast schon gleichgeschaltete Refrain. Aus der Europäischen Union. Aus den USA. Aus dem Vereinigten Königreich. Von der NATO. Dass unsere eigenen Politiker maßgeblich zur Instabilität beigetragen hatten, schien ihnen entgangen zu sein. Es fühlte sich an, als würden wir auf eine Welt vorbereitet, aufgestachelt und emotional erpresst, in der Krieg und Gewalt unvermeidlich seien.
Das alles war so offensichtlich das genaue Gegenteil von Care. Gewalt fegt jede Vernunft weg. Rache erzeugt Rache. Wut entfacht neue Wut. Innerhalb eines Jahres wurde die Welt unbarmherzig aus ihrem langen Covid-Schlummer gerissen. Lockdown war gestern. Solidarität war nur noch eine Wahnvorstellung. Rosarote Träume von einer besseren Welt mussten warten. Zeit, der Realität ins Auge zu blicken. Und diese Realität hatte ein eindeutig von Gewalt geprägtes Antlitz.
Ich hatte das Gefühl, dass wir in einer Welt lebten, in der die Unantastbarkeit der Gesundheit und das Ethos des fürsorglichen Miteinanders nur noch ein verschwommener Schatten aus einem anderen Leben waren. Die letzten Überreste eines Traums aus früherer Zeit schwanden dahin wie der Morgennebel im grellen Licht des Tages. Und mein Projekt, Fürsorge als Organisationsprinzip der postpandemischen Wirtschaft zu positionieren, lag, jedenfalls vorübergehend, in Trümmern.
Der ewige Gegenspieler
Und dann fiel mir eine BBC-Radiosendung ein, die ich im Februar 2022 gehört hatte. Es war der Nachmittag am Tag der Invasion in die Ukraine. Eine Expertenrunde diskutierte, wie der Westen nun mit Putin umgehen sollte, nachdem das »Unvermeidliche« eingetreten war. Vieles an dieser Diskussion war vorhersehbar. Bewaffnet die Ukraine. Begegnet Gewalt mit Gewalt. Schwächt Russland. Entzieht Putin seine Macht. Tut, was auch immer notwendig ist. Kaum ein Wort des Eingeständnisses eines offensichtlichen Versagens des Westens bei der Ausübung von Diplomatie, seit über dreißig Jahren. Oder von den gebrochenen Versprechen der NATO, sich nicht nach Osten auszudehnen.13
Doch ein Beitrag von Mary Kaldor, Direktorin des Konfliktforschungsprogramms an der London School of Economics, überraschte mich. Sie bezeichnete das, was sich gerade abspielte, als eine Manifestation »toxischer Männlichkeit«. Nicht bloß als isolierten Akt der Aggression eines autokratischen russischen Präsidenten. Sondern als ein Phänomen, das schon lange in der Gesellschaft grassiert und von unseren führenden Politikern – auch im Westen – seit Jahrzehnten, wenn nicht schon länger, vorgelebt wird. Ein Phänomen, das durch den männlichen Hang zur Gewalt aufrechterhalten wird, dessen ultimativer Ausdruck immer der Krieg ist.14
Ich hörte mir die Sendung noch mal an. Dabei fiel mir auf, wie schnell Kaldor von den anderen (männlichen) Podiumsteilnehmern abgewürgt wurde. Sie hassten es. Sie konnten die Vorstellung nicht ertragen, dass hier etwas Systemisches im Gange war. Eine Art gegenseitige Abhängigkeit zwischen Putin und dem Westen. Etwas inhärent Maskulines. An diesem Tag sollte es einzig und allein darum gehen, den Feind aufs Schärfste zu verurteilen. Und nicht etwa unsere eigene Verantwortbarkeit zu kontemplieren. Auch ich hasste es. Der Gedanke, dass das Geschlecht, dem ich nun einmal selbst angehöre, in Toxizität verstrickt ist, widerstrebte mir. Aber je mehr ich über ihre Worte nachdachte, desto schwerer fiel es mir, sie zu ignorieren.
Es erinnerte mich an etwas, das ich in Kathleen Lynchs Care and Capitalism gelesen hatte – eine von vielen exzellenten und kämpferischen feministischen Kritiken an der Marginalisierung von Care in der modernen Gesellschaft. Eine Aussage darin sprach mich ganz besonders an. Wenn wir dem Care-Prinzip in der Gesellschaft einen neuen Stellenwert verschaffen wollen, argumentierte sie, müssen wir ihren großen Gegenspieler verstehen: Krieg und Gewalt. »Gewalt zu ignorieren, wenn wir über Liebe und Fürsorge, Rücksichtnahme und Solidarität sprechen«, sagte sie, »heißt, das zu ignorieren, was in deren Schatten lauert.«15
Und wenn wir Gewalt verstehen wollen, kommen wir nicht um die Erkenntnis herum, dass sie in erster Linie von Männern verübt wird. Und zwar in den meisten Fällen an Frauen. Berichte über systematische sexuelle Gewalt kennen wir aus fast allen Kriegen der Geschichte, auch aus den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten. Die beiläufigen Opfer von Frauen und Mädchen in den Krankenhäusern des Gazastreifens erreichten in den ersten Monaten des israelischen Militärschlags entsetzliche Ausmaße.16
Ich fühlte zunehmend, dass die Verdrängung des fürsorglichen Miteinanders durch rohe Gewalt nach der Pandemie kein Zufall war. Das war nicht bloß eine Frage schlechten Timings oder eine unglückliche historische Situation. Es war Teil eines Musters, das sich wiederholte. Immer und immer wieder. Es war wie das Schwingen eines Pendels. Eine Spannung, die die Zivilisation seit jeher verfolgt. Ein Konflikt mit tiefen sozialen und kulturellen Wurzeln. Der sich immer wieder durch die Geschichte zieht, durch alle Gesellschaften. Vielleicht ist er sogar in der menschlichen Psyche selbst angelegt.
Es gibt offensichtlich einen geschlechtsspezifischen Aspekt dieses Konflikts. Aber es gibt auch etwas, das über die Einfachheit der Geschlechterspezifik hinausgeht. Etwas, das uns zwingt, uns mit grundlegenden Aspekten der menschlichen Natur und des sozialen Verhaltens auseinanderzusetzen. Etwas, das ein Schlaglicht auf die Werte richtet, an denen uns angeblich so viel liegt. Etwas, das die Hoffnungen und Visionen, an die wir uns klammern, infrage stellt. Und allmählich begann sich mein Verständnis von der Care-Ökonomie zu wandeln. Und meine Aufgabe, über sie zu schreiben.
Als ich langsam anfing, mich auf dem Weg zur Hölle zurechtzufinden, wurde mir immer mehr klar, dass die Notwendigkeit, Wohlstand als Gesundheit zu formulieren, weiterhin besteht. Es gibt immer noch allen Grund, Wirtschaft als Fürsorge zu begreifen. Aber meine Aufgabe besteht nicht so sehr darin, auf das Offensichtliche hinzuweisen, sondern vielmehr darin, zu hinterfragen, warum das Offensichtliche ausbleibt. Immer und immer wieder.
Das Buch als Reise
Fast ohne dass ich es bemerkte, hatte sich Ökonomie der Fürsorge in etwas anderes verwandelt. Wenn ich das Buch, das Sie gerade in Händen halten, mit meinen ursprünglichen Absichten vergleiche, erfasst mich ein Gefühl des Staunens über den kreativen Prozess. »Eure Kinder sind nicht eure Kinder«, schrieb einst der Dichter Kahlil Gibran. »Sie kommen durch euch, aber nicht von euch.« Ich vermute, über Bücher könnte man das Gleiche sagen. Über dieses Buch auf jeden Fall.17
Es fängt ungefähr an der Stelle an, die ich mir ausgemalt hatte. Ich untersuche unsere Vorstellungen – und Fehlvorstellungen – davon, was Gesundheit ist (Kapitel 2). Und was sie nicht ist. Ich erkunde die Unterschiede zwischen Gesundheit, dem Streben nach Vergnügen und der Vermeidung von Schmerz. Diese Unterscheidungen sind essenziell, um zu vermitteln, was ich meine, wenn ich von »Wohlstand als Gesundheit« spreche.
Und dann beginne ich damit, zwei entscheidende Themen herauszuarbeiten. Eines betrifft die Gesundheit als Anpassungsprozess (Kapitel 3). Das andere beschreibt Fürsorge als restaurative Kraft (Kapitel 4). Es sind wichtige Ausführungen zu den Definitionen von Gesundheit und Care, mit denen wir in diesem Kapitel begonnen haben. Beide sind für das Verständnis der Care-Ökonomie von ausschlaggebender Bedeutung.
Zu diesem Zeitpunkt stattete ich gerade dem walisischen Städtchen Tredegar, dem Geburtsort des britischen National Health Service, einen Besuch ab (Kapitel 5). Das war ursprünglich nicht vorgesehen – und veranschaulicht perfekt, was ich über das Schreiben sagte. Dennoch war dieser Besuch von enormer Wirkung. Er verschaffte mir einen echten Einblick darüber, was passiert, wenn das Care-Prinzip auf das grelle Licht der Wirtschaft trifft.
In den folgenden Kapiteln vertiefe ich diesen Aspekt weiter. Indem ich die Beziehung zwischen Fürsorge und meinen früheren Arbeiten über die Post-Wachstumsökonomie (Kapitel 6) beleuchte. Indem ich den Druck untersuche, der durch die veränderte globale Krankheitslast auf die Gesundheitssysteme ausgeübt wird (Kapitel 7). Und indem ich denjenigen Kräften auf den Grund gehe, die diese Veränderungen herbeigeführt haben (Kapitel 8).
So weit, so gut. Vielleicht war das Buch ein bisschen vom Kurs abgekommen. Aber nicht allzu weit. Und dann beschloss es, ein Eigenleben zu entwickeln und seine eigene Richtung einzuschlagen. Dafür gab es mehrere Gründe. Der erste war, dass ich mich selbst darin nicht mehr nur als Beobachter, sondern auch als Subjekt wiederzufinden begann. Das liegt nicht allein am Geschlecht. Nicht allein an der Historie. Es geht vielmehr auch auf die Folgen des an sich harmlosen Stolperers zurück, der mich gleich zu Beginn ins Straucheln brachte. Der zweite Grund war, dass ich anfing, mich heillos zu verzetteln. Die Gefahr besteht immer, wenn man sich in ein Schreibprojekt vertieft. Und man kann sich auch wieder entzetteln. Wenn es das Wort gibt. Aber manchmal bekommt man den Duft eines Geheimnisses einfach nicht aus der Nase. Vor allem, wenn das Ganze, wie in meinem Fall, zu etwas zutiefst Persönlichem geworden ist.
Alsdann, es hilft alles nichts. Du tauchst hinab. Du zerrst an den Schleiern der Geschichte. Du versuchst, die Fäden der Vergangenheit zu entwirren. Auf der Suche nach Antworten, was – in diesem Fall – der Medizin selbst widerfahren ist, dass wir uns so verrannt haben, mit einem überlasteten Gesundheitssystem und unbezahlbaren Gesundheitskosten. Zumal die Erkenntnisse, die uns vor diesem Schicksal hätten bewahren können, längst bekannt waren – nicht erst seit Jahrzehnten, sondern schon seit Jahrhunderten.
Vielleicht halten Sie das alles für rein akademische Überlegungen. Oder Sie fragen sich, welchen Sinn es haben soll, sich mit Argumenten zu beschäftigen, die im Nebel der Vergangenheit längst verloren gegangen sind. Aber eines der Dinge, die ich in diesem Abschnitt des Buchs (Kapitel 9 und 10) gelernt habe, ist, dass diese Erkenntnisse nicht einfach verloren gegangen sind. Es ist nur so, dass man ihnen keine Beachtung schenkt – nach wie vor nicht. Schlimmer noch: Sie wurden mit voller Absicht aus dem Kanon des Wissens gestrichen. Sie werden weiterhin als Quacksalberei verteufelt oder zugunsten von Prinzipien und Praktiken in den Hintergrund gedrängt, die ihre Autorität in erster Linie kommerziellen Interessen verdanken. Und die wenig bis gar nichts mit Gesundheit zu tun haben.
Aber Geschichte ist natürlich nicht das Einzige, was wir brauchen, um unsere missliche Lage zu begreifen. Und an diesem Punkt des Buchs unternahm ich einen erneuten Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen. Mir war klar: Ich musste den ökonomischen Strukturen auf den Grund gehen, die dem Konzept der Fürsorge konsequent im Wege stehen (Kapitel 11). Und ich war fest entschlossen, auf die hier bereits angedeutete Frage von Geschlecht und Gewalt (Kapitel 12 und 13) zurückzukommen und ihr gerecht zu werden.
Inzwischen hatte ich zunehmend das Gefühl, die ganze Sache könnte von einer Art Gesamtsynthese profitieren. Etwas, das man als eigenständiges Stück lesen könnte, wenn einem der Sinn danach steht. Etwas, das die einzelnen Stränge meiner Argumentation zusammenführt (Kapitel 14). Und als das erledigt war, merkte ich auch, dass ich nicht darum herumkommen würde, eine Art von Antwort auf die drängende Frage anzubieten: Was um alles in der Welt können wir tun? Kapitel 15 widmet sich dieser herausfordernden Aufgabe.
Ich weiß nicht mehr, wann es mir zum ersten Mal einfiel, das Ganze an den Orten zu verankern, die ich unterwegs streifte. Schließlich verbinde ich mit dem Buch ein ganz generelles Anliegen. Es begibt sich auf eine Reise über mehrere Jahrtausende und quer durch die Kontinente. Die Argumentation fußt eindeutig auf einer westlichen Perspektive, stützt sich aber auf Erkenntnisse aus Kulturen in Ost und West. Sie sind für die Volkswirtschaften des Südens genauso relevant wie für die des Nordens.
Aber rein aus dem Abstrakten heraus lässt sich nicht überzeugend schreiben. Vor allem, wenn sich das intellektuelle Terrain um einen herum ständig verschiebt und wie ein Karussell zu drehen scheint. Also begann ich, die physische Geografie meiner eigenen Reise in den Schreibprozess einfließen zu lassen. Auf einer Ebene kann man dieses Buch fast wie einen Reisebericht lesen. Ort, Politik, die eigene Gesundheit, Literatur, Geschichte und die Soziologie der Ideen. All diese Dinge begannen, sich in den erzählerischen Bogen des Buchs einzuweben.