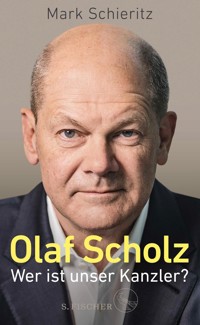
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler. Aber wer ist dieser Mann eigentlich? Wofür steht Olaf Scholz? Und was haben wir von ihm als Kanzler zu erwarten? Nach 16 Jahren endet die Ära Merkel. Mit dem neuen Kanzler steht nun erstmals wieder ein Sozialdemokrat an der Spitze des Landes. Für viele kam sein Wahlsieg überraschend, ist Olaf Scholz doch der große Unbekannte in der deutschen Politik. Mark Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der »ZEIT« und intimer Kenner der hiesigen Politlandschaft, erklärt den Menschen, Politiker und Kanzler Scholz, mit dessen Regentschaft auch eine neue Zeit anbricht. Die Pandemie wie die Klimakrise sind Beispiele für die immensen globalen Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen. Wie werden Scholz und seine Ampelkoalition mit ihnen umgehen? Mit analytischem Feingespür und journalistischer Expertise zeigt »ZEIT«-Journalist Schieritz, wie die Methode Scholz funktioniert, was den Kanzler antreibt und wie Deutschland sich mit dem neuen Mann an der Spitze verändern könnte. Seine These: Scholz hat vor dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels in der Ökonomie die sozialdemokratische Programmatik erneuert und das Thema soziale Gerechtigkeit wieder in das Zentrum der Politik gerückt. Er könnte ein Kanzler des Aufbruchs werden – wenn er das Wagnis eingeht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mark Schieritz
Olaf Scholz – Wer ist unser Kanzler?
Über dieses Buch
Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler. Aber wer ist dieser Mann eigentlich? Wofür steht Olaf Scholz? Und was haben wir von ihm als Kanzler zu erwarten? Nach 16 Jahren endet die Ära Merkel. Mit dem neuen Kanzler steht nun erstmals wieder ein Sozialdemokrat an der Spitze des Landes. Für viele kam sein Wahlsieg überraschend, ist Olaf Scholz doch der große Unbekannte in der deutschen Politik. Mark Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der »ZEIT« und intimer Kenner der hiesigen Politlandschaft, erklärt den Menschen, Politiker und Kanzler Scholz, mit dessen Regentschaft auch eine neue Zeit anbricht. Die Pandemie wie die Klimakrise sind Beispiele für die immensen globalen Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen. Wie werden Scholz und seine Ampelkoalition mit ihnen umgehen? Mit analytischem Feingespür und journalistischer Expertise zeigt »ZEIT«-Journalist Schieritz, wie die Methode Scholz funktioniert, was den Kanzler antreibt und wie Deutschland sich mit dem neuen Mann an der Spitze verändern könnte. Seine These: Scholz hat vor dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels in der Ökonomie die sozialdemokratische Programmatik erneuert und das Thema soziale Gerechtigkeit wieder in das Zentrum der Politik gerückt. Er könnte ein Kanzler des Aufbruchs werden – wenn er das Wagnis eingeht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mark Schieritz, geboren 1974, studierte Politik und Volkswirtschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der London School of Economics, wo er auch seinen Abschluss machte. Seine journalistische Karriere begann er bei der »Financial Times Deutschland«, für die er die Finanzmarktredaktion verantwortete. Heute ist Schieritz wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der »ZEIT«. Er lebt in Berlin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Peter Jülich/laif
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491614-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1 Er
2 Agenda
3 Respekt
4 Wumms
5 Partei
6 Arbeit
7 Klima
8 Pannen
9 Europa
10 Sie
1Er
Das ist seine Chance. An einem Mittwoch im November 2018 betritt Olaf Scholz den Senatssaal der Humboldt-Universität in Berlin. Er hat gewissermaßen ein date mit der Geschichte. Seit fast zwanzig Jahren lädt die Universität Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein. Sie sollen sich Gedanken über die Zukunft Europas zu machen. Der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer forderte an dieser Stelle eine europäische Verfassung, der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker sprach sich für eine gemeinsame europäische Identität, auch in Abgrenzung zu den Amerikanern. Die Humboldt-Rede ist für Politiker die Gelegenheit, etwas Grundsätzliches zu sagen. Anders formuliert: Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt: Scholz muss ihn nur noch reinmachen. Der aber stellt sich ans Rednerpult und spricht über eine »gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer«, über die »Arbeitsbedingungen im Transportgewerbe«, einen »gemeinsamen Mechanismus zur Abwicklung von Banken«, der eine »Letztabsicherung« bekommen soll. Am Ende seiner Rede hat man als Zuhörer den Eindruck, dass Europa genau so ist, wie man sich das immer vorgestellt hat: irgendwie wichtig, aber vor allem schrecklich kompliziert und auch ein bisschen langweilig. »Scholz, der Zauderer« schreibt das Handelsblatt, »Wenig gewagt« der Tagesspiegel.
Der Ball ist ganz offensichtlich nicht im Tor. Er ist daran vorbeigerollt. Wie so häufig, wenn Scholz in den vergangenen Jahrzehnten eine Rede gehalten hat. Dann war eigentlich immer alles schrecklich kompliziert und ein bisschen langweilig. Deshalb hat man irgendwann nicht mehr richtig hingehört. Und Scholz galt als ein Mann von gestern, über den man eigentlich nichts wissen wollte. Weil man das Gefühl hatte, dass es da nichts zu wissen gibt.
Nun ist dieser Mann Bundeskanzler. Was die Frage aufwirft, ob es vielleicht doch etwas zu wissen gab. Und man einfach nicht genau genug hingeschaut hat. Vielleicht schon damals im November nicht. Denn während Scholz über das Transportgewerbe und die Körperschaftssteuer spricht, werden in seinem Ministerium längst die Weichen für eine Neuausrichtung der deutschen Europapolitik gestellt. Als die Coronakrise den Kontinent zwei Jahre später in die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit stürzt, arbeitet er gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire ein Konzept für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas aus. Scholz nimmt sogar auf Alexander Hamilton Bezug, den ersten Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika. Der hatte einst die finanziellen Voraussetzungen für die Zentralisierung des damals noch losen Gebildes unterschiedlicher Bundesstaaten geschaffen. Und auf einmal ist in der öffentlichen Debatte von Olaf Scholz als Wegbereiter der Vereinigten Staaten von Europa die Rede.
Es ist nicht die einzige überraschende Wendung in der Karriere des Olaf Scholz. Noch wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September galt es als ausgeschlossen, dass er das Rennen machen würde. So schwach war seine Partei in den Meinungsumfragen, so stark schienen seine Gegner zu sein. Es ist doch anders gekommen, erstmals seit 16 Jahren wird das Land von einem Sozialdemokraten regiert, in einer Dreierkoalition mit den Freien Demokraten und den Grünen. Auch das hat es in der Geschichte der Republik noch nicht gegeben. Ein Bündnis der Erneuerung und des Fortschritts soll die Ampel werden, so steht es im Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Scholz selbst hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er einiges vor hat in seiner Kanzlerschaft. Er wolle »die Welt ein Stück besser machen«, sagt er wenige Tage nach der Wahl. Und wenn es nach ihm geht, dann wird er dafür nicht nur vier, sondern acht oder mehr Jahre zur Verfügung haben.
Der Wahlsieg von Olaf Scholz markiert aber nicht nur parteipolitisch eine Zäsur. Scholz übernimmt ein Land, das von tiefgreifenden Veränderungsprozessen erfasst worden ist. Der Umbau der Wirtschaft hin zu einer klimaschonenden Produktionsweise hat begonnen, mit erheblichen Folgen für alle Lebensbereiche. Der demographische Wandel schreitet voran und wird die Republik vor neue Herausforderungen stellen. Niemand kann heute sagen, woher morgen die Rente kommen soll. Die Digitalisierung revolutioniert die Arbeitswelt. Der Klimawandel ist kein Schauermärchen mehr, sondern Realität, wie zuletzt die Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gezeigt hat. Die Coronapandemie erschüttert alte Gewissheiten und rückt das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt des öffentlichen Interessens. Und in der Welt lösen sich währenddessen alte Allianzen auf. Deutschland hat wie kaum ein anderes europäisches Land von der Liberalisierung des Welthandels und der Einbindung in das westliche Sicherheitsbündnisse profitiert. Der ökonomische Aufstieg Chinas und die politischen Auflösungserscheinungen der Vereinigten Staaten bedrohen aber die Stabilität der Nachkriegsordnung.
Angesichts der Dimension der Probleme wachsen weltweit die Zweifel an den althergebrachten Politikansätzen. Der Staat als Ordnungsmacht wird immer weniger als Bedrohung der Freiheit empfunden und immer mehr als notwendiges Korrektiv zu den Kräften eines globalen Marktes. Nach Jahrzehnten der Deregulierung hat eine Phase der Reregulierung begonnen. Schutz, Sicherheit, Ausgleich – das sind die Schlagwörter dieser neuen Zeit. Es ist kein Zufall, dass Olaf Scholz die Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns und den Begriff »Respekt« ins Zentrum seines Wahlkampfs gerückt hat. So gehen in diesen Monaten nicht nur 16 Jahre Angela Merkel zu Ende, sondern auch vier Jahrzehnte Neoliberalismus. Und mit dem Amtsantritt von Olaf Scholz beginnt möglicherweise nicht nur eine neue Legislaturperiode, sondern eine neue Ära. Er fällt jedenfalls in eine Zeit, in der die Sozialdemokratie in den Ländern des Westens nach Jahren der konservativen Hegemonie international im Aufwind ist.
Dieses Buch ist der Versuch, sich der Kanzlerschaft von Olaf Scholz vor dem Hintergrund des sich vollziehenden ökonomischen, sozialen und ökologischen Paradigmenwechsels zu nähern. Wird es Scholz gelingen, das Land auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten? Ist er der Richtige, um die nötigen Reformen anzustoßen, ohne den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden? Steckt vielleicht mehr in ihm, als es auf den ersten Blick den Anschein hat? Was wäre das? Und ist die Welt vielleicht nun einmal schrecklich kompliziert und ein bisschen langweilig?
2Agenda
Am 14. März 2003 – einem Freitag – gegen neun Uhr morgens nimmt Olaf Scholz im Bundestag Platz. Gerhard Schröder will eine Rede halten. Schröder ist Bundeskanzler und Parteichef der SPD, Scholz sein Generalsekretär. Die Lage ist ernst. Mehr als vier Millionen Bundesbürger sind ohne Arbeit, die Wirtschaftsleistung schrumpft, die staatliche Schuldenquote steigt. Die britische Wirtschaftszeitung »The Economist« bezeichnet Deutschland als den »kranken Mann Europas«. »Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren!«, beginnt Schröder seine Rede. »Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern. Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.«
Fast 90 Minuten spricht Schröder zu den Abgeordneten. Seine Regierungserklärung ist das Startsignal für ein umfangreiches Paket von Sozialreformen, die als Agenda 2010 in die Geschichte eingegangen sind: Der Kündigungsschutz wird gelockert, die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gekürzt, die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds gesenkt. Vor allem aber wird die bisherige Arbeitslosenhilfe abgeschafft und mit der Sozialhilfe zu einer neuen Hilfsleistung fusioniert: Hartz IV. Wie kaum eine andere Politikmaßnahme steht die Einführung von Hartz IV für den Rückzug des Staats aus seiner sozialen Verantwortung. Denn von nun an gilt: Wer länger ohne Arbeit ist, hat nur noch Anspruch auf eine staatlich festgelegte Mindestsicherung. Dadurch hat sich vor allem die finanzielle Situation von Langzeitarbeitslosen erheblich verschlechtert. Auch die Abstiegsängste in der Mittelschicht nehmen zu. Denn die Neuregelung sieht vor, dass das eigene Vermögen für den Lebenserhalt herangezogen werden muss, bevor der Staat einspringt. Was die Eigenverantwortung stärken soll, bedeutet für viele Menschen: Im Zweifel ist nicht nur die Arbeit weg, sondern auch das Ersparte.
Die Agendareformen werden in der Wirtschaft bejubelt, in der Bevölkerung kommen sie nicht gut an. In vielen deutschen Städten gingen die Menschen massenweise auf die Straße, um gegen eine als Sozialabbau wahrgenommene Politik zu demonstrieren. Das stürzt die SPD in eine schwere Krise, die auch das deutsche Parteiensystem verändert. Am 22. Januar 2005 wird in Göttingen von enttäuschten Sozialdemokraten eine neue Partei gegründet. Ihr Name: Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative. Sie fusioniert mit der PDS, die aus der Staatspartei der DDR hervorgegangen ist. Die neue Partei nennt sich Die Linke. Die Führung übernimmt Oskar Lafontaine, der unter Schröder zunächst Finanzminister war und dann aus Protest gegen die Regierung sein Amt hinwarf. Als Schröder nach dem Verlust einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen die Vertrauensfrage stellt und der damalige Bundespräsident Horst Köhler den Bundestag auflöst, holt die Linkspartei 8,7 Prozent der Wählerstimmen und zieht mit 54 Abgeordneten in den Bundestag ein. Die SPD hingegen verliert 4,3 Prozentpunkte. Die Sozialdemokraten verlieren das Kanzleramt und werden Juniorpartner in einer großen Koalition mit der Union. Die Agendajahre sind für das Verständnis des politischen Denkens von Olaf Scholz zentral. Denn was damals in Deutschland passierte, war kein nationaler Alleingang, sondern Teil einer weltweiten Neujustierung der Grenzen zwischen Markt und Staat.
Die ersten Nachkriegsjahre zeichnen sich in fast allen westlichen Gesellschaften durch ein hohes Maß an staatlicher Kontrolle der Wirtschaft aus. In den Vereinigten Staaten werden Topverdiener deutlich stärker als heute zur Kasse gebeten. Der Spitzensteuersatz liegt bis in die sechziger Jahre hinein bei über 90 Prozent – in der obersten Einkommensklasse müssen also von jedem zusätzlich verdienten Dollar mehr als 90 Cent an den Fiskus abgetreten werden. Ganz ähnlich ist die Lage in Großbritannien. Dort betrug der Spitzensteuersatz nach dem Krieg 75 Prozent, für Gewinne aus Kapitalanlagen galten sogar noch höhere Raten. In Deutschland werden Spitzenverdiener zunächst mit 80 Prozent besteuert. Die Daseinsvorsorge ist weitgehend in öffentlicher Hand: Bei der Post und der Bahn arbeiteten Staatsbeamte, es gibt genau eine Telefongesellschaft, und die Lufthansa ist ein Staatsunternehmen. Der Einfluss des Staates zeigt sich auch in der Finanzwirtschaft. Die internationalen Kapitalmärkte sind streng reguliert, die Banken ebenfalls, die Währungen der großen Volkswirtschaft schwanken nicht frei, sondern sind in festen Austauschverhältnissen aneinandergekoppelt.
Die wirtschaftspolitische Philosophie jener Jahre ist untrennbar mit dem Namen John Maynard Keynes verbunden. Der 1883 in Cambridge geborene Wirtschaftswissenschaftler war einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Er beriet die britische Regierung und nahm an den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg teil. Nebenbei war er ein erfolgreicher Börsenspekulant und interessierte sich für Kunst und Literatur. Keynes argumentierte, dass Volkswirtschaften zur Instabilität neigen, wenn man sie sich selbst überlässt. In einem wirtschaftlichen Abschwung halten die Haushalte aus Angst vor dem Jobverlust ihr Erspartes zusammen, und die Unternehmen investieren nicht mehr. Dadurch verstärkt sich der Rückgang der Wirtschaftsleistung. Es wird schließlich noch weniger Geld ausgegeben und weniger produziert. Denn wozu eine Maschine anwerfen, wenn die fertige Ware doch nur im Lager landet? Am Ende werden noch mehr Arbeitsplätze gestrichen, denn wenn die Maschine ohnehin nicht läuft, muss sie auch niemand bedienen. In einem Aufschwung ist es umgekehrt: Die Leute kaufen mehr ein, die Unternehmen werfen ihre Maschinen an und schreiben neue Stellen aus. Irgendwann laufen alle Maschinen auf Hochtouren, und alle, die arbeiten wollen, haben Arbeit. Um ihre Arbeitskräfte zu halten, müssen die Unternehmen ihnen höhere Löhne bieten. Damit sie trotz der steigenden Lohnkosten keine Verluste machen, erhöhen sie die Preise. Die Inflationsrate steigt. Keynes sah sich durch die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre in seinen Annahmen bestätigt. Damals war ein Viertel der Amerikaner ohne Job, und in Europa machte sich der Faschismus breit.
Nach Ansicht von John Maynard Keynes muss deshalb der Staat die Schwankungen der Konjunktur ausgleichen. Im einfachsten Fall: im Abschwung mehr Geld ausgeben, um die Wirtschaft zu stützen. Und im Aufschwung weniger, um sie abzubremsen. Das Symbol dieses Politikverständnisses ist das am 8. Juni 1967 in Kraft getretene »Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft«. Dieses Gesetz legt vier Ziele für die Politik fest, an denen sich die Wirtschaftspolitik ausrichten soll: Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsgrad, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Genauso hatte sich das Keynes vorgestellt. Das Gesetz wird von der ersten großen Koalition der Nachkriegsgeschichte auf den Weg gebracht, die nach dem Rücktritt von Ludwig Erhard als Bundeskanzler am 30. November 1966 die Arbeit aufgenommen hat. Es ist eine Zeit, in der das Bruttoinlandsprodukt erstmals seit den Boomjahren des Wirtschaftswunders stagniert und die Zahl der Arbeitslosen steigt. Und das will die Regierung nicht hinnehmen.
In der Regierung ist Karl Schiller für das Projekt zuständig. Schiller wächst in Kiel auf, nach dem Krieg wird er Professor für Volkswirtschaft an der Universität Hamburg. Mit dem Eintritt in die SPD im Jahr 1946 begann seine politische Karriere. Er wird 1948 Wirtschaftssenator, zunächst in Hamburg und später in Berlin. In der Koalitionsregierung übernimmt er das Amt des Wirtschaftsministers. Es gibt ein Foto aus dem Jahr 1971, das ihn auf der Frankfurter Frühjahrsmesse zeigt, wie er einen alten Maschinentelegraphen bedient. Das ist ein Hebelapparat, mit dem früher zum Beispiel von der Schiffsbrücke Kommandos an die Maschinisten übermittelt wurden. Das gewünschte Tempo wurde mit einem Hebel eingestellt, daraufhin ertönte im Maschinenraum das entsprechende Klingelsignal. So wie ein Schiff von der Brücke gesteuert werden kann, so soll nach den Vorstellungen Karl Schillers der Staat die Wirtschaft steuern. Die deutsche Konjunktur nimmt im Jahr 1967 tatsächlich wieder Fahrt auf. Und auch wenn das nicht nur an den staatlichen Maßnahmen liegt, tragen diese dazu bei, dass sich die Lage bessert. So wird das jedenfalls in weiten Teilen der Öffentlichkeit gesehen. Und die SPD ist auf einmal die Partei des Aufschwungs und der Wirtschaftskompetenz. Oder wie es der Hamburger Wirtschaftswissenschaftler Arne Heise formuliert: »Eine breite und durchweg positive mediale Berichterstattung über wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Entwicklungen verfestigte diesen Eindruck und verknüpfte ökonomische Kompetenz und Vertrauen untrennbar mit Wirtschaftsminister Karl Schiller und seiner Sozialdemokratie, die zunehmend für modernes Regieren der Zukunft stand.«
Die Verbindung sollte allerdings bald auf die Probe gestellt werden. Am 10. Oktober 1973 treffen sich in Kuwait die Energieminister der elf in der Organisation erdölproduzierender Länder (OPEC) zusammengeschlossenen Staaten: Venezuela, Irak, Saudi-Arabien, Iran, Kuwait, Libyen, Indonesien, Katar, Algerien, Nigeria, die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenige Tage zuvor – am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur – haben Ägypten und Syrien völlig überraschend mit Panzern und Flugzeugen Stellungen der israelischen Armee auf den Golanhöhen und der Halbinsel Sinai angegriffen. Mit den Kriegshandlungen wollen die Angreifer die von den Israelis wenige Jahre zuvor besetzten Gebiete zurückerobern. Nachdem die israelische Armee unter Druck gerät, unterstützen die USA und andere westliche Nationen das Land mit Kriegsmaterial. Die arabischen Staaten werten dies als einseitige Parteinahme und setzen eine neuartige Waffe ein: Öl. Die OPEC beschließt, die Produktion monatlich um fünf Prozent zu drosseln. Die Kürzungen sollen aufrechterhalten werden, bis Israel die besetzen Gebiete wieder räumt. Die Folgen der Strafaktion sind dramatisch: Am Erdölmarkt bricht Panik aus, die Preise schießen in die Höhe. In der Folge verteuern sich auch Heizöl, Benzin, Kunststoffe und andere Produkte auf Ölbasis. Die Bundesregierung – inzwischen ist der Sozialdemokrat Willy Brandt Kanzler – beschließt das sogenannte Energiesicherungsgesetz. Es legt fest, dass zum Zweck der Energieeinsparung die Benutzung von Autos eingeschränkt werden kann. So wird den Deutschen am 25. November 1973 erstmals der Autoverkehr untersagt, Ausnahmen gibt es nur für Polizisten, Ärzte, Diplomaten und andere wichtige Personengruppen. In den Städten sind Pferdekutschen und Rikschas unterwegs, auf den Autobahnen gehen Menschen spazieren. Die Sonntagsfahrverbote werden von der Regierung schon im Dezember wieder aufgehoben, und die Autobahnen füllen sich daraufhin schnell wieder, aber ökonomisch markiert die Ölkrise einen tiefen Einschnitt. Denn weil die Verbraucher nun mehr Geld für Energie ausgeben müssen, bleibt weniger für den Kauf anderer Güter übrig. Damit können die Unternehmen weniger Waren absetzen und müssen Stellen abbauen. Im Jahr 1975 bricht die Wirtschaftsleistung in Westdeutschland erstmals seit Gründung der Bundesrepublik dramatisch ein. Gleichzeitig steigt die Zahl der Arbeitslosen deutlich an.
Die Ölkrise ist kein rein deutsches Problem, in fast allen westlichen Industrienationen bremst der Anstieg der Energiepreise die Konjunktur. Nach der Lehre von John Maynard Keynes müssten die Regierungen darauf mit einem staatlichen Ausgabenprogramm reagieren, doch in der Ölkrise stößt die sozialdemokratische Globalsteuerung an ihre Grenzen. Das hat mit einem Phänomen zu tun, das als Stagflation in die Wirtschaftsgeschichte eingegangen ist. Die keynesianische Wirtschaftspolitik der damaligen Zeit macht sich nämlich einen ökonomischen Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Arbeitslosenquote zunutze: In einer Wirtschaftsflaute mit steigender Arbeitslosigkeit akzeptieren die Beschäftigten geringere Lohnsteigerungen oder sogar eine Kürzung ihres Verdiensts. Sie müssen schließlich damit rechnen, dass sie sonst ihren Job verlieren. Dadurch müssen die Unternehmen weniger Geld für Lohnzahlungen ausgeben und können ihre Waren günstiger anbieten. So wie ein Obstbauer weniger für einen Apfel verlangen wird, wenn er seinen Erntehelfern weniger Lohn bezahlen muss. Die Folge: Die Inflation geht zurück. Deshalb kann der Staat gefahrlos zusätzliches Geld in die Wirtschaft pumpen. Als Helmut Schmidt nach dem Rücktritt Willy Brandts im Jahr 1974 Bundeskanzler wird, steigen allerdings sowohl die Inflationsrate als auch die Arbeitslosenquote. Schmidt steht vor einem Dilemma: Die hohe Arbeitslosenquote spricht für staatliche Konjunkturprogramme, um die Beschäftigung zu stützen. Das würde aber die ohnehin hohe Inflationsrate noch deutlicher ansteigen lassen. Schmidt gibt trotzdem mehr Geld aus. Doch anders als unter Karl Schiller in den sechziger Jahren gelingt es diesmal nicht, die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen, dafür steigt die Staatsverschuldung. Und auf einmal ist die SPD in der Bevölkerung nicht die Partei des Aufschwungs, sondern die Partei der finanzpolitischen Zügellosigkeit. Mit dieser Erzählung haben seither fast alle sozialdemokratischen Spitzenpolitiker zu kämpfen. Auch Olaf Scholz wird einen Teil seines politischen Kapitals darauf verwenden, mit dem Vorurteil aufzuräumen, die Sozis könnten nicht mit Geld umgehen.
Dabei war das damals schon nicht ganz korrekt. Denn ein wichtiger Grund für die Stagflation ist nicht die Finanzpolitik der Regierung, sondern die Lohnpolitik der Gewerkschaften. Sie sind nicht bereit, den durch steigende Preise für Benzin und Heizöl verursachten Kaufkraftverlust hinzunehmen, und fordern als Ausgleich höhere Löhne. Es kommt zu Arbeitskämpfen und Streiks. Eine Schlüsselfigur ist Heinz Kluncker, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV). Die ÖTV will angesichts der gestiegenen Energiepreise einen deutlichen Anstieg der Löhne und Gehälter durchsetzen und fordert ein Tarifplus von 15 Prozent. Als die Arbeitgeber darauf nicht eingehen, beginnt der Ausstand: Busse und Bahnen fahren nicht, Ämter bleiben geschlossen, und der Müll wird nicht abgeholt. Nach drei Streiktagen einigt man sich auf eine Lohnerhöhung in Höhe von elf Prozent. Auch in anderen Branchen steigen die Entgelte. Die Unternehmen müssen nun aber wegen der höheren Lohnkosten ihre Preise anheben, worauf die Gewerkschaften wiederum mit neuen Lohnforderungen reagieren: Der Versuch, die Preissteigerungen durch eine aggressive Lohnpolitik auszugleichen, führt somit im Ergebnis dazu, dass sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln. Das war in den keynesianischen Wirtschaftsmodellen jener Zeit nicht vorgesehen. Um die Inflation zu bekämpfen, muss die Deutsche Bundesbank die Zinsen erhöhen, was die Konjunktur zusätzlich belastet. So hat die Ölkrise der Globalsteuerung ihre ökonomische Grundlage entzogen und einer neuen Ideologie den Weg bereitet: dem Neoliberalismus. Damit ist hier gemeint: einem Rückzug des Staates aus dem Wirtschaftsleben.
Die Ursprünge der neoliberalen Denkschule reichen in die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Am 26. August 1938 reisen 25 Sozialwissenschaftler aus ganz Europa nach Paris, um am Colloque Walter Lippmann im Institut de Coopération Intellectuelle teilzunehmen. Es ist die Zeit, in der sich die politische Landschaft auf dem Kontinent zunehmend radikalisiert. In Russland sind die Bolschewisten an der Macht, in Deutschland die Nationalsozialisten, in Italien und Spanien formieren sich faschistische Bewegungen. Anlass für das Treffen ist ein neues Buch des amerikanischen Journalisten Walter Lippmann mit dem Titel »Die Gesellschaft freier Menschen«. Lippmann argumentiert darin, dass sowohl staatsorientierte Wirtschaftsmodelle – zu denen er die Sozialdemokratie zählt – wie auch der Manchesterkapitalismus des 19. Jahrhunderts in den Untergang führten. Nur eine »Wiedergeburt des Liberalismus« könne die Menschheit vor der Katastrophe bewahren. In Paris will man diese liberale Erneuerung auf den Weg bringen. Anwesend sind unter anderem die österreichischen Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises und die deutschen Ökonomen Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke, die als Gründerväter der Sozialen Marktwirtschaft gelten. Man bleibt auch während der Wirren des Zweiten Weltkriegs in Kontakt, und nach Kriegsende nimmt Hayek den Faden wieder auf. Am 1. April 1947 lädt er erneut eine Gruppe einflussreicher Intellektueller zu einem Treffen ins Hôtel du Parc am Fuß des Mont Pèlerin am Genfer See. Europa liegt in Trümmern, und die Weichen für den Wiederaufbau müssen gestellt werden. Hayek, der später mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet werden sollte, hält die staatliche Einmischung in den Wettbewerb für falsch und freiheitsfeindlich. Deshalb gründet er an diesem Apriltag die Mont-Pèlerin-Gesellschaft, eine Vereinigung liberaler und libertärer Denker, die sich seither weltweit für mehr Markt und weniger Staat einsetzen.
Im sozialdemokratischen Wirtschaftsidyll der Nachkriegszeit wurde Hayek nicht gehört, doch in der allgemeinen Orientierungslosigkeit der Ölkrise sind seine Lehren gefragt. Schon Mitte der siebziger Jahre schwenkt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung um. Der Rat – die sogenannten Wirtschaftsweisen – ist das wichtigste wirtschaftspolitische Beratungsgremium der Bundesregierung. Die Wirtschaftsprofessoren erklären die keynesianische Globalsteuerung für gescheitert und sprechen sich für Reformen aus. Die sollen die Volkswirtschaft »leistungsfähiger« machen. Die Wirtschaftsweisen lassen auch keine Zweifel daran, was sie unter diesem Begriff verstehen: Lohnkürzungen, Sozialabbau, Marktliberalisierung. Überall auf der Welt werden jetzt solche Gutachten veröffentlicht, in den Vereinigten Staaten wird die Universität von Chicago zum Zentrum der neuen Denkrichtung. Die Wende in der Wirtschaftspolitik manifestiert sich zuerst in Chile. Das südamerikanische Land ist die Wiege des Neoliberalismus als »realpolitisches Projekt«, wie es der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher formuliert. Nach dem Putsch gegen Salvador Allende verordnet die Militärregierung unter Augusto Pinochet dem Land eine ökonomische Schocktherapie. Zölle werden gesenkt, Staatsunternehmen privatisiert und öffentliche Ausgaben zurückgefahren. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die sogenannten »Chicago Boys«, eine Gruppe von Ökonomen, die an der Universität von Chicago ausgebildet wurden.
Als Nächstes erreichte die neoliberale Revolution die angelsächsischen Länder. In den USA bringt der Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Ronald Reagan gegen den demokratischen Amtsinhaber Jimmy Carter bei der Präsidentschaftswahl im Herbst 1980 den Wendepunkt. Reagan bezeichnet Hayek als einen der Denker, der ihn am meisten beeinflusst habe. Er lädt ihn ins Weiße Haus ein und schickte ihm Geburtstagskarten. Wie Hayek argumentierte Reagan, dass die Wirtschaft durch ein Übermaß an staatlichen Regeln, hohen Steuern und großzügigen Sozialleistungen gelähmt werde. Deshalb seien Steuersenkungen und Sozialkürzungen notwendig. Damit die Menschen arbeiten müssen, wenn sie überleben





























