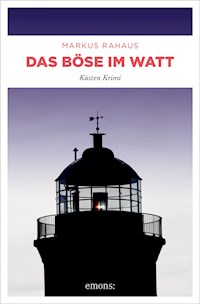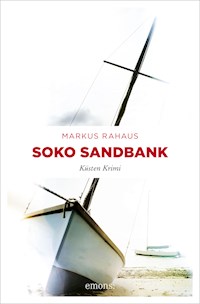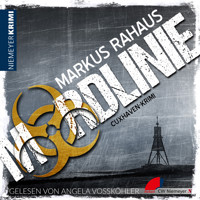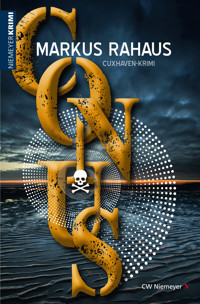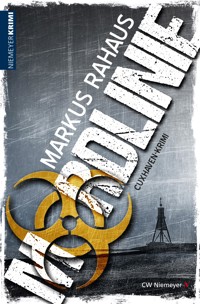9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was ist richtig – ein Leben zu retten oder tausende? Anstatt nach einem harten Arbeitstag bei der Kripo in Cuxhaven entspannt in den Feierabend starten zu können, landet Hauptkommissar Arne Olofsen in seinem schlimmsten Albtraum: Die Tür zu seinem Haus steht offen, und seine Frau Paula ist verschwunden. Dazu die unmissverständliche, in Blut geschriebene Botschaft: "Sie ist weg. Du wirst leiden." Olofsen leidet, doch sehr schnell schlägt seine Angst in Wut um. Als er dann von dem brutalen Gefängnisausbruch im niedersächsischen Celle hört und sich der Flüchtige mit seiner Forderung – eine Biowaffe im Austausch für Paulas Leben – direkt an ihn wendet, sieht Olofsen rot und fliegt prompt aus dem Ermittlerteam. Was nun? Findet er einen Weg, Paula zu befreien und gleichzeitig tausende andere Leben zu schützen? Ein Wettlauf beginnt – gegen die Zeit und gegen die eigene Angst …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Für Ole
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2024 Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von Adobe StockEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-9772-6
Markus RahausOperationSturmflut
Prolog
Ende Januar 2020
Nächtliche Dunkelheit lag über der Elbe, vereinzelt blinkten die grünen und roten Lichter der Fahrwassertonnen. Direkt am Wasser blies der Wind kräftiger als hinter dem Deich und die Kälte des Winters zog durch Mark und Bein. Das Oberfeuer Otterndorf sandte in regelmäßigen Abständen Lichtstrahlen in die Finsternis, um den Schiffen auf der Elbe den Weg zu weisen. Für all das hatten die beiden Männer, die soeben aus dem Fahrzeug stiegen, das sie am Rand der schmalen Straße oben auf dem Deich geparkt hatten, keinen Blick.
Kaum war der Kofferraumdeckel nach oben geschwungen, griffen vier behandschuhte Hände in den Innenraum und wuchteten den schweren, schwarzen und länglichen Sack erst auf die Ladekante, dann auf den Boden. Der schmale Lichtstrahl einer Taschenlampe huschte auf der Suche nach neugierigen Beobachtern hin und her, verlor sich in der Dunkelheit und blieb schlussendlich auf dem Sack haften. Einer der beiden Männer, groß und muskulös, mit poliertem, im Mondschein glänzendem Schädel, ging davor in die Knie, wobei der maßgeschneiderte schwarze Anzug sich beängstigend über dessen Muskelbergen spannte.
Mit flinkem Griff und die Kälte der winterlichen Nacht ignorierend, zog er den Reißverschluss am Rand des Sacks auf. Das Licht der Taschenlampe fiel auf ein bleiches Gesicht und beleuchtete schonungslos ein Paar blutunterlaufene und leer in den Himmel starrende Augen. Mitten auf der Stirn prangte ein deutlich erkennbares Einschussloch, die vom Blut feuchten Haare klebten an den Schläfen des Toten. In den Mundwinkeln haftete ebenfalls eingetrocknetes Blut.
Der zweite Mann, einen guten Kopf kleiner als sein Partner, aber ebenfalls im schwarzen Anzug und kahlköpfig, räusperte sich. „Drecksarbeit. Scheiß Kälte. Mach schnell, ich will hier weg.“ Er wandte sich dem Wagen zu und holte eine dunkelgraue Winterjacke mit Fellkragen vom Rücksitz.
„Yes, Mister T“, entgegnete der andere mürrisch. Auf den Boden neben sich hatte er ein Kästchen gestellt, dem er nun die erste von zwei großen Spritzen entnahm und die Schutzkappe von der Kanüle abzog. Ohne mit der Wimper zu zucken, stach er die dicke Nadel direkt ins Herz und zog langsam den herabgedrückten Stempel wieder nach oben. Die Spritze füllte sich langsam, aber stetig mit dunkelrotem, fast schwarzem Blut. Danach wiederholte er die Prozedur mit der zweiten Spritze.
„Fertig.“ Mit einem leisen Ratschen schloss sich der Reißverschluss des Leichensacks. Die Spritzen lagen bereits wieder in dem Kästchen.
Mister T nickte, ging zum Kofferraum des Wagens zurück und förderte zwei Klappspaten zutage. Die beiden Männer griffen die Enden des Leichensacks und trugen ihn auf die schmale Behelfsbrücke der Schleusenbaustelle in Otterndorf. Es war menschenleer und gespenstisch still. Die umstehenden Bäume wiegten sich im Wind, der ein wenig aufgefrischt hatte und in diesem Moment eine dicke Wolke vor den Mond schob.
„Auf drei“, sagte Mister T.
Gleichmäßig begannen die beiden, den Leichensack hin und her zu schwingen.
„Eins“, zählte Mister T vor. „Zwei.“
Bei „Drei“ flog der Sack von der Brücke und schlug Sekundenbruchteile später mit einem dumpfen Geräusch auf dem lehmigen Boden der großen, mit Spundwänden umschlossenen Baugrube unter ihnen auf. Dort würde in Kürze das Fundament der neuen Schleusenkammer zum Handler Kanal gegossen werden.
„Jetzt noch ein bisschen buddeln“, brummte Mister T.
Gemächlichen Schrittes gingen die beiden über die Baustelle und schwangen sich behände einer nach dem anderen in die Kammer. In deren Mitte hoben sie mit den Klappspaten ein Loch im feuchten Boden aus, ein Grab. Wenige Minuten später rollten sie den Toten aus dem Leichensack hinein und schaufelten den Aushub wieder darüber.
„Möge der aufmüpfige Doktor in Frieden ruhen“, sagte Mister B mit leiser Stimme und klopfte sich Schmutz von der Anzughose.
„Und niemals gefunden werden“, ergänzte der andere.
Sie hatten die Erde über dem Grab flach getreten. Wenn in einigen Stunden die Bauarbeiter ihre Arbeit aufnehmen würden, wäre nicht mehr zu erkennen, was hier geschehen war. „Auf geht’s. Der Boss wartet.“
***
Gegenwart, zehn Tage zuvor
Dichte Wolken hingen tief am Himmel und tauchten den Innenhof seitlich des Hauptgebäudes in ein tristes, fahles Licht. Der graue und leicht schmuddelige Anstrich der Gebäudefassade unterband erfolgreich jegliches Wohlbehagen. An einigen der vergitterten Fenster waren Jalousien heruntergelassen. Es gab Kameras an verschiedenen Positionen hoch oben an den Wänden, ausgerichtet auf die Freifläche darunter.
Der asphaltierte Boden war noch von dem Regenschauer feucht, der erst vor wenigen Minuten über der Justizvollzugsanstalt Celle niedergegangen war. Ein paar Schlaglöcher standen voller Wasser. Eine aus einem schlecht geschlossenen Container heraushängende Plastikplane flatterte im Wind.
Eine Tür an der Gebäudeseite öffnete sich und ein Mann trat nach draußen. Er war untersetzt, hatte jedoch die Statur eines Bodybuilders: muskulös mit auffällig breiten Schultern und auf wenige Millimeter kurz geschorenen Haaren, kräftigen Oberarmen und Beinen. Er trug einen dunklen, gut sitzenden Anzug, ein beißend pinkes Hemd, dazu eine dunkelblaue Krawatte. Die braunen Augen scannten selbstsicher den öden Hof. Ein Außenstehender hätte den Mann wahrscheinlich für einen körperkult-besessenen Geschäftsmann vom Typ Alpha-Männchen gehalten, vielleicht auch für einen siegesgewohnten Sportler, wäre da nicht dieses eine störende Detail gewesen: Der Mann trug Handschellen und Fußfesseln. Beides konterkarierte seine ansonsten elegante und seriöse Erscheinung. Die Fesseln an den Fußknöcheln erlaubten ihm keine der Statur entsprechend ausladenden Schritte, sondern ließen ihn nur trippelnd vorwärts gehen. Ungelenk versuchte der Mann, einer der Pfützen auszuweichen, aber die kurze Kette der Fußfesseln wusste dies zu verhindern. Mit einem seiner polierten Lackschuhe trat der Mann mitten in die Wasserlache und fluchte unhörbar.
Hinter ihm traten zwei uniformierte Vollzugsbeamte in den Innenhof. Beide beäugten missmutig das Grau des Himmels, dann wandten sie sich dem Mann vor ihnen zu.
„Häftling, stehen bleiben“, rief einer der beiden, ein großgewachsener und etwas schlaksig wirkender Mann mit Haaren, so grau wie der Himmel.
Der Mann im Anzug funkelte den Aufseher böse an, tat aber wie geheißen. Er senkte den Blick – nicht demütig, sondern nur, um seine Schuhe zu betrachten. Das Leder war nass, was ihn ärgerte. Seine Anwälte hatten mit Engelszungen auf die Anstaltsleitung einwirken müssen, um dieses Outfit für seinen ersten Auftritt nach vielen Monaten hinter diesen Mauern gestattet zu bekommen – und er marschierte geradewegs in eine Pfütze. Angewidert über seine eigene Ungeschicklichkeit spuckte er aus.
Eine weitere Tür schwang auf, aus der ebenfalls mehrere Gefangene, begleitet von zwei Vollzugsbeamten, heraustraten. Im Gegensatz zum Ersteren trugen diese Gefängnisinsassen die normale Anstaltskleidung – und keine Hand- und Fußfesseln.
An der gegenüberliegenden Seite des Hofes öffnete sich ein großes, schwarzes Rolltor, begleitet von einem orangenen Blinklicht und einem enervierenden Piepton. Nachdem es ausreichend weit über Schienen zur Seite gerollt war, fuhren ein cremeweißer Kleinbus und ein schwarzer, unmarkierter Transporter vor. Die beiden Fahrzeuge hielten im Abstand von einigen Metern nebeneinander an, die Türen öffneten sich und weitere Vollzugsbeamte stiegen aus. Sie winkten die kleine Häftlingsgruppe zu dem Kleinbus.
Trotz der tristen Umgebung wirkten die Männer gut gelaunt. Sie flachsten über irgendetwas, einer knuffte den anderen, was weitere Lacher zur Folge hatte. Selbst die Beamten lachten mit, wenn auch zurückhaltender. Einer nach dem anderen bestieg den Bus, dann schlossen sich die Türen. Der Motor wurde gestartet, doch das Fahrzeug blieb an Ort und Stelle stehen.
„Weiter gehen“, forderte der schlaksige Beamte den Anzugträger auf. „Zum Transporter.“
Der Mann im Anzug straffte sich. „Klasse, ihr habt für mich den Luxusschlitten organisiert – das wäre doch nicht nötig gewesen. Gibt es Häppchen und Schaumwein?“
„Hier schäumt gar nichts. Außerdem gilt nach wie vor Grundregel eins: Klappe halten.“ Der Sarkasmus in der Stimme des Anzugträgers war dem Vollzugsbeamten entweder entgangen oder er ignorierte diesen. „Hinten einsteigen und hinsetzen.“
Nach einer für ihn gefühlt endlosen Zahl von erniedrigenden Trippelschritten erreichte der Mann den hinteren Teil des Transporters. Eine kleine Treppe mit drei Stufen war heruntergeklappt worden, sodass er halbwegs komfortabel hineinsteigen konnte. Der Innenraum war schmutzig weiß, an den beiden Längsseiten gab es Sitzbänke, auf denen jeweils vier Personen Platz nehmen konnten.
„Hinsetzen!“, befahl einer der Aufseher.
Der Mann im Anzug befolgte die Anweisung und ließ sich auf einen der harten Sitze mit dem abgewetzten Kunstlederbezug fallen. Hinter ihm folgten die beiden Vollzugsbeamten und setzten sich ihm gegenüber. Der Mann bedachte sie mit einem verächtlichen Blick. Aber er sagte nichts, denn ihm war klar, dass es ein Fehler wäre, die beiden zu provozieren – obschon es ihm wahrscheinlich großen Spaß gemacht hätte. Insbesondere den langen Schlaks hielt er für einen außerordentlichen Dummkopf, der sich in seiner Uniform, so schlecht sie auch saß, enorm bedeutsam vorkam. Von außen wurde die kleine Treppe hochgeklappt, dann schlossen sich die Türen mit einem vernehmlichen Knall. Noch immer verzog keiner der drei eine Miene oder sagte ein Wort.
Die beiden Wagen setzten sich langsam in Bewegung, wendeten auf dem engen Hof und fuhren wieder auf das schwarze, offenstehende Tor zu. Erst passierte der Transporter, dahinter folgte der Kleinbus. Wie von Geisterhand bewegt, schloss sich das Tor geräuschlos. Die beiden Fahrzeuge standen in einem Schleusenbereich, vor ihnen eine Barriere, hinter ihnen ebenso, beide geschlossen. Das Licht starker Scheinwerfer an den Wänden verdrängte das trübe Grau und überzog den Schleusenbereich und die beiden Fahrzeuge mit gleißender Helligkeit. Auch hier wurden via Kameras alle Ecken und Winkel beobachtet, nicht einmal eine Maus hätte sich unbeobachtet hinein- oder hinausschleichen können. Die abschließende Kontrolle ging schnell vonstatten und nun öffnete sich das vordere Tor, schwerer und größer als das innere.
Die Wagen fuhren an und verließen die Justizvollzugsanstalt. Nach einer Linkskurve erhoben sich linker Hand die hohen Mauern des Gefängnisses, rechts waren die Fahrzeuge der Mitarbeiter geparkt. Hier stoppte der Kleinbus. Zwei Polizeifahrzeuge, die abfahrbereit auf dem Parkplatz gewartet hatten, scherten aus, eines setzte sich vor den Transporter, das andere dahinter. In dieser Formation bogen die drei Fahrzeuge nach links in die Trift ab. Das Ziel der kleinen Kolonne war das Oberlandesgericht am Schlossplatz, die Fahrt dorthin sollte gute sechs Minuten dauern und galt als Routine, denn regelmäßig wurden Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt zu Anhörungen oder Verhandlungen dorthin gebracht. Noch nie war etwas passiert, der unmarkierte Transporter erregte keine Aufmerksamkeit. Trotzdem war es eine kleine Besonderheit, dass der Transporter heute von zwei Streifenwagen eskortiert wurde. Der Mann im Anzug war aber auch nicht irgendein Häftling.
Es waren nur wenige andere Fahrzeuge unterwegs, an einem Grünstreifen stand ein Mann und beobachtete seinen Hund, der gerade ein größeres Geschäft erledigte.
Nach knapp zweihundertfünfzig Metern bogen die drei Fahrzeuge links in die Breite Straße ein, die durch eine kleine Parkanlage führte. Hier waren mehr Menschen unterwegs, Hundehalter, Jogger, Radfahrer. Die Wagen schwenkten nach links auf die B214, die kurz darauf nach links abknickte und durch ein locker bebautes Wohn- und Geschäftsviertel führte. Am Straßenrand parkten Autos, aber nicht dicht gedrängt, es gab diverse Lücken. Hier und da stand ein Baum.
„Heute ist dein erster großer Auftritt seit langem“, sagte der schlaksige Beamte mit einem hämischen Grinsen. „Schon nervös?“
Der Mann im Anzug reagierte nicht.
„Ich spreche mit dir, du Vogel“, zischte der Beamte. „Bist du nervös? Hast du den Text auswendig gelernt, den deine Anwälte dir vorgebetet haben? Gibst du zu, was man dir vorwirft, oder willst du die Unschuld vom Lande spielen?“
„Lass ihn in Ruhe, Fred.“ Der andere Vollzugsbeamte verschränkte die Arme und beobachtete den Mann im Anzug wachsam. „Wir machen hier unseren Job, das muss reichen.“
„Ich mache doch nur Spaß“, entgegnete Fred mürrisch und kratzte sich im Schritt.
Die kleine Fahrzeuggruppe erreichte die Lenthestraße, als plötzlich ein halb auf dem Bürgersteig geparkter schwarzer SUV mit aufheulendem Motor vorschoss und seitlich in das hintere Polizeifahrzeug krachte. Glas splitterte, Metall verbog, Plastik brach, der Motor erstarb, Öl spritzte auf den Straßenbelag, Schmerzensschreie waren zu hören. Der Fahrer des SUV gab weiter Vollgas und drückte den Polizeiwagen unnachgiebig von der Straße und gegen die gegenüberliegende Hauswand. Auf dem Stoff des aufgeblasenen Airbags auf der Beifahrerseite – dort, wo der SUV eingeschlagen war – breitete sich ein großer, roter Fleck aus.
Zeitgleich beschleunigten zwei weitere schwere Fahrzeuge aus der der Lenthestraße schräg gegenüberliegenden Einfahrt des Amtsgerichtes. Eines krachte in die Fahrerseite des vorausfahrenden Streifenwagens, das andere traf den Transporter mit voller Wucht auf Höhe der Fahrerkabine. Wieder kreischte Metall, wieder splitterten Scheiben, wieder erklangen von Schreck und Schmerz ausgelöste Schreie.
Aus allen drei SUV sprangen die Fahrer heraus, gekleidet in schwarzen Kampfmonturen und mit Sturmhauben, die die Gesichter bedeckten und nur schmale Schlitze für die Augen frei ließen. Sie rissen kurzläufige automatische Waffen in die Höhe und feuerten ohne mit der Wimper zu zucken auf die beiden Polizeifahrzeuge und die Fahrerkabine des Transporters. Mit knackenden, knirschenden und kreischenden Geräuschen schlugen die Geschosse in die Fahrzeuge ein, hinterließen Löcher und kleine Krater, trafen die Beamten, zerfetzten Muskeln und Knochen, verletzten sie schwer, Blut floss, mehr Blut spritzte, weitere Schreie waren zu hören. Passanten ließen sich entsetzt zu Boden fallen oder suchten ihr Heil in der kopflosen Flucht.
Der Mann, der auf den Transporter geschossen hatte, ließ achtlos seine Waffe fallen und rannte zur Hecktür. Er zog eine schwarzglänzende Pistole aus einem Halfter am rechten Oberschenkel und gab eine Reihe gezielter Schüsse auf das Schloss ab, das sofort zerbarst. Die Türen schwangen auf, Licht durchflutete den Innenraum. In der Mitte der Ladefläche stand, so breitbeinig, wie es die Fußfesseln erlaubten, der Mann im Anzug. Hinter ihm auf dem Boden lagen die beiden Vollzugsbeamten. Fred stöhnte und wandte sich vor Schmerzen, sein rechter Unterarm stand in einem nach ärztlicher Hilfe schreienden Winkel vom Oberarm ab, der andere blutete stark aus einer Kopfwunde und rührte sich nicht.
Der Anzugträger nickte dem Mann am Rande der Ladefläche kurz zu und trat einige kurze Schritte vorwärts. Ein zweiter schwarz gekleideter Mann tauchte hinter dem ersten auf, in der Hand hielt er einen Bolzenschneider. Mit zwei geschickt angesetzten Schnitten durchtrennte er erst die Fuß-, dann die Handfessel des Anzugträgers.
„Danke.“ Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Nun wieder mit voller Bewegungsfreiheit ausgestattet, drehte er sich in einer fließenden Bewegung um und trat Fred mit Wucht in den Magen. „Ich bin nicht nervös, du Wichser. Ich bin dir überlegen.“
Ein Donnern und Wummern, dass schon vor dem Angriff auf die Fahrzeugkolonne präsent gewesen, aber im Lichte der Ereignisse kaum wahrgenommen worden war, schwoll nun zu einem ohrenbetäubenden Getöse an. Der Anzugträger sprang aus dem Transporter und blickte nach oben. Von dort näherte sich ein Hubschrauber so schnell, dass es wirkte, als würde er senkrecht zu Boden stürzen. Der dunkelglänzende Unterboden mit den beiden Kufen kam näher und näher. Die von den sich in rasender Geschwindigkeit drehenden Rotorblättern erzeugte Luftströmung wirbelte trotz des regenfeuchten Bodens eine dichte Staubwolke auf, riss verstreut liegende Papierfetzen in die Höhe.
Auch der dritte Schütze, der zuvor mit seiner Waffe immer wieder in Richtung des Amtsgerichtes gefeuert hatte, um die dortigen Sicherheitskräfte in Schach zu halten, kam nun angerannt.
Alle vier Männer hoben schützend eine Hand vor die Augen und gingen leicht in die Knie, um sich gegen Staub und Luftzug zu schützen. Der Hubschrauber, ein schwarz lackierter Jet Ranger Bell 206 mit weißen Streifen an der Seite, schob sich ein Stückchen zur Seite und setzte gut zehn Meter hinter dem Transporter auf der menschenleeren Mühlenstraße auf. Kaum berührten die Kufen den Asphalt, sprinteten die Männer los und schwangen sich behände durch die offenen Türen in den Passagierraum. Der Anzugträger kletterte auf den Sitz neben dem Piloten, setzte einen Kopfhörer auf und zeigte den nach oben gereckten Daumen – unklar ob als Andeutung, dass alles in Ordnung sei oder dass es losgehen sollte. Der Pilot nickte. Einer der maskierten Männer blieb auf der Kufe stehen, klammerte sich mit einer Hand an einem Handgriff im Inneren der Kabine fest und gab weitere Schüsse aus seiner Schnellfeuerwaffe ab.
Ein Ruck durchlief den Hubschrauber und er hob wieder ab. Schneller, als er gelandet war, schoss er in die Höhe und schwenkte nach Osten. In einiger Entfernung waren die ersten Sirenen zu hören, doch die Einsatzkräfte würden zu spät kommen. Der Mann im Anzug war befreit. Die ganze Aktion hatte kaum vierzig Sekunden gedauert.
In weniger als dreißig Metern Höhe überflog der Jet Ranger mit donnernden Rotoren die Altstadt von Celle und hielt auf die träge dahinfließende Aller zu. Zwar hatte der Pilot alle aktiven Ortungs- und Identifikationssysteme abgeschaltet und flog unterhalb der Radarlinie, aber man würde ihn sehen und verfolgen können.
Alles musste schnell gehen.
Die über dreihundert Kilowatt starke Turbine konnte das Fluggerät auf eine Geschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde beschleunigen, aber über dicht bebautem Stadtgebiet und mit extrem niedriger Flughöhe war dies dem Piloten zu gefährlich, trotz des Zeitdrucks.
Der maskierte Mann auf der Kufe hatte sich indessen in die Kabine geschwungen und die Tür zugezogen. Der Pilot beschleunigte den Hubschrauber ein wenig und flog eine Kurve. Der Jet Ranger folgte nun dem Lauf des Flusses nach Südosten. Hier waren die Flächen kaum noch besiedelt, die Farbe Grün prägte die Landschaft, in der vereinzelte Gehöfte lagen. Ostwärts erstreckte sich ein großer Wald. Am Abzweig des Osterbruchkanals von einem blinden Arm der Aller ließ der Pilot seine Maschine einige Meter sinken. Er hielt nun genau auf einen Streifen grauen Asphalts am Ahnsbecker Weg zu, der in den Straßenkarten als Startpunkt des Rundwanderwegs Altencelle C1 markiert war. Drei Autos parkten hier, sonst war weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Es gab nur Felder und Wiesen.
Fünfundzwanzig Meter von den Wagen entfernt brachte der Pilot sein gut zehn Meter langes und eineinhalb Tonnen schweres Fluggerät sanft zu Boden. Schon vor dem Aufsetzen flogen die hinteren Türen auf und die drei Männer in den Kampfanzügen sprangen hinaus. Im militärisch anmutenden Laufschritt und mit geduckten Körpern entfernten sie sich vom Hubschrauber und den gefährlich kreisenden Rotorblättern.
Der Mann im Anzug dagegen blieb auf seinem Platz sitzen, bis der Helikopter auf dem Boden aufgesetzt hatte. Mit professioneller Ruhe und Effizienz drückte der Pilot Knöpfe und legte Schalter um, und augenblicklich verlangsamte sich die Drehung der Rotoren, das Brüllen der Turbine verlor sich erst zu einem Wimmern und erlosch dann ganz.
Der Anzugträger nahm seelenruhig den Kopfhörer ab und öffnete die Kabinentür. Bevor er ausstieg, wandte er sich dem Piloten zu. „Gute Arbeit. Präzise, schnell, erfolgreich.“
„Ich mache nur meinen Job.“ Der Pilot deutete ein Nicken an und zog eine etwa schuhkartongroße Schachtel hervor, aus der einige verschiedenfarbige Kabel heraushingen. Auf der Oberseite prangte ein roter Kippschalter.
„Wie lange ist die Zündung verzögert?“, fragte der Anzugträger.
„Sechzig Sekunden.“ Der Pilot legte den Zeigefinger auf den Schalter.
„Das ist in Ordnung. Auch auf der Flucht sollte man sich nicht hetzen lassen.“
„Eine Sache noch.“ Der Pilot griff in eine kleine Tasche seiner Jacke und zog einen silberglänzenden USB-Stick hervor. „Beste Grüße vom Boss. Auf dem Stick sind Ihre neuen Instruktionen. Prägen Sie sich die Anweisungen ein und vernichten Sie anschließend den Stick.“
„007 lässt grüßen.“ Der Mann im Anzug nahm den USB-Stick an sich und glitt elegant aus dem Hubschrauber. Der Boden war durch den Regen der vergangenen Tage durchweicht und so sank er bei jedem Schritt in den morastigen Boden ein. Ein weiteres Mal fluchte er leise in sich hinein – das Schicksal seiner Schuhe war nun besiegelt, sie würden im nächsten Mülleimer enden.
Bei den wartenden Autos handelte es sich um einen neuen, anthrazitfarbenen Tesla, einen altersschwachen dunkelgrünen Golf mit vier Türen und einen weißen Audi A4. Die Fahrer der Wagen hatten bereits die Motoren gestartet und warteten auf ihre Mitfahrer. Zwei der Männer in den Kampfanzügen setzten sich in den Audi, der dritte zog gerade seine Sturmhaube ab und zwängte sich auf den Beifahrersitz des Golfs. Der Anzugmann erreichte den Tesla und nahm im Fond Platz. Auch der Pilot hatte mittlerweile den Parkstreifen erreicht und warf sich auf die Rückbank des Golfs. Sofort fuhren alle Wagen an. Einer wendete und folgte dem Ahnsbecker Weg in den Wald hinein, die anderen beiden Fahrzeuge erreichten die Kreuzung und bogen nach links und rechts ab.
Sekunden später explodierte der zurückgelassene Jet Ranger in einem gigantischen Feuerball.
Der Fahrer des Tesla warf einen Blick über die Schulter. Durch das Heckfenster konnte er die in den Himmel aufsteigenden Flammen und umherfliegende Trümmerteile sehen.
Dann traf sein Blick seinen Fahrgast. „Willkommen zurück, Herr Erbil.“
Kapitel 1
Schwärze hatte ihn umfangen. Tiefe, brutale Schwärze. Vor seinen Augen, in seinem Kopf, in seinem Herzen. Er konnte kaum atmen, hatte vergessen, wie man Luft holte. Olofsen presste die Hände so fest um die Stuhllehne, dass die Knöchel weiß hervortraten und die Gelenke vor Schmerz rebellierten. Er nahm es nicht wahr. Dann zuckten Blitze vor seinem inneren Auge. Blitze, die sich zu Buchstaben verbanden. Grellweiße Buchstaben, die die Schwärze durchbrachen. Buchstaben, die Worte formten.
Sie ist weg.
Du wirst leiden.
Sein Verstand kehrte zurück, sein Hirn begann wieder zu arbeiten.
Die Schwärze verlor an Intensität, wurde grau, dann noch heller. So hell, dass er die Buchstabenblitze nicht mehr sehen konnte.
Olofsen schlug die Augen auf. Er brüllte seinen Zorn, seine Angst, seine Panik heraus. Es war ein Schrei, der in ganz Nordleda zu hören gewesen sein musste. Er reckte die Arme gen Zimmerdecke, dann fiel er auf die Knie. Behutsam zog er den Hund Sam unter dem Tisch hervor. Der Hund winselte, blickte Olofsen durch seine schwarzen Kulleraugen Hilfe suchend an, streckte eine der Vorderpfoten vor. Olofsen legte seine Hand auf die Tatze des Hundes. Als er die Blutspur sah, die sich nun zwischen Tisch und seinen Füßen auf dem Boden abzeichnete, musste er schlucken.
Er liebte dieses Tier.
Er liebte Paula.
Was musste er jetzt tun? Sein Kopf war wie leer gefegt, als hätte die Schwärze zuvor jedes Wissen, was wann wo und wie zu tun war, ausgelöscht. Er schlug sich mit den blutverschmierten Händen gegen den Kopf, als wolle er seinem Hirn zu verstehen geben, endlich flotter zu arbeiten, damit er wusste, was er jetzt unternehmen musste.
Blut. Viel Blut.
In einer solchen Situation braucht man einen Arzt, schoss es ihm durch den Kopf.
Sam verblutet.
Ein Tierarzt.
Paula.
Paula war weg.
Paula muss gesucht und gefunden werden.
Eines nach dem anderen.
„Steh auf!“, schrie er sich selbst an.
Er kam auf die Beine, hob Sam hoch und lief durch die noch immer offen stehende Seitentür zu den Nachbarn. Vor deren Haustür schrie er, trat mit den Füßen gegen die Tür, da er keine Hand frei hatte, um den Klingelknopf zu erreichen. Innen erklang ein Donnergrollen aus Hundegebell.
Er hörte, wie ein Schlüssel von innen im Schloss gedreht wurde. Die Tür öffnete sich einen Spalt.
„Was zur Hölle ist ...“ Die Stimme brach ab. „Arne, was ist passiert?“
„Sam. Er verblutet. Ich benötige Hilfe. Jetzt sofort“, brachte Olofsen hervor. „Paula ist weg. Ich muss sie suchen.“
„Klar. Komm erst einmal rein.“ Die Tür schwang ganz auf.
Jörg Schreiner, in Jogginghose und T-Shirt, bedeutete ihm, hereinzukommen. Seine Haare waren feucht und standen in allen Richtungen vom Kopf ab. Er sah aus, als wäre er noch vor einer Minute unter der Dusche gewesen. „Silvia. Komm runter.“ Mit einer herrischen Geste scheuchte er den eigenen Hund, der wegen des Blutgeruchs mit eingekniffenem Schwanz an der Treppe stand, in die Gästetoilette und schloss die Tür.
„Was ist denn los?“, kam die Frage aus dem oberen Stockwerk.
„Arne braucht unsere Hilfe.“ Er wandte sich an Olofsen. „Leg Sam vorsichtig auf den Boden. Was ist passiert?“
Olofsen legte den Hund ganz sachte auf den Fliesen ab, streichelte sanft über sein Fell und wischte sich mit der blutigen Hand durch das Gesicht. Sam winselte leise.
Auf der Treppe waren Schritte zu hören. Silvia Schreiner kam herab. „Hallo Arne. Wo brennt’s denn?“ Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht, um den Schrei des Entsetzens zu unterdrücken, als sie den blutenden Hund auf den hellen Bodenfliesen erblickte.
Olofsen blickte flehentlich von einem zum anderen. „Könnt ihr euch um Sam kümmern? Ihn zum Tierarzt nach Otterndorf bringen? Ich muss Paula suchen. Ich fürchte, sie ist entführt worden.“
„Was sagst du da? Entführt?“, rief Silvia Schreiner aufgeregt. „Was ist denn bloß ...“
„Selbstverständlich helfen wir“, unterbrach Jörg Schreiner seine Frau energisch. „Das ist doch gar keine Frage.“ Er wandte sich direkt an sie. „Hol ein paar Decken und leg sie auf den Rücksitz im Wagen. Ich ziehe mich schnell an, dann bringen wir Sam zum Doc.“
Olofsen legte ihm die Hände auf die Schultern. „Danke. Ihr seid echte Freunde.“
„Ach was. Wir lieben Sam fast so sehr wie unsere Mira.“ Jörg Schreiner winkte ab. „Los, suche Paula, wir kümmern uns um Sam.“ Damit schob er Olofsen zielsicher durch die Haustür. „Ich melde mich.“
Draußen vor der Tür musste Olofsen erst einmal durchatmen. Er spürte, wie er zu zittern begann. Abermals gab er sich selbst eine Backpfeife. „Reiß dich zusammen. Sam wird versorgt. Jetzt mach den nächsten Schritt.“
Er lief wieder zurück in sein Haus, griff nach seiner Jacke, die er, ohne es zu bemerkt zu haben, auf einen Stuhl gelegt hatte, und zog das Handy hervor. Als Erstes wählte er den Notruf, danach rief er Greiner an und erklärte ihm in hastigen Worten, was geschehen war. Martin Greiner, ebenfalls Hauptkommissar bei der Cuxhavener Kripo, war sein Freund und Partner. Er würde einen kühlen Kopf bewahren und wissen, was nun zu tun war. Nach dem Telefonat ließ er sich einfach auf einen der Stühle am Esstisch fallen und vergrub sein Gesicht in den Händen. Er kämpfte gegen die Wut und die Tränen, die aus ihm herausbrechen wollten, nahm gar nicht wahr, dass er mit den Füßen in Sams Blutlache stand, wollte nicht, dass sich seine Sinne abermals in Schwärze verwandelten.
Er hatte keine Ahnung, wie lange er am Tisch gesessen hatte, als er hörte, dass ein Streifenwagen mit quietschenden Reifen und heulenden Sirenen vor dem Haus anhielt. Nur Sekunden später stoppte ein weiterer Wagen mit gleichem Bremseneinsatz vor seinem Haus. Vermutlich war Greiner eingetroffen. Olofsen schlug einmal mit der Faust auf den Tisch. „Hoch mit dir!“
„Arne? Wo bist du?“, hörte er Greiners Stimme aus dem Wirtschaftsraum. Er musste durch die nach wie vor offene Seitentür hereingekommen sein.
„Hier“, rief er mit dünner Stimme.
Nur Augenblicke später spürte er eine Hand auf seiner Schulter. „Wir finden sie. Das steht außer Frage.“
Olofsen rang sich ein Nicken ab.
„Erzähl mir haarklein, was passiert ist. Aber nicht hier.“ Greiner griff Olofsen unter die Schulter und versuchte, ihn sanft, aber bestimmt hochzuziehen. „Frank und seine Truppe werden in ein paar Minuten eintreffen und sich das hier“, er deutete mit dem Arm unbestimmt in die Runde, „in Ruhe ansehen.“
Frank Pall war der Leiter der Tatortgruppe. Zusammen mit seinem kleinen Team aus zwei Mitarbeitern war er der Herr über alle Spuren. Olofsen und Pall respektierten sich, würden mit dem anderen durch Flammen gehen, aber ähnlich wie Olofsen war auch Pall ein wenig kompromissbereites Alphatier. Regelmäßig gerieten die beiden heftig aneinander, um über die richtige Reihenfolge der Schritte bei der Untersuchung eines Tatortes zu streiten: Hatte zunächst der leitende Ermittler Zugang oder doch erst die Spurensicherung? Richtlinien oder Dienstanweisungen hatten in dieser Frage für die beiden eher einen informativen, aber keinen bindenden Charakter. Ihre mit gepfeffertem Humor versehenen Diskussionen waren inzwischen in Polizeikreisen legendär und über das Cuxland hinaus bekannt.
Plötzlich sprang Olofsen auf, wie von der Tarantel gestochen. „Verdammt“, brüllte er, „Wer macht so etwas? Wer bricht hier ein, sticht meinen Hund ab und nimmt Paula mit?“
Abermals krachte die Faust auf den Tisch. „Wer?“, schrie Olofsen erneut.
Auf die Schwärze folgte die lavarote Wut.
Die beiden anderen Streifenbeamten, die zeitgleich mit Greiner eingetroffen waren, zogen sich in den Wirtschaftsraum zurück.
„Ich werde mir den Wichser holen, der dafür verantwortlich ist.“ Olofsens Faust krachte weiterhin auf die Tischplatte. „Ich werde ihn kriegen, mit den Eiern an die Kugelbake nageln und selbige mit einem dicken Hammer zu Brei kloppen.“
Jemanden mit den Eiern an die Kugelbake zu nageln war Olofsens universell angedrohte Strafmaßnahme für alle und jeden, die es wagten, sich mit ihm anzulegen, sei es privat oder dienstlich. Diese Drohung war zwischenzeitlich sogar überregional bekannt geworden. Einmal hatte Olofsen im Internet eine schlechte Zeichnung von der Kugelbake, einem Ei und einem Hammer entdeckt. Dazu ein Lach-Smiley und die Worte ‚Kripo Cuxhaven. Wir kümmern uns.‘
„Arne, ruhig“, versuchte Greiner seinen Kollegen zu beschwichtigen.
„Nein!“, brüllte der zurück. Sein Zeigefinger schoss wie eine Überschallrakete auf Greiner zu. „Ich will den Scheißer haben und ihn in Stücke reißen.“
„Wir werden ihn finden, verhaften und vor Gericht stellen“, präzisierte Greiner, auch, um seinem Kollegen klarzumachen, über jedwede Form der Selbstjustiz nicht einmal nachzudenken.
Olofsen blies die Luft aus den Backen. „Natürlich.“
„Okay Leute, hier handelt es sich um einen Tatort.“ Eine neue, laute und kräftige Stimme mischte sich ein. Pall war eingetroffen. „Alle, die hier nichts zu suchen haben, sind bei drei draußen. Ich werde jetzt mein Luminol versprühen und ganz genau feststellen, was sich hier ereignet hat.“
„Moin Frank“, rief Greiner.
„Eins, zwei, drei“, zählte Pall und hielt unterstützend drei Finger in die Luft. „Jetzt raus mit euch.“
Olofsen nickte Pall kurz zu, griff nach Jacke und Handy und verließ das Haus. „Wenn du nur die kleinste Kleinigkeit übersiehst, nagele ich dich an die Kugelbake“, zischte er im Vorbeigehen.
„Ich übersehe nichts. Niemals“, entgegnete Pall und schlug Olofsen aufmunternd und schrittbeschleunigend auf die Schulter. „Raus jetzt. Wir haben zu arbeiten.“
Greiner fasste für Pall in kurzen Sätzen zusammen, was er von Olofsen erfahren hatte, dann ging auch er.
Draußen lehnte Olofsen an der Motorhaube von Greiners Wagen. Er bot einen bemitleidenswerten Anblick. Der kurze Wutausbruch im Haus schien ihm seine letzten Kräfte geraubt zu haben.
Greiner trat vor ihn und hielt ihm ein Schlüsselbund hin. „Die Kollegen fahren dich jetzt zu meiner Wohnung. Geh duschen, steck deinen Kopf in Eiswasser, dann komm in die Inspektion. Dort sehen wir weiter.“
Neunzig Minuten später betrat Olofsen die Cuxhavener Polizeiinspektion in der Werner-Kammann-Straße. Wie von Greiner vorgeschlagen, hatte er sich von einem der Streifenkollegen zu dessen Wohnung bringen lassen und sich dort lange unter die Dusche gestellt – abwechselnd heiß und kalt.
Er war tatsächlich zuvor noch nie privat bei Greiner gewesen und war, trotz der Tatsache, dass seine Gedanken ganz woanders waren, überrascht, wie gemütlich es sich sein Kollege in der kleinen Wohnung in Altenwalde eingerichtet hatte. Das Wohnzimmer dominierte ein riesiger Flachbildschirm, an den die allerneuste Play-station angeschlossen war, diverse Spiele lagen auf dem Boden, eine Virtual-Reality-Brille auf dem ansonsten leeren und blitzblanken Tischchen vor dem lederbezogenen Sofa.
Abgetrocknet und wieder angezogen, wenn auch in den schon zuvor getragenen und teils mit Hundeblut beschmierten Sachen, hatte er lange am Fenster gestanden und nach draußen gestarrt, ohne wahrzunehmen, was dort vor sich ging. Die Minuten verstrichen und der Nebel in seinem Kopf hatte sich Schwade für Schwade gelichtet. Es wurde Zeit, die Lähmung abzuschütteln und aktiv zu werden. Vorher musste er aber noch Sams Blut von seinen Schuhen wischen.
„Moin“, sagte Olofsen, als er den Besprechungsraum betrat. Ein paar Minuten zuvor hatte er von Greiner eine WhatsApp-Nachricht erhalten, dass man sich zusammensetzen wolle, um den Sachstand zu besprechen.
Nils Niklas Nunk, der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, ZKD, und damit Olofsens direkter Vorgesetzter, saß an einem Tisch. Da seine Vornamen und auch sein Nachname jeweils mit dem Buchstaben N begannen, wurde er hinter vorgehaltener Hand N-Kubik genannt. N und N und N gleich N hoch drei gleich N-Kubik.
„Moin“, erwiderte er den Gruß und erhob sich. „Kommst du klar?“
„Was wissen wir bislang?“ Olofsen ging nicht auf die Frage Nunks ein. Er zog lautstark einen Stuhl vor, drehte ihn um und setzte sich. Die Arme überkreuzte er auf der Lehne vor ihm.
„Tatsächlich nicht viel“, sagte Nunk. „Die Kollegen sollten in ein paar Minuten hier sein. Frank ist noch bei dir zu Hause. Aber ich werde ihn über Handy dazu holen. Vielleicht hat er bereits Erkenntnisse, die uns einen ersten Anhaltspunkt zu den Ereignissen geben.“
Olofsen nickte.
„Kaffee?“, erkundigte sich Nunk.
Abermals nickte Olofsen.
Als wäre es abgesprochen gewesen, betraten Greiner und Frauke Nilsson, die Pressesprecherin, den Besprechungsraum. Greiner trug ein Tablett mit Tassen, Nilsson zwei gefüllte Thermoskannen. „Hier kommt der Hirnstarter“, rief er.
„Perfektes Timing“, lobte Nunk und stellte Dosenmilch und Zucker vom Sideboard hinter ihm in die Mitte des Tisches. Nach und nach trafen weitere Beamte ein. Der Raum füllte sich, aber – anders als sonst – blieb es still. Konzentration und Beklemmung lagen zu gleichen Teilen in der Luft. Entführungen bedeuteten immer schwierige Ermittlungen, vieles musste schnell und manchmal ohne Kenntnis der vollständigen Sachlage entschieden werden, und nun war einer der ihren direkt betroffen. Das bedeutete gleichzeitig Ansporn und Zurückhaltung für alle.
Greiner verteilte Tassen, die Kollegen gossen sich Kaffee ein, Nunk nestelte an dem Lautsprecher, mit dem er sein Handy verbunden hatte. Kurz darauf stand die Verbindung, Palls Stimme ertönte quäkend aus dem Lautsprecher. „Kann’s losgehen?“
„Ja, fangen wir an“, bestätigte Nunk. Sofort verstummten alle leisen Unterhaltungen. „Wie es scheint, wurde Arnes Haus von bislang unbekannten Personen betreten, seine Partnerin wurde entführt und der Hund der beiden schwer verletzt. Das Tier befindet sich bereits – dank der Nachbarn – in bester tiermedizinischer Versorgung. Von Paula dagegen fehlt jede Spur.“
Die Anspannung war im Raum förmlich spürbar.
„Frank, was kannst du uns zum jetzigen Zeitpunkt berichten?“, fragte Nunk.
„Nicht viel“, wiederholte der Angesprochene Nunks Worte von kurz zuvor. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns und ...“
„Komm zum Punkt“, drängte Olofsen. „Hast du etwas finden können oder nicht?“
Pall hatte Empathie genug, sich in dieser Situation nicht auf einen Disput mit Olofsen einzulassen. „Wir können mit Sicherheit sagen, dass weder die Haustür noch die Seitentür gewaltsam geöffnet wurden.“
„Die Seitentür war nur angelehnt, als ich nach Hause kam“, sagte Olofsen. „Sofern Paula oder ich zu Hause sind, ist die Tür tagsüber nie abgeschlossen.“
„Theoretisch könnte also jeder bei euch hereinspazieren?“, fragte Greiner.
Olofsen nickte mit dem Kopf. „Theoretisch ja.“
„Okay, dann lautet die Arbeitshypothese, dass die Kidnapper durch die unverschlossene Seitentür ins Haus gekommen sind“, sagte Pall.
„Wir reden über Entführung“, sagte Greiner und blickte Olofsen an. „Ich weiß, du wirst die Frage nicht mögen – aber könnte es einen anderen Grund geben, dass Paula nicht zu Hause war?“
Normalerweise wäre Olofsen jetzt aufgesprungen und hätte Greiner lautstark verbal zusammengefaltet, aber er wusste, dass sein Kollege diese Frage stellen musste. „Nein. Es gibt keinen anderen Grund, der ihre Abwesenheit erklären könnte. Wir hatten noch miteinander telefoniert. Sie erwartete mich. Warum sollte sie auch erst Sam schwer verletzen und dann abhauen?“
„Guter Punkt“, sagte Nunk mit ruhiger Stimme. Bedächtig nahm er einen Schluck Kaffee aus seiner Tasse. Nicht hektisch oder hitzig werden, das war seine Devise. Er wusste, wie schnell in einem solchen Fall die Gemüter hochkochen konnten.
„Damit ist und bleibt eine Entführung unsere Arbeitshypothese“, fasste Greiner zusammen.
Einer der anderen Beamten meldete sich zu Wort: „Wir haben die Nachbarn befragt, aber niemand hat etwas Auffälliges gesehen oder gehört. Allerdings fahren dort täglich unzählige Kleintransporter durch die kleinen Straßen, in die man die Frau hätte sperren können. Meist handelt es sich um Handwerker oder Lieferdienste. Niemand schaut mehr genau hin.“
„Danke für die Info“, sagte Nunk.
„Ein weiteres Dutzend Kollegen haben die Gärten und die nähere Umgebung durchkämmt. Nichts.“
„Wer steckt dahinter?“ Olofsen klang noch immer ruhig und gefasst.
Nunk massierte seine Schläfen. „Ich fürchte, bei dieser Frage tappen wir in tiefer Finsternis.“
„Hat es in letzter Zeit Drohungen oder Anfeindungen gegeben?“, fragte jemand.
„Nein, gar nichts“, sagte Olofsen. „Natürlich habe ich in den Jahren hier so einige kriminelle Gestalten eingebuchtet, aber mir fällt da auf Anhieb niemand ein, dem ich eine solche Nummer zutrauen würde. Wenn, dann würden die mich eher direkt angehen, aber nicht die Angehörigen. Das ist unterste Schublade.“
„Das weiß man leider immer erst später“, merkte Nunk an.
„Wir gehen die alten Fälle von Arne noch einmal durch und prüfen, ob es da einen Kandidaten für eine Entführung geben könnte.“ Greiner gab zwei der Kollegen ein Zeichen, die sofort Zustimmung bekundeten.
Frauke Nilsson räusperte sich. „Ich werde die sozialen Medien durchkämmen. Es mag unwahrscheinlich sein, aber vielleicht brüstet sich jemand mit der Tat. Bitte vergesst aber nicht, dass es die Suche nach einer klitzekleinen Nadel in einem riesigen Heuhaufen ist.“
Olofsen warf die Hände in die Luft. „Wir müssen irgendeinen Anhaltspunkt finden. Wir müssen irgendetwas machen und nicht nur hier herumsitzen und Kaffee trinken. Es geht hier um Paula.“
Nunk beugte sich vor. „Beruhige dich, Arne. Uns allen ist die Schwierigkeit dieser Situation vollkommen bewusst. Aktionismus bringt uns aber nicht weiter. Ich fürchte, wir müssen warten. Entweder, bis sich die Entführer melden und uns ihre Forderungen mitteilen, oder bis Frank etwas findet, das uns auf eine konkrete Spur bringt.“
„Das ist alles Mist!“ Olofsen sprang auf. Dabei riss er seine Kaffeetasse um, sodass die schwarze Flüssigkeit herausspritzte. Die Tasse rutschte über die Tischkante und zerbarst am Boden. Obwohl dies eines von Olofsens typischen Missgeschicken war und sonst immer Anlass zur Heiterkeit gab, sagte in diesem Moment niemand ein Wort. Eigentlich durfte Olofsen hauseigenes Porzellan nicht einmal mehr anfassen – zu hoch war die Verlustrate. Vor einiger Zeit hatten die Kollegen ihm einen unkaputtbaren Hartplastikpott samt Deckel und Trinkhalm geschenkt. Allerdings war heute versehentlich eine normale Tasse vor ihm gelandet.
Nachdem er ein Taschentuch aus seiner Hosentasche gekramt hatte, wischte Olofsen wenig effektiv durch die Kaffeepfütze. „Sorry“, murmelte er.
„Ich klinke mich aus und arbeite weiter“, unterbrach Pall die Stille. „Wenn wir hier fertig sind, machen wir im Labor weiter. Wir werden einen Anhaltspunkt finden – und wenn es die ganze Nacht dauert. Versprochen.“
„Okay, wir gehen jetzt die alten Fälle durch und warten ansonsten entweder auf Frank oder eine Mitteilung der Entführer. Mehr können wir nicht tun“, resümierte Nunk.
„Was ist mit der Presse?“, fragte Frauke Nilsson.
Nunk überlegte kurz. „Absolutes Stillschweigen. Keine Mitteilung, keine Reaktion, sollte es Anfragen geben.“
Nilsson verließ den Raum.
Greiner stand auf und blickte aus dem Fenster. Draußen war es mittlerweile dämmrig geworden. Erstaunt sah er auf die Uhr – fast halb zehn am Abend. „Wo bleibst du heute Nacht?“, fragte er an Olofsen gewandt.
Der sah sich irritiert um. „Natürlich hier – wo denn sonst? Ich will wissen, wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt. Notfalls schlafe ich in einer Arrestzelle – wenn ich überhaupt ein Auge zubekomme.“
„Ich verstehe“, sagte Nunk mit ruhiger Stimme. „Auch, wenn ich die Idee nicht gut finde. Wir müssen alle fit sein, um klar denken und die richtigen Entscheidungen treffen zu können.“ Er wandte sich an Greiner. „Martin, ich möchte, dass du diese Ermittlung leitest.“
Olofsen drehte sich ruckartig seinem Chef zu. „Und was ist mit mir?“
„Arne, du kennst die Regeln“, sagte Nunk. „Du bist persönlich betroffen, du bist befangen. Du darfst die Ermittlungen nicht leiten und ...“, hier wurde seine Stimme schärfer, „du wirst sie nicht leiten. Wir schließen dich nicht aus, dein Wissen und dein Input sind stets willkommen, aber Martin wird die Entscheidungen treffen.“
„Aber ...“, setzte Olofsen an.
„Nein, Arne. Punkt.“ Nunk verschränkte die Arme.
In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Besprechungsraum und Joachim Tinsch, der Leiter der Polizeiinspektion, trat ein. Mit einem leisen Klicken schloss er die Tür hinter sich und sah sich im Raum um. „Guten Abend, meine Herren.“
Die Anwesenden nickten ihm zu.
„Herr Olofsen, zusammen schaffen wir es“, sagte Tinsch mit seiner ruhigen Baritonstimme. „Im gesamten Landkreis Cuxhaven gibt es keinen Beamten, der nicht auf der Suche nach Ihrer Partnerin ist. Wir werden sie finden.“
„Danke.“ Es war beileibe keine mitreißende Ansprache gewesen – wofür Tinsch nun einmal nicht bekannt war –, aber dennoch war Olofsen gerührt.
„Wir haben bereits den originalen Drohbrief, der bei Ihnen zu Hause auf dem Tisch gefunden wurde, zu tiefer gehenden chemischen und graphologischen Untersuchungen per Eilboten ins Labor nach Oldenburg bringen lassen. Sie sehen, es vergeht keine Sekunde, in der die Kollegen nicht mit vollem Einsatz dabei sind.“
Olofsen wusste nicht, was er sagen sollte. Sein Mund war staubtrocken.
„Ich habe soeben Hauptkommissar Greiner die Leitung der Ermittlungen übertragen“, informierte Nunk den Inspektionsleiter.
„Sehr gut.“
Olofsens Handy läutete. Der Ton klang schrill und durchdringend. „Entschuldigung, ich hatte vergessen ...“
„Nehmen Sie das Gespräch an“, sagte Tinsch. „Es könnte wichtig sein.“
Olofsen folgte der Aufforderung. „Hallo?“
„Wollen Sie Ihre Braut wiederhaben?“, fragte eine elektronisch verzerrte Stimme.
Olofsens Herzschlag setzte einmal aus, dann drückte er mit dem Daumen das Symbol für die Lautsprecherwiedergabe auf dem Display, mit der anderen Hand schlug er auf die Tischplatte. Schlagartig hatte er die volle Aufmerksamkeit im Raum.
„Wer sind Sie?“, fragte er mit bebender Stimme. „Lassen Sie Paula sofort gehen.“
Ein heiseres, verzerrtes Lachen erklang.
„Was wollen Sie?“, setzte Olofsen in scharfer Tonlage nach.
Der andere antwortete mit einem Zischlaut. „Du willst wissen, was ich will? Okay, dann hört mir jetzt ganz genau zu, denn ich werde es nur einmal sagen.“
Nunk, Greiner und Tinsch drängten sich neben dem Tisch, auf dem das Handy lag. Keiner von ihnen wollte auch nur eine Silbe versäumen. Geistesgegenwärtig legte Greiner sein eigenes Handy daneben und aktivierte die Aufzeichnungsfunktion, um das Gespräch aufzunehmen.
Olofsen standen schlagartig kleine Schweißperlen auf der Stirn, obwohl es im Raum eigentlich kühl war. „Raus mit der Sprache, du Dreckskerl“, zischte er mit zusammengepressten Lippen.
Im Lautsprecher ertönte für einige Sekunden nichts als ein Rauschen, dann war die Stimme wieder da. „Ich will eine Probe von dem Virus haben.“
„Was für ein Virus?“, fragte Olofsen. Er verstand gar nichts.
„Das modifizierte Hantavirus, das von dem unlängst verstorbenen, aber nichtsdestotrotz genialen Wissenschaftler Doktor Finn Berger erzeugt wurde“, sagte der andere. „Ich denke, Sie wissen, wovon ich spreche.“
Olofsen lief es kalt den Rücken herunter. Schlagartig erinnerte er sich an diesen Fall. Drei skrupellose Wissenschaftler hatten in einem ebenso heimlich wie illegal aufgebauten Labor im Hafen die Wildform des Hantavirus mit ebenso genialen wie für den Fachmann simplen molekularbiologischen Methoden verändert und es so zu einer höchst gefährlichen Biowaffe gemacht. Zwei der drei Forscher waren damals ums Leben gekommen, der dritte saß in Bremervörde für viele Jahre im Gefängnis. Die drei hatten im Auftrag einer international agierenden kriminellen Organisation gehandelt, dessen Anführer nur als ‚Der Brite‘ bekannt war. Olofsen war es damals gelungen, ein hochrangiges Mitglied dieser Organisation, der die Geschäfte mit den drei Wissenschaftlern in Cuxhaven gemanagt hatte, nach einer wilden Verfolgungsjagd durch den neuen Fischereihafen zu verhaften.
Das Virus war damals sichergestellt und der seriösen Wissenschaft zur genauen Analyse übergeben worden. Für Olofsen war der Fall damit abgeschlossen gewesen. Allerdings war die Organisation des Briten nicht zerstört worden – und allem Anschein nach war diese gerade wieder aktiv geworden, um sich zu holen, was sie damals nicht bekommen hatte.
„Ihr Scheißkerle“, fluchte Olofsen.
„Das ist Ansichtssache“, erwiderte der Unbekannte süffisant. Dann wurde seine Stimme abermals hart. „Das Virus gegen Ihre Partnerin. Sie haben ab Mitternacht zweiundsiebzig Stunden Zeit, es zu beschaffen und nach meinen Anweisungen zu übergeben. Läuft die Frist ab, ohne dass ich das Virus in Händen halte, stirbt sie. Langsam, qualvoll, schmerzhaft. Wollen Sie das?“
Olofsens Mund entwich ein Schmerzensschrei. Nein, das wollte er nicht.