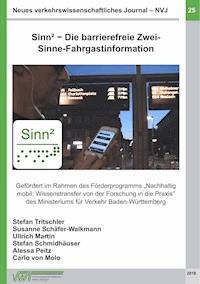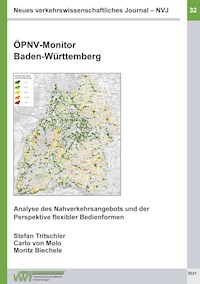
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Neues verkehrswissenschaftliches Journal
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende ÖPNV-Monitor Baden-Württemberg verfolgt zwei Ziele: Die Analyse und Visualisierung des aktuellen Bedienungsangebots des ÖPNV in Baden-Württemberg, um Bedienungslücken zu identifizieren und Handlungsbedarfe aufzuzeigen sowie die Erfassung und Analyse des Angebots und der Ausgestaltung flexibler Bedienformen. Dazu wurde im Herbst 2019 eine umfassende skriptbasierte Abfrage der elektronischen Fahrplanauskunft Baden-Württemberg durchgeführt sowie im Sommer 2020 das Angebot flexibler Bedienformen bei den Landkreisen erhoben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Die vorliegende Untersuchung wurde 2019 von der NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium ausgeschrieben und Ende 2020 durch die VWI GmbH als durchführendes Institut abgeschlossen.
Erster Schwerpunkt der Studie war, ein besseres Verständnis für den Handlungsbedarf für ein räumlich und zeitlich umfassendes ÖPNV-Angebot im Land zu erhalten. Vorab wurde dieser vor allem in den ländlichen Räumen vermutet. Aus dieser Überlegung heraus wurden einige methodische Festlegungen zur Ausrichtung der Untersuchung getroffen. Dazu gehören etwa der Verzicht auf eine Betrachtung größerer Städte, die getrennte Auswertung für Schultage und schulfreie Tage sowie die zusammenfassende Betrachtung aller Fahrten pro Siedlungsbereich.
Konzeption und Durchführung fielen in die inzwischen abgeschlossene Legislaturperiode. Mit dem neuen Koalitionsvertrag 2021-26 gibt es inzwischen anspruchsvollere Ziele hinsichtlich des als „Mobilitätsgarantie“ kommunizierten Angebotsausbaus. Die zeitlich angestrebte Abdeckung der Mobilitätsgarantie - „Erreichbarkeit von früh bis spät“ - ist jedoch unverändert geblieben. In der vorliegenden Studie lag der Schwerpunkt auf der zeitlichen Verteilung des Fahrtenangebots, nicht auf der Fahrplandichte. Die Analyseergebnisse sind daher im Grundsatz weiter aktuell.
Mit der Detailanalyse flexibler Verkehre als zweitem Schwerpunkt schafft die Untersuchung die Grundlagen für Verbesserungen, indem sie etwa unzureichend publizierte Verkehre identifiziert und Möglichkeiten zur Harmonisierung der Angebote deutlich macht. Die Untersuchung kann und soll die Planung vor Ort nicht ersetzen, gibt aber viele konkrete Hinweise, wo damit sinnvoll angesetzt werden kann.
An dieser Stelle ist daher sowohl den Befragten in den Landkreisen als auch dem Team des VWI für Fleiß und Gründlichkeit beim Zusammentragen der vielen Details und die anschauliche Aufbereitung zu danken.
Stuttgart, im Dezember 2021
Dr. Martin Schiefelbusch (Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH)
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Kurzfassung
Einführung
1.1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung
1.2 Flexible Bedienformen
1.3 Aufbau des Dokumentes
Ermittlung und Analyse des aktuellen Leistungsumfangs des ÖPNV-Bedienungsangebotes
2.1 „Mobilitätsoffensive“ des Landes Baden-Württemberg
2.2 Studie Verkehrsbild Deutschland – Angebotsqualitäten und Erreichbarkeiten im öffentlichen Verkehr
2.3 Vorgehensweise zur Erfassung des ÖV-Angebots und der Siedlungsdaten
2.4 Erfassung von Siedlungsdaten und Abgrenzung der Siedlungsbereiche
2.4.1 Vorgehensweise
2.4.2 Aufbau eines Geoinformationssystems
2.4.3 Visualisierung der Siedlungsgebiete in Baden-Württemberg
2.5 Erfassung des ÖV-Angebots
2.5.1 Vorgehensweise zur Erfassung und Aufbereitung der ÖPNV-Daten
2.5.2 Erster Datenabgriff Landesdatendrehscheibe
2.5.3 Zweiter Datenabgriff Landesdatendrehscheibe
2.5.4 Flexible Bedienformen in der Landesdatendrehscheibe
2.5.5 Bei der automatischen Abfrage nicht erfasste flexible Bedienformen
2.6 Zusammenführung von ÖV-Angebot und Siedlungsdaten
2.7 Zeitlückenauswertung
2.7.1 Datenauswertung – Vorgehensweise
2.7.2 Grenzen der Datenauswertung am Beispiel einer Ringlinie
2.8 Visualisierung des Bedienungsangebotes nach Zeitlückenauswertung
2.8.1 Erste Analyse und Einteilung
2.8.2 ÖV-Bedienungsangebot (Werktag)
2.8.3 ÖV-Bedienungsangebot (Werktag/Ferien)
2.8.4 ÖV-Bedienungsangebot (Samstag)
2.8.5 ÖV-Bedienungsangebot (Sonntag)
2.8.6 Ergebnisübersicht der Zeitlückenauswertung der 3.248 Siedlungsbereiche
2.8.7 Sonderfall: Siedlungsbereiche in Baden-Württemberg gänzlich ohne ÖPNV Bedienung
Handlungsbedarf zur Umsetzung der „Mobilitätsoffensive“
3.1 Vorbemerkung: Zeitlücken- vs. Zeitscheibenauswertung
3.2 Zeitscheibenauswertung
3.2.1 Tagesganglinien
3.2.2 Clusterbildung mittels Bedienungsklassen
3.2.3 ÖV-Bedienungsklassen (Werktag)
3.2.4 ÖV-Bedienungsklassen (Werktag/Ferien)
3.2.5 ÖV-Bedienungsklassen (Samstag)
3.2.6 ÖV-Bedienungsklassen (Sonntag)
3.2.7 Zwischenergebnis Zeitscheibenauswertung
3.3 Vergleich: Zeitlücken- vs. Zeitscheibenauswertung
3.3.1 Vorbemerkung Vergleich
3.3.2 Zeitlücken- vs. Zeitscheibenauswertung (Werktag)
3.3.3 Zeitlücken- vs. Zeitscheibenauswertung (Werktag/Ferien)
3.3.4 Zeitlücken- vs. Zeitscheibenauswertung (Samstag)
3.3.5 Zeitlücken- vs. Zeitscheibenauswertung (Sonntag)
3.3.6 Zusammenfassung
3.4 Clusteranalyse zur Identifikation räumlicher Zusammenhänge
3.5 Zusammenfassung des Handlungsbedarfes und Vorschlag eines Stufenkonzepts zur Umsetzung der „Mobilitätsoffensive“
Ausgestaltung und Umfeld flexibler Bedienformen
4.1 Vorgehensweise
4.2 Bestandsaufnahme des Angebots flexibler Bedienformen in Baden-Württemberg: Schriftliche Befragung der Landkreise
4.2.1 Vorbemerkung
4.2.2 Aufbau des Fragebogens der schriftlichen Landkreisbefragung
4.2.3 Auswertung der schriftlichen Landkreisbefragung
4.2.4 Zwischenergebnis der schriftlichen Landkreisbefragung
4.3 Formen und Standards der Umsetzung auf Anbieter- und Aufgabenträgerseite: Telefonische Landkreisbefragung
4.3.1 Vorbemerkung
4.3.2 Aufbau des Fragebogens der telefonischen Landkreisbefragung
4.3.3 Auswertung der telefonischen Landkreisbefragung
4.4 Fazit der schriftlichen und telefonischen Befragungen
4.5 Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten flexibler Bedienformen
4.5.1 Überblick
4.5.2 Beispiele von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten flexibler Bedienformen auf Länderebene
4.5.3 Besondere Förderung flexibler Bedienformen durch Landkreise, Beispiel Ortenaukreis
4.6 Exkurs: Vergleich verschiedener Zielkonzepte mit unterschiedlichem Umfang flexibler Verkehre
4.7 Rechtlicher Rahmen der wettbewerblichen Vergabe flexibler Verkehre
4.7.1 Nationale Gesetzgebung
4.7.2 Europäische Gesetzgebung
4.8 Entwicklung flexibler Bedienformen zu bedarfsgesteuerter Mobilitätsdienstleistungen: Ridepooling
Zusammenfassung und Fazit
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Drei typische Grundtypen der flexiblen Bedienformen
Abbildung 2: Aufbau und Zusammenhang der Kapitel 2 und 3
Abbildung 3: Erfassung der Siedlungsdaten und Abgrenzung der Siedlungsbereiche
Abbildung 4: Beispiel der Clusterbildung von Zensus-Zellen zu Siedlungsbereichen
Abbildung 5: Relevante Siedlungsbereiche in Baden-Württemberg
Abbildung 6: Beispielhafte Filterung von zu großen und zu kleinen Siedlungsbereichen
Abbildung 7: Erfassung des ÖV-Angebotes
Abbildung 8: Ungültige Haltestellenangabe nach Text-Suche „(Haltestelle)“ in der EFA-BW am Beispiel Spaichingen Burger, Code de:08327:1507
Abbildung 9: Suche nach Haltestellen-ID – mehrere Haltestellen vorhanden
Abbildung 10: VVS-Suche – doch Abfahrten vorhanden
Abbildung 11: Zusammenführung des ÖV-Angebotes und der Siedlungsdaten.
Abbildung 12: Abfrage der Bedienungshäufigkeit der relevanten Siedlungsbereiche
Abbildung 13: Beispiel-Auswertung Ringlinie 13 bis 17 Uhr nach Siedlungsbereich
Abbildung 14: Bildung von Stufen zur Ableitung eines Stufenkonzeptes
Abbildung 15: Visualisierung des Bedienungsangebots (Zeitlückenauswertung Werktag)
Abbildung 16: Häufigkeitsverteilung der Stunden ohne Bedienung (Werktag)
Abbildung 17: Durchschnittliche Stunden ohne Bedienung nach der Größe des Siedlungsbereichs (Werktag)
Abbildung 18: Visualisierung des Bedienungsangebots (Zeitlückenauswertung Werktag/Ferien)
Abbildung 19: Häufigkeitsverteilung der Stunden ohne Bedienung (Werktag/Ferien)
Abbildung 20: Durchschnittliche Stunden ohne Bedienung nach der Größe des Siedlungsbereichs (Werktag/Ferien)
Abbildung 21: Visualisierung des Bedienungsangebots (Zeitlückenauswertung Samstag)
Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung der Stunden ohne Bedienung (Samstag)
Abbildung 23: Durchschnittliche Stunden ohne Bedienung nach der Größe des Siedlungsbereichs (Samstag)
Abbildung 24: Visualisierung des Bedienungsangebots (Zeitlückenauswertung Sonntag)
Abbildung 25: Häufigkeitsverteilung der Stunden ohne Bedienung (Sonntag)
Abbildung 26: Durchschnittliche Stunden ohne Bedienung nach der Größe des Siedlungsbereichs (Sonntag)
Abbildung 27: Tagesganglinie (Werktag)
Abbildung 28: Tagesganglinie (Werktag/Ferien)
Abbildung 29: Tagesganglinie (Samstag)
Abbildung 30: Tagesganglinie (Sonntag)
Abbildung 31: Visualisierung der ÖV-Bedienungsklassen (Zeitscheibenauswertung Werktag)
Abbildung 32: Visualisierung der ÖV-Bedienungsklassen (Zeitscheibenauswertung Werktag/Ferien)
Abbildung 33: Visualisierung der ÖV-Bedienungsklassen (Zeitscheibenauswertung Samstag)
Abbildung 34: Visualisierung der ÖV-Bedienungsklassen (Zeitscheibenauswertung Sonntag)
Abbildung 35: Verteilung der Klassen der Siedlungsbereiche nach Wochentag
Abbildung 36: Zeitlückenauswertung (Kartenausschnitt Werktag)
Abbildung 37: Zeitscheibenauswertung (Kartenausschnitt Werktag)
Abbildung 38: Zeitlückenauswertung (Kartenausschnitt Werktag/Ferien)
Abbildung 39: Zeitscheibenauswertung (Kartenausschnitt Werktag/Ferien)
Abbildung 40: Zeitlückenauswertung (Kartenausschnitt Samstag)
Abbildung 41: Zeitscheibenauswertung (Kartenausschnitt Samstag)
Abbildung 42: Zeitlückenauswertung (Kartenausschnitt Sonntag)
Abbildung 43: Zeitscheibenauswertung (Kartenausschnitt Sonntag)
Abbildung 44: Beispiel Clusterbildung (Zeitscheibenauswertung, Kartenausschnitt Werktag)
Abbildung 45: Frageblock I der schriftlichen Befragung
Abbildung 46: Frageblock II der schriftlichen Befragung
Abbildung 47: Frageblock III der schriftlichen Befragung
Abbildung 48: Betreiberunternehmen
Abbildung 49: Abrufbarkeit der Fahrpläne
Abbildung 50: Art des Verkehrs
Abbildung 51: Art des Betriebes
Abbildung 52: Haustürbedienung
Abbildung 53: Tarife
Abbildung 54: Möglichkeiten der Fahrtenbuchung
Abbildung 55: Erreichbarkeit der Buchungsstelle
Abbildung 56: Erreichbarkeit der Buchungsstelle (gröbere Sichtweise)
Abbildung 57: Anmeldefrist
Abbildung 58: Genehmigungsbehörde
Abbildung 59: Regierungspräsidien als Genehmigungsbehörden
Abbildung 60: Ausschreibungen und Betreibersuche
Abbildung 61: Zentrale Bestellannahme und Disposition
Abbildung 62: Dispositionssoftware
Abbildung 63: Ausstattung mit mobilen Endgeräten
Abbildung 64: Übermittelte Daten
Abbildung 65: Genauigkeit der übermittelten Daten
Abbildung 66: Ausstattung mit Geräten zur Ausstellung von Verbundfahrscheinen
Abbildung 67: Abrechnung mit den beauftragten Fuhrunternehmern
Abbildung 68: Ansprechpartner der Fahrgäste bei Ausfall der Fahrleistung
Abbildung 69: Separate Erfassung der mit flexiblen Bedienformen erbrachten Verkehrsleistung
Abbildung 70: Aufwand für die Angebote an flexiblen Verkehren
Abbildung 71: Fördermöglichkeiten für flexible Verkehre
Abbildung 72: Zukunftsfähigkeit flexibler Verkehre
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Beispiel-Auswertung Ringlinie 13 bis 17 Uhr nach Siedlungsbereich
Tabelle 2: Bedienungsangebot (Werktag)
Tabelle 3: Bedienungsangebot (Werktag/Ferien)
Tabelle 4: Bedienungsangebot (Samstag)
Tabelle 5: Bedienungsangebot (Sonntag)
Tabelle 6: Ergebnisübersicht der Zeitlückenauswertung der 3.248 Siedlungsbereiche
Tabelle 7: Ergebnisübersicht Siedlungsbereiche ohne jede ÖV-Bedienung...
Tabelle 8: Linienverkehr vs. Mietwagen
Kurzfassung
Ausgehend von der 2016 im Koalitionsvertrag verankerten Mobilitätsoffensive des Landes Baden-Württemberg, ergibt sich das operative Ziel eines landesweit flächendeckenden und ganztägigen Basisangebots im Stunden-Takt von 5 bis 24 Uhr an Werktagen sowie am Samstag von 6 bis 24 und an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 24 Uhr. Der vorliegende ÖPNV-Monitor Baden-Württemberg verfolgt zwei Ziele: Die Analyse und Visualisierung des aktuellen Bedienungsangebots des ÖPNV in Baden-Württemberg, um Bedienungslücken zu identifizieren und Handlungsbedarfe aufzuzeigen sowie die Erfassung und Analyse des Angebots und der Ausgestaltung flexibler Bedienformen.
Zur Erreichung der beiden Ziele wurde im ersten Teil der Untersuchung eine umfassende skriptbasierte Abfrage der elektronischen Fahrplanauskunft Baden-Württemberg (EFA-BW) im Herbst 2019 durchgeführt und das aktuelle ÖPNV-Angebot dargestellt. Die folgende Analyse zeigt im Ergebnis,
An Werktagen wird in rund 55 % der untersuchten Siedlungsbereiche der geforderte Standard erreicht bzw. nahezu erreicht; während nur rund 4 % der Siedlungsbereiche mehr als 10 Stunden ohne Bedienung sind.
An Wochenenden wird das Bedienungsangebot generell ausgedünnt und sonntags erfüllen nur noch 36 % der Siedlungsbereiche den geforderten Standard, während rund 33 % der Siedlungsbereiche mehr als 10 Stunden ohne Bedienung sind.
Werktags sind vor allem in den Früh- und Abendstunden Bedienungslücken vorhanden.
Samstags und sonntags verteilen sich die Bedienungslücken über den ganzen Tag.
Es ergibt sich ein räumlicher und zeitlicher Zusammenhang von Angeboten mit vergleichbaren Bedienungslücken, so dass Clusterbildungen als Ansatzpunkt für Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.
Der zweite Teil der Untersuchung zeigt, dass das Angebot flexibler Bedienformen zum Erfassungszeitraum im Sommer 2020 über 800 Linien in Baden-Württemberg umfasst,wovon über 80 % (~650 Linien) in EFA-BW eingepflegt und etwa 20 % (~160 Linien) zum Befragungszeitpunkt nicht über EFA-BW abrufbar waren.
Die flexiblen Verkehre in Baden-Württemberg entsprechen überwiegend einer „klassischen“ Ausrichtung, d. h.
eine Fahrtanmeldung kann überwiegend nur telefonisch durchgeführt werden,
die Anmeldefristen betragen meist bis zu 60 Minuten vor Fahrtbeginn,
i. d. R. ist ein Aufschlag zum jeweiligen Verbundtarif zu entrichten,
eine Beförderung von Haustüre zu Haustüre bzw. von Haltestelle zu Haustüre oder umgekehrt wird nur bei rund einem Fünftel der flexiblen Verkehre in Baden-Württemberg angeboten.
Insgesamt wird deutlich, dass aktuelle technische Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung derzeit nur wenig genutzt werden und für hochflexible Verkehre wie „Ridepooling“ bislang nur wenige Beispiele vorhanden sind.
Die entwickelten Instrumente erleichtern die Abfrage und die Auswertung des Nahverkehrsangebots in Baden-Württemberg deutlich. Eine Verstetigung der Auswertung im Sinne eines regelmäßigen „ÖPNV-Monitoring“ bietet sich zur weiteren Steigerung der Aussagekraft der Ergebnisse an.
1 Einführung
1.1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung
Mobilität ist einerseits für die Gesellschaft ein wichtiges Element der persönlichen Freiheit und einer der wichtigsten Wirtschafts- und Standortfaktoren, andererseits machen sich die Auswirkungen des demografischen Wandels an den Rändern der Ballungsräume bemerkbar, so dass dort aus Kostengründen das Angebot im öffentlichen Verkehr abgebaut und damit Schrumpfungsprozesse und negative sozialpolitische Effekte im ländlichen Raum verstärkt werden.
Im Rahmen der im Koalitionsvertrag verankerten Weiterentwicklung des Verkehrsangebots in Baden-Württemberg, der „Mobilitätsoffensive“, wurde nun das Ziel festgehalten, dass „alle Ortschaften im Land entsprechend der für den Schienenpersonennahverkehr und die Regiobuslinien geltenden Standards an allen Tagen bis abends im Stundentakt mit dem ÖPNV erreichbar sind“.1
Dieses Leitbild eines flächendeckenden und ganztägigen Basisangebots im ganzen Land im Stunden-Takt von 5 bis 24 Uhr (Montag bis Freitag; samstags 6 bis 24 Uhr, sonntags 7 bis 24 Uhr) kann nur mit einer geeigneten Mischung aus klassischem ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) und geeigneten flexiblen Bedienformen erreicht werden. Zudem wird sich bei der angenommenen Reduktion der Fahrgastzahlen im ländlichen Raum laut der Studie „Finanzierungsbedarf des ÖPNV bis 2025“ 2 aus dem Jahr 2009 der Zuschussbedarf zur Aufrechterhaltung des ÖPNV in der Fläche um rund 50 % erhöhen.
Zu den genannten bedarfsorientierten flexiblen Bedienungsformen, im folgenden Bericht kurz als flexible Bedienformen (FBF) bezeichnet, zählen Rufbusse, Anruf-Sammeltaxis, o. ä., deren Kennzeichen z. B. die Voraussetzung einer expliziten Anmeldung des Fahrtwunsches ist.3 Allerdings sind auf Landesebene keine hinreichend detaillierten und aktuellen Übersichten vorhanden. Dies liegt unter anderem daran, dass die Aufgabenträgerschaft für diese flexiblen Bedienformen in der Regel bei den Landkreisen und Kommunen liegt, die über die Jahre zusätzlich zu einigen bürgerschaftlich getragener Angeboten zahlreiche solcher Maßnahmen initiiert haben.
Die Entwicklung und Einführung solcher flexiblen Bedienformen, häufig auch als On- Demand-Verkehre bezeichnet, hat in den letzten Jahren zugenommen. Dies liegt einerseits am steigenden Kostendruck und Wunsch nach Individualisierung des Verkehrs, andererseits auch den mit der Digitalisierung mittlerweile zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Gerade letztere machen hochflexible Bedarfsverkehre, die auch als Ridepooling bezeichnet werden, erst möglich.
Es soll daher eine detaillierte Bestandsaufnahme der ÖPNV-Leistungen in Baden-Württemberg erfolgen, die zu den beiden Themenkomplexen
Umfang des ÖPNV-Angebots (angebotene Fahrplanleistungen derzeit) und für das Erreichen der o. g. Zielvorstellungen nötige Zusatzleistungen sowie
Umfang, Ausgestaltung und Qualität der Angebote im Bereich flexibler Bedienformen
einen qualifizierten Überblick zur Situation auf Landesebene und in den einzelnen Zuständigkeitsgebieten der Aufgabenträger liefert.
Im Anschluss an die Datenerfassung und Datenauswertung wird der Handlungsbedarf aufgezeigt und Empfehlungen zur Verbesserung ausgesprochen. Abschließend wird auf die Ausgestaltung der angebotenen flexiblen Verkehre eingegangen.
1.2 Flexible Bedienformen
Neben dem klassischen Linienverkehr, der das Rückgrat des ÖPNV ist, kommen in Baden-Württemberg flexible Bedienformen (FBF) bereits unter verschiedenen Bezeichnungen und in unterschiedlichsten Angebotsausprägungen im ÖPNV zum Einsatz.
Flexible Bedienformen sind Bedarfsverkehre, die ein Grundangebot des ÖPNV in Schwachlastzeiten und Schwachlasträumen mit kleinen Bussen oder Taxis sicherstellen, wenn ein klassischer Linienverkehr wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. In der Regel werden die Verkehre als Rufbusse oder Anrufsammeltaxis (AST) bezeichnet.
Grundsätzlich ist auch eine Kombination von Linien- und Bedarfsverkehr möglich. Dabei kann z. B. ein Hauptnetz als Verbindung zentraler Orte in klassischem Linienverkehr betrieben werden, während kleiner Orte abseits der Hauptverbindungen mit flexiblen Bedienformen erschlossen werden.
Die flexiblen Bedienformen sind entweder räumlich oder zeitlich flexibilisiert. Die räumliche Flexibilisierung betrifft die Verbindung zwischen Ein- und Ausstiegspunkt, die zeitliche Flexibilisierung betrifft den Grad der Fahrplanbindung.
Es können grundsätzlich drei Grundtypen der flexiblen Bedienformen unterschieden werden: Bedarfslinienbetrieb, Richtungsbandbetrieb und Flächenbetrieb.4 In manchen Publikationen wird zusätzlich der Sektorbetrieb genannt, bei dem im Gegensatz zum ähnlichen Richtungsbandbetrieb Start- und Zielhaltestelle in einem einzigen Verknüpfungspunkt zusammenfallen.5