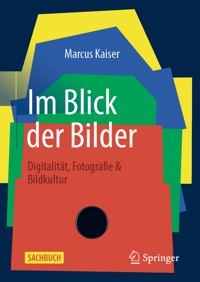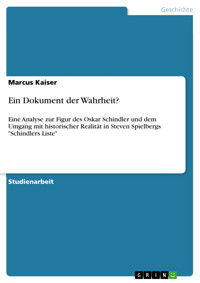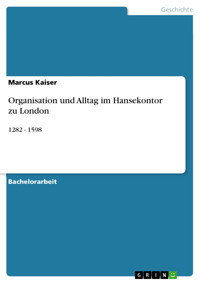
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,0, Universität Siegen (Fachbereich 1 ), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Hansekontor zu London, kurz "Stalhof", hat ab dem späten Mittelalter für mehr als 300 Jahre einen festen Platz im Herzen Londons, direkt am Ufer der Themse. Hier liegt der Dreh- und Angelpunkt für den Handel deutscher Kaufleute im Königreich England. Der Fernhandel im Ausland bietet in dieser Zeit die größten Chancen auf Profit und sogar unermesslichen Reichtum. Doch mit dem Warenumschlag in fremden Ländern sind auch enorme Risiken verbunden. Überfälle, Willkür des Adels, Verhaftung und Anklage bedrohen den Kaufmann ebenso wie die Unkenntnis der fremden Sprache und der ausländischen Sitten. Schutz vor diesen Gefahren bietet lediglich die Gemeinschaft und eine gute Organisation. In dieser Arbeit wird die Organisation des Kontors in London zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert eingehend untersucht. Hierbei entstehen detaillierte Einblicke in den Alltag der Kaufleute, die oft schon im Alter von 20 Jahren in die Megametropole London kommen um ihr Glück zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 2
Page 5
1. Einleitung
Hugo von Trimberg beschreibt in seiner Schrift „Der Renner“ die Stände der Gesellschaft im 13. Jahrhundert. Mit dem Vers„Pfaffen, ritter und gebûre / sint all gesippe von natûre“1nennt er die Komponenten der mittelalterlichen Trinitas2, ein Gesellschaftsmodell, das die Menschen in Beter, Krieger und Bauern unterteilt. Der Kaufmann befindet sich nicht darunter. Er entzieht sich der angenommenen gottgegebenen Dreieinigkeit innerhalb der Gesellschaft, steht außerhalb davon. Das gesamte Mittelalter hindurch sollte es nicht gelingen, ihn in diesem Modell
einzuordnen.3Die Kaufleute wurden mit dem im Handel erworbenen Wohlstand zu den Trägern der städtischen Selbstverwaltung und führten oftmals die ratsfähige
Oberschicht der bürgerlichen Kommunen an.4Ihr Reichtum sicherte ihnen somit eine Freiheit, die sich kaum jemand sonst in der mittelalterlichen Gesellschaft erträumen konnte.
Die profitabelste Variante des Handels war der Fernhandel, für den sich die Kaufleute in
Hansen zusammenschlossen.5Im deutschsprachigen Raum entwickelte sich hieraus im 14. Jahrhundert der Städtebund der Hanse.6
War der Handel im Ausland erfolgreich, erwarben die Kaufleute dort Grundbesitz und gründeten Niederlassungen, die späteren Kontore. Die wichtigsten innerhalb der Hanse
waren die Standorte in Novgorod, Bergen, Brügge und London.7
Allerdings bot der Fernhandel nicht nur die Aussicht auf Profit. Überfälle, Willkür des Adels, Verhaftung und Anklage konnten den Kaufmann ebenso bedrohen wie die Schwierigkeiten mit der fremden Sprache und Unkenntnis über die ausländischen
Sitten.8Schutz vor diesen Problemen bot lediglich die Gemeinschaft und eine gute Organisation.
1Zit. n. TRIMBERG, H. v., Der Renner, Hrsg. von Gustav Ehrismann, Bd. 1., Berlin 1970, S. 21, Vrs. 505.
2Vgl. MITSCH, R., Stand, Stände, -lehre, in: Auty, R. u. a. (Hrsg.), LdM, Bd. 8, München 1997, Sp. 45; s. a. BORST, O., Alltagsleben im Mittelalter, Frankfurt a. M. 1983, S. 56.
3Vgl. Ebd.
4Vgl. KELLENBENZ, H., Kaufmann, in: Auty, R. u. a. (Hrsg.), LdM, Bd. 5, München 1991, Sp. 1083-1085.
5Vgl. Ebd.
6Vgl. DOLLINGER, P., Die Hanse, Stuttgart 1998, S. 116.
7Vgl. Ebd., S. 132.
8Vgl. KELLENBENZ 1991, Sp. 1083-1085.
Page 6
In dieser Arbeit steht die Organisation der Niederlassung in London im Mittelpunkt der Betrachtung. Es soll die Frage geklärt werden wie die Administration des Hansekontors in London organisiert war. Im Detail soll dabei nicht allein der Inhalt der Statuten behandelt werden sondern auch die Frage, wer deren Urheber waren, welchen Zweck sie verfolgten und wie sie letztlich durchgesetzt wurden.
Zu diesem Zweck ist es notwendig, zunächst die Grundlagen der englisch-deutschen9Handelsbeziehungen zu untersuchen. Zentrale Aspekte sind hierbei die Herkunft der verschiedenen Handelsgemeinschaften, ihre Privilegierung durch den englischen König und eventuelle Bedingungen die hiermit verbunden waren. Diese werden im ersten Teil des einführenden Kapitels untersucht. Im zweiten Teil wird die Besitz- und Wohnsituation der Kaufleute diskutiert. Hierbei werden sowohl die kölnische Gildhalle als auch der später erworbene Stalhof behandelt.
Im folgenden Hauptteil wird die Administration des Kontors untersucht. Die Betrachtung wird hierbei auf den Zeitraum zwischen den Jahren 1282, dem Gründungsjahr des Hansekontors, und 159810, dem Jahr der Schließung des Stalhofs durch Elisabeth I.11, begrenzt.
Die Betrachtung beginnt an der Basis der Fernhandelsgemeinschaft, dem Zusammenschluss der einzelnen Kaufleute in Form der Vollversammlung. Hierbei werden - sofern diese bestanden - Kriterien für die Mitgliedschaft im Kontor untersucht und wie man diese Mitgliedschaft wieder verlieren konnte.
Der nächste logische Schritt ist die Herausarbeitung der Rechte und Pflichten des Kaufmanns, der zum Handel im Kontor zugelassen wurde. Der zentrale Aspekt hierbei ist die Einbindung des Einzelnen in die Administration des Kontors. Weiterhin wird der Kontorvorstand betrachtet, also durch wen die Gemeinschaft geleitet wurde und welche Funktionen der Vorstand ausübte. Die unterstützenden Ämter werden im Fall Londons von besonderer Bedeutung sein.
9Ank.: Zur Verbesserung des Leseflusses werden in dieser Arbeit die Kaufleute des Heiligen Römischen Reiches unabhängig von ihrer konkreten Herkunft über die gesamte Epoche hinweg als „Deutsche“ bezeichnet, auch wenn bis in das frühe 16. Jahrhundert hinein nur sehr bedingt von einer nationalen Zugehörigkeit gesprochen werden kann; Vgl. SEIBT, F., Glanz und Elend des Mittelalters, Eine endliche Geschichte, Berlin 1987, S. 150 f.
10Vgl. DOLLINGER 1998, S. 61.
11Vgl. Ebd., S. 443.
Page 7
Im Folgenden soll die Grundlage der Administration, die Kontorordnung, in ihren wesentlichen Punkten angesprochen werden. Interessant ist hierbei vor allem wie die Statuten durchgesetzt wurden, ob es in der Umsetzung in die Praxis Probleme gab und ob sie dauerhaft Bestand hatten.
Im letzten Teil wird die Administration auf mögliche externe Einflüsse untersucht, womit in erster Linie die Hansetage und die Vertreter der englischen Politik gemeint sind. Besonders für diesen Teil ist anzumerken, dass im Rahmen dieser Arbeit lediglich auf diejenigen historischen Ereignisse oder Entwicklungen eingegangen werden kann, die für das Verständnis der Arbeit unumgänglich sind und sich nicht aus dem Kontext erklären. Im Schlussteil werden die Ergebnisse der Untersuchung resümiert und analysiert.
Page 8
2. Quellenlage und Forschungsstand
Die hansischen Aktivitäten in London werden grundsätzlich durch einen reichhaltigen Fundus an Quellen dokumentiert. In dieser Arbeit werden hauptsächlich die Quelleneditionen Konstantin Höhlbaums12und Goswin von der Ropps13verwendet. In direktem Bezug auf die Urkunden des Kontors in London hat Johann Martin Lappenberg14zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine umfangreiche Edition herausgegeben. Diese enthält u. a. die ersten Statuten des Kontors, welche durch Rolf Sprandel15in einer korrigierten Version herausgegeben wurden. In dieser werden vor allem Datierungsfehler revidiert, die in der Ausgabe Lappenbergs zu finden sind und auf einer fehlerhaften Hamburger Handschrift beruhen.16In dieser Arbeit wird daher bevorzugt die neuere Ausgabe Sprandels verwendet.
Hinsichtlich der weitgehend guten Quellenlage bestehen allerdings zwei größere zeitliche und thematische Lücken. Dies betrifft zum einen die Organisation der Kontorgemeinschaft im 13. und 14. Jahrhundert. Hier liegen praktisch keine Quellen vor die über die Situation innerhalb dieses Zeitraums Aufschluss geben könnten. Die zweite Lücke betrifft die letzten Statuten des Kontors aus dem Jahr 1554. Diese wurden bislang in keiner Quellenedition veröffentlicht und liegen lediglich im Original vor, welches sich im Besitz der British Library befindet, und leider nicht persönlich eingesehen werden konnte. An dieser Stelle meinen Dank an Dr. Nils Jörn, der so freundlich war, für diese Arbeit seine persönliche Abschrift zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der Vielfalt der erlassenen Verordnungen wird es nicht möglich, allerdings auch nicht notwendig sein, sämtliche Paragraphen anzusprechen. Daher werden die
Statuten in voller Länge im Anhang bereit gestellt.17
12HANSISCHES URKUNDENBUCH, Hrsg. vom Verein für Hansische Geschichte, Bearb. von Konstantin Höhlbaum, Halle 1876-1916.
13HANSERECESSE, Zweite Abteilung, 1431-1476, Hrsg. vom Verein für Hansische Geschichte, Bearb. von Goswin von der Ropp, Leipzig 1876-1892.
14URKUNDLICHE GESCHICHTE DES HANSISCHEN STAHLHOFES ZU LONDON, Hrsg. und bearb. von Johann Martin Lappenberg, Osnabrück 1851.
15QUELLEN ZUR HANSEGESCHICHTE, Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Deutschen Mittelalters, Freiherr-von Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 36, Hrsg. und bearb. von Rolf Sprandel, Darmstadt 1982.
16QZH 1982, S. 350.
17B. L., C. P., Vespasian B VIII (Zitiert nach der Abschrift von Dr. Nils Jörn; Gliederung und Paginierung durch den Verfasser eingefügt), Anhang S. I-XXXVI.
Page 9
Bei einer Arbeit die sich mit einem Bereich innerhalb des äußerst populären Themenfeldes der deutschen Hanse auseinandersetzt, verwundert ein derartig dünner Forschungsstand, wie er in diesem Fall vorliegt.
Die Forschung zur Administration des Kontors wird für den Zeitraum bis zum Utrechter Frieden nach wie vor durch die knappen Untersuchungen Karl Engels aus den Jahren
191318und 191419dominiert. Aus dieser Zeit existiert eine Vielzahl von Aufsätzen zu diesem Thema, welche jeweils einzelne Teilaspekte behandeln. Diese müssen hier nicht im Detail aufgeführt werden und können dem Literaturverzeichnis entnommen werden. Äußerst aufschlussreich war der Beitrag Werner Kurzinnas20zur Begriffsgeschichte des hansischen Stalhofs.
Ebenfalls hervorzuheben ist der Aufsatz Martin Weinbaums21zur rechtlichen Situation der Hansen im 13. und 14. Jahrhundert sowie der Beitrag Klaus Friedlands22zur Privilegierung der Hansen und den Bezügen zum Hansetag.
Die Schrift Friedrich Wilhelm Ostermanns23zur Geschichte des Stalhofs in London entspricht in keiner Weise aktuellen wissenschaftlichen Standards und ist stellenweise
durch nationalsozialistisches Gedankengut geprägt.24Sie findet daher in dieser Arbeit keine Verwendung.
In der modernen Forschungsliteratur gibt Derek Keene in seinen Beiträgen zum
Londoner Hafen25, dem frühen Handel in London26und zur Gildhalle27selbst, durch die Verbindung literarischer Quellen und archäologische Untersuchungen, einen sehr detaillierten Einblick in den Aufbau, die Funktionen und den Alltag des Stalhofgeländes.
18ENGEL, K., Die Organisation der deutsch-hansischen Kaufleute in England im 14. und 15. Jahrhundert bis zum Utrechter Frieden, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll 19, Köln u. a. 1913, S. 445-517.
19Ders., Die Organisation der deutsch-hansischen Kaufleute in England im 14. und 15. Jahrhundert bis zum Utrechter Frieden, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll 20, Köln u. a. 1914, S. 173-225.
20KURZINNA, W., Der Name „Stalhof“, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll, Köln u. a. 1912, S. 429-461.
21WEINBAUM, M., Stalhof und Deutsche Gildhalle zu London, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll, Köln u. a. 1928, S. 45-65.
22FRIEDLAND, K., Kaufleute und Städte als Glieder der Hanse, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll 56, Köln u. a. 1958, S. 21-41.
23OSTERMANN, F. W., 900 Jahre Kölner Stalhof in London, Köln 1950.
24Vgl. Ebd., S. 6.
25KEENE, D., New Discoveries at the hanseatic Steelyard in London, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll 107, Köln u. a. 1989, S. 15-25.
26Ders., Ein Haus in London: Von der Guildhall zum Stalhof, in: Bracker, J. (Hrsg.), Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos, Bd. 1, Hamburg 1989, S. 46-48.
27Ders., Die deutsche Guildhall und ihre Umgebung, in: Bracker, J. (Hrsg.), Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos, Bd. 1, Hamburg 1989, S. 149-155.
Page 10
Weiterhin ist hier vor allem die Publikation Nils Jörns28zu nennen, der unmittelbar an die Forschungen Karl Engels anknüpft und die Statutengebung sowie die politischrechtliche Situation des Kontors in der Zeit nach dem Utrechter Frieden untersucht. Ebenfalls gestützt wird die Arbeit durch die Publikation von Stuart Jenks, der die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Hanse und England bis zum Utrechter
Frieden bearbeitet.29Diese wird durch seine verschiedenen Aufsätze zur Entwicklung des Englandhandels30, der Aufnahmepolitik der Hanse in London31sowie der Privilegierung der Kaufleute in der Carta Mercatoria32ergänzt.
Als Überblicksliteratur wurden hauptsächlich die Werke Terence Henry Lloyds33zu den englisch-hansischen Beziehungen zwischen 1157 und 1611 sowie das Standardwerk
Philippe Dollingers34zur Hanse im Allgemeinen genutzt. Zum letztgenannten Werk muss gesagt werden, dass hier in Bezug auf das Thema der Arbeit die Ergebnisse Karl Engels für die Zeit nach dem Utrechter Frieden verallgemeinert wurden, was nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung entspricht.35
Eine sehr interessante interdisziplinäre Ergänzung bildete der Beitrag Katrin Petters zu den Stalhof-Portraits Hans Holbeins des Jüngeren. Die Darstellungen sowie auch die näheren Umstände unter denen die Bilder entstanden, werden hier sehr detailliert
untersucht.36
28JÖRN, N., „With money and bloode“, Der Londoner Stalhof im Spannungsfeld der englisch-hansischen Beziehungen im 15. und 16. Jahrhundert, Köln u. a. 2000.
29JENKS, St., England, die Hanse und Preußen, Handel und Diplomatie, 1377-1474, Köln u. a. 1992.
30Ders., Der Englandhandel: Erfolge und Rückschläge, in: Bracker, J. (Hrsg.), Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos, Bd. 1, Hamburg 1989, S. 68-73.
31Ders., Leben im Stalhof, in: Bracker, J. (Hrsg.), Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos, Bd. 1, Hamburg 1989, S. 157-159.
32Ders., Die Carta Mercatoria: Ein „hansisches“ Privileg, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll 108, Köln u. a. 1990, S. 45-85.
33LLOYD, T. H., England and the German Hanse, 1157-1611, Cambridge 1991.
34DOLLINGER 1998.
35Vgl. JÖRN 2000, S. 2.
36PETTER, K., „Wenn Du die Stimme hinzufügst, ist hier Derich selbst,…“, Eine Spurensuche zu den Stalhof-Portraits von Hans Holbein d. J., in: Österreichische Galerie Belvedere (Hrsg.), Belvedere: Zeitschrift für bildende Kunst 1, Wien 2002, S. 4-17.
Page 11
3. Von der „Guildhall“ zum „Stalhof“ - die Grundlagen der deutsch-englischen
Handelsbeziehungen
Die Art und Weise in der die Administration des Kontors in London organisiert war kann als Spiegelbild der organisatorischen und rechtlichen Lebensumstände der deutschen Kaufleute in London verstanden werden. Die Statuten wurden - sofern dies möglich war - an den bestehenden Rahmenbedingungen vor Ort ausgerichtet um einen reibungslosen Ablauf des Handels zu gewährleisten und die erhalten Privilegien nicht zu gefährden. Daher werden in diesem Kapitel so pointiert wie möglich die Grundlagen der deutsch-englischen Handelsbeziehungen dargestellt, um ein besseres Verständnis der Verwaltung zu ermöglichen.
Die zentralen Aspekte, die behandelt werden, sind das Auftreten und die Herkunft der verschiedenen kaufmännischen Gruppierungen sowie die ihnen verliehenen Privilegien und die jeweiligen Bedingungen, die mit diesen verbunden waren. Die verschiedenen Privilegien werden hierbei lediglich kurz dargestellt, da sich ihr Inhalt im Detail nur indirekt auf die Administration auswirkte. Eine kurze Erläuterung zur Herkunft der Kaufleute und ihrer rechtlichen Situation ist jedoch unumgänglich, da zahlreiche Punkte der Kontorverwaltung hierauf beruhen.
Ferner sollen auch Wohn- und Handelssitz der deutschen Hansen angesprochen und auf ihre genaue Funktion im Rahmen der englisch-hansischen Beziehungen untersucht werden. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls auf Begriff und Struktur der Gildhalle und des Stalhofs eingegangen. Der zeitliche Schwerpunkt dieses Kapitels bildet das 12.- bis 14. Jahrhundert.
Page 12
3.1. Die deutschen Hansen in England
3.1.1. Herkunft und Privilegierung der frühen Hansen
Das Auftreten deutscher Kaufleute in London kann bereits für die ottonische Zeit belegt werden. Diese werden in einer Urkunde König Aethelreds von Wessex sehr
unspezifisch als„homines imperatoris, qui veniebant in navibus suis“37angegeben. Die Schrift wird auf den Zeitraum zwischen den Jahren 978 und 1016 datiert und
erlaubt den Kaufleuten das Handeln von Bord ihrer Schiffe aus.38Ein älterer Beleg liegt bislang nicht vor, obwohl kaum anzunehmen ist, dass es sich hierbei um einen ungewöhnlich frühen Ausnahmefall handelt. Heribert T. Brennig weist klar darauf hin, dass entgegen älteren Forschungsmeinungen schon seit dem Frühmittelalter eine
berufsständisch geschlossene Fernhändlerschicht etabliert war.39Bereits unter den Karolingern sei der Fernhandel, der sich schon zu Zeiten der Merowinger regenerierte,
wieder massiv gefördert worden.40Derek Keene weist für die Stadt London der nachrömischen Zeit sogar schon um das Jahr 700 einen regen Handel nach.41Die erneute Aufnahme des Fernhandels dürfte auch hier rasch erfolgt sein.42
Erste konkretere Hinweise auf die Besuche deutscher Kaufleute finden sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1157.43König Heinrich II. stellt darin die„homines et cives Coloniensis“44sowie deren Waren unter seinen Schutz. Weiterhin gestattet er ihnen im selben Jahr, ihren Wein auf denselben Märkten anbieten zu dürfen wie die
französischen Händler.45Gegen Ende des 12. Jahrhunderts, 1197, wurde der Schutz der Kölner durch Heinrich II. auf ganz England ausgedehnt.46
37Zit. n. HUB 1876, Bd. 1, S. 1, Nr. 2.
38Vgl. Ebd.
39Vgl. BRENNIG, H. R., Der Kaufmann im Mittelalter, Literatur - Wirtschaft - Gesellschaft, Pfaffenweiler 1993, S. 1-2.
40Zit. n. Ebd., S. 21 f.
41Vgl. KEENE, Haus, 1989, S. 46.
42Felicitias Schmieder bezeichnet London bereits für das Jahr 1100 als einen der wichtigsten Handelsknotenpunkte, mit einer Population von ca. 25000 Einwohnern. Diese rasche Erholung sei eine Folge der normannischen Eroberung und der daraus resultierenden straffen Führung der Städte durch die Krone; Vgl. SCHMIEDER, F., Die mittelalterliche Stadt, Darmstadt 2005, S. 55.
43Vgl. HUB 1876, Bd. 1, S. 8, Nr. 14.
44Zit. n. Ebd.
45Vgl. Ebd., S. 8, Nr. 13.
46Vgl. Ebd., S. 16, Nr. 25; Das Königreich England umfasste zu diesem Zeitpunkt in etwa die ehemaligen Kleinkönigreiche Wessex, Sussex, Essex, Kent, East Anglia, Mercia und Northumbria. Wales und Schottland wurden erst unter der Herrschaft Edwards I. unter die englische Herrschaft gezwungen; Vgl. KING, E., England, 1175-1425, London 1979, S. 143 f.
Page 13
Weitere deutsche Kaufleute scheinen erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts in England aufgetreten zu sein. Eine genaue Datierung ist aufgrund der Quellenlage leider nicht möglich. Den Kölnern folgten Bremer, Hamburger und Lübecker, die nach und nach
ihren Konkurrenten aus dem Rheinland gleichgestellt wurden.47Den sogenannten Osterlingen fiel es nicht schwer sich mit ihren Waren, vornehmlich Holz, Getreide,
Eisen, Kupfer, Asche, Pech, Harz und Wachs, in England zu etablieren.48Die Rheinländer bemühten sich erfolglos das Eindringen der norddeutschen Konkurrenten in ihren Handelsraum zu verhindern, u. a. indem sie ihnen illegale Tribute für den Handel abpressten. Diese Tribute wurden allerdings 1226 durch Kaiser Friedrich
II. mit der Verleihung der Reichsfreiheit Lübecks aufgehoben.49Der Konflikt ging so weit, dass die verschiedenen Gruppierungen aktiv in die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Heinrich III. und den englischen Baronen eingriffen, um ihre jeweilige Position zu stärken.50Am 08. November 1266 erwarben die Hamburger das Recht, ebenso wie die Kölner, eigene Hansen in England zu bilden.51Die Lübecker folgten ihnen hiermit ein Jahr später, am 05. Januar 1267, als Heinrich III. ihnen dieses Privileg für die Zahlung von fünf Schillingen garantierte.52
„(…) habeant hansam suam reddendo inde quinque solidos eodem modo, quo burgenses et mercatores Colonie hansam suam habent et eam temporibus retroactis habere et reddere consueverunt (…).“53
Das gesamte Spektrum der hansischen Privilegien muss im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden, zumal gerade bzgl. des Rechtsstatus ausländischer Kaufleute in
England bis in das 14. Jahrhundert eine sehr wechselvolle Geschichte vorliegt.54Die Privilegien wurden durch englische Händler stets aufs Neue angefochten und die gesetzliche Lage änderte sich häufig.55Dies gilt besonders für den Zeitraum nach dem Jahr 1297.56
47Vgl. DOLLINGER 1998, S. 60.
48Vgl. KEENE, Haus, 1989, S. 47.
49Vgl. HUB 1876, Bd. 1, S. 64, Nr. 205.
50Vgl. WEINBAUM 1928, S. 50 f.
51Vgl. FRIEDLAND 1958, S. 24.
52Vgl. Ebd.
53Zit. n. HUB 1876, Bd. 1, S. 220, Nr. 636.
54Den genauen Ablauf der Rechtsstreitigkeiten stellt Stuart Jenks in seiner Arbeit zur Carta Mercatoria dar; Vgl. JENKS 1990, S. 45-55.
55Vgl. STEIN, W., Die Hansebruderschaft der Kölner Englandfahrer und ihr Statut vom Jahre 1324, in: Hansischer Geschichtsverein (Hrsg.), HGBll, Köln u. a. 1908, S. 214.
56Seit der Niederlage des deutsch-flämisch-englischen Bündnisses bei Veurne im August 1297 durch die Verspätung Edwards I., wurde die Situation der deutschen Kaufleute in London komplizierter. Der
Page 14
Drastisch erschwert wurde die Situation der Hansen durch eine Neuerung im englischen
Recht von 1278. In diesem Jahr wurde das„Quo warranto“57-Verfahren eingeführt, das im Statut von Gloucester festgelegt wurde.58Dieses Gesetz, das in Folge der Baronenkriege entstand, ermöglichte es jedem königlichen wie auch privaten Kläger, feststellen zu lassen, auf welchen Grundlagen bestimmte Sonderrechte oder
Immunitäten beruhten und dies ggf. gerichtlich anzufechten.59Die englischen Händler machten von diesem Gesetz besonders im 14. Jahrhundert geradezu exzessiv gebrauch, um den Spielraum der ausländischen Konkurrenten einzuengen. Dies gilt besonders für die zweite Hälfte des Jahrhunderts, in der sich zunehmend auch englische Fernhändler-
Gemeinschaften etablierten, die „MerchantAdventures“60, welche versuchten, sich ihrer hansischen Konkurrenten zu entledigen.61Darüber hinaus kam immer wieder der Verdacht auf, dass die Hansen Waren nicht-privilegierter Kaufleute, sogenannter Butenhansen62, als ihre eigenen deklarierten, um diesen einen Vorteil zu verschaffen und selbst an ihrem Geschäft teilzuhaben.63Die Folge war eine stetige Zunahme von Güterarresten bei hansischen Kaufleuten.64Die Hansen waren zur Wahrung ihrer Rechtssicherheit teils zu empfindlichen Zahlungen gezwungen, z. B. ging an Edward II. im Jahr 1314 die ungeheure Summe von 1000 £ Sterling, welche den rechtlichen
Frieden allerdings nur für kurze Zeit erkaufen konnte.65Um diese Unsicherheit zu umgehen, schufen sich die kölnischen Fernhändler im Jahr 1324 ein eigenes Statut, um sich von den übrigen Deutschen abzugrenzen und ihre juristische Position zu stärken.66Viele Kaufleute versuchten sogar sich durch persönliche Vorsprache beim König Schutz als Einzelpersonen zuzusichern.67
englische König hatte seinem Volk hohe finanzielle Lasten für einen Krieg aufgebürdet, der zu nichts geführt hatte. In Folge dessen musste Edward der Stadt London die seit 1285 aufgehobene Selbstverwaltung wieder gestatten. Hierauf folgte ein direkter Abbau der Verordnungen königlicher Kommissare, welche zugunsten der ausländischen Händler erlassen worden waren. Die Engländer versuchten, die Hansen in den Status von reinen Zulieferern zu verweisen; Vgl. JENKS, Erfolge, 1989, S. 68; s. a. JENKS 1990, S. 46 f.
57Zit. n. JENKS 1992, S. 476.
58Vgl. Ebd.
59Vgl. Ebd.
60Zit. n. KING, E., Merchant Adventures, in: Auty, R. u. a. (Hrsg.), LdM, Bd. 6, München 1993, Sp. 534 f.
61Vgl. Ebd.
62Der Begriff„buten“entstammt dem Mittelniederdeutschen und bedeutet„ausserhalb“oder„fremd“,s. a.„butenman“;Vgl. LÜBBEN, A., Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, Darmstadt 1965, S. 71.
63Vgl. FRIEDLAND 1958, S. 25.
64Vgl. JENKS 1990, S. 52.
65Vgl. Ebd.
66Dieses regelte lediglich die Bildung einer kölnischen Hanse unter einem gewählten Ältermann und die Teilhabe an den Privilegien; Vgl. STEIN 1908, S. 201-203.
67Vgl. Ebd., S. 214 f.