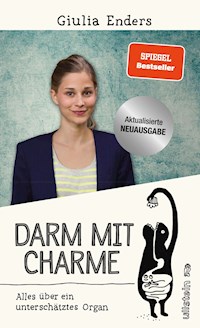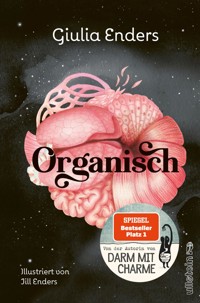
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nach dem Millionenbestseller "Darm mit Charme": Faszinierende Antworten aus dem Innersten unseres Körpers Manchmal braucht es den Blick nach innen, um das Leben draußen besser zu verstehen. Tief in unserem Inneren wirken Kräfte, die uns Tag für Tag schützen, heilen und am Leben halten – meist, ohne dass wir es bemerken. Giulia Enders nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise zu den unsichtbaren Helden unseres Körpers. Sie zeigt, wie unser Innerstes mit erstaunlicher Intelligenz auf Herausforderungen reagiert und uns immer wieder neue Wege aufzeigt. Mit anschaulichen Geschichten und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen öffnet dieses Buch nicht nur die Augen für die Wunder in uns, sondern inspiriert dazu, dem eigenen Körper mit mehr Achtsamkeit und Vertrauen zu begegnen. Organisch ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, das Leben von innen heraus zu verstehen – und zu lieben. Mit wissenschaftlicher Präzision und erzählerischem Charme öffnet dieses Buch Türen zu einer Welt, die uns täglich begleitet – und doch voller Geheimnisse steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Organisch
Dr. Giulia Enders ist Ärztin und Autorin. 2014 veröffentlichte sie den Bestseller Darm mit Charme. Sie forschte in der Mikrobiologie, arbeitete als Ärztin und engagiert sich für die verständliche Vermittlung wissenschaftlicher Themen.
Jill Enders ist Kommunikationsdesignerin und spezialisiert auf die Vermittlung von Wissenschaft. Sie gestaltet Bücher, Ausstellungen und Veranstaltungskonzepte, darunter die Illustrationen für Darm mit Charme sowie die Konzeption der Ausstellung Microbiote in Paris.
In einer Welt, die immer lauter und komplexer wird, hilft manchmal der Blick nach innen: der Blick in unseren Körper.Seit Jahrtausenden wird er vor Probleme gestellt und löst sie auf ganz eigene Art. Was können wir von ihm lernen? Was wissen unsere Organe über das Leben?Giulia Enders nimmt uns mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise in unser Inneres. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrem unnachahmlichen Talent, komplexe Zusammenhänge spielerisch leicht auf den Punkt zu bringen, weckt sie eine tiefe Liebe zu dem, was uns so nah und doch oft fern ist: uns selbst.In ihrem Millionenbestseller Darm mit Charme hat Giulia Enders eine neue Art begründet, über Wissenschaft zu schreiben.In Organisch erkundet sie, was es wirklich bedeutet, auf den Körper zu hören.
Giulia Enders
Organisch
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2025 Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin
Alle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44 b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung und Illustrationen: © Jill EndersFür die Aquarellzeichnungen wurde das Papier Canson, hot pressed, verwendet.
Foto der Autorin: © Julia Sellmann
E-Book-Konvertierung powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3639-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Organisch
der Anfang
1
Ein Grundbedürfnis
Die Lunge
2
Sicherheit
Das Immunsystem
3
Beziehungen
Die Haut
4
Kraft und Wirken
Die Muskeln
5
Denken und Sein
Das Gehirn
Wichtigste Quellen
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Organisch der Anfang
Widmung
Für Reginald, Ruth und Alfred. Auch wenn ich ihre Geschichten hier nicht erzähle, schreibe ich doch mit ihren Worten.
Organisch der Anfang
Meine Begeisterung galt eigentlich immer nur einem Organ – dem Darm. Schon als Teenager wollte ich alles über ihn wissen, wachte im Studium oft erst richtig auf, wenn sein Name fiel, und schrieb mit 23 Jahren sogar ein Darm-Buch, das überraschend zum Beststeller wurde.
Ab hier – dachte ich – wäre mein weiterer Weg klar: Ich suchte mir ein Krankenhaus mit dem Schwerpunkt »Verdauungstrakt« und begann, mich zu spezialisieren. Dabei prallte ich jedoch bald auf die Realität: Hatte ich früher geglaubt, um eine gute Ärztin zu sein, müsste ich nur die »Darm-Forschung« kennen, konnte ich darüber bald nur noch lächeln.
Ich behandelte eine Frau, die nach dem Verlust ihres Babys unter Bauchkrämpfen litt und sich schämte, nicht schnell genug »wieder fit« zu sein. Ich beriet einen Schichtarbeiter, dessen Verdauung durch die andauernden Zeitumstellungen durcheinandergeraten war. Eine Rentnerin mit ellenlanger Medikamentenliste beklagte sich über »diffuse Übelkeit«, und eine in der Politik beschäftigte Person litt unter störendem Durchfall, der – wie sich herausstellte – von den Aufputschmitteln kam, die helfen sollten, alle Termine zu schaffen.
Als mir an einem Nachmittag ein bärenartig geformter Bauunternehmer gestand, oft nervös zu sein und an Ängsten zu leiden – sagte ich in einem Moment der Selbstvergessenheit einfach nur: »Ja, das haben echt viele!« Herunterspielend meinte ich das nicht, sondern war – wie er dann auch – einfach nur verwundert.
Klar konnte ich diesen Menschen Abhilfe verschaffen – etwas verschreiben, Verschiedenes ausprobieren und Beschwerden lindern, aber gleichzeitig fühlte sich das auch nicht wie die wirkliche Lösung ihrer Probleme an. In mir wuchs eine nagende Unzufriedenheit. Ich beobachtete, dass es Menschen belastete, wenn sie nicht wie Maschinen funktionierten, nicht wie Puppen aussahen – und dass es ihnen peinlich war, einsam zu sein oder traurig zu werden.
Mir fehlten die Worte für etwas, das ich auf Dauer immer spürbarer fand. Mindestens so oft, wie ich kranke Organe behandelte, behandelte ich eine merkwürdige Zeit.
Als ich bereits ein paar Jahre arbeitete, starb plötzlich meine Großmutter. Sie war einer der wichtigsten Menschen für mich, und dennoch fühlte ich in der ersten Zeit nach ihrem Tod einfach nichts. Ich stand auf, ging zur Arbeit und abends ins Bett. Sogar meine Angst im Dunkeln war verschwunden. »Gefühle wie Trauer nicht zuzulassen verschiebt sie nach hinten und macht sie größer«, hatte ich mir bei einer Psychologievorlesung einmal grob notiert. Jetzt musste ich daran denken – doch dieses Wissen half mir nicht. Was war los mit mir?
Einige Zeit später saß ich an meinem Schreibtisch in der Sonne und las einen medizinischen Text über Wunden. Auf einmal kamen die Tränen. Es war, als ob die Haut verstand, wie es ist, jemanden zu verlieren. Das Verletzt-Sein, das plötzliche Fehlen von Gewebe, die erste Schockreaktion. Was ich vorher nicht zugelassen hatte, durfte nun endlich passieren: Ich konnte trauern. Auch bei der Frage »Wie würde ich darüber hinwegkommen?« orientierte ich mich daran, wie die Haut mit ihren Wunden umging. Ein Blick auf den Körper half mir, Mensch zu sein.
Dieses Erlebnis brachte mich zum Nachdenken. Wir leben in einer lauten und fordernden Welt. Von außen prasseln andauernd Informationen auf uns ein: was wir erreichen sollten, wie wir leben könnten, wie wir auszusehen oder uns zu fühlen haben – während wir oft noch nicht einmal begreifen, was wir im Hier und Jetzt bereits sind.
Könnte Wissen über unseren Körper ein Gegengewicht zu dem sein, was ich im Krankenhaus und an mir selbst beobachtete? Würde eine körperliche Perspektive – wenn auch nur ein Stück weit – helfen, im Strudel der Modernität das Menschliche zu bewahren?
Wer einmal darauf achtet, wird merken, wie viele Begriffe aus Technik, Wirtschaft oder sogar der Kriegsführung benutzt werden, um über unseren Körper zu sprechen. Das Gehirn vergleichen wir mit einem Computer, unser Immunsystem »entsendet Truppen«, um »Eindringlinge anzugreifen«, im Sport steigern wir die »Effizienz« des Trainings mit »Fitnessregimes«, und wer nicht genügend in seine Gesundheit investiert, kriegt später »die Rechnung präsentiert«. Offensichtlich färben die Themen der Welt die Sicht auf uns selbst – doch was macht das mit uns? Und könnte es nicht auch öfter andersherum der Fall sein: dass unser Körper vorgibt, wie wir über das Arbeitsleben oder unser soziales Miteinander denken?
Meiner These nachzugehen wurde ein Hobby. Stand ich erneut mit Fragezeichen vor der Welt, las ich in verschiedenen Fachbüchern über unser Innenleben. Neue Recherchen zur Lunge ließen mich anders über Grundbedürfnisse denken. Wie unser Köper sich holt, was er braucht, und wie er mit Ungewolltem umgeht, wurde mir zum Vorbild. Das Eintauchen in die moderne Immunforschung brachte mich dazu, andere Dinge für meine Sicherheit wichtig zu finden. Die Haut gab mir eine neue Sicht auf Beziehungen – auf Verletzung, Heilung, Berührung und Grenzen. Und wer hätte gedacht, dass Muskeln eine ziemlich eigene Perspektive auf Kraft und Stärke liefern? Für die wichtigsten menschlichen Bedürfnisse gab es immer ein passendes Organ.
Es ist faszinierend, wie unser Körper seine Probleme löst. Immer wieder konnte ich daraus Anregungen für mein Leben ziehen und fühlte mich wie in einem Eiscremeladen voller Antworten.
Den Körper zu verstehen nützt nicht nur, um Krankheiten vorzubeugen. Unsere Organe haben auch einen wesentlichen Anteil daran, was es heißt, wir selbst zu sein. Sie beeinflussen zentrale Fragen, etwa: Was brauchen wir wirklich? Wie gehen wir mit Bedrohung um? Auf welche Weise wollen wir einander behandeln? Oder auch: Was können wir leisten und auf welchem Weg? Verstehen wir die Antworten des Körpers besser, können wir ein stimmigeres Leben führen.
Jenseits von Krankheiten und Pandemien gibt der Körper selten den Ton öffentlicher Debatten vor – und dann ist auch noch einiges, was wir von unserem Körper zu wissen glauben, ziemlich veraltet. Etwa hat die Forschung zum Immunsystem der letzten 20 Jahre herausgestellt, dass unsere Sicherheit nicht einfach nur darauf beruht, »Böses abzuwehren«. Wer versteht, wieso, findet eine solche Überzeugung eventuell auch im eigenen Leben – etwas plump … und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Was in diesem Buch steht, beruht auf Wissenschaft und hat gleichzeitig etwas Persönliches. Beispielsweise fand ich die Lunge anfangs ziemlich passiv und weich, bis ich merkte, dass sie mich an meine Urgroßmutter erinnerte. Obwohl diese eine weiche und ja – manchmal eben auch passiv wirkende – Frau war, hatte sie einen enormen Einfluss auf alle, die nach ihr kamen. Sie bildete ein Fundament, wie auch die Lungen und das Atmen es tun.
Statt diese persönlichen Überlegungen (wie anfangs gedacht) nur für mich aufzuschreiben, ließ ich sie vor jedem Kapitel stehen, denn sie zeigen: Meine Worte sind beeinflusst davon, wie ich aufgewachsen bin und wie ich die Welt sehe. Auch die Forschung und Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, sind das. Dadurch werden Gedanken oder wissenschaftliche Entdeckungen nicht falsch oder unsachlich, aber es bedeutet, dass der Weg, wie wir zu ihnen kommen, persönlich sein kann.
Von meinem Körper zu lernen und nicht nur über ihn hat mich verändert. Ich schaue mit einem neuen Respekt auf das Menschliche. »Unproduktive Gefühle«, körperliche Grenzen oder eine andere Definition von Macht wirken auf einmal nicht mehr unerhört oder schwach auf mich, sondern folgen einer Logik, die mir jetzt näher ist. Mittlerweile denke ich: So wie es Teil des Erwachsenwerdens ist, zu erkennen, wer wir sind, ist es auch Teil des Menschwerdens, zu begreifen, was wir sind. Und was wir brauchen. Denn: Egal, wie laut die Welt um uns herum ist, ob sie auf Klicks basiert, auf Nullen und Einsen und auf nichts dazwischen, es ändert nichts an unserem Innersten – wir sind organische Wesen. Verbunden über Fasern, verweben wir die Fähigkeiten der Organe zu einer einzigartigen Lebendigkeit. Wir erfinden uns andauernd neu, formen uns um und bleiben gleichzeitig Millionen Jahre alt.
Es gibt eine Stimme, die uns an all das erinnert. Ihre Sprache zu sprechen macht uns zu Ureinwohnern unseres Selbst: Organisch.
1 Ein Grundbedürfnis Die Lunge
Müdis Ratschlag
Der Spitzname meiner Urgroßmutter war Müdi. Eigentlich hieß sie Hedwig, aber diesem Vornamen fehlte ein wesentlicher Anteil ihrer Person: die Stimmungen, die sich tentakelartig durch ihr Leben zogen. »Schaffig« und »unschaffig« nannte mein Urgroßvater sie dann – je nachdem. Müdi kam aus einer pfälzischen Familie, die eine Baumschule besaß. Ihr Vater war ein zarter Mann ohne jeglichen Geschäftssinn. Oft lag er melancholisch auf der Wiese und betrachtete Pflanzen. Ihre Mutter war eine energische Frau, die sich direkt aufs Pferd schwang, wenn sie etwas mit dem Bürgermeister oder Bankdirektor besprechen wollte. Zuvor kratzte sie noch ihre Haare »nuff« und zog »das Hütl« auf – ein Ritual, das den Umstehenden ihre Tatkraft ankündigte. Beide Seiten fand meine Urgroßmutter in sich wieder – wie der Atem, der kommt und geht: schaffig und unschaffig, wach und »müdi«.
Das einzig Verlässliche auf dieser Welt war für sie die Natur. An diesem Anker konnte sie ihre Seele befestigen und immer wiederfinden. Alles andere flimmerte eher flüchtig an ihr vorbei. Als junge Frau zog sie mit ihrem Mann in das Berlin der wilden Zwanzigerjahre, ging zu Frauentreffen, den damals völlig neuen Yoga-Kreisen oder Sternkunde-Versammlungen und dinierte mit wichtigen politischen Persönlichkeiten. Sie hatte eine angenehme Unverstelltheit, die in diesen Runden gut ankam.
Nach der Machtergreifung der Nazis änderte sich viel. Sie ließ alles zurück und fuhr mit dem Fahrrad von Berlin zur Familie in die Pfalz. Bei ihrer Ankunft standen dort noch immer dieselben Bäume, die Sonne schien. Ihr Vater lag seufzend auf der Wiese und schaute Gänseblümchen an. Eigentlich war alles wie immer und doch völlig anders. Ihr Leben lang hegte meine Urgroßmutter danach keinen besonderen Respekt mehr für Politik, Ideologien, mächtige Menschen oder Trends. Sie interessierte sich für die von ihr geliebten Menschen (»Liebesle«), die Wälder und allem voran für den Sonnenuntergang, den sie jeden Abend von ihrer Terrasse aus verfolgte.
Wer das Leben meiner Urgroßmutter nicht besser kannte, würde vielleicht sagen, sie war keine bedeutende Person. Für Außenstehende war sie stets bloß »die Ehefrau« ihres Mannes – ein beliebter Jurist. Sie war klein, gab schnell nach und hatte ein weiches Gesicht mit gütigen Augen. Je mehr ich über sie nachdachte, umso wichtiger erschien sie mir. Sie gab etwas weiter, das bis heute existiert. Ihre Milde, kleine Weisheiten, witzige Sprüche und eine ewige Neugier – all das ist auch Jahre nach ihr noch bestens erhalten und lebt in uns fort. Mit den Fingern fahre ich über die Kette, die einst an ihrem Hals hing. Auch wenn ich meine Urgroßmutter nie kennenlernte, fühle ich mich mit ihr verbunden. Bin ich müde und von der Welt irritiert, denke ich an den Ratschlag, den sie ihren Töchtern einmal gab: »Wer Durst hat, trinkt. Wem’s schwer ist, atmet.«
War ich eben noch grübelig und müde, wird es mir dann mit jedem Atemzug leichter. Bald ist es geschafft – die Brust ist weit, der Kopf ist frei. So auch an diesem Nachmittag. Auf der Wiese der alten Baumschule liege ich in der Sonne, schlafe bald erleichtert ein und beginne gerade erst zu begreifen, was ihr Ratschlag wirklich bedeutet.
Die Lunge und die Luft
Wir bekommen 20.000-mal am Tag, was wir brauchen. Atmen ist unser wichtigstes Bedürfnis. Eine Minute ohne Atemzug – und unser Verlangen wird größer als Durst nach stundenlangem Wandern. Selbst wer völlig ausgetrocknet Wasser erreicht, würde das Trinken unterbrechen, um Luft zu holen. In der Hierarchie des Körpers steht Atmen an erster Stelle.
Das Organ, das uns diese zentrale Fähigkeit vermittelt, ist auf den ersten Blick nicht besonders eindrucksvoll. Lungen sind weder robust noch stark oder selbstständig. Ohne die Hilfe von anderen Körperteilen (wie den Rippen), schrumpeln sie, die sonst den Brustkorb ausfüllen, sofort auf die Größe einer Faust und sehen nur noch aus wie zwei zu oft benutzte Spülschwämme. Auch im entfalteten aufgepusteten Zustand wirken sie nicht gerade einschüchternd: Drückt jemand provokant mit einem Finger in sie hinein, knistert es einfach nur leise, das Gewebe gibt widerstandslos nach und erinnert dabei an verschwindenden Badewannenschaum. Wer hinter dem wichtigsten menschlichen Bedürfnis ein außergewöhnlich imposantes Organ erwartet hätte, liegt falsch.
Lungen sind weich. Sie passen sich permanent ihrem Umfeld an. Im Normalzustand finden sich daher auf ihrer Oberfläche Abdrücke der Rippen, des Herzens und der Speiseröhre. Auch Atembewegungen initiieren sie nicht selbst, sondern sie folgen den Muskeln des Brustkorbs und des Zwerchfells. In ihrer unbestreitbaren Passivität und Verformbarkeit besitzen die Lungen jedoch eine der wirkungsvollsten Eigenschaften, die es auf unserem Planeten gibt: die stille Kraft des Weichen.
Bei jedem Atemzug schmiegt sich die Lunge an ihr Umfeld an – wer sie dabei genau betrachtet, erkennt ihre sanfte Rafinesse: Atmen wir ein, trifft der Luftzug genau so auf ihre Fasern, dass diese sich darin aufspannen können wie Segel. Das öffnet die Atemwege – die Luftröhre im Hals weitet sich mehrere Millimeter, die Bronchien der rechten und linken Lunge gehen auf und ziehen auch die feinen Luftwege im Endstromgebiet mit sich. Das Aufweiten geschieht mühelos durch eine optimale Anordnung der Verstrebungen. Passiv? Vielleicht, aber nicht wirkungslos. Um ein Vielfaches einfacher fällt uns das Einatmen durch ihre Luftsegel. Um auszuatmen, müssen die elastischen Fasern nur noch zurückschnellen wie Gummibänder. Durch dieses harmonische Zusammenspiel können unsere Muskeln ihre Atembewegungen tausendfach am Tag wiederholen, ohne zu ermüden. Nur durch kluge Weichheit reicht die Kraft.
Mit ihrer verästelten Struktur wirken Lungen außerdem einem Missstand entgegen, den alle wünschenden Wesen kennen: Fast nie bekommen wir exakt das, was wir gerne hätten. So ist auch unsere Atemluft in der Regel etwas zu kalt, besitzt meistens zu wenig Feuchtigkeit und den ein oder anderen Schmutzpartikel. Im Laufe ihrer Entwicklung haben die Lungen ihre Architektur deshalb perfektioniert: 22-mal teilen sich die Atemwege ab der Luftröhre. Zuerst etwa fünf Zentimeter unterhalb des Halses in die rechte und linke Lunge, danach pro Lunge noch mindestens 21 weitere Male. Die Gestalt, die dadurch entsteht, wird in der Anatomie »Arbor bronchiale« genannt: der Bronchialbaum. Die Atemluft, die ihn durchströmt, passiert ein Streckennetz von insgesamt 2400 Kilometern Länge. Auf diesem Weg wird gereinigt, befeuchtet und aufgewärmt. Zusammen mit der Vorarbeit von Nasenhärchen und Rachen macht das den Atem zu dem, was er am Ende ist: körperwarm, 98 % Feuchtigkeit und äußerst sauber.
Diese Vorarbeit dient einem besonders zarten Gebilde am Ende der Atemwege. Dort schlingen sich letzte elastische Fasern um winzige Öffnungen und ziehen sie beim Einatmen auf. Millionen solcher Mündchen schnappen dann mit uns nach Luft und verstärken den Sog auf den letzten Mikrometern. Hier hat die Lunge ihr Kernstück errichtet – eine minimalistische Kathedrale aus ultradünnen Zellen. Als Bläschen spannen sie sich um die Luft. 300 Millionen solcher Kuppeln sitzen den Atemwegen auf und krönen sie mit der Fähigkeit, Gase auszutauschen: Hier steigen Moleküle aus unserem Blut in die Luft und sinken aus der Luft ins Blut hinab. Ein Gleitfilm schützt das feine Gebilde gerade so vorm Kollabieren. Nirgendwo in unserem Körper sind wir so verletzlich und fein gebaut wie hier.
Während ihrer Entwicklung wurde die Lunge zarter und empfänglicher für das, was wir brauchen, und schützte uns gleichzeitig immer besser vor Ungewolltem. Mittlerweile ist ihre Architektur fast perfekt. Einzig und allein ein Fehler wird ihr immer wieder vorgeworfen: die etwas hastige Anlage direkt an der Speiseröhre. Durch sie verschlucken wir uns und husten Getränke auf.
Wer die Entwicklungsgeschichte der Lunge kennt, muss ihr solche Schwachstellen allerdings verzeihen. Sie entstand in Fischen, deren Lebensraum mit der Zeit zu sauerstoffarm wurde. Um nicht zu ersticken, suchten sie an der Wasseroberfläche nach Sauerstoff, so die These. Indem diese Fische immer bessere »Luft-Säcke« ausbildeten, schafften sie es zu überleben.
Die Entstehung der Lunge markiert ein verblüffendes Ereignis. Sich als Wasserwesen auf ein völlig fremdes Element einzulassen ist ein drastischer Schritt. Dafür ein komplett neues Organ zu bilden ist eine enorme Leistung. So etwas überhaupt geschafft zu haben kommt in der Evolution selten vor und lief (trotz gewisser Verschluck-Probleme) ziemlich erfolgreich. Zusammengenommen sind Lungen und Atemwege ein einziger großer Beweis dafür, zu was wir Lebewesen fähig sind, wenn wir etwas wollen und wenn uns etwas fehlt.
Die zwei wichtigsten Eigenschaften moderner Säugetiere basieren auf dem Atem: Für ihn gingen wir an Land, statt weiter im Meer zu leben, und immer raffinierter werdende Atembewegungen ermöglichten es uns schließlich, ein komplexeres Gehirn auszubilden, das wesentlich mehr Sauerstoff verbrauchte.
Während unser Gehirn den Impuls zum Atmen gibt und die Muskeln für das Luftholen zuständig sind, bilden die Lungen das dritte Glied: Sie sind das, was in der Leistungsgesellschaft gern übersehen wird, wenn wir aufzählen, was getan werden muss, um etwas zu erreichen. Wollen wir unseren Bedürfnissen gerecht werden, braucht es nicht nur Ehrgeiz und Fleiß, sondern auch das Eingehen auf das, was kommt. Wer nicht mit der Luft mitfließen kann, die er atmen will, hat eine schwere Zeit.
Atmen, genauso wie Trinken, Verdauen, Schlafen – das sind die Hausfrauentätigkeiten des Menschseins. Historisch abgewertet und leichtfertig übergangen, sind sie jedoch nicht nur cleverer als lange vermutet, sondern formen auch das Leben stärker, als wir es ihnen bisher zugestanden haben.
Unsere Lungen zeigen damit auch: Was wir brauchen, verändert uns. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Maschinen. Unsere Bedürfnisse sind keine Benzintanks, die gefüllt werden müssen, damit wir funktionieren. Was wir wollen und wie wir es erreichen, bestimmt, wer wir werden. Wir Lebewesen formen uns durch unsere Bedürfnisse voran. Jetzt und 19.999 weitere Male am Tag.
Der Stoff, den wir brauchen
Vor 2,4 Milliarden Jahren kam es zu einem furchtbaren Giftgasunfall. Mutierte Meeresbakterien hatten sich so verändert, dass sie auf einmal Sonnenenergie in eine chemische Reaktion einspeisten. Dabei entstand ein Abfallgas, das andere Bakterien und Pflanzen vergiftete. Ein Großteil der damaligen Lebewesen starb. Viel Platz wurde frei – die Giftgas-Bakterien konnten sich fast ungehindert verbreiten. Bald verpestete ihr Abgas nicht nur das Meer, sondern stieg in die Lüfte auf. Unsere Atmosphäre füllte sich damit: Sauerstoff.
Nach und nach verdrängte der Sauerstoff andere Gase, die bis dahin die Atmosphäre ausmachten – darunter Kohlenstoffdioxid (CO2) und Methan. Kohlenstoffdioxid und Methan sind Treibhausgase – damals wie heute. Sie halten die Erdatmosphäre warm. Ihre plötzliche Reduktion war das Gegenteil des heutigen Klimawandels: Es wurde wahnsinnig kalt. Die Erde erlebte ihre erste große Eiszeit und erstarrte rund 200 Millionen Jahre lang im Permafrost.
So hätte alles enden können. Schließlich gibt es auch andere eisige Planeten im Weltall, auf denen nicht viel passiert, außer … Kälte. Doch nach 200 Millionen Jahren brachen glücklicherweise mehrere Vulkane aus und schleuderten so viel CO2 in die Luft, dass es wieder wärmer wurde. Durch das Aufwärmen der Erde und das Schmelzen der Eiskrusten konnte das Leben weitergehen. Und wer hätte es gedacht: Das Giftgas »Sauerstoff« überraschte mit ein paar interessanten Eigenschaften …
Sauerstoff ist hoch reaktiv. Er verbindet sich mit so ziemlich allem, was in seiner Nähe ist. Eisen? – Rost! Frischer Apfel? – Brauner Apfel! Wasserstoff? – Wasser! Dadurch entstanden in kürzester Zeit allerlei neuartige Verbindungen (Vorsicht – »in kürzester Zeit« bedeutet für die Adrenalinjunkies der Geografie in »wenigen Hundert Millionen Jahren«). Die daraufhin gebildeten Materialien, Pflanzen und Einzeller wurden die Grundlage des neuen Lebens. Und sagen wir es ruhig mal ein bisschen parteiisch: eines aufregenderen Lebens.
Was jetzt leben wollte, musste mit Sauerstoff klarkommen. Dem unberechenbaren Sauerstoff! Die einzigen Möglichkeiten waren also: ihm entkommen (nicht viele Orte), ihn nutzen (schon besser) oder sich so auf ihn einstellen, dass damit umgegangen werden kann (ebenfalls gut). Pflanzen stellten bald schon selbst Sauerstoff mithilfe von Sonnenlicht her. So entstanden meterhohe Bäume und kilometerlange Algenzüge – schließlich gibt es Sonne an guten Tagen reichlich, ohne dass man sich dafür bewegen müsste. Angetrieben durch die Reaktivität des Sauerstoffs, lagerten sich Einzeller zu ersten Mehrzellern zusammen, und diese entwickelten sich zu einer schier unüberschaubaren Menge unterschiedlicher Tiere.
Dieser Teil der Geschichte wird »die große Sauerstoffkatastrophe« genannt. Ob bei der Namensgebung mehr Mitleid mit sauerstoffempfindlichen Bakterien bestand als mit uns (Sauerstoff-Atmenden), ist nicht überliefert. Der Begriff ist dennoch passend, denn er erinnert an etwas Elementares: Wir entstanden aus einer Krise – durch die Fähigkeit, damit umzugehen.
Um mit Sauerstoff klarzukommen, muss man dessen Ziele verstehen: Er hat keine. In der Luft bewegt er sich nach absolut zufälligen Mustern. Trifft er dabei auf irgendein passendes Molekül, verbindet er sich gerne damit. Manchmal klappt das, manchmal nicht.
Die Strategie des Körpers, um mit der Sauerstoffkatastrophe möglichst gut umzugehen, basiert auf dieser einfachen Erkenntnis: Sauerstoff ist Chaos … und Chaos ist ungelenkte Energie! Schaffen wir es, seine Energie ein wenig zu lenken, ist sie kaum katastrophal. Wie bei Feuer entscheidet der Umgang damit, ob wir entspannt grillen oder unsere Veranda abfackeln.
Gelangt ein Schwall Sauerstoffmoleküle in unsere Lungen, schwirren sie zunächst richtungslos umher, doch das ändert sich bald. Treten die ersten von ihnen ins Blut über, werden sie vom Körper in geregelte Bahnen gebracht. Der erste Clou: das Eisen in unserem Blut. Mit Eisen will sich Sauerstoff zu Rost verbinden (einer seiner Klassiker), doch unser Blut ist ihm einen Schritt voraus. Eisen wird auf den Blutkörperchen so in Proteine eingefaltet, dass der Sauerstoff zwar äußerst nah drankommt – aber nicht nah genug, um erfolgreich damit zu reagieren. Mit dieser Strategie lässt sich Sauerstoff ohne störende Zwischenfälle durch den ganzen Körper locken. Ein Zusatzbonus: Das Eisen kann direkt im nächsten Herzschlag wiederverwendet werden.
Kommen mit Sauerstoff beladene Blutkörperchen an einer Zelle vorbei, die Energie braucht, drücken sie den Sauerstoff noch weiter vom Eisen weg. Spätestens jetzt fällt er vom Glauben ab, sich je damit zu verbinden, und er wandert in neue Gefilde. Doch auch diese Wanderung dauert nicht allzu lang – schwupps – schnappt ihn ein Enzymkomplex, der an das Rad einer Mühle erinnert. Was nun folgt, ist der Grund, wieso wir Sauerstoff zum Leben brauchen und weshalb wir sterben, wenn er fehlt.
Die Mühlenrad-Enzyme (genauer: ATP-Synthasen und Cytochrom-c-Oxidasen) gewinnen durch Sauerstoff Energie! Dafür nehmen sie die absolut kleinsten Überbleibsel unserer Nahrung (Wasserstoff-Reste) und geben sie jemandem, der überhaupt nicht wählerisch ist – Sauerstoff!
Wird er vom Mühlenrad gepackt und auf die Wasserstofffetzen geworfen, darf er endlich (!) freidrehen und das tun, was er am besten kann: wild damit herumreagieren! Mit zwei Wasserstofffetzen verbindet er sich zu Wasser und fließt davon. Die Energie, die durch diese Reaktion frei wird, treibt das Mühlenrad an und versorgt unsere Zellen. Atmen wir, kommt neuer Stoff nach. Läuft das Rad, gibt es Leben. Stoppt es, sterben wir.
Die Reaktion, die uns am Leben erhält, ist ein Stück weit ironisch: Von den Lungen über die Blutgefäße, innerhalb der Zellen bis ins kleinste Zellkompartiment wird Sauerstoff begleitet und akribisch kontrolliert. Nirgendwo soll er loslegen und sich wahllos verbinden. Doch im letzten Schritt brauchen wir genau das von ihm! Die Energie des Chaos ermöglicht unsere Stabilität.
Unser Umgang mit Sauerstoff hat sich im Laufe der Evolution verfeinert, aber komplett kontrollierbar wurde er nicht: Circa alle einhundert Drehungen entwischen dem Mühlenrad-Enzym zwei Portionen Sauerstoff – mitten in der Reaktion. Was dabei herauskommt, nennt sich »Sauerstoffradikal«. Dieses halb fertige Molekül ist noch reaktionsfreudiger als sein Ausgangsstoff und der Grund dafür, warum nicht nur »zu wenig«, sondern auch »zu viel« Sauerstoff schädlich ist: Es kann sich mit fast allem verbinden und in unserem Körper wahllos Kettenreaktionen lostreten. Im Normalfall werden diese Ausreißer von speziellen Abfang-Enzymen zurück zum Mühlrad gebracht … aber manchmal klappt das nicht.
Bei all unseren Bedürfnissen gibt es ein »Zuviel« und ein »Zu wenig«. Nahrung im Übermaß tut uns nicht gut. Schlafen wir zu lange, fühlen wir uns danach oft eher müde als frisch, und sogar durch das schnelle Trinken von zu viel Wasser kriegen wir ernsthafte Probleme – bis hin zum Koma. Überall in unserem Körper geht es um ein Gleichgewicht und um die Frage: Wie halten wir es?
Sauerstoffradikale
Sauerstoffradikale sind mehr als heikel. Fangen wir sie nicht rechtzeitig ab, klatschen sie sich ungefragt an Proteine, runzeln die Fette unserer Zellmembrane oder bleichen sogar ganze Strähnen der DNA wie Blondierungsmittel (die übrigens auch durch Sauerstoffradikale wirken)! Werden sie zu zahlreich, können unsere Zellen sie nicht mehr im Zaum halten. Es kommt zu »kleinen Sauerstoffkatastrophen« in unseren Zellen.
»Zu viel« werden Sauerstoffradikale im Alltag nach dem Verzehr von besonders energiereichen Mahlzeiten, wie Spätzle mit Käse, Burger mit Pommes und danach noch was Süßes – also wenn die Mühlenräder auf Hochtouren laufen. Zu überaktiven Mühlenrädern kommt es auch bei ungewohnt starker körperlicher Belastung, großen Entzündungen, mentalem Stress oder Gewebsschäden. Quasi immer dann, wenn unsere Zellen sich verausgaben und deutlich mehr Energie brauchen, mehr Abwehrstoffe herstellen oder mehr Schäden melden als sonst.
Im ungünstigsten Fall kommen dann auch noch Radikale von außen dazu! Das kann unbeabsichtigt durch Medikamente passieren (z. B. nach einer zu hohen Dosis Paracetamol), durch Kochvorgänge (wie das Überhitzen von Fetten und Räuchern) oder typischerweise durch: Alkohol, Tabakrauch und zu viel Sonne. Kippt die Stimmung in Richtung Chaos, ist das schlecht für Zellen.
Sauerstoffradikale sind an fast allen Krankheiten beteiligt, die es gibt: Sie sind es, die mit »schlechtem« LDL-Cholesterin reagieren und dadurch Gefäßplaques entstehen lassen, was den Blutdruck in die Höhe treibt. Sie sind es, die von überaktiven Immunzellen ausgeschüttet werden und dadurch chronische Entzündungen antreiben, wie Rheuma an Gelenken oder Morbus Crohn im Darm. Und sie sind es, durch die Alkohol und Zigaretten die DNA schädigen und Krebs verursachen. Auch bei Alzheimer, Parkinson oder Multipler Sklerose braucht es mindestens einen Reaktionsschritt mit Sauerstoffradikalen, damit die typischen Läsionen an Nervenzellen entstehen.
Die gute Nachricht ist: Wir haben Verbündete. Pflanzen arrangieren sich seit ein paar Milliarden Jahren mit radikalem Sauerstoff und haben in dieser Zeit einige bemerkenswerte Tricks entwickelt. Essen wir sie, leihen wir uns diese. Die Daumenregel der Ernährungsmedizin lautet: Fettlösliche Radikalfänger, z. B. in Nüssen und Samen, schützen die Fette unserer Zellen. Wasserlösliche aus dem Fruchtfleisch von Obst und Gemüse bewachen eher den flüssigen Innenraum und das Blut. Wer von beidem genug isst, wird vor vielen Krankheiten besser geschützt.
Innerhalb dieser Grundlehre gibt es einige Fein- und Besonderheiten: Blaubeeren gelten unter den Radikalfängern beispielsweise als »Superfood«, weil sie drei verschiedene Radikal-Arten gleichermaßen gut neutralisieren (Singulett-Radikale, Peroxyl-Radikale und Superoxidanionen). Tomaten fangen nur eine dieser Arten ab (Singulett-Radikale) – diese dafür jedoch am effektivsten! Vitamin C (das in fast allen Obst- und Gemüsesorten steckt) kann die Rollen tauschen: In gesunden Zellen fängt es Radikale leichter ab als in bösartig veränderten und benachteiligt diese dadurch.
Trotz all der erfreulichen Erkenntnisse macht die Forschung bei diesem Thema jedoch auch ein gequältes Gesicht. Hoffnungsvoll gestartete Studien, in denen einzelne Radikalfänger (Vitamin A, C, E) in Kapseln oder als Tabletten verabreicht wurden, enttäuschten maßlos! Für Zehntausende Versuchsteilnehmer von jahrelangen Studien brachten sie keinen großartigen Vorteil. Weder schützten sie wesentlich vor Krankheiten, noch verlängerten sie das Leben. Bei manchen Rauchern erhöhte sich durch Vitamin E sogar das Krebsrisiko! Seither wird gerätselt, warum.
Sauerstoffradikale haben noch eine andere Seite, die lange Zeit übersehen wurde: Sie sind nicht nur chaotischer als Sauerstoff – sie liefern auch eine Extraportion Energie … in der Sprache der Autofans: mehr »Ooomph«. Gewebszellen nutzen das, um untereinander zu kommunizieren – quasi als Ausrufezeichen der Zellkommunikation!!! Immunzellen stellen sie her, um damit Bakterien und Viren abzuwehren (das Desinfizieren von Kontaktlinsen mit dem Sauerstoffradikal Wasserstoffperoxid basiert ebenfalls darauf), und außerdem können wir mit ihrer Hilfe krebsartig veränderte Zellen auflösen. Sie systematisch abzufangen könnte diese guten Funktionen hemmen. Das wäre ungünstig.
Hinzu kommt eine ungeahnte Vielfalt: Von Vitamin E gibt es beispielsweise acht verschiedene Formen! Die in den großen Studien meist hoch konzentriert verwendete Variante (γ-Tocopherol) wird von einigen Menschen genetisch nicht gut vertragen. In Pflanzen sind außerdem noch andere Stoffe, die Radikale vermutlich sogar besser abfangen und die nicht zu den Vitaminen gehören (wie Polyphenole).
Angesichts dieser verwirrenden neuen Sachlage ist es schön, ein entspanntes Gesicht zu sehen. Professor Ronald Prior, ein Urgestein der Radikalforschung aus den USA, vertritt eine recht pragmatische Meinung: Wir sollten uns auf das konzentrieren, was sicher ist: den Anstieg der Radikale nach dem Essen. Dieser Anstieg passiert nicht, um Krebszellen zu markieren oder Bakterien abzuwehren – er kommt in aller Regel einfach nur von angestrengten Mühlenrädern, denen jede Hilfe recht ist.
Gemüse, Obst und Nüsse – im besten Fall bringt eine gesunde Ernährung die hilfreichen Radikalfänger mit, quasi frei Haus. Abseits von dieser Art der Ernährung wird es jedoch komplizierter: Pommes, Schnitzel, Törtchen und Chips – Energie bringen sie, aber Radikalfänger kaum. Je mehr wir uns von solchen Kalorienbomben ernähren, desto höher ist das Risiko für chronische Krankheiten, Herzinfarkte und Co.
Für eine mittlere Portion Pommes mit 320 Kilokalorien (kcal) braucht es theoretisch eine Hand voll Blaubeeren (rund 25 Gramm), um einen Radikal-Ablasshandel zu betreiben. Alternativ gingen auch eine Hand voll Haselnüsse (ca. 15 Gramm), ein Drittel Apfel oder anderthalb Bananen. Ketchup allein wäre schwieriger – die benötigten 250 Gramm sind fast eine halbe Flasche. Der darin enthaltene Zucker vermiest die Statistik! (Indem er die Mühlenräder zusätzlich antreibt.)
Aktuell wird noch einiges auf diesem Gebiet diskutiert. Etwa ob Radikalfänger aus Gemüse und Co. auch wirklich in allen Zellen ankommen oder manche vielleicht nur im Darm wirken. Doch selbst wenn dem so wäre, kann Ronald Prior recht unbekümmert mit den Schultern zucken, denn das, was er aufgrund seiner Berechnungen empfehlen müsste, gilt schon längst: Wer täglich fünf Portionen Gemüse und Obst isst, lebt nachweislich gesünder und länger. Genau diese Menge fängt die anfallenden Radikale einer durchschnittlichen Ernährung mit 2200 kcal pro Tag ab. Behält Prior also recht, könnte das unseren Umgang mit Sauerstoff ein weiteres Mal verfeinern.
Vor 2,4 Milliarden Jahren kam es zu einem wunderbaren Unfall – Sauerstoff war dessen Abfallprodukt. Die Unfähigkeit, mit ihm umzugehen, löschte uns fast aus … und auch heute läuft damit nicht alles glatt. Jeder Atemzug, jeder blubbernde Fisch, jeder meterhohe Baum ist der Beweis, dass wir Lebewesen fähig sind, Krisen zu überwinden und mit Ungewolltem umzugehen. Auch wenn es dauert, holprig ist oder weiterhin Fehler bestehen – unsere Mühlenräder laufen, wir finden Wege und treiben stoisch und unbeeindruckt das Leben an.
Ein kleiner Exkurs zum Gleichgewicht des Lebens
1944 stellte der Physik-Nobelpreisträger Erwin Schrödinger der Wissenschaftswelt das Rätsel: »Was ist das Leben?« Die Frage trat einen Diskurs los, den Schrödinger zusammenfasste. In seiner Veröffentlichung begegnen uns die beiden Eigenschaften des Sauerstoffs wieder: die Energie und das Chaos. Hier eine Zusammenfassung:
Alles, was es heute auf der Welt gibt, lässt sich in der Physik danach einteilen, wie viel Energie es braucht, um zu existieren, und wie chaotisch (oder stabil) es ist. Ein Stein ist beispielsweise sehr stabil und braucht fast keine Energie, um zu existieren. Das sich sekündlich ändernde Wetter ist dagegen unglaublich chaotisch und verbraucht enorm viel Energie. Wir Menschen sind auf dieser Skala fast genau in der Mitte, jedoch ein klein wenig näher am Chaos des Wetters als an der Ruhe der Steine.
Immer wieder müssen wir Bedürfnisse erfüllen, um uns zu erhalten – atmen, essen, trinken, schlafen. Immer wieder kommen wir dabei nah an den Punkt in der Mitte – genau zwischen Stein und Wetter –, nur um uns in der nächsten Sekunde schon wieder davon zu entfernen.
Mit jedem Ein- und Ausatmen flattern wir so um den Punkt unserer Existenz. Dass wir nie länger in der Mitte bleiben können – in völligem Frieden, ohne Wünsche, Sehnsüchte oder Enttäuschungen –, ist nicht etwa der »Fluch des Lebens« – es ist seine Definition!
Die Regulation des Atems
Bis vor ein paar Jahren glaubten Forschende noch, Atmen funktioniere plump wie ein Lichtschalter. Sobald ein Atemzug vorbei sei (so war die anerkannte Meinung), würden die Nervenzellen fürs Einatmen automatisch wieder angeknipst … »Plipp-Plopp« sozusagen. Doch so läuft es nicht. Wie und wann wir einatmen, wird jedes einzelne Mal neu entschieden. Es wird sekündlich darüber abgestimmt, wie tief geatmet werden soll, wie viele Muskeln dafür mit welcher Energie eingesetzt werden und wie langsam wir die Luft wieder auspusten. Das Atemzentrum im Gehirn braucht für seine Entscheidungen eine ganze Palette an Informationen von Lungen, Blut und Muskeln.
Um die Lungen so exakt wie möglich zu bewegen, erfühlen Rezeptoren den Säure-, Kohlendioxid- und Sauerstoffgehalt des Blutes gleich an mehreren Stellen – in den Halsgefäßen, im Vorhof des Herzens und im Gehirn. Auch die Dehnung der Lungen und ihrer Gefäße, der Blutdruck und der Puls werden erfasst. In einem komplexen Abstimmungsprozess werden diese Informationen im Gehirn damit verbunden, ob wir gerade liegen, rennen, Grund zu Angst haben oder tauchen. Theoretisch reichen schon drei überzeugte Nervenzellen, um das Einatmen auszulösen. In der Realität wird es jedoch unter Tausenden von ihnen koordiniert und beschlossen.
Auch die Luft der Erde basiert auf einem solchen Abstimmungsprozess – dem sogenannten Sauerstoffzyklus. Was hier Zyklus genannt wird, ist ein verwobenes Netz aus Sauerstoff-Produzenten (wie Pflanzen), Sauerstoff- Verbrauchenden (wie uns Tieren) und der Atmosphäre (wie Gesteinsschichten, Ozeane und Erdböden). Durch sie alle wird Sauerstoff entweder aufgenommen oder abgegeben. Die kluge Verbindung aller Beteiligten sorgt dafür, dass der Erde seit Milliarden von Jahren nicht die Luft ausgeht. Es kann beispielsweise niemals mehr (Sauerstoff verbrauchende) Tiere geben als (Sauerstoff herstellende) Algen und Pflanzen. Ein Markt regelt sich selbst – aber nur wenn alle Beteiligten sinnvoll voneinander abhängig sind.
Abhängigkeit ist das Markenzeichen der Natur. Jedoch ist abhängig zu sein für sie kein Zeichen von Schwäche, sondern dient einer spezifischen Form der Intelligenz. Indem die Natur alles Mögliche sinnvoll miteinander verknüpft, entstehen Muster – ähnlich zu Denkmustern in unserem Kopf. Wissenschaften wie Mathematik, Physik, Geografie oder Medizin sind nichts anderes als Versuche, diese Muster zu verstehen und aufzuschreiben.
Gerät das fein austarierte Netz der Abhängigkeiten durcheinander, kriegen wir das zu spüren. Dann tritt beispielsweise eine Fraktion aus Nervenzellen besonders laut oder überzeugend auf, obwohl sie irrt! Wie in jedem Parlament, jeder WG-Sitzung oder Büro-Besprechung kommt es auch in unserem Atemzentrum manchmal zu Unstimmigkeiten. Wir atmen auf einmal schneller und tiefer, als wir müssten, hecheln unnötig angestrengt oder zu flach. Bei Anspannung und Panik, Sorgen und Kummer oder Freude werden unsere Lungen dann manchmal bewegt, als würden wir rennen, uns verstecken oder hüpfen … wir sitzen still da.