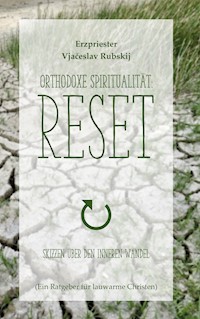
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über geistliche Suche heute, aus der Sicht eines orthodoxen Priesters und Psychologen."Was dieses Buch enthält, ist für die einen notwendig und für die anderen absolut unnütz", schreibt der Verfasser in seiner Einführung. Wer gerade frischverliebt in die Orthodoxie oder das Christentum überhaupt ist, oder wer seine Liebe über lange Jahre frisch bewahren konnte, der kann vielleicht nicht viel damit anfangen. Doch es ereilt zuweilen auch ernsthafte und rechtgläubige Christen: das Gefühl, nach jahrelangem Fasten, Beten, Beichten in einer Sackgasse angelangt, lauwarm geworden, gottfern zu sein. Die heiligen Kirchenväter verlangen scheinbar Unmögliches, und nicht an jeder deutschen Straßenecke wartet ein kluger geistlicher Altvater, um dem Herzen wieder auf die Sprünge zu helfen. Nicht in jeder Gemeinde findet man sogleich verständnisvolle Glaubensschwestern und -brüder. Weltliche Lebenshilfe-Literatur hilft kaum weiter: Der gläubige Christ findet sich dort nicht wieder, weil er nicht bereit ist, selbst sein eigener Gott zu sein ... Diese "Skizzen über den inneren Wandel" können ihm wahrscheinlich aus seiner Sackgasse heraushelfen. Allerdings muss man durchhalten bis zum Schluss. Erzpriester Vjacheslav Rubskij rüttelt an vielen liebgewonnenen Denkgewohnheiten und stürzt tradierte christliche Ersatzgötter vom Sockel, um anschließend gangbare Auswege zu entwickeln - gangbar für jeden, auch ohne Mönchsgelübde und Theologiestudium. Mut zur Veränderung reicht. Ob das alles auch orthodox genug ist? Nun - Vater Vjacheslav versteht seine "Skizzen" als Diskussionsangebot, nicht als Katechismus. Kritik ist erlaubt und erwünscht. Man ist nach der Lektüre näher bei Gott. Und das ist nicht wenig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Einführung
Glaube, Gott und Mensch
Die Bergpredigt: Game Change für die Rechtschaffenheit
Der Wandel in der Motivation zur Rechtschaffenheit
Auf der Suche nach dem Kriterium der Heiligkeit
Die andere Seite des Heiligenscheins
Heiligkeit und das Denksystem
Die Liebe und die Funktionen
Buße, Verbesserung, Annahme
Orthodoxes Gebet unserer Zeit
Schema des geistlichen Wegs in der heutigen Zeit
Weggabeln geistlicher Werte
Nachwort, auch über Psychologie
VORWORT
„Was dieses Buch enthält, ist für die einen notwendig und für die anderen absolut unnütz“, schreibt sein Verfasser in seiner Einführung. Wer gerade frischverliebt in die Orthodoxie oder das Christentum überhaupt ist, oder wer seine Liebe über lange Jahre frisch bewahren konnte, der kann vielleicht nicht viel damit anfangen. Es ereilt aber zuweilen auch ernsthafte und rechtgläubige Christen: das Gefühl, nach jahrelangem Fasten, Beten, Beichten in einer Sackgasse angelangt, lauwarm geworden, gottfern zu sein. Die heiligen Kirchenväter verlangen scheinbar Unmögliches, und nicht an jeder deutschen Straßenecke wartet ein kluger geistlicher Altvater, um dem Herzen wieder auf die Sprünge zu helfen. Nicht in jeder Gemeinde findet man sogleich verständnisvolle Glaubensschwestern und -brüder. Weltliche Lebenshilfe-Literatur hilft kaum weiter: Der gläubige Christ erkennt sich nicht darin wieder, weil er nicht bereit ist, selbst sein eigener Gott zu sein … Diese „Skizzen über den inneren Wandel“ können ihm wahrscheinlich aus der Sackgasse heraushelfen. Allerdings muss man durchhalten bis zum Schluss. Erzpriester Vjačeslav Rubskij rüttelt an vielen liebgewonnenen Denkgewohnheiten und stürzt tradierte christliche Ersatzgötter vom Sockel, um anschließend gangbare Auswege zu entwickeln – gangbar für jeden, auch ohne Mönchsgelübde und Theologiestudium. Mut reicht. Ob das alles auch orthodox genug ist? Nun – Vater Vjačeslav versteht seine „Skizzen“ als Diskussionsangebot, nicht als Katechismus. Kritik ist erlaubt und erwünscht. Man ist nach der Lektüre näher bei Gott. Und das ist nicht wenig.
Der Übersetzer
SKIZZEN ÜBER DEN INNEREN WANDEL
EINFÜHRUNG
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Überlegungen zur Qualität des orthodoxen geistlichen Lebens anzuregen.
Vertieft man sich in die Problematik, führt es zu nichts, wenn man Meinungen aufeinanderprallen lässt und versucht, „richtige“ und „falsche“ zu definieren. Binär denkende Christen tun dies schon seit langem und begnügen sich mit dem „Richtigen“.
Das menschliche Bewusstsein ist jedoch heterogen, unlogisch. Daran ist nichts Beschämendes, ebenso wie an der Tatsache, dass viele Christen an viele Bestimmungen ihrer Religion gar nicht glauben und dennoch weiterhin denken, dass sie es tun. In uns koexistieren zwei und zuweilen auch drei Orthodoxien und beunruhigen uns mit ihrer Vielfalt. Erst die reale Verbundenheit mit dem Herrn Jesus Christus macht das offensichtlich und gibt uns den Mut, diese Tatsache anzuerkennen.
So habe ich immer mal wieder frommen orthodoxen Christen für einen bestimmten Betrag angeboten, ihren gesamten Besitz posthum an meine Nachkommen zu vererben. Natürlich hat niemand zugestimmt. Natürlich – denn die Frage an sich ist Narrheit: „Wie erwarten Sie einerseits Seine unmittelbar bevorstehende Wiederkunft, wenn Sie andererseits nicht bereits sind, selbst später, nach Ihrem Tod, Ihr Eigentum an andere abzugeben?“ Wie wollen wir an den Heiligen Geist glauben, wenn wir uns keine Situationen vorstellen können, in denen Er spürbaren Einfluss auf unseren Alltag hätte? Stellen Sie sich vor, ein Seminarist, der zum Unterricht zu spät kommt, würde zum Dozenten sagen: „Entschuldigen Sie, der Heilige Geist hat mich zurückgehalten.“ Das dürfte wohl nur für Gelächter sorgen.
Die Sakramente und Gottesdienste, deren Grundlage das Wirken Gottes ist, sind so beschaffen, dass sie in gleicher Weise auch ohne Gott vollzogen werden könnten. Wir haben uns schon vor langer Zeit angewöhnt, über Gott zu denken: Nichts würde sich ändern, wenn Er nicht dabei wäre. Wir haben nicht einmal ein Kriterium für die Präsenz Christi in Seinen furchteinflößenden Sakramenten (d. h. für die Kommunion), und wir könnten geistlich einen ungeweihten Kelch nicht von einem geweihten unterscheiden, ebenso wie wir einen rechtmäßigen Priester nicht von einem unterscheiden können, der suspendiert ist.
Mir scheint, dass mit der geistlichen Ordnung unseres Handelns etwas nicht stimmt. Es hat sich von Gott, seiner wichtigsten Komponente, weitgehend unabhängig gemacht. Unsere Art des geistlichen Lebens ist allzu vorsichtig, die Manifestation Gottes darin auf ein Minimum zurückgeführt – auf lediglich noch den Einklang der eigenen Stimmung mit den gelesenen Gebeten.
Die kostbare Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott muss sich heutzutage ihren Weg bahnen wie eine Blume durch den Asphalt. Die orthodoxe Tradition ist lebendig, sie hat viele Saiten, die in der Geschichte der Beziehung zwischen Gott und Mensch als eine einzige Melodie klingen. Die Orthodoxie hat das Beste aufgenommen und als ihr Eigenes anerkannt. Denn die polyphone Natur der Orthodoxie, ihre innere Vielfalt ist ein Heiligtum, das großen Seelen die Freiheit und den Raum dafür gibt, andere Arten von Orthodoxie zu akzeptieren und sich in der Wärme und im Licht des Herrn geistlich zu entfalten.
Bei Gott sind alle Menschen verschieden. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, spricht der Herr (Joh 14,2). Ich glaube, dass es bei Gott nicht nur viele Wohnungen, sondern ebenso viele Wege zu ihnen gibt. Die Orthodoxie als lebendige und tiefe Tradition eröffnet uns diese vielen Wege.
Es gibt Bücher, die von Enttäuschung, Neugier, neuen Entdeckungen usw. motiviert sind. Das vorliegende Buch entstand aus dem Glauben an Christus und aus der Hoffnung, die Einsamkeit derer zu überwinden, die einen ähnlichen Weg gehen; jene zu unterstützen, die es annehmen und verstehen werden; den Versuch zum Dialog mit denjenigen orthodoxen Christen zu unternehmen, die ganz anders denken.
Einige Kapitel mögen nihilistisch oder zu radikal erscheinen, aber ich bitte Sie, bis zu jenen Kapiteln weiterzulesen, in denen die Liebe zu Gott, zu den Menschen, zur Anbetung und zu den Ritualen begründet wird, wenn auch aus einer etwas ungewohnten Sicht.
Das menschliche Bewusstsein neigt dazu, allem Neuen einen natürlichen Widerstand entgegenzusetzen. Vom Neuen wollen wir nur das annehmen, was uns gefällt und erhebt. Aber das Leben ist komplizierter. Zum Beispiel erschien Christus nach der Auferstehung einigen Jüngern, später dann vielen, sowohl solchen, die an Ihn glaubten, als auch solchen, die zweifelten (vgl. Mt 28,17). Uns erscheint es sinnlos, dass Er auch jenen Zweiflern erschienen ist, denn sie zweifelten schließlich auch nach Seiner Erscheinung noch immer. Die Weisheit Christi besteht darin, dass Er auch in der Ablehnung von etwas einen Sinn erkennt. Ablehnung ist für die Persönlichkeitsbildung ebenso wichtig wie Akzeptanz.
Der rechtschaffene Hiob stimmte nicht mit den orthodoxen theologischen Ansichten seiner Freunde überein, Gott aber sagte, dass Hiob mehr recht habe als seine Freunde. Aus dieser Sicht liegt eher derjenige Christ richtig, der nicht mit der Mehrheit des Christentums einverstanden ist. Bestimmte Ideen, Umstände und Praktiken werden von Gott gegeben, um sie abzulehnen, so wie im Fall von Hiob. Manchmal erwartet Gott genau dies.
Ablehnung prägt uns ebenso wie Akzeptanz: Wir müssen diese Weisheit bei unserer Bildung obenan stellen. Würde Gott uns nicht im Laufe des Lebens auch das geben, was wir nicht akzeptieren, könnten wir uns nicht vollständig ausprägen, sondern wären wie ein Fluss, der alles, was ihm zufließt, passiv aufnimmt.
Was dieses Buch enthält, ist für die einen notwendig und für andere absolut unnütz. Aber wenn man ihm auf einer Seite zustimmt und auf einer anderen wiederum nicht, dann möge man sich daran erinnern, dass beide Seiten im Kopf des Verfassers die eine Wahrheit des Lebens widerspiegeln.
Im Bewusstsein eines Schlafenden fügt sich das Klingeln des Weckers in die Traumbilder ein. So fügen auch wir auf natürliche Weise alle Phänomene der Welt in die uns vertraute Situation ein, um weiterzuschlafen. Menschen denken zumeist in Stereotypen, und das ist richtig so. Stereotypisierung spart Energie, ermöglicht die Automatisierung von Routinevorgängen (Licht ein- und ausschalten, sich in der Wohnung bewegen, Geschirr spülen usw.). Aber stereotypes Denken widersetzt sich dem Neuen, dem Überdenken, es nimmt Neues als Gefahr wahr. Es will gar nicht „wiedergeboren“ werden.
Die orthodoxe Erfahrung der Teilhabe ist zu kostbar, um sie nur aufzuschreiben und sich dann über Jahrhunderte zur Ruhe zu begeben, wie es uns unsere Ängstlichkeit diktiert. Wir möchten die rechte Erfahrung des wahren Gottes ein für alle Mal festhalten, protokollieren und besiegeln. Leider aber werden diese Weinschläuche, in die wir den jungen Wein des Christentums gießen, mit der Zeit alt. Im Laufe der Jahrhunderte verändern die menschlichen Ideen und Konzepte ihren Klang und Inhalt.
Die Basis jeder innovativen Idee ist es, Akzente zu setzen. Sie hängt direkt von anderen Ideen ihrer Zeit ab; die Innovation lehnt diese Ideen ab, stützt oder korrigiert sie. Es ist nicht so, dass einige Ideen falsch und andere wahr sind, so dass wir nur die richtigen auswählen müssten. Der in der Luft kreisende Schwarm von Ideen und Konzepten schafft eine fließende Leinwand, auf die wir das rettende Wort der Wahrheit malen müssen. Wir können eine Idee nicht in einem Vakuum verbreiten. Daher überarbeitet die orthodoxe Theologie ständig ihren Katechismus, und Prediger wählen die jeweils angemessene sprachliche Form, mit der sie das Herz ihrer Zeitgenossen erreichen können. Getreue Wiederholung uralter Wortformeln und -praktiken aber wird dabei mehr und mehr zu einer eigenständigen, lobenswerten, doch fernab vom Alltag liegenden Beschäftigung.
Innere Transformation, Wandel durch Krise, Wiedergeburt und Auferstehung sind die Essenz des Christentums, ein Zeichen seines Lebens. Es lohnt sich, darüber froh zu sein und unsere Zeit zu segnen. Ich möchte meine einleitende Betrachtung daher mit dem Zitat eines weltlichen Denkers beenden, der ständig über Gott und das Christentum schreibt: Dies gerade ist die Heldentat, die das Christentum vollbringen muss: Um seinen Schatz zu retten, muss es sich opfern, wie es Christus getan hat, Der sterben musste, damit das Christentum entstehen konnte“.1
1 Žižek, Slavoj: Die Puppe und der Zwerg (dt. Berlin 2003)
GLAUBE, GOTT UND MENSCH
GLAUBE ALS BEGEGNUNG
Glaube ist, wenn Gott mich berührt hat und ich mit Ihm / in Ihm lebe. Für mich ist das wichtiger als die Frage, wer über Ihn geschrieben hat, und was. Wenn ich doch wieder nach dem Geschriebenen greife, was für einen Sinn hatte es dann, dass Gott mich berührt hat? Ich werde eine heilige Schriftrolle gegen eine andere eintauschen.
Jedes Format unseres Lebens ist vergänglich, jedes Mal muss der Mensch neu geboren werden. Jeder Glaubensschritt ist wahr, wunderbar, notwendig, aber es ist jedes Mal notwendig, von diesem Schritt aus den nächsten zu tun. Dies nicht etwa, weil der Mensch in einer Lüge zu stehen kommt – wenn er aufhört, wiedergeboren zu werden, stirbt er einfach. Innerhalb von ein oder zwei Jahren wird er von der Gesellschaft aufgesogen, und er wird alles so betrachten, wie es alle tun – der Mensch hört auf zu sein. Was aber bedeutet „wiedergeboren“? Das bedeutet, die Welt mit einem freien, frischen Blick zu betrachten, sozusagen frisch-ketzerisch. So sah Christus die Welt an und schien ebenfalls ein Ketzer zu sein, weshalb Nikodemus auch lieber nachts zu ihm kam.
Jeder von uns muss ständig „neustarten“. Wie machst man das? Der erste Weg ist der apostolische: Lebe einfach, schaue möglichst aufmerksam Gott an und Er wird Sich offenbaren. Und jedes Mal, wenn Er etwas Unerwartetes tut, nimm es am besten als an dich persönlich adressiert an.
Nun ist nicht jeder so aufmerksam und hingebungsvoll wie die heiligen Apostel; es gibt deshalb einen zweiten Weg: den des Nikodemus, den Weg des Fragens. In der Orthodoxie gibt es Gebete des Lobpreises, des Flehens, der Buße, aber völlig verloren gegangen sind die fragenden Gebete, in denen also eine Frage an Gott gestellt wird. Wir wissen, dass die Frage genauso wichtig ist wie die Antwort, und dass jede Frage es schon an sich wert ist, ausgesprochen zu werden. Wenn wir Gott etwas fragen, bekommen wir eine Antwort – wie PAULUS, der fragte: „Warum brauche ich diesen Stachel im Fleisch?“ (vgl. 2 Kor 12,7), oder wie Nikodemus.
Der Weg von Nikodemus besteht auch darin, in diese undurchdringliche, nicht enden wollende Nacht hineinzugehen, in das Unbekannte unserer Erfahrung einzutauchen, sein geistliches Leben zu riskieren. Nikodemus – der Lehrer, der Rabbiner, eine angesehene Person – riskierte die Unversehrtheit seines geistlichen Lebens, das reich an spiritueller Erfahrung und Wissen war. Naturgemäß erhielt er den Ratschlag zum Neustart.
Wenn wir Gott fragen, müssen wir aufmerksam und zu jeder Antwort bereit sein. Dann wird uns alle anderthalb oder zwei Jahre garantiert genau solch ein Neustart zuteil. Wir werden das orthodoxe Gotteshaus und den Gottesdienst, unsere Seele, unsere Persönlichkeit und die Person Gottes und auch alles andere neu betrachten. Menschen müssen viele Male überdenken, was sie haben, sonst können sie nicht mit dem leben, womit sie leben müssen.
Nehmen wie ein junges Ehepaar – sie schauen einander an und sind froh. Aber lassen wir zehn Jahre vergehen, so werden sie sich anschauen und denken: „Was sehe ich vor mir? Es ist nicht mehr das, was vor zehn Jahren war, es ist viel schlechter.“ Da es keinen Neustart gab, haben sich diese beiden nicht neu erblickt. Sie haben Groll, Vorwürfe und Argumente angesammelt, die nicht immer gerechtfertigt sind. Wenn wir nicht lernen, einander, die Welt, Gott neu zu betrachten, sind wir als Christen ungeeignet.
Die Geschichte von Nikodemus gilt auch für uns. Dieser Mann war es wert, das Wort der Wahrheit zu hören. Die Wahrheit aber ist, dass man nicht an einem Ort verharren darf, sondern ständig Risiken eingehen muss. Viele unserer Heiligen standen im Konflikt mit den Kirchenführern. BASILIUS DER GROßE wurde fast eingesperrt, GREGOR DER THEOLOGE wurde, wie man heute sagen würde, nach Sibirien geschickt, JOHANNES CHRYSOSTOMUS kam praktisch durch die Verbannung zu Tode, ATHANASIUS wurde fünfmal inhaftiert, GREGOR PALAMAS wurde exkommuniziert, MAXIM DER GRIECHE verbrachte 25 Jahre im Gefängnis … Vielen Menschen kamen sie absonderlich vor, und mehr noch: Auch sie selbst hielten sich dafür, was sie in ihren Gebeten zum Ausdruck brachten. Sie wussten nicht, was ihr Fragen, ihr Experimentieren im geistlichen Leben bewirken würde. Aber ohne ein solches ist Orthodoxie unmöglich – es bliebe nur eine Art standardisierte Religion. Jeder Standard auf diesem Gebiet aber neigt zum Heidentum, zum Hohepriestertum.
Wie weit war Christus doch von den Hohepriestern entfernt! Einst brachten Seine Mutter und Sein Ziehvater zu Ehren Seiner Geburt zwei Tauben zum Jerusalemer Tempel. Als Er aufgewachsen war, hat Er dann die Tische mit den Tauben umgeworfen, ein recht radikales Verhältnis zu diesen Opfertieren erwiesen. Es gibt viele andere Beispiele, in denen Christus nicht nur einen Neustart predigte, sondern Selbst das sich verändernde Leben überdachte. Seine Freude kann sich bei Ihm in Enttäuschung wandeln; wir lesen etwa: Ich preise Dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil Du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast (Mt 11,25). Weiter aber sagt Er zu diesen Unmündigen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt sein werdet, jeder in sein Haus, und Mich alleinlassen werdet (Joh 16,31f). Es gibt Stellen im Evangelium, an denen wir sehen, dass Christus unterschiedliche Einstellungen zu denselben Dingen hat, und dies nicht, weil eine Ansicht wahr und die andere falsch wäre. Wir dürfen nicht erstarren, denn dann sind wir nicht bereit, Gott zu begegnen, Der weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist (Joh 3,8). Er kann von einer Seite her wehen, die für uns tabu ist, so wie für die Juden des 1. Jahrhunderts … Bei allem Wunsch, die Wahrheit zu festzunageln, Gott einzufangen wie einen Goldfisch und Ihn sich zu unterwerfen, wissen wir doch nicht, woher der Wind wehen wird, wie wir auch nicht wissen, was Gott morgen tun wird. Bei einer solchen Gottessicht ist es nicht leicht, zwischen Falsch und Wahr zu unterscheiden. Gerade hast du dein geistliches Segel nach der einen Seite gewendet, schon bläst Er von der anderen oder von allen Seiten gleichzeitig, wie es auch manchmal vorkommt. Gott erwartet von uns, dass wir wachsam sind und nicht denken, wir hätten bereits Gewissheit erlangt, dass Gott hier oder da ist. Orthodoxe Christen müssen wie ein Steuermann ständig die ganze Umgebung im Auge haben, um Gott zu erblicken.
Der Apostel JOHANNES DER THEOLOGE, der sich beim letzten Abendmahl an Jesus anlehnt, fragt: „Herr, wer verrät Dich?“ (vgl. Joh 13,25). Später in seinem Brief schreibt er: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm (1 Joh 4,16). All diese Fragen: Wer genau ist der Verräter? Was tun mit ihm? Was sind Wunder? Ist Er der Sohn Gottes oder nicht? usw. verlieren ihr Gewicht im Angesicht der späteren und reifen These des Apostels. Wir sehen einen anderen JOHANNES – nicht den geliebten Jünger vom Ende oder der Mitte des Evangeliums, geschweige denn den JOHANNES vom Anfang des Evangeliums, wo Christus ihn und seinen Bruder „Donnersöhne“ nannte (so eine Art persönlicher Spitzname – sie waren wohl am Anfang ihres christlichen Weges harte Männer). Aber JOHANNES ging diesen Weg nicht als getreuer Arbeiter, der sich der Parteilinie verschrieben hat, sondern als lebendiger Mensch, der seine Vision von Gott ständig erneuerte.
Daher sehen wir im Evangelium auch, dass die Apostel nicht nur einmal, sondern mehrmals Glauben gefasst haben – PETRUS und JOHANNES letztmalig gar erst nach der Auferstehung (Joh 20,8). Und auch wir können Gott viele Male nacheinander annehmen. Zuerst fassten wir Glauben daran, dass es da Jemanden im Himmel gibt. Dann, dass Gott mich persönlich ansieht und etwas mit mir zu tun hat. Später gewannen wir den Glauben, dass Er mich nicht anklagt, nicht nachtragend ist wie ein kleinlicher Mensch, sondern mich großmütig in Sein Herz aufnimmt. Und schließlich die Erkenntnis, dass Gott mich so geschaffen hat, dass ich mich und einen anderen Menschen annehmen kann. Er offenbarte mir diesen Akt als unseren gemeinsamen, synergistischen Akt, Er offenbarte mir die Metaphysik der Annahme eines anderen durch Sich Selbst.
DER GLAUBE AN ETWAS
Der Glaube an das Orthodoxe als ein gewisses Etwas ist nicht Glaube an Christus. Das gnadenhafte Feuer kann, selbst wenn es wirklich vom Himmel herabkommt, keineswegs irgendetwas bezeugen; es ist ein Wunder, es ist „Etwas“, mit dem man nicht auf persönlicher Ebene in Berührung kommen kann. Der Glaube an die Richtigkeit des Evangeliums, der Dogmen usw. ist nicht Glaube an den Gekreuzigten. Die Schrift ist richtig – ihre Prophezeiungen erfüllen sich textgetreu. Der Gekreuzigte ist dagegen nicht richtig, Er hat nicht die prophezeite Kraft erwiesen, hat keine Rache an Seinen Verfolgern genommen, keine Ordnung wiederhergestellt, weder in Israel noch in uns.
Tradition ist „Etwas“, Gott ist eine Person. Deshalb gerade bezeugt mein Glaube an „Etwas“ – an das Priestertum, an das Sakrale, an Wunder oder Entrückung – in keiner Weise meinen Glauben an Christus. Ich glaube an Gott, und verglichen mit Ihm glaube ich weder an Philosophie noch Theologie, weder an die Schrift noch an nette Überlieferungen. Dies alles war und ist ein beeindruckendes Reich der Worte, doch es ist nicht Er. Es ist nur Umgebung, nahebei.
DIE VERKÜNDIGUNG DES ORTHODOXEN GLAUBENS DER ANDEREN
In der großen Mehrheit der Fälle stellt die Predigt, die der Priester vom Ambo aus verkündigt, nicht dessen eigenes Denken, persönliches Empfinden und eigene Eingebung dar. Nach „schweigender Übereinkunft“ würde man solches als eitles Von-sich-aus-Gerede interpretieren. Nein, die Predigten werden im Namen der „Orthodoxie“ selbst gehalten. Ohne Gesicht, entpersönlicht aber kann solche Orthodoxie nicht wahrhaftig sein.
Im Kern steckt hinter der Anreicherung der eigenen Predigt mit Zitaten aus den Kirchenvätern und aus der Schrift ein ängstliches Verbergen des eigenen „Ich“; nur dieses allein aber könnte irgendetwas bezeugen. Hieraus entspringt die oft mangelnde Einbezogenheit der Gottesdienstbesucher in die Lehre der Kirche: Die Pastoren haben sie davon überzeugt, dass Orthodoxie nicht von dem ausgehen kann, der neben einem steht. Orthodoxie wird als etwas vermittelt, das von den heiligen Vätern und den Ökumenischen Konzilien ausgeht, so als habe es im Schaffen der Väter oder in der Rezeption der Konzilien keine Freiheit gegeben. Auf diese Weise wird die lebendige Wahrheit Gottes als Museumsstück dargeboten, denn dem Zuhörer stellt sie sich als unbeweglich und leblos dar, als Götze, als vollendetes, abgespieltes Lied. Wenn Wahrheit nicht mehr erfordert, dass man sie zu Ende denkt und singt, wenn sie in ihrer Tiefe nicht mehr ratend erlangt werden muss, dann ist ihre Erschöpftheit Tod. Wahrheit ist Leben, ein als Verpflichtung auferlegtes wahres Dogma ist Lüge.
Kein Mensch kann die „Orthodoxie“ als reines Konzept predigen. Dies wäre gerechtfertigt, würde es sich bei der Orthodoxie lediglich um ein theologisches System handeln – doch ein solches gibt es nicht ohne die Menschwerdung! Richtig wäre es daher zu sagen: Orthodoxie besitzt ein theologisches und philosophisches System, lässt sich jedoch nicht darauf zurückführen, sie lässt sich lediglich damit erklären.
Wäre Orthodoxie nur die geistliche Erfahrung allein der heiligen Väter, so bliebe sie deren Sache, nicht meine. Ein Prediger kann nicht ausschließlich Fremdes predigen, selbst wenn dieses Fremde wunderbar erscheint, denn das wäre nicht frei von Falschheit. Orthodoxie ist Teilhabe an Gott, daher kann man auch nur sich selbst predigen als den sichtbaren Teil dieser Teilhabe. Nicht von ungefähr predigte Christus Sich Selbst und nicht irgendeine Lehre. Nicht nur, weil Er Gott ist, sondern auch, weil dies die einzig reale Predigt ist.
Ihr seid das Licht der Welt (Mt 5,14). Es fällt uns schwer, unserem Lehrer zu folgen und zu sagen: „Ja, ich bin das Licht der Welt!“ Wir ziehen es vor, uns hinter den Heiligen zu verstecken: „Nein, nicht ich, ein anderer; da, diese Heiligen von der Ikonstase gewiss, aber ich bin weder Licht noch Salz!“ Nicht so „wie die Schriftgelehrten“ zu predigen heißt aber gerade, sich selbst in Christus zu verkündigen, ohne dabei das eigene Leuchten den eigenen Tugenden zuzuschreiben. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und Sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir (1 Kor 15,10).
CHRISTENTUM UND ENTTÄUSCHUNG
Das Christentum kann als gutes Märchen verstanden werden und ähnelt ihm stellenweise. Bei einer solchen Auffassung wird Skepsis auf jede erdenkliche Weise vermieden, sonst ist das Märchen aus. Es gibt viele kluge Menschen, die kritisches Denken auf dem Gebiet des Glaubens nicht zulassen, weil es für sie mit der Religion unvereinbar ist. Ein erwachsenes Christentum jedoch, das der Absurdität und Sinnlosigkeit sowohl des Alltagslebens als auch aller Ideologien furchtlos entgegensieht, steht jenseits der Skepsis.
Wenn jemand das Christentum aus Naivität angenommen hat und jetzt fürchtet, „den Glauben zu verlieren“, dann muss er, um seine Angst zu überwinden und im Christentum standhaft zu bleiben, durch äußerste Skepsis hindurchgehen. Für die hellen und reinen Seelen der Atheisten aber bleibt es bei dem fast kindlichen Glaube an den „Weg des Guten“, die „Gerechtigkeit“, die „Menschlichkeit“, beim „das darf man nicht“ und dem „gesunden Menschenverstand“. Im Anschluss an überzeugende Vorträge darüber, dass das Universum aus mehreren Arten von Energie und Fluktuationen von Quantenfeldern besteht und der Mensch eine Proteinmasse mit einer Reihe von Neuronen ist, legen kluge Biologen und Astronomen ein aufrichtiges Bekenntnis zu Sinn und zu hohen Werten des Menschen ab.
Nur wer sich der Bedingtheit aller Werte und Meinungen deutlich bewusst ist, kann fest an Gott glauben. Andernfalls wird sein Glaube an den „Weg des Guten“, an die „Gerechtigkeit“ usw. Gott zwingen, Sich um diese Götzen zu drehen und ihnen zu dienen: Akzeptiert wird Er dann nur in dem Maße, in dem Er ihnen entspricht.
DOSTOJEWSKI bemerkte, dass der Weg des Nihilismus aus der Enttäuschung bezüglich einer einzelnen und, wie es scheint, kleinen, unbedeutenden Sache seinen Anfang nimmt. Wenn aber ein Mensch erst einmal in einer seiner Lebensansichten desillusioniert worden ist, erkennt er, dass auch andere Positionen seiner Weltanschauung instabil sind. Wer sich an Milch den Mund verbrannt hat, der wird auch beim Kaffee vorsichtig. Daher ist die Erfahrung der Enttäuschung äußerst wichtig: Sie kann durch den Schock, den sie hervorruft, jegliche Selbsterkenntnis zum Erliegen bringen, sie kann aber auch zum konstruktiven Anfang des Erwachens werden. Ich zweifle, also bin ich, sagte AUGUSTINUS.
Enttäuschung kann dabei um sich selbst kreisen und zur Leidenschaft werden, die sich selbst nährt und gefällt. Der Enttäuschte glaubt dann, in eine höhere Stufe der Wahrnehmung der Welt einzutreten – dies ist ein latenter romantischer Narzissmus. Höchstwahrscheinlich tritt er nur auf der Stelle und bleibt derselbe wie vorher. Deshalb sage ich, dass man Ent-täuschung nicht nur in Bezug auf den Rausch der Verzückung, sondern auch in Bezug auf die Enttäuschung selbst erfahren muss, denn diese ist nicht weniger berauschend.
Der berühmte „Philosoph des Verdachts“ des 19. Jahrhunderts hatte den gleichen Gedanken: Freund, alles, was du liebtest, hat dich enttäuscht: Die Enttäuschung wurde endlich deine Gewohnheit: Und deine letzte Liebe, die du „Liebe zur Wahrheit“ nennst, ist vielleicht eben die Liebe zur Enttäuschung2 – ein Beispiel für die Fixierung auf das Enttäuschtsein. Ich versuche, Christen vor dieser Fallgrube zu schützen. Bald kommt die Zeit – und sie bricht bereits an – der großen und kleinen Enttäuschungen im Lager der Kirche. Und viele werden nicht zynisch genug sein, nicht menschenfeindlich genug, um dem subtilen Charme der enttäuschten Gefühle zu widerstehen.
Das romantische Selbstverständnis hat den kirchlich Naiven eine Grube gegraben, und diese Grube wird sich mit den kirchlich Enttäuschten füllen. Um den drohenden Sturm der großen und kleinen Enttäuschungen zu überleben, muss man in der Nähe von jemandem sein, der Gott liebt, dagegen die Theologie, Psychologie, Philosophie, Hermeneutik usw. nur schätzt, jedoch bereits jetzt an sie nicht glaubt – weil er, nach FREUD, Begehren mit Worten darin sieht: das Vergnügen daran, den erstrebten Gegenstand auf der Zunge zu tragen, als eine Form des Besitzes. Denn die sogenannte Desillusionierung hinsichtlich Gott und der Kirche ist meistens eine Enttäuschung in Bezug auf die Fähigkeit dieser Objekte, die Wahrheit zu garantieren. Wenn wir die intellektuelle Selbstbefriedigung von vornherein als die eigentliche Rolle der Geisteswissenschaften betrachten, dann werden ihr Fall und ihre Rebellion für einen Christen gleichermaßen unterhaltsam sein.
Die Liebe zu Gott sollte auf vielen Dingen basieren. Aber zwei fundamentale Grundlagen scheinen mir die wichtigsten zu sein: die Offenbarung der Begegnung, oder Berührung, mit Gott und ein besonnenes Misstrauen gegenüber allen Formen Seiner Darstellung in der Welt. Wenn es weder das eine noch das andere gibt, dann ist auch der Anfang zum Christentum nicht gelegt, sondern es herrscht nur heiliger Glaube an einen Weihnachtsmann namens Jesus, Allah, Vishnu, Perun usw.
GLAUBE UND ANTIKLERIKALISMUS
Als Element des besonnenen Misstrauens und Teil des orthodoxen Kerygmas (der Verkündigung) wäre heutzutage ein nüchterner Antiklerikalismus von Nutzen. Es ist kein Zufall, dass der Erlöser Selbst einen ansehnlichen Teil Seiner Verkündigung dieser Frage widmete (Mt 23). Es ist ja nicht so, dass die Pharisäer zu Seiner Zeit besonders schlecht gewesen wären – nein, es immer und überall dasselbe. So wie sich das Volk von seinen Abgeordneten unterscheidet, so muss auch zwischen Gott und Seinen Delegierten unterschieden werden. Um also die Schönheit Gottes zu predigen, muss ein Priester zumindest teilweise antiklerikal sein.
Die Entwicklung einer Kultur der Selbstkritik ist ein unschätzbares Anzeichen dafür, dass die Kirche reift. Die Asketen der Antike haben immer wieder ihre Bereitschaft unter Beweis gestellt, sich auch mit äußerst unfreundlicher Kritik auseinanderzusetzen. Toleranz ist zu wenig – man muss bereit sein, die Situation aus der Sicht des Gegners zu hören, zu analysieren, zu berechnen.
Die meisten Anhänger der Orthodoxie zeigen leider immer noch unbewusst Misstrauen gegenüber der Wahrheit und tabuisieren ängstlich die Position des Antiklerikalismus selbst innerhalb des Klerus selbst. Persönlich gesehen ist, wie ich meine, der Klerus etwas Wunderbares. Aber gerade in seinen goldenen Gewändern, in seinem Ikonenhaften ist er schrecklich, weil irreparabel, unverbesserlich, reuelos, schrieb WASSILI ROSANOW.3 Ein Verhältnis zur Kirchlichkeit wie zu einer heiligen Kuh erweist der Verkündigung der Orthodoxie keinen Gefallen. Aus fehlender Offenheit und dem Verbot der Antiklerikalität entwickelt sich ihre geschlossene Form. Mit Blick auf ihre Entwicklungsperspektiven im 21. Jahrhundert ist das ein strategischer Fehler.
Das Beispiel Christi und der Propheten bezeugt, dass Heiligkeit und offener Widerstand gegen etablierte Kirchlichkeit und Volksfrömmigkeit sich nicht ausschließen. Die Heiligkeit des Glaubens ist nicht weniger scharfsichtig als die Skepsis des Materialismus. Daher sollte das Vorrecht der freien Kritik an „allem, was heilig ist“, nicht leichtfertig Agnostikern und Atheisten eingeräumt werden.
Das odiöse Bild des Klerikers zog gesunde Kritik nicht nur von Seiten der Kirchenfeinde, sondern auch seitens ihrer Heiligen nach sich. Aus den Tagebüchern des heiligen JOHANNES VON KRONSTADT: Aber wer glaubt den Gefühlen unserer Mitbrüder – der Erzpriester? Alles beruht bei ihnen auf einem einzigen Interesse, dem Geld, und für Geld sind sie bereit, ihren Bruder hundertmal zu verkaufen: Auf dich geben sie keinen Groschen. Gott möge sie richten. Manchmal geben sie auf uns keinen Groschen, weil auch wir diejenigen nicht respektieren und keinen Groschen auf sie geben, die uns nicht respektieren. Dies geschieht zum größten Teil unter solchen, die gemeinsamen Dienst tun. Und leider zwischen den geistlichen Mitbrüdern; und die größte Feindschaft unter der Geistlichkeit herrscht wegen des Geldes. Geld, Geld betrübt diejenigen, die doch stets aufwärts schauen und in gegenseitiger Liebe leben sollten – in Demut und Sanftmut, in Geduld und Langmut.4 NIETZSCHE nannte das Priestertum Gottes Truthähne5, das ist beleidigend; aber noch viel weniger schmeichelhaft ist die Zoologie des heiligen GREGOR DES THEOLOGEN, der über seine Mitbischöfe schrieb: Du kannst einem Löwen vertrauen, ein Leopard kann zahm werden, und sogar eine Schlange kann vor dir davonlaufen, obwohl du Angst vor ihr zeigst; aber hüte dich vor einem – vor schlechten Bischöfen, und lass dich durch die Würde ihres Bischofsstuhls nicht beirren … Es sind unglückliche, verabscheuungswürdige Würfel des Schicksals; zweideutig in Glaubensfragen; Verehrer der Gesetze des vorübergehenden Gewinns anstelle der göttlichen Gesetze. Ihre Worte schwanken wie biegsame Äste hin und her. Sie sind eine Versuchung für die Frauen; sie sind ein Gift, das gut schmeckt; sie sind Löwen gegenüber den Schwächeren, aber Hunde gegenüber den Mächtigen; sie sind Raubtiere mit einem wunderbaren Gespür für jeden Leckerbissen. Sie putzen die Klinken der Türen der Mächtigen, nicht aber die der Weisen; sie denken nur an ihren eigenen Nutzen, aber nicht an den öffentlichen Nutzen, um ihren Nächsten Böses anzutun.6
Man könnte weitere Zitate der Heiligen anführen. Die Alten haben viel zu diesem Thema gesagt, ich aber sage euch: Liebt eure Popen, segnet diejenigen, die euch segnen, tut Gutes jenen, die euch sonntags nicht immer sehen, gebt Geld, wo ihr nichts zurück erhoffen könnt! Und ihr werdet die Söhne des Höchsten sein; denn auch Er ist gütig gegen die undankbaren und bösen Popen (Anspielung auf Lukas 6,35).
GLAUBE UND TRADITIONALISMUS
Wie authentisch ist die Orthodoxie? Authentizität ist die alte Vorbedingung der Wahrheit, ein bemoostes Götzenbild, das an die Stelle Christi tritt. Um es anzubeten, muss die Kirche ihrer Vergangenheit ähneln, ihre Texte wiederholen, auf alte Ängste zurückblicken, tote Gegner besiegen und antike Siege feiern (vgl. den „Triumph der Orthodoxie“ über die Ikonenverehrung).
Ich denke, wenn alle ihre Texte über Nacht vergessen würden, würde die Kirche ihre Authentizität nicht verlieren: Sie würde sie, gezwungenermaßen in anderer Form, mit anderen Akzenten, aber mit dem gleichen Zweck reproduzieren.
Strukturell besteht jede Predigt aus einer Antithese zu einer Idee (Invektive, Diatribe), etwas Neuem und dem Zweck der Äußerung selbst. Die Antithese - das, wogegen die Idee behauptet wird, kann sich verändern und wird sich verändern. Auch das Neue muss sich ändern, denn die Menschen lieben Neues. Der Zweck der Äußerung aber ist immer mit sich selbst identisch, schließlich ist es das Einzige, was wir bekennen. So ist zum Beispiel der Averroismus in der Geschichte nicht mit Aristoteles und selbst nicht mit dem Aristotelismus gleichzusetzen, und der Neuplatonismus ist nicht dasselbe wie Platon – doch ohne diese späteren philosophischen Strömungen würden wir kaum etwas über die antiken Philosophen wissen. Fazit: Um die christliche Botschaft zu transportieren, muss sie immer wieder überdacht werden. Ja, sie hört dabei auf, ganz authentisch zu sein, aber anders ist es unmöglich, sie mit ganzer Seele zu vermitteln. DOSTOJEWSKIS Dialog zwischen dem Großinquisitor und Christus ist eine brillante Illustration und, wenn man so will, eine Apologie dieser Unausweichlichkeit. LUTHERS Urteil „Sie haben es verzerrt, also haben sie es verraten“ ist falsch, nein: Indem sie es verzerrten, haben sie es überliefert!
Der orthodoxe Philosoph und Theologe CHRISTOS YANNARAS bewertet die Beziehung zwischen Traditionalismus und Spiritualität so: Die Menschen versuchen, sich durch ihre individuellen Tugenden zu bestätigen … Auf diese Weise verwandeln sie die frohe Botschaft der Kirche – einmal die Schrift, ein andermal die Tradition, zuweilen auch beides gemeinsam – in eine objektive „Autorität“, aus der sie metaphysische und sittliche Wahrheiten schöpfen, von denen sie ihre egozentrische Selbstgewissheit nähren. Sie machen aus der Kirche eine „Religion“, verwandeln sie in eine von einer Bürokratie getragene Institution, die über den Glauben regiert, als ob der Glaube eine Ideologie sei. Die Autorität der Institution und das der Ideologie innewohnende Gewicht garantieren die Richtigkeit der individuellen Wahl des „Glaubens“ ... Die Eucharistie hört auf, die Verwirklichung des evangelischen Daseinswegs, eine Manifestation des wahren Lebens zu sein, und wird zu einer individuellen Verpflichtung, am gemeinsamen Gebet teilzunehmen. Das Dogma, das die allgemeine kirchliche Erfahrung ausdrückt, wird zu einem autonomen ideologischen Inhalt, zu einem rationalistischen Verhaltenskodex, der den Einzelnen vor Unwissenheit und Fehlern schützt. Theologie wird dem Vorrang der Methodik unterworfen und verwandelt sich in eine „Wissenschaft“, die auf Beweisführung beruht und intellektuell gesicherte Fakten bietet. Die Askese der Gläubigen – der Akt und die Praxis der Teilhabe an der Dynamik der Beziehungen, welche die Kirche ausmachen – wird in Gesetzesregeln und Prinzipien individueller Moral kodifiziert. So verwandelt sich die Tradition, anstatt eine Überlieferung und Übernahme lebendiger Erfahrung zu sein, in eine Sammlung versteinerter Formeln der „Rechtgläubigkeit“ (Orthodoxie), die eine individuelle Selbstgenügsamkeit nährt, welche leblosen Schemata ergeben ist.7
GLAUBE UND RISIKO
Die Schultheologie teilt die Offenbarung in „natürlich“ und „übernatürlich“ ein. Niedergeschrieben wurde dies in einer Zeit, als der Positivismus als neue Richtung der Wissenschaftsmethodik in der Blüte stand (Positivismus erkennt als einzige Quelle für wahres Wissen das materiell-sensorisch Gegebene an). Die Orthodoxen spielten unbewusst mit, indem sie die oben erwähnte Einteilung der Offenbarung in der Tradition ausgruben. Mit „natürlicher“ Offenbarung war eine Schlussfolgerung gemeint, die auf überprüfbaren Beobachtungen (über Natur und Mensch) basiert, als „übernatürlich“ dagegen galt, wenn Gott direkt zum Menschen spricht. Durch welche Art der Offenbarung aber wurde die christliche Religion geboren?
Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh vor Mir und sei untadelig! (Gen 17,1); und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu Mir auf den Berg! (Ex 24,12). Im Neuen Testament: Der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen! (Apg 8,29). Während Petrus noch über die Vision nachdachte, sagte der Geist zu ihm: Siehe, da sind drei Männer und suchen dich (Apg 10,19). Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen (Apg 11,12) usw. Hier ist Gott der Handelnde, und Er handelt, wobei Er die positivistischen Anforderungen voll erfüllt. Erst sprach der Geist, dann schenkte Er Wunder, breitete das Meer zu den Seiten aus
Fundamentalism as an Ecumenical Challenge , Ed. Hans Küng und Jürgen Moltmann, London 1992)
– das ist das Feld der Sinneswahrnehmung der Welt: Alles ist verständlich, beobachtbar und sogar gefährlich. Wenn die Materialisten des 19. Jahrhunderts bei dem Reigen der machtvollen Wunder des Alten Testaments dabei gewesen wären, hätten sie aufgehört, Atheisten zu sein – doch Positivisten wären sie geblieben.
Aber wenn wir in der modernen Realität keine biblischen Wunder wie etwa die Aufnahme von Datan und Abiram in den Schoß der Erde (Num 16,32), die Auferstehung der Toten usw. sehen, dann bleibt einem positivistisch begründeten Atheismus nur übrig zusammenzufassen: Es gibt keinen Gott, denn Er flüstert mir nichts ins Ohr, heilt nicht auf wundersame Weise die guten Menschen und begräbt nicht auf wundersame Weise die schlechten. Der Glaube wird sich dann beeilen zu versichern, dass Gott nicht im Schall der Hörner ist (vgl. Ps. 46/47,6 russ.), sondern tief in der Seele, sehr tief – und leugnet so die wahre Grundlage des Katechismus-Christentums – die „übernatürliche Offenbarung“.
Wir haben schon lange Furcht vor der eigenen spirituellen Erfahrung gefasst. Ängstlich geworden durch die Gefahr der „Selbsttäuschung“8 fallen wir in das entgegengesetzte Extrem – den Positivismus im spirituellen Leben. Heutzutage wird der Satz „Gott hat mir gesagt ...“ gerade bei Orthodoxen ein spöttisches Lächeln hervorrufen. Die Fülle solcher Formulierungen in der Heiligen Schrift haben wir, nach positivistischer Auslegung, zu beinahe sinnleeren Floskeln degradiert. Es erscheint uns seltsam, dass PETRUS oder PAULUS ihre persönliche Erleuchtung in der Schrift selbst als Stimme Gottes bezeichnen. Und wenn es nicht Gott Selbst gewesen sein sollte, Der Seinen Meißel über die Steintafeln getrieben hat, dann würde das in den Augen jener Gläubigen, die der spirituellen Erfahrung misstrauen, fast schon die Wahrhaftigkeit des Dekalogs infrage stellen: Sollten es etwa wirklich persönliche Vermutungen sein, die Moses vierzig Tage lang auf dem Berg Sinai in Gebote gefasst hat? „Nein“, werden die gläubigen Positivisten antworten. „Nur so ist es möglich“, sagen dagegen die intuitiven Gläubigen.
Natürlich besteht eine „Gefahr von links“ – von Seiten des alles leugnenden Nihilismus – aber warum sehen wir keine symmetrische „Gefahr von rechts“ – seitens eines materialistischen Verständnisses der biblischen Geschichte? Der ehrwürdige DOROTHEOS VON GAZA schreibt: Ich weiß keinen größeren Sturz eines Mönchs als den, dass er seinen Gefühlen vertraut,9 rät aber selbst zum Gehorsam gegenüber einem Altvater, der seinen Gefühlen vertraut. Es gibt kein Entkommen aus unserem riskanten Vertrauen in unsere religiösen Gefühle. Gutgemeinte Versuche, sich hinter der Schrift oder den Werken der heiligen Väter zu verstecken, entbinden nicht von der Notwendigkeit, die Frage „Was war das?“ zu beantworten, und auf die Stimme Gottes, Der Seinen Adam sucht, zu erwidern: „Herr, bist Du es?“
Wir stehen vor der Notwendigkeit, den intuitiven Charakter der Erkenntnis aller Arten der Offenbarung Gottes anzuerkennen und gleichzeitig damit ihre Authentizität, die in der Schrift und bei den heiligen Vätern offenbart wird. Als Beispiel für das frühchristliche Verhältnis zur intuitiven Offenbarung will ich ein Fragment aus dem Väterbuch10 anführen: Drei Väter kamen zu Altvater SILUANOS, um Einsiedler in ihren Kellien zu sehen, und als sie einen von ihnen nicht vorfanden, beklagten sie sich. Sobald die Väter gegangen waren, ging Abbas Siluanos, mit sich selbst über das Geschehene nachdenkend, zu diesem Bruder und sagte zu ihm: „Du weißt, dass ich mein Kellion nur samstags und sonntags verlasse, aber jetzt bin ich mitten unter der Woche herausgegangen, denn mein Gott hat mich zu dir gesandt.“ Jener heilige Narrenmönch offenbarte dem Abbas sein asketisches Werk, worauf der Abbas SILUANOS sprach: „Wahrlich, die Väter, die gekommen sind, waren heilige Engel, die die Tugend des Bruders verkünden wollten, denn bei ihrem Kommen geriet ich in große Freude und geistliche Erhebung.11 In dieser Geschichte sehen wir, dass das Erkennen der Stimme Gottes und der Engelserscheinungen nicht empirisch, sondern völlig intuitiv, also als eine Variante der persönlichen Interpretation, geschah.
GLAUBE, ÜBERZEUGUNGEN UND ARGUMENTE
Der Hauptgegner des Glaubens ist nicht der Atheismus, sondern die quasireligiösen Fesseln, die dem religiösen Glauben Abbruch tun. Sie entstehen ursprünglich in Form eines zusätzlichen Arguments, treten anschließend als integraler Bestandteil des Glaubens auf und beginnen, die Frage „Gibt es Gott?“ zu beherrschen.
So wurde etwa im 19. Jahrhundert das Gilgamesch-Epos entziffert, in dem es eine Geschichte über eine Flut gibt, die sehr an die Bibel erinnert. Im viktorianischen England wurde dies zu einem starken Argument gegen den Glauben, und die religiösen Briten erlitten einen Nervenzusammenbruch. Heute gilt diese Erzählung umgekehrt als Argument für die Geschichtlichkeit der Bibel.
Für viele waren auch die Entdeckungen liberaler christlicher Textgelehrter über die Autorenschaft der Tora ein Schlag gegen die Autorität der Bibel, das heißt gegen den Glauben. Heute ist es uns aus verschiedenen Gründen egal, wer genau den Pentateuch verfasst hat. Das gleiche gilt für die Bibelkritik im Allgemeinen und für den Kreationismus und Evolutionismus ebenso.
Um die Vorstellung von der Unverweslichkeit der Heiligenreliquien zu widerlegen, haben die Bolschewiki Anfang des 20. Jahrhunderts absichtlich deren Schreine geöffnet und dort verweste Gebeine vorgefunden. Für vorrevolutionäre orthodoxe Christen war dies ein sehr gewichtiges Argument gegen Gott. Ende des 20. Jahrhunderts war es der Glaube an die Echtheit des sogenannten fünften Evangeliums, des Turiner Grabtuchs, der erschüttert wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren orthodoxe Christen und Katholiken im Allgemeinen bereits darauf vorbereitet, dass weitere „unwiderlegbare Zeugnisse“ scheitern würden, dennoch bedeutete dies eine weitere schwere Glaubensprüfung.





























