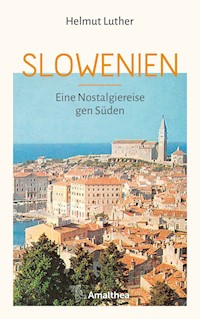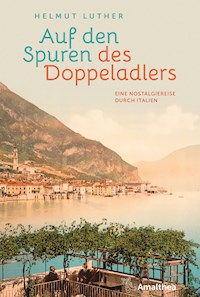Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren des alten Kaiserreichs Brioni, Abbazia, Fiume – das sind die klingenden Namen der Kur- und Badeorte an der einstigen k. u k. Riviera. Wer heute durch Brijuni, Opatija oder Rijeka schlendert, trifft noch immer auf den Charme vergangener Zeiten. Helmut Luther begibt sich auf nostalgische Entdeckungsreise von Meran über den Gardasee bis nach Triest und Pula ins einstige Österreichische Küstenland. Unterwegs begegnet er historischen Persönlichkeiten wie den Bildhauern und Malern Peter und Paul Strudel, Ingenieur Carlo Ghega, Mozart-Konkurrent Antonio Salieri, der Schauspielerin Nora Gregor, dem Industriellen Paul Kupelwieser und vielen anderen. Gestern und Heute, Berge und Meer – entdecken Sie die k. u. k. Sehnsuchtsorte aus einer Zeit, als Österreich am Meer lag. Mit zahlreichen Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Luther
—
Österreich liegt am Meer
HELMUT LUTHER
Österreich
liegt am Meer
EINE REISE DURCH DIE
K. U. K. SEHNSUCHTSORTE
Mit 49 Abbildungen
Für Bettina
Bildnachweis
Helmut Luther (17, 33, 57, 64, 71, 81, 86, 99, 115, 117, 125, 129, 139, 160, 164, 184, 195, 203, 213, 216, 223, 227, 237, 249, 260, 267, 270), Wikimedia Commons/Lungoleno (28), Archiv des Amalthea Verlages (41, 44, 53, 93, 175, 201, 235), AKON Ansichtskarten Online (55, 255, 265), Biblioteca Archivio del CSSEO (61), Wikimedia Commons/Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures (75), IMAGNO/Austrian Archives (S) (105), lacollina.org (108), IMAGNO/Franz Hubmann (135), IMAGNO/Österreichische Nationalbibliothek (147, 243), Wikimedia Commons/Foto: FORTEPAN/Budapest Főváros Levéltára (171), IMAGNO/Sigmund Freud Privatstiftung (183), Wikimedia Commons/WestportWiki (198), SRS – Rene van Bakel (204)
Übersichtskarte Seite 10/11: © arbeitsgemeinschaft kartographie
Der Verlag hat alle Rechte abgeklärt. Konnten in einzelnen Fällen die Rechteinhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig gemacht werden, bitten wir, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2017 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagabbildung: Das Café Principe Umberto in Abbazia, Kroatien, Postkarte um 1920 © IMAGNO/Archiv Dr. Samsinger
Herstellung und Satz: Lothar Bienenstein KG
Gesetzt aus der Minion Pro und Museo Sans 500
Printed in the EU
ISBN 978-3-99050-072-9
eISBN 978-3-903083-58-5
Inhalt
Einleitung
Drei Brüder
CLES – VERVÒ
Pezzi grossi – schwere Brocken
VILLA LAGARINA – NOGAREDO
Ein Capostazione, der das große Los gezogen hat
MORI – ARCO – RIVA
Wiege eines Bundeskanzlers
RIVA
Ein Landschaftsmensch
NAGO
Treu der Pflicht, fest im Recht
PRIMIERO
Der Weltmusiker aus Legnago
LEGNAGO
In Venedig fing alles an
VENEDIG – MESTRE
Ihr Blick ging in die Ferne
GORIZIA– CORMÒNS
Slowenischer Ikarus
GORIZIA
Ein Nachfahre von Eichendorffs Taugenichts
GORIZIA – TRIEST
Die Welt als Bühne
TRIEST
Haifisch aus dem Ghetto
TRIEST
Schatten der Vergangenheit
OPICINA – TRIEST
Es gibt keine Alpen mehr als hindernde Schranke
TRIEST
Im Auge des Zyklons
TRIEST
Capo, Nero, Deca
TRIEST
Wo Pferde Vorfahrt haben
LIPICA
Mother’s little helper
OPATIJA
Zwei Erfindungen
RIJEKA
Traumgestalt aus der Pampa
VIŽINADA
Ein glückloser Erfinder
MOTOVUN
Wie schön wäre es als Feuerwehrmann auf Brijuni
DIE BRIJUNI-INSELN
Glück einsamer Nachtwachen
PULA
Nachwort
Literaturverzeichnis
Personenregister
Ortsregister
Einleitung
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich das Schlafzimmer meiner Großmutter vor mir: das stille Halbdunkel hinter weißen Vorhängen, der knarzende Parkettboden, das breite Ehebett aus Massivholz, der Schrank und das Nachtkästchen, wo stets eine Dose mit Hustenbonbons »Schwarze Johannisbeere« bereitlag. Großmutter litt an einer chronischen Erkrankung der Atemwege, nie begegnete ich ihr ohne Taschentuch und ekelte mich ein wenig, wenn sie mich schwer atmend abküsste, nachdem sie das schleimige Tüchlein im Ärmel verstaut hatte, und dabei den Geruch von Eau de Cologne auf welker Haut verströmte. Und doch liebte ich Großmutter. Zugegeben, ein bisschen lag das an der Hustenbonbondose. Denn unsere Besuche folgten einem festen Muster. Nach der Begrüßung stürmten meine Geschwister und ich ins Schlafzimmer, ergriffen die Bonbondose und vertilgten ihren Inhalt, während wir auf dem Bett herumturnten, ungeachtet Großmutters Warnung, dass die Bonbons eigentlich Medizin seien: »Zu viel davon schadet!«
Im Schlafzimmerschrank befand sich noch eine weitere Dose, eine viereckige Keksschachtel aus Blech, in welcher Oma ihre Erinnerungsschätze hütete: vergilbte Briefe, Zeugnisse, Schwarzweißfotos mit Zackenrand und ein nach dem Modell der Heiligenbilder bemaltes Kartonstückchen, an dem ein fingernagelkleiner bunter Stofffetzen hing. Angeblich stammte er von Kaiser Karls I. Feldmarschalluniform, eine Art Reliquie also, die Großmutter mit größter Sorgfalt in die Hand nahm und dabei einen ehrfürchtigen Ton anschlug. Im Grunde interessierten uns jene Geschichten nicht sonderlich, die Oma erzählte, wenn sie sich zu uns aufs Bett setzte und bemerkte, dass wir auch diese Schachtel geöffnet hatten. Die Geschichten handelten von ihrer Kindheit, als sie einmal am Hauptplatz unserer Heimatstadt Meran mit anderen Schulmädchen Spalier gestanden war, um begeistert Kaiser Franz Joseph zuzuwinken. Und sie handelten vom Krieg, der Spanischen Grippe, die Millionen Todesopfer gefordert hatte, von den Hungerjahren, in denen sie die Bauern in den umliegenden Dörfern um etwas Essbares angefleht und einmal zur Antwort bekommen hatte, die Milch, um die sie gebeten hatte, werde für die Schweine benötigt. Es waren stets dieselben von Klagen untermalten Erzählungen, wir kannten sie alle, und doch sog ich sie auf wie ein süßes Gift, während ich, an Großmutters weichen Körper geschmiegt, ein Hustenbonbon nach dem anderen lutschte.
Schoben wir im Schlafzimmer die Vorhänge zur Seite, konnten wir am Berghang gegenüber die Vinschgauer Bahn sehen. In den ausgehenden 1960er-Jahren wurden auf dieser Strecke für den Güterverkehr noch Dampflokomotiven verwendet. Wenn die Lok damals in Kehren aufwärts kroch, war ihr rhythmisches Stampfen durch das geöffnete Fenster zu hören. An der Lautstärke ließ sich beurteilen, ob das Wetter schlecht würde (in diesem Fall hörte man die Lok deutlicher), und wenn sich die Fahrt wegen der schweren Last verlangsamte, schien die Lok stoßweise »jetzt derschnauf i’s nimmer, jetzt derschnauf i’s nimmer!« zu jammern – so erklärte es die Großmutter, sie war eine einfache Frau. Auf dem Retourweg hatte die Bahn auf den offenen Güterwaggons manchmal tonnenschwere Marmorblöcke aus den Vinschgauer Brüchen geladen, welche in der Sonne wie mächtige Zuckerkristalle glitzerten. »Mit diesen Steinen wurde Wien erbaut«, behauptete die Großmutter, was prinzipiell der Wahrheit entsprach. Tatsächlich wurden etliche Monumente an der Wiener Ringstraße aus Vinschgauer Marmor errichtet – wie zahllose andere Denkmäler des Habsburgerreichs, welche von der Südbahn in die Hauptstadt und von dort weiter in alle Ecken der Monarchie transportiert wurden. Der Zug, der damals vor meinen Augen in Richtung Wien rollte, diente mir als Traumvehikel und nahm mich mit auf die Reise.
Aus Vinschgauer Marmor gehauen wurde auch eine Statue im Kaiserin-Elisabeth-Park meiner Heimatstadt: Die Regentin sitzt dort kerzengerade in einem filigranen Stuhl mit halbkreisförmiger Lehne, in ihrem Schoß ein Buch, über dem sie verträumt in die Ferne blinzelt. Eines Tages, als ich schon älter war, gab es um diese Statue eine schreckliche Aufregung: Vandalen hatten Sisi mit roter Farbe beschmiert und ihr den Kopf abgeschlagen. »Faschisten!«, hörte ich die empörten Erwachsenen murmeln – damals begann ich zu ahnen, dass Monumente häufig mit einer zwiespältigen Bedeutung aufgeladen sind. Als dann die gereinigte Statue, das Haupt angeklebt, erneut an ihrem Platz stand, umkreiste ich sie scheu und suchte nach den Spuren des Gewaltaktes. Zwischen 1870 und 1889 hielt sich die Kaiserin insgesamt einige Monate in Meran auf. Der Besuch bescherte der Kurstadt, was der Direktor des lokalen Tourismusmuseums heute als »Brigitte Bardot-Effekt« bezeichnet. Sisi, das begriff ich später, hat vielen Kurorten zu Ruhm verholfen. In zahlreichen Städten des ehemaligen Habsburgerreichs ließ sich die Kaiserin – in ihrem Gefolge andere Berühmtheiten jener Epoche – zeitweilig nieder. Diese Menschen waren dort mit ihren echten oder eingebildeten Leiden beschäftigt. Sie frönten den damals modernen Freizeitbeschäftigungen, residierten in Villen und Schlössern, welche manchmal eigens für diesen Zweck erbaut worden waren, sie dilettierten als Künstler oder erforschten mit wissenschaftlicher Neugier die Alltagskultur der Region.
Der legendären Südbahn folgend, welche einst den Süden des Imperiums als Lebensader durchzog, werde ich mich auf den Weg machen, um Spuren von damals zu entdecken. Entlang einer aufgelassenen Teilstrecke gelange ich zuerst zum Gardasee, dem kleinen Meer am Südrand der Alpen, wo im späten 19. Jahrhundert die mondäne Gesellschaft kurte. Dem Saum der Adria folgend, wird die Tour über Venedig nach Görz im Friaul führen, nach Triest, Rijeka und Opatija an der Kvarner Bucht und schließlich nach Istrien. Bis zum Untergang der Donaumonarchie bildete die Halbinsel zusammen mit Triest und Görz das Kronland »Österreichisches Küstenland«. Österreich lag damals also wirklich am Meer. Seit 1873 war der aufstrebende Kurort Opatija bequem über Nacht aus der Hauptstadt erreichbar, die Mehlspeisen wurden täglich frisch aus Wien angeliefert. In Opatija und an manch anderer Adria-Perle möchte man heute wieder den Brigitte Bardot-Effekt ankurbeln. Andernorts hasste man jede Habsburgnostalgie. Nicht nur in meiner Heimatstadt schlug man Monumenten aus der österreichischen Vergangenheit den Kopf ab. Doch sind es vielleicht gerade diese Brüche, die uns heute verbinden. Unterwegs werde ich auch nach Großmutters Kaiser Karl-Reliquie Ausschau halten, sie war im Lauf verschiedener Umzüge verloren gegangen. Die Suche wird vergeblich bleiben. Was den Verlust aufwiegt, sind viele interessante Begegnungen und Geschichten.
Drei Brüder
CLES – VERVÒ
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als die Brüder Paul, Peter und Dominik Strudel von Venedig in ihre Heimat, das Nonstal, zurückreisten, benötigten sie für die Strecke acht oder zehn Tage. Heute dauert die Fahrt kaum mehr als drei Stunden. Bei Mezzocorona nördlich von Trient verlässt man die Brennerautobahn. Überschwemmungen schufen hier am Zusammenfluss des Noce und der Etsch in Jahrtausenden eine weite Schuttebene, die jetzt eine grüne Reblandschaft bildet. Durch einen langen Tunnel geht es zunächst vierspurig, dann auf einer gut ausgebauten, zweispurigen Straße immer tiefer in das Val di Non hinein, wie es im Italienischen heißt. Soweit das Auge reicht, klettern an den Hängen terrassierte Obstanlagen empor, ganz oben umkränzen es die zackigen Ausläufer der Brentagruppe. An den Rändern der Dörfer dehnen sich gewaltige Kistenlager für die Obsternte aus. Die Äpfel, welche an Verkaufsständen entlang der Straße angeboten werden, lagern in ebenso gewaltigen Kühlhäusern, um später, mit dem Marken-Aufkleber »Melinda« versehen, in weite Teile Europas verkauft zu werden. Ab und zu, wenn man über eine Brücke fährt und tief unten in einer Schlucht der Nocefluss vorbeibraust, kann man erahnen, wie gefährlich und mühsam das Reisen hier früher gewesen sein muss, als es nur Saum- und Treidelpfade gab. Verwitterte Burgen auf Hügelkuppen verraten jedoch, dass im Nonstal, welches über Pässe nach Norden hin mit dem deutschsprachigen Südtirol und nach Süden hin durch das Etschtal mit Venetien verbunden ist, schon immer ein reger Verkehr herrschte.
In Cles, dem Hauptort des Tales, fällt mir an einer Renaissancefassade das Wappen der Miller-Aichholz auf. Im 19. Jahrhundert, als Zuckerfabrikanten zu einem der reichsten Industriellengeschlechter des Habsburgerreichs aufgestiegen, hatten die Miller-Aichholz hier ihren Ursprung. Das Palais in der Prinz-Eugen-Straße im vierten Wiener Gemeindebezirk diente der Kunst liebenden Familie zur Ausstellung ihrer Preziosen, bis es während der Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg an den Spekulantenkönig Camillo Castiglioni verkauft werden musste. Castiglioni werden wir später noch einmal in Triest begegnen. Schwieriger gestaltet es sich, im hübschen Dorf einen Hinweis auf die Brüder Strudel zu entdecken.
Vervò, St.-Martins-Kirche: Den linken Seitenaltar, den Heiligen Philipp und Jakob gewidmet, hat Pietro Strobli geschnitzt.
Mit seinem Roman »Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre« machte Heimito von Doderer die Monumentaltreppe im neunten Bezirk sowie den dazugehörigen Strudlhof berühmt. Weniger bekannt ist dessen Erbauer Peter Strudel sowie die Rolle, die er mit seinen Brüdern Paul und Dominik im Wien des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts gespielt hat. 1688 gründete Peter im Strudlhof eine private Kunstschule – sie gilt als Grundstein der ältesten Kunstakademie Mitteleuropas. Nach der überwundenen Türkengefahr beginnen Kaiserhof, Kirche und Adel mit einer imponierenden Bautätigkeit. Die Gründe dafür erklärte Antonio Bormastini, der Edelknaben-Sprachmeister am Kaiserhof – ja, diesen Beruf gab es damals auch!: »In einer solchen Statt« würden es »die Vornehmen einer … dem anderen zu Trutze thun, stattliche Gebäude aufzuführen.« Als Maler, Bildhauer und Architekten machten die Brüder aus dem Nonstal mit der Bau- und Repräsentierwut der Wiener Hautevolee gute Geschäfte. Venedig war die Zwischenstation auf ihrem Weg in die Hauptstadt gewesen.
Auch in der Serenissima war es nämlich im Zuge der Türkenkriege, die den Expansionsdrang dämpften und die Energien nach innen richteten, zu einer regen Bautätigkeit gekommen, berichtet Manfred Koller, dessen Biografie »Die Brüder Strudel« mir auf dieser Tour wertvollste Dienste leistet. Die meisten Lexika geben Cles als Geburtsort der Strudel-Brüder an. Nach Lehrjahren als Holzschnitzer in den Werkstätten des Nonstales gelangten der um 1648 geborene Paul sowie sein zwölf Jahre jüngerer Bruder Peter als angehende Künstler in die Serenissima. Der Tag ihrer Ankunft sowie genaue Geburtsdaten sind nicht bekannt. Sicher ist, dass das Duo in der Werkstatt des aus Bayern stammenden Johann Carl Loth nahe der Rialtobrücke tätig war. Dort ließ Loth nach Originalen sowie Kopien Tintorettos, Veroneses und Strozzis arbeiten und nahm es in seinem von Kunsthistorikern als »Bilderfabrik« gescholtenen Atelier je nach Preis mit der Qualität nicht so genau. Sieht man sich heute in den Antiquitäten- und Juwelierläden der Sotoportegos rund um die von Menschenmassen überflutete Rialtobrücke im Herzen Venedigs um, kann man in punkto mangelnder Qualität eine gewisse Kontinuität feststellen.
In die Steuerlisten der Malervereinigung, in welcher auch Händler von Masken, Leinwänden und Farben vertreten waren, ist »Piero Strubi« 1685 mit sechzehn Lire eingetragen. 1697, aus Wien erneut zurück in Italien, tauscht Peter Strudel in der Kirche San Bernardino in Verona ein Gemälde Veroneses gegen eine Kopie aus, das bis heute unauffindbare Original nahm er vermutlich in die Kaiserstadt mit. Drei Mönche des zugehörigen Klosters wurden für diese Nacht-und-Nebel-Aktion zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Diebstahl, Fälschung, dunkle Geldkanäle, Kunst und Verbrechen sind also keine Spezialität des 21. Jahrhunderts. Neben seinem eigenen Kunstschaffen wird Peter Strudel zeitlebens Geschäfte mit den Werken anderer machen, für die Kaiserin besorgt er etwa »italienische Galanterien«. Aber ist Piero Strubi überhaupt »unser« Strudel? In den Archiven tauchen die Namen »Strodl«, »Strobl«, »Strobli«, »Strobth«, »Strol«, »Strodlin« sowie »Strudl« auf – erst in jüngerer Zeit setzte sich die Schreibung »Strudel« durch. Bis heute werden die Künstlerbrüder verwechselt oder für eine einzige Person gehalten. Auch über ihre Herkunft gab es lange unterschiedliche Theorien, mittlerweile gilt als gesichert, dass die Familie aus dem oberbayrischen Mittenwald ins Nonstal eingewandert ist.
Der älteste Strudel-Bruder Paul gelangte um 1680 nach Wien, wo er nach dem Vorbild Berninis erstmals Großplastiken schuf und so in der Hauptstadt »sofort Furore« machte, wie sein Biograf Koller schreibt. Den großen Coup landete Paul Strudel, indem es ihm gegen alle Widerstände der lokalen Handwerker und Künstler gelang, mit der Projektleitung der Pestsäule am Graben beauftragt zu werden. Die von Kaiser Leopold I. während einer der letzten großen Pestepidemien 1679 versprochene Säule gehört zu den bekanntesten Kunstwerken Wiens. Ein grandioses Denkmal der Glaubensstärke, in welchem die irdische Welt der Sünden und Gottesstrafen (Türkenbelagerung und Pest), das Zwischenreich der Engel sowie die Sphäre der Dreifaltigkeit in einem himmelwärts stürmenden Rausch aus Gold und Marmor als eine große, alle Widersprüche auflösende Einheit dargestellt werden. 16 818 Gulden bekommt Paul Strudel für seine Arbeiten an der Dreifaltigkeitssäule – weit mehr als alle übrigen beteiligten Künstler. Unter anderem stammt Kaiser Leopold I., der mit schulterlanger Allongeperücke, Schnurrbart und seltsam vorgeschobenem Unterkiefer vor dem oberen Säulensockel kniet, aus der Hand Paul Strudels. Selbstbewusst platziert der Künstler als Einziger seine Unterschrift gleich dreimal an gut sichtbarer Stelle. Bis zu seinem Tod am 20. November 1708 vollendete Paul sechzehn der einunddreißig von Kaiser Leopold in Auftrag gegebenen, lebensgroßen Statuen aus weißem Marmor für die Habsburger Ahnengalerie, welche heute zum Teil den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien zieren.
Aus vielen Quellen geht hervor, dass den Künstler Schulden und Existenzängste wegen der schlechten Zahlungsmoral hoher Auftraggeber plagten. Er habe »alles versetzt, um mein Versprechen zu manutenieren, die Verfertigung der Statuen zu größer Glori und ewiger Gedächtnuß des glorwürdigsten Ertzhauß …«, klagte Paul Strudel, als wieder einmal die vereinbarten Raten für längst auf eigene Kosten hergestellte Arbeiten ausblieben. Nach seinem Tod fertigte der jüngere Bruder Peter die restlichen fünfzehn Marmorfiguren für die Ahnengalerie an. Als »Direttore della Struttura delle Cesaree statue« war auch Peter ständig in Konflikte mit Auftraggebern um Geld verwickelt – mit Pauls Sohn Leopold stritt er sich um das Erbe.
Der Siegeszug des Zweitgeborenen in Wien ist noch beeindruckender als die Karriere von Paul Strudel. 1888 wird ihm der Titel »Kammermaler« verliehen. Nur ein Jahr später erhält der kaum Dreißigjährige vom Kaiser ein Jahresgehalt von dreitausend Gulden zugesprochen, mehr bekommt kein Hofkünstler. Im Gegenzug musste der Künstler sein Talent acht Monate im Jahr ausschließlich der Ruhmesvermehrung des Kaisers widmen. Ähnlich wie in der Architektur Johann Bernhard Fischer von Erlach fiel Peter Strudel mit seiner Malerei die Rolle zu, dem imperialen Anspruch des erstarkten Kaiserreichs Geltung zu verschaffen. Er belieferte die Hauptstädter mit seinen an venezianischen Vorbildern geschulten Portraits, religiös mythologischen Gemälden, die heute in Wiener Gotteshäusern hängen – etwa in der Rochuskirche oder der Währinger Pfarrkirche, im Belvedere oder der fürstlich Liechtenstein’schen Galerie. Sein Selbstbewusstsein wird an den hohen Honorarforderungen deutlich: Für zwei Altarbilder und zwei Supraporten verlangt und bekommt er 3500 Gulden – heute wären das etwa 180 000 Euro.
Quellen schildern Peter Strudel als tatkräftigen, vor Ehrgeiz brennenden und rastlos an seiner Karriere bastelnden Künstler. »Manchmal sticht der Geck dem Maler vor und der Welsche einem praktikablen Mann«, urteilte Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn wenig schmeichelhaft – spekulierte aber nach Strudels Tod auf eine sofortige Wertsteigerung von dessen Werken: »Strudelius ist maustot und werden nun gar in balden dessen Gemahl sicher in höheren Wert sein.« Im Strudlhof an der Währinger Straße, der als Sitz der Akademie sowie als Wohn- und Arbeitsort Peter Strudels und seiner Familie dient, hält er sich einen Hofstaat mit eigenem Kammerdiener, Sekretär und ergebenen Schülern. Zum Unterricht gehören Lektionen in Anatomie, Geometrie, Militär- und Zivilarchitektur. Durch das Nachmodellieren von Gipskopien antiker Plastiken, die Strudel von einer Romreise mitgebracht hatte, sowie durch Kopieren alter Meistergemälde sollten die Schüler ihr Können unter Beweis stellen. Peter Strudels Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung wird 1696 mit der Verleihung des Truchsessamtes an der kaiserlichen Tafel belohnt. 1701 wird er als »Strudl de Strudenhoff« in den Freiherrenstand erhoben – auch wenn der Kaiser privatim dazu meint, der Titel solle besser dem »guten alten Adel« vorbehalten bleiben.
Vielleicht wirft dies ein Licht auf die Arbeitsumstände der Strudel-Brüder: ihre ungesicherte Existenz als freie Künstler, das ständige Ringen um Aufträge und soziale Anerkennung, das alle drei in die Rolle von Unternehmern und »Erfindern« schlüpfen ließ. Gleich nach seiner Ankunft in Wien hatte Peter Strudel mit den kaiserlichen Truppen an der Belagerung von Ofen, heute in Budapest, teilgenommen. Anschließend bemühte er sich, dort die Erlaubnis zur Gründung einer Papierfabrik sowie eine Branntweinpacht zu erhalten. Später wollte er bei Wissegrad einen Ziegelkalkofen errichten. Sein Bruder Paul hielt den engsten Kontakt mit der alten Heimat. 1707 verlieh ihm das Dorf Denno die Ehrenbürgerschaft. Im Jahr darauf erhielt er das Privileg, in den Wäldern des Nonstals Holz schlagen zu dürfen.
Am wenigsten Künstler des Brüdertrios und mehr »Erfinder« war der 1667 geborene Dominik. Mittels einer neuen »Invention« gelingt es dem »Ingenieur«, Fortschritte bei der Trockenhaltung mehrerer Bergwerke zu erzielen. Durch »Wasserkunstwerke« schafft er es, die Anzahl der zur Entwässerung der Schächte notwendigen Pferde zu reduzieren. 1704 will er das Kriegsministerium von der Errichtung einer schwimmenden Festung auf der Donau überzeugen. »Domenico Strudel überreicht ein Projekt, wie eine von etlichen Schiffen formierte Maschine auf der Donau wider den Feind gebraucht werden kann«, vermerkt ein am 3. Juni 1704 abgefasstes »Hofkriegsratsprotokoll«.
Und wie hängen Kaiserin Sisi und die Strudel-Brüder zusammen? Ganz einfach: durch den Marmor und das k. und k. Transportwesen. Wie schon erwähnt, ist die meist mit einem frischen Blumenstrauß im Schoß geschmückte Sisi-Statue im gleichnamigen Park von Meran aus Vinschgauer Marmor. Entstanden ist das weiße Gold vor etwa vierhundert Millionen Jahren, als vor Afrika gelagerter Kalkstein durch die Kontinentalplattendrift nach Norden verfrachtet wurde und sich unter Hitze und großem Druck in kristallinen Marmor verwandelte – besonders harten und witterungsbeständigen Marmor, was die Steine aus dem Vinschgau für im Freien aufgestellte Denkmäler geeignet macht. Im großen Stil bekannt wurde das 1873 durch die Weltausstellung in Wien, wo Möbel und Kunstgegenstände aus »Laaser Marmor« (Laas heißt ein Dorf im Vinschgau) präsentiert wurden. In Laaser Marmor erstrahlt die Wiener Ringstraße. Entdeckt hat ihn Paul Strudel – behauptet er jedenfalls. Und er begann auch mit dem Abbau des edlen Gesteins. »Hab ich … ein schönes weißes Marmor durch meine angewandte Mühe undt aigene Unkosten, insonderheit zu S(ch)landers über Greflen im Taal Fraz (Laas) erfunden … ein von Godt destinirtes Klainodt, davor die glorwürdigste Statuen zur ewigen Gedächtnuß des Erzhauß von Österreich auff die Füeß gantz natürlich … zu machen«, schreibt er am 10. Mai 1707 in einem an den »Kayßer, König und Herr Herr ecc.« gerichteten Brief. Auf Karren sowie Flößen wurden die Marmorblöcke nach Wien geschafft. Einmal kenterte ein Floß mitsamt seiner tonnenschweren Ladung – ein herber Verlust für den Künstler-Unternehmer.
Als die Brüder in kurzen Abständen sterben, Paul 1708, Peter 1714 und Dominik 1715, bricht das Strudel-Imperium schnell zusammen. Weder Pauls Sohn, noch der von Peter besitzen die Begabung ihrer Väter. Dominik hatte keine Nachkommen. Peters Sohn Johann Wilhelm scheint ein Hallodri gewesen zu sein. Vom Vater erbte er nur die Maßlosigkeit und Großtuerei, er leistete sich eigene Bedienstete, richtete einen Privatzoo ein, trat als Cornet, Rittmeister und schließlich als kaiserlicher Hauptmann in ein Regiment ein. Den in seinen Besitz gefallenen Strudlhof musste er verpfänden. Als Baron Johann Wilhelm nicht einmal dreißigjährig in einem Gasthaus das Zeitliche segnete, hatte er seit Langem keine Miete mehr bezahlt. Das Jahresgehalt eines Universitätsprofessors beträgt zu dieser Zeit etwa dreihundert Gulden – der Strudlhoferbe hinterlässt eine Schuld von vierzigtausend Gulden. Danach sei das Leben der Strudel-Sippe »wieder in die bescheideneren Bahnen des Nonsberger Stammes zurück(gekehrt)«, schreibt Biograf Manfred Koller.
Vielleicht kann ich dort Näheres erfahren. Piergiorgio Comai, mein lokaler Gewährsmann, hat Vervò als Treffpunkt vorgeschlagen. Das kleine Dorf liegt auf einem Hochplateau über dem Nocefluss. Vor der Pfarrkirche mit nadelspitzem Turm plätschert ein Brunnen. Aus einer Bar an der zentralen Piazza, wo die Autobusse anhalten, dringen laute Männerstimmen. Von hier zweigen enge Gassen wie Blutgefäße von der Herzader ab. Hölzerne Torbögen markieren die Einfahrten zu Ställen und Heustadeln, wo längst kein Heu mehr gelagert wird und keine Kühe mehr gemolken werden. Auf Fenstersimsen blühen Geranien. Vervò wirkt gepflegt, wie alle Dörfer im Nonstal. Auf einem Felsen am Dorfrand, hinter dem es steil bergab geht, klebt eine gotische Kirche. Während wir in wenigen Minuten dorthin spazieren, zeigt Comai auf den Hang über dem Gotteshaus, wo Ausgrabungen ein römisches Kastell, Gräber, Münzen sowie beschriftete Steine aus der Antike zutage gefördert haben. Wegen der häufigen Überflutungen des Etschtales hätte hier eine antike Straße vorbeigeführt, sagt Comai. »Die Steine befinden sich heute im Museo Lapidario von Verona und werden schon von Theodor Mommsen in seiner »Geschichte Roms« beschrieben.«
Durch eine Seitentür gelangen wir in das Innere der dem Heiligen Martin geweihten Kirche. An der Decke zwischen dem Kreuzgewölbe prangt neben den Evangelistensymbolen das Wappen von Cles mit zwei kletternden Löwen. Der linke Seitenaltar, den Heiligen Philipp und Jakob geweiht, wurde 1683 von Pietro Strobli geschnitzt. Piergiorgio Comai hat einen Spiegel mitgebracht, sodass ich ihn mit der Hand in den engen Spalt zwischen Mauer und hölzernem Altarpfosten zwängen kann, um die aufgepinselte Künstlersignatur zu lesen. Auch der Hauptaltar mit einem Gemälde des Heiligen Martin, der für einen Bettler seinen Mantel teilt, wurde laut Unterschrift von »Pietro Strobli intagliatore (Holzschnitzer) di Cles« geschnitzt. Die mit viel Gold, Akanthusblättern und Engeln verzierten Altäre bleiben stark der alpenländischen Schnitztradition verhaftet. Könnten aber, schließlich werden seine ersten Werke in der Hauptstadt auf 1687 datiert, von »unserem« Strudel stammen. Piergiorgio Comai hält das jedoch für unwahrscheinlich und tippt auf einen namensgleichen Verwandten. Ein Historiker aus dem Nonstal hingegen behaupte das Gegenteil, erzählt mein Begleiter. »Wie alle Lokalpatrioten möchte er ein ruhmvolles Licht auf den Heimatort werfen – und ignoriert unbequeme Fakten.«
Klarheit verschaffen vielleicht die Bücher im Pfarrhaus von Cles. Im Erdgeschoss des Gebäudes, aus dessen Grundmauer eckige Steine hervorragen, wuchtet Don Renzo einen dicken Lederband nach dem anderen auf seinen Bürotisch. Gemeinsam durchforsten wir die alten Bücher und stoßen bald auf eine Eintragung im Heiratsregister, wo unter dem 4. September 1611 in ausladenden Buchstaben die Eheschließung von »magistrum Paulum Strudl de Mitebolt et Antoniam f(i)g(liam) cavalier de Clesio« vermerkt ist. »Mittenwald – Bavaria«, hat jemand mit Kugelschreiber an den Rand notiert – ich bin nicht der Erste, der hier nach den Brüdern Strudel forscht. Dieser Magister gilt allgemein als der lokale Stammesgründer. 1612 lässt das Ehepaar in Cles einen Alexander, 1612 einen Peter und 1621 einen Johannes taufen. Doch im Cles jenes Jahrhunderts gibt es viele Strudel, die heiraten, Kinder taufen lassen und sterben. Für den Laien scheint es unmöglich, in dem Labyrinth gleichlautender Namen die drei Künstler zu entdecken, die in Wien Karriere gemacht haben. Biograf Manfred Koller gelangt zum Schluss, dass »die lückenhafte Überlieferung der Namen … ein eindeutiges Urteil nicht mehr zu(lässt)«.
Ich verabschiede mich also von Don Renzo. Nachdem ich in der Gelateria Veneta auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Eis gekauft habe, mache ich einen Rundgang durch die quirlige Fußgängerzone von Cles. Vom großen, nach dem Kardinal Bernhard von Cles benannten Platz schlendere ich die gepflasterte Hauptgasse in Richtung mittelalterliches Zentrum hinauf. Die Gasse ist von Patrizierpalästen gesäumt, dem Palazzo Assessorile etwa, einem wehrhaften Kasten aus dem späten Mittelalter. Einst gehörte er den Grafen von Thun, später war er Sitz des Gerichts und heute finden hier Konferenzen sowie Kunstausstellungen statt. Erfreulicherweise gibt es in der Fußgängerzone viele Sitzbänke, wo man bequem das Treiben rundherum beobachten kann. Die Via Fratelli (Brüder) Strudel erinnert an die großen Künstlerbrüder, man fragt sich als Besucher allerdings, warum dafür ausgerechnet diese bescheidene Sackgasse ausgewählt worden ist, die wie ein überflüssiger Blinddarm von einer breiten Hauptstraße herabhängt. Auch das Caffè Bertolasi bietet der Fantasie wenig Möglichkeiten, sich das bunte Leben zu Zeiten der Strudel-Brüder vorzustellen, obwohl man hier einen wunderbar schaumigen Cappuccino trinken und von der Terrasse der flirtenden Dorfjugend zusehen kann. Wo heute das Caffè steht, soll sich einst das »Strudelhaus« befunden haben, heißt es auf einem Faltblatt, das mir die Dame im lokalen Tourismusbüro reichte, nachdem sie lange in einer Schublade herumgekramt hatte. Aber sicher ist auch das nicht. Es bleiben also nur die Werke, welche die drei Brüder oder zumindest ihre Verwandten der Nachwelt nicht nur in Vervò, sondern auch in Cles und anderen Orten des Nonstales hinterlassen haben. Aber vielleicht ist das für Künstler ohnehin die angemessenste Art der Erinnerung.
Pezzi grossi – schwere Brocken
VILLA LAGARINA – NOGAREDO
Heute kennen nur mehr Eingeweihte die großen Namen, die mit Villa Lagarina und Nogaredo verbunden sind.
Die allermeisten Urlauber rasen an diesen Orten vorbei und ahnen nicht, was sie sich entgehen lassen. Nach kurzer Fahrt über die Brennerautobahn biege ich bei Rovereto-Nord rechts ab nach Villa Lagarina. Das Viertausend-Einwohner-Dorf bildet ein altes Weinbauzentrum, in das sich freilich in den vergangenen Jahrzehnten neben der Bahntrasse und der Autobahn hässliche Gewerbe- und Industriehallen vorgefressen haben. Mein erstes Ziel hier ist die Pfarrkirche Santa Maria Assunta. Seit dem 15. Jahrhundert stellt das ursprünglich romanisch-gotische Gotteshaus den geistlichen Mittelpunkt der mächtigen Feudalherrschaft der Lodrons dar. Paris Lodron, Reichsfürst und Erzbischof von Salzburg, beauftragte Mitte des 17. Jahrhunderts den aus der Gegend von Como stammenden Architekten und Bildhauer Santino Solari, die alte Pfarrkirche im barocken Stil umzugestalten.
Das schwere, nach Osten zur halbrunden Piazza ausgerichtete, hölzerne Portal von Santa Maria Assunta bleibt an diesem Vormittag verschlossen. Daher gehe ich rechts gegen den Uhrzeigersinn um das Gotteshaus herum und hoffe auf eine geöffnete Seitentür. Die Tür gibt es zwar, aber sie ist ebenfalls geschlossen. Noch gebe ich nicht auf, denn aus einem flachen Nebengebäude neuerer Bauart dringt Männergelächter. Den Stimmen nachgehend, treffe ich einige Herren, die vor dem Nebengebäude rauchend herumstehen und aus Plastikbechern dunklen Wein trinken. Hier sei der Altentreffpunkt, »und dass wir hierher gehören, sieht man doch, he, he!«, erklärt ein rundlicher Kerl mit Stoppelfrisur sowie nicht mehr ganz intakten Zahnreihen, indem er auch mir einen Becher reicht. »Salute!«, »Prost!«, fordert Paolo Zandonai mich zum Trinken auf und erzählt, dass schon Mozart den lokalen Rotwein Marzemino im Don Giovanni besungen habe. »Also sind wir hier berühmt!«
Castel Noarna, Stammsitz der Lodrons
Ich erfahre von Paolo Zandonai, dass der Komponist auf seinen insgesamt drei Italienreisen zwischen 1769 und 1773 stets im nahen Rovereto haltgemacht und dort am 26. Dezember 1769 sein erstes Konzert auf italienischem Boden gegeben habe. Darauf sind meine Trinkgenossen in Villa Lagarina mächtig stolz. Völlig zu Recht, wie eine ausführlichere Beschäftigung mit der lokalen Geschichte ergeben wird. Doch dazu später. Paolo arbeitete früher als Metallschlosser, jetzt hat er viel Zeit und vor allem die Nummer von Don Massimo in seinem Handy gespeichert. »Der Pfarrer wohnt nicht mehr hier, er ist für die halbe Talschaft zuständig«, sagt Paolo, bevor auch schon Don Massimo am Apparat ist. »Kein Problem«, heißt es anschließend, wir könnten den Schlüssel bei einer Nachbarin abholen, Paolo werde mich begleiten.
Ein Glücksfall, denn es stellt sich heraus, dass Paolo Zandonai über persönliche Verbindungen zu den heutigen Nachfahren des Salzburger Erzbischofs Lodron verfügt. Seine Mutter Mariota sei von der Grafenfamilie als Waisenkind aufgenommen worden, erzählt der Mittsechziger, während wir zum Haus der Nachbarin spazieren. Mariota war 1919 sechs Jahre alt, als ihre Mutter an der Spanischen Grippe starb. Contessa Giuseppina gehörte demselben Jahrgang an wie sie, die beiden waren Vertraute von Kindesbeinen an. »Meine Mutter verbrachte ihr ganzes weiteres Leben – sie wurde fünfundneunzig Jahre alt – im Palazzo der Grafenfamilie, wo sie auch gestorben ist«, sagt Paolo. In früheren Jahren, erfahre ich weiter, sei Paolos Mutter als »bambinaia« für die Beaufsichtigung der Grafenkinder verantwortlich gewesen und später, als es offiziell längst keine »dienstbaren Geister« mehr gab, führte Mariota als letzte Getreue für Gräfin Giuseppina den Haushalt. Sie habe den Stammbaum der Lodrons auswendig gekannt und erinnerte die Kindheitsgefährtin, falls diese mal den Geburtstag eines Enkelkindes vergaß, an ihre Großmutterpflichten. »Wenn dann die Contessa seufzte: ›Mariota, du bist unser wandelndes Familienarchiv!‹, strahlte Mama, das war der Lohn ihrer Treue«, sagt Paolo Zandonai. Um zu erahnen, wie gut Mariotas Gedächtnis in besagter Angelegenheit funktionierte, muss man einen Blick auf den weitverzweigten Stammbaum der Lodrons werfen, wie er etwa in einem langen Wikipedia-Eintrag abgebildet ist, mit den verschiedenen Linien des auf das 11. Jahrhundert zurückreichenden Grafengeschlechtes samt älteren und jüngeren Primo- sowie Sekundogeniturlinien. Nur mit Ausdauer gewinnt man einen groben Überblick.
Als Paolo das Kirchenportal aufgedrückt hat, blendet der überirdische Glanz der Fresken, Altäre, Heiligenstatuen, Stuckornamente, Marmorböden und Pilaster meine Augen – Santa Maria Assunta gilt als herausragendes Beispiel barocker Architektur in der Region. Vor allem die dem Heiligen Rupert geweihte Seitenkapelle ist mit dem Namen des Salzburger Fürstbischofs Paris Lodron verbunden – und mit dessen Baumeister Santino Solari. Dreiunddreißigjährig, am 13. November 1619, wird Lodron zum Erzbischof von Salzburg ernannt, nach dem Tod seines Vorgängers, dessen Berater er war. Es ist eine äußerst schwierige Zeit für die katholische Kirche. Im Jahr zuvor war der Dreißigjährige Krieg ausgebrochen, ein furchtbarer Religionskonflikt und ein Ringen um die Vormachtstellung in Europa sowie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. An seinem Ende waren ganze Landstriche entvölkert. »Nicht nur das Erzbistum, sondern ganz Deutschland ist jetzt in höchster Gefahr … Ich bin gezwungen, bis auf einige wenige notwendige Minister den ganzen Hof zu entlassen, um die Ausgaben zu reduzieren«, schreibt der frischgebackene Kirchenfürst in einem Brief an seinen Vater Nikolaus.
Portraits aus jener Zeit zeigen einen gedrungenen Mann mit strengen Gesichtszügen, hoher Stirn, Kinn- und Schnurrbart. Bekleidet ist der Kirchenfürst mit einem scharlachroten Schulterumhang (der Mozetta), am Ringfinger der rechten Hand steckt der Bischofsring, vor dem Herzen trägt Paris Lodron das Brustkreuz, ein weiteres Zeichen seiner Amtswürde. Auf keinem Portrait fehlt auch das Wappentier der Grafenfamilie: ein aufgerichteter Löwe mit Brezelschweif.
Geboren wurde Paris Lodron auf dem Stammschloss Castel Novo, von den Einheimischen Castel Noarna genannt, es thront auf einer Hügelkuppe oberhalb von Villa Lagarina. Nach dem Theologiestudium in Trient, Bologna und Ingolstadt zum Priester geweiht, kommt Lodron nach Salzburg, wo er 1606 Domherr wird. Den Weg ebnete ihm sein Onkel Graf Antonio, Domherr zu Salzburg und Passau, der dem Neffen 1612 auch die Pfarrei in Villa Lagarina überließ. Zwar besuchte Paris Lodron seinen Heimatort nur noch selten, aber er blieb ihm zeitlebens verbunden, indem er sich etwa für die Landbevölkerung einsetzte. Zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse eröffnete Lodron eine Schule im Ort und ließ am Salzburger Marianokolleg für junge Männer aus Villa Lagarina drei fixe Studienplätze reservieren. Um die lokale Wirtschaft anzukurbeln, gründete der Fürstbischof ein Leihhaus in Villa Lagarina mit neuen Kreditmöglichkeiten. Durch eine kluge Politik gelang es ihm, während der Dreißigjährige Krieg Europa verwüstete, Salzburg aus allen Händeln herauszuhalten und der Stadt in Zusammenarbeit mit seinem Baumeister Solari ihr norditalienisches frühbarockes Aussehen zu verleihen. An vielen Gemäuern Salzburgs prangt heute noch der Brezellöwe, etwa an den Festungsanlagen im venezianischen Stil oder an der 1622 gegründeten Universität, die heute seinen Namen trägt. Und natürlich im Dom, der von Solari nach dem verheerenden Brand von 1598 neu erbaut wurde. In dessen Krypta wurde der Erzbischof nach seinem Tod 1653 beigesetzt. Die sterblichen Überreste Santino Solaris ruhen ebenfalls in Salzburg auf dem Friedhof Sankt Peter.
Aber zurück nach Villa Lagarina und zurück zum Heute. Nachdem seine Eltern gestorben waren (die Mutter 1615, der Vater 1621), beauftragte Paris Lodron den damals noch am Salzburger Dom tätigen Architekten Solari mit der Errichtung eines Denkmals: der St. Rupertskapelle, einem nördlichen Seitenbau der Pfarrkirche Santa Maria Assunta. Dort macht mich Paolo Zandonai auf das Lodron-Wappen mit Widmungsinschrift aus dem Einweihungsjahr 1629 aufmerksam, rechts an der Ostwand prangt ein großes Ölgemälde auf Kupfer mit den verewigten Eltern: beide kniend, die Mutter in schwarzem Kleid, die Hände vor der Brust zum Gebet gefaltet, der Vater in goldgeschmücktem Ritterkleid. Die acht trapezförmigen Gemälde an der Kuppel, angeordnet um eine auf blauem Grund schwebende Taube, symbolisieren die von Christus in der Bergpredigt verkündeten Seligpreisungen und sind ein Werk des Salzburger Hofmalers Donato Mascagni. Die Kunsthistoriker gehen davon aus, dass es dieselben italienischen Meister waren, die die reichen Stuckornamente im Salzburger Dom und in der St. Rupertskapelle von Villa Lagarina schufen. Die herrlichen Gemälde bewundere ich in unbequemer Haltung auf dem Boden hockend, während Paolo den schweren, mit einer Kette verhängten Vorhang ein wenig hochhebt, damit ich etwas sehen kann. »Hoffentlich ist kein Alarm eingeschaltet«, sagt Paolo und kurz grinsen wir, weil uns ein Dritter, der nicht weiß, dass wir hier mit Erlaubnis von Don Massimo eingedrungen sind, für Diebe halten könnte. Als wir die Kirche verlassen, weist Paolo mit der Hand hinter den Hauptaltar, dort führe eine Stiege zu einer Sakristei hinauf, »wo früher die kostbaren Messgewänder und liturgischen Geräte aufbewahrt wurden.« Inzwischen sind sie im nur einen Steinwurf entfernten Palazzo Libera zu besichtigen, einem Ableger des Diözesanmuseums von Trient.
Paolo hat auch die Nummer seiner Cousine Ilda aus Nogaredo im Handy gespeichert. Ist die Grafenfamilie abwesend, zeigt Ilda Zandonai Besuchern deren Palazzo am oberen Dorfrand. Von Villa Lagarina nach Nogaredo sind es wenige Autominuten. Rund um das Dorf winden sich aus hellem Kalkgestein gemauerte Weinterrassen, über denen seit dem 11. Jahrhundert das zinnengekrönte Schloss Noarna thront. Ende des 15. Jahrhunderts fiel das Kastell an die Grafen Lodron, deren Oberhaupt Graf Nikolaus etwa ein Jahrhundert später den Palazzo in Nogaredo erbaute. Die marmorne Rittergestalt in der Nische über dem Haupteingang stelle den Grafen Nikolaus dar, erklärt Ilda. Getroffen haben wir uns auf der Piazza vor dem Palazzo Candelpergher, früher Wohnsitz eines Verwalters der Lodron, heute residiert hier die Gemeindeverwaltung. Von dort führt eine Gasse – eine Tafel weist sie als Vicolo Lodron aus – zum ockergelb getünchten Grafenpalast. Sein heutiges Aussehen erhielt er durch Paris Lodron, der seinen Baumeister Solari auch hier mit den Aus- und Umbauarbeiten beauftragte. Ob Solari und seine Salzburger Dekorateure auch bei der Gestaltung der Kapelle links vom Haupteingang tätig waren, kann mangels Quellen nicht belegt werden. Die mit Volutenköpfen und Akanthusblättern dekorierten Gewölbe und die mit Puttenköpfen, Obstgirlanden und Schriftrollen geschmückten Bilder ähneln jedoch auffallend jenen von Villa Lagarina. Am Altar ist die Fotografie einer zarten alten Dame aufgestellt: Das sei Giuseppina, erklärt Ilda. »Man spürte an ihrer Ausstrahlung, dass sie eine Gräfin war.«
Ilda führt mich durch die repräsentativen Räume, einen Salon mit wandhohem Kachelofen und einer mit Blumen und bunten Vögeln bemalten Decke sowie den mindestens hundert Quadratmeter großen Saal mit rotweißem Marmorboden, offenem Kamin und an den Wänden hängenden Hellebarden. Während der warmen Jahreszeit werden die Räumlichkeiten heute für Hochzeiten oder Konzerte vermietet. Da schadet es nicht, dass die Familie Lodron mit Mozart bekannt war und man die Gäste darauf hinweisen kann: In Salzburg wohnte man nicht weit voneinander, Mozart und seine Schwester Nannerl erteilten den Grafentöchtern Luigia und Giuseppina Klavierunterricht. Einige Klavierkompositionen, bekannt als »Lodron’sche Nachtmusiken«, widmete Mozart seiner Gönnerin, der Gräfin Antonia. Die Quellen liefern zwar keinen Hinweis, aber es ist anzunehmen, dass der Komponist seine Gönner auch während seiner Italienreisen besucht hat. Jedenfalls ist es eine hübsche Vorstellung, sich in denselben Räumlichkeiten aufzuhalten und durch die vergitterten Fenster einen Blick auf die mediterrane Landschaft zu werfen, die schon das Musikgenie aus Salzburg bezaubert hat.
Nogaredo, Palazzo Lodron: im Hof der Löwe mit Brezelschweif, das Stammwappentier
Ilda zeigt auch die Sala del Giudizio. Als Feudalherren oblag den Lodrons die Gerichtsbarkeit, hier fanden noch im 17. Jahrhundert Hexenprozesse gegen einheimische Bäuerinnen statt, die im Gefängnis von Castel Noarna gefoltert und dann geköpft und verbrannt wurden. Ilda erzählt von einer mündlichen Überlieferung, derzufolge ein geheimer unterirdischer Gang das Stammschloss auf dem Berg oben mit dem Palazzo hier in Villa Lagarina verbinden soll. Genaueres weiß offenbar niemand in der Gegend, aber vielleicht handelt es sich auch nur um einen fernen Nachhall aus jener Zeit, wo man als Normalsterblicher lieber einen Bogen um die herrschaftlichen Gemäuer machte. Heute ist das nicht mehr nötig, wie ein Blick in einen kleineren, von der Grafenfamilie privat genutzten Raum offenbart. Kein Ahne mit Halskrause und Schwert blickt hier düster von einem Ölgemälde herab. Dafür reihen sich Bücher in den Regalen, zwei Globen und eine ältere Stereoanlage. Nichts wirkt in diesem Raum wie auf Hochglanz poliert. Am liebsten würde man sich gleich in ein gemütliches Sofa fläzen, um zu Mozart’scher Klaviermusik in einem der vergilbten Bände zu blättern.
Erneut in Villa Lagarina bin ich mit Sandro Giordani verabredet. Zusammen wandern wir durch winkelige Gassen und kommen an hinter hohen Mauern verborgenen Ansitzen vorbei. In einer dieser Gassen hat der Verein Borgo antico seinen Sitz, Sandro ist dessen »Presidente«. Während wir in dem steingemauerten Raum auf wackeligen Stühlen sitzen und Sandro Giordani einige Hefte herzeigt, die der Verein zur lokalen Geschichte herausgegeben hat, erzählt er von Sigismondo Moll, einem früheren Bewohner des gegenüberliegenden Palazzos, dessen Mauern jetzt ihre Schatten durch das Fenster des Vereinslokals werfen: »Er war ein bizarrer Typ, der sich mit dem Dorfpfarrer überworfen hatte. Um den Geistlichen zu ärgern, organisierte er während der Sonntagsmesse Ballspiele vor der Kirche.«
Wer war dieser seltsame Baron? Ein Peppone, eine Art kommunistischer Bürgermeister avant la lettre, der die Dorfbevölkerung gegen den Don Camillo seiner Zeit aufhetzte und den die Leute dafür im Gedächtnis behielten? Sigismondo Moll entstammte einem österreichischen Adelsgeschlecht und machte eine steile Karriere im diplomatischen Dienst. 1787 wurde er Kreiskapitän »an den Grenzen Italiens« mit Sitz in Rovereto. Nach verschiedenen politischen Missionen, die ihn nach Paris, Mailand und Wien führten, wurde Moll 1810 zum Senator des Königreichs Italien ernannt, zog sich jedoch wenig später ins Privatleben auf seinem Landsitz in Villa Lagarina zurück. Hier legte er mit Leidenschaft und Fachkenntnis einen riesigen botanischen Garten an, wo er nach seinem Tod 1826 auf eigenen Wunsch auch begraben wurde.
Sigismondo scheint ein pedantischer Sammler und Rechner gewesen zu sein. Musste er beispielsweise in offizieller Angelegenheit mit der ganzen Familie nach Mailand reisen, wurde ein Gehilfe beauftragt, eine Kutsche ausfindig zu machen, die »weniger Ausgaben« verursache. Trotz seines erfolgreichen Wirkens in Politik und Ökonomie, war Sigismondo Moll von den Wissenschaften angezogen, er studierte die französischen Klassiker, las Voltaire und Montesquieu und vertiefte sich in die Schriften materialistischer Denker wie Buffon und La Mettrie. Letztere scheinen in ihm den Freigeist geweckt zu haben, dem es Spaß machte, den Dorfpfarrer zu plagen. Ein nicht von seiner Gunst abhängiger Geistlicher namens Giuseppe Pederanzi rächte seinen Kollegen jedoch, indem er den Baron mit Satiren und Spottgedichten verfolgte. In einem Gedicht, das unter der Hand im Dorf verbreitet wurde, lässt Pederanzi den »lutherischen« Sigismondo bei Luzifer im untersten Kreis der Hölle schmoren, in Zeiten, als die allergrößte Mehrheit in Glaubensfragen keinesfalls gleichgültig mit den Schultern zuckte, die denkbar schlimmste aller Strafen. Im irdischen Leben scheint Sigismondo sein Ketzertum freilich nicht geschadet zu haben. Die von ihm begründete tridentinische Linie der Molls erlosch erst 1946 mit dem Tod von Leopoldo Moll. Durch Erbschaft fiel der Palazzo dann an das Mantovaner Geschlecht der Guerrini-Gonzaga.
Marchese Tullo Guerrini lächelt melancholisch, als ich ihn nach der Bedeutung der Jahreszahl 1789 im Wappenportal seines Palazzos frage. »Seit damals – im Jahr 1789 brach die Französische Revolution aus – zählen die Adeligen nicht mehr viel«, sagt der hoch in den Achtzigern stehende Marquis und lehnt den Rechen an die Hausmauer, mit dem er gerade den Kies vor dem Eingang geharkt hat – jemand muss hier schließlich für Ordnung sorgen. Dann geht der alte Herr mit kurzen Trippelschritten voran, seine zu locker sitzende Hose klemmt er mit einem Ellbogen an seinen schmalen Hüften fest, während er eine Tür zur Bibliothek öffnet. Mit mehreren durch eine Mitteltür verbundenen Sälen stellt diese einen Traum für jeden Bücherfreund dar. In den bis zur Decke reichenden Regalen stapeln sich kostbare ledergebundene Werke. Einige der Molls wären schwere Brocken im Habsburgerreich gewesen, »pezzi grossi, deshalb liegt hier viel Zeug herum«, sagt der Marchese und greift nach einer dicken Schwarte.
Es handelt sich um ein Exemplar des vielbändigen codex austriacus, der österreichischen Gesetzessammlung. In einem