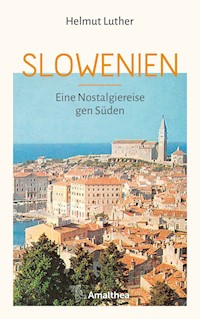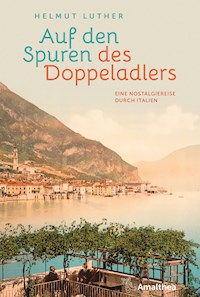Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Poreč bis Dubrovnik Als er in Pula über die Uferpromenade schlendert, überkommt Helmut Luther kurz das Gefühl, sich im Ort vertan zu haben. Warum sind hier überall Habsburger-Prachtbauten? Ähnliche Déjà-vu-Erlebnisse hat der Autor viele auf seiner Reise entlang der kroatischen Küste. In Rijeka wurde Schriftsteller Ödön von Horváth geboren, wo man das örtliche Nationaltheater auf den Spuren Gustav Klimts entdecken kann. Franz von Suppè, der Schöpfer der Wiener Operette, wuchs in Zadar auf, der Erfinder Nikola Tesla in der Lika. Bis 1918 gehörten diese Städte wie auch zahlreiche Inseln zum Habsburgerreich. Mithilfe lokaler Gesprächspartner spürt Helmut Luther die spannendsten Berührungspunkte zwischen Gestern und Heute auf und nimmt uns mit auf einen historischen Roadtrip entlang der kroatischen Adria. Mit zahlreichen Abbildungen und Karte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Luther
Immer der Küste nach
Eine Nostalgiereise entlang derKROATISCHEN ADRIA
Mit 64 Abbildungen
Der Umwelt zuliebe #ohnefolie
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagmotiv: Dubrovnik, Altstadt, um 1900 © histopics/Ullstein Bild/picturedesk.com
Karte auf Seite 8: © arbeitsgemeinschaft kartographie
Lektorat: Helene Breisach
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11,5/14,8 pt Minion Pro
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-202-0
eISBN 978-3-903217-96-6
Inhalt
Vorwort
Von der Bora geschoben
Triest – Poreč
Eine Frage der Gerechtigkeit
Rovinj
Mit Ankerketten um den hölzernen Schiffsbauch
Fažana – Brijuni
Genie-Schmiede
Pula
Botschaft des »Duce«
Raša – Labin
Gustav Klimt an der Adria
Rijeka
Teure Kleiderabfindung
Rijeka
Kaiserliche Sommerfrische
Crikvenica– Matulji – Opatija
Zeit für Freundlichkeit
Krk – Baška
Kuren hinter Gittern
Lošinj
Auf der richtigen Seite
Senj
Visionär aus der Pampa
Smiljan – Gospić
Alle Wege führen nach Wien
Zadar
Ein faustischer Mensch
Prvić – Šibenik
Verkehrte Welt
Trogir
Brodelnder Nationalismus, dalmatinische Identität und ein Lebemann vom Schlage Casanovas
Split
»Was, etwas essen wollen Sie? Das ist jetzt unmöglich – kommen Sie in zwei Monaten wieder!«
Brač
Nicht nur Party
Hvar
Ölgärten in Flammen
Korčula
Was man nicht kaufen kann
Lopud
Weit weg von Wien
Dubrovnik
Literatur
Bildnachweis
Namenregister
Vorwort
Es waren Begegnungen wie jene mit dem ehemaligen Hafendirektor von Mali Lošinj, der einige Bücher über seine Heimatinsel geschrieben hat, die mir deutlich machten, dass alles mit allem zusammenhängt. Ähnliche Erinnerungen und Erfahrungen verbinden. Wie man es beim Kennenlernen macht, sprachen der pensionierte Hafendirektor und ich über die Geschichte, über Orte und Namen, die wir beide kennen. Unsere gemeinsame Sprache bildete das Italienische. Die Venezianer und dann das faschistische Italien haben an der kroatischen Küste ihre Spuren hinterlassen. Der Hafendirektor erzählte vom Rizinusöl, das in seiner Kindheit unter den faschistischen Machthabern jene trinken mussten, denen ein Wort in ihrer kroatischen Muttersprache entschlüpfte. So ähnlich sei das auch bei uns in Südtirol gewesen, entgegnete ich – und auch im heutigen Italien rede man nicht gerne über jenes Geschichtskapitel. Dann sprachen wir über das Habsburgerreich, darüber, dass bis 1918 zum Studieren jeder Südtiroler und jeder Bewohner des Küstenlandes nach Wien ging. Wie ein Magnet habe die Hauptstadt aufstrebende Talente angezogen. Und wie es so geht: Aus der Schnittmenge gemeinsamer Erfahrungen, eines geteilten Wissens, entsteht ein Einverständnis, ein Gefühl von Zugehörigkeit – so war es zwischen mir und dem sympathischen Hafendirektor und auch mit vielen anderen, die ich auf dieser Reise traf.
Nicht nach dem Trennenden hielt ich Ausschau, sondern nach dem Verbindenden, Lebenszugewandten. Die Tafelfreuden gehören für mich wesentlich dazu. Was mir auffiel: Vieles im Küstenland ist nicht so glatt, auf Hochglanz poliert, »professionell« wie in unseren Breiten. Natürlich: Dem Heruntergekommenen, Tristen, »Zurückgebliebenen« begegnet man auch bei uns. Mir kommt jedoch vor, dass im Süden mehr gelacht wird. Das Improvisierte, Unperfekte wird dort nicht als Makel empfunden. Man akzeptiert die Hinfälligkeit des Lebens und macht das Beste daraus. In kroatischen Bars und Konobas wird geraucht auf Teufel komm raus – im dichten Nebel kann man oft seine Hand nicht vor den Augen sehen –, auch Rakija, Schnaps, wird ausgiebig getrunken. Ein schlechtes Gewissen hat deshalb keiner. Vom Geist der Selbstoptimierung – trägt er nicht masochistische, paranoide Züge? – scheint man im Küstenland nicht angekränkelt zu sein. Mir gefällt das. Wissend genießt man den goldfarbenen Malvazija, an den Gestaden der Adria beherrscht man die Kunst des Carpe diem. Weil dort vielleicht die Klügeren leben, zieht es mich immer wieder hinunter an die blaue Sehnsuchtsküste.
Von der Bora geschoben
Triest – Poreč
Per Fahrrad auf der ehemaligen Parenzana-Bahnstrecke von Triest nach Poreč
Blaurot, mit dem gezackten Dreigestirn des Triglav, hängt die slowenische Flagge an Joško Joras’ Haus bei Plovanija. Darunter verkünden schwarze Lettern: »Auch hier ist Slowenien!« Joras, ein stämmiger Endfünfziger mit ergrautem Stoppelbart, ist ein Sturschädel, der mich freundlich einlädt, vom Rad zu steigen und zu ihm hinauf auf seine Terrasse zu kommen. »Damit wir auf Augenhöhe miteinander sprechen können.« Und so sitze ich nun auf einem weiß gepolsterten Rattansessel und erfahre von Joras’ Gefängnisstrafe: »Erst nach 17 Tagen Hungerstreik ließen sie mich wieder frei.« Der Grund: Bis heute weigert er sich anzuerkennen, dass sein Haus und seine Felder nach dem Zerfall Jugoslawiens auf kroatischem Staatsgebiet liegen – und nicht auf slowenischem, wie es in alten Verträgen festgelegt war. Joras beweist das anhand eines Stapels ausgebreiteter Dokumente, die zum Teil auf die Zeit Maria Theresias zurückgehen. Er hat sich an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Dort wolle aber niemand seine Partei ergreifen. »Die halten es mit dem Recht des Stärkeren«, meint der Endfünfziger und zuckt mit den Schultern. Ans Aufgeben denkt er deshalb noch lange nicht, Joško Joras wird weiterkämpfen.
Es ist mein zweiter Tag auf der Parenzana, einem mit EU-Mitteln finanzierten Radweg auf der Trasse der ehemaligen Parenzaner Bahn zwischen Triest und Poreč (italienisch Parenzo). 1902 wurde die Zugverbindung eröffnet, sie sollte das damals österreichische Istrien mit Wien verbinden, im Habsburgerreich waren istrisches Öl und Wein begehrte Handelsgüter. 1935 schlossen die Italiener, die neuen Herren über Istrien, die Parenzaner Bahn schon wieder – mit dem aufkommenden Autoverkehr konnte die langsame Schmalspurbahn nicht mehr konkurrieren.
Das alte Bahnhofsgebäude in Poreč
Am Vortag startete ich mit dem Fahrrad vom Bahnhof Campo Marzio in Triest. Nachdem ich vielleicht zwei Kilometer an den im Dunst schwimmenden Gleisen hinter dem aufgelassenen Bahnhof vorbeiradelte, landete ich, weil nirgends eine Hinweistafel zu entdecken war, in einer Sackgasse in einem Vorort von Triest. Über meinem Kopf dröhnte der Autobahnverkehr, rundherum breiteten sich Industriegebäude und riesige Öltanks aus. Eine Zeit lang kurvte ich noch im Slalom um die stinkenden Stahlungetüme herum. Weil nirgends ein Radweg zu entdecken war, rief ich Alen Auguštin an.
»Ich bin ein Meister im Improvisieren«, grinste mein Retter, während er mich und mein Rad in einem blauen Lieferwagen ins slowenische Koper chauffierte. Alen Auguštin, ein trainierter Typ mit Raspelfrisur, wuchs in Holland auf, 2001 kehrte er als Outdoor-Guide in seine kroatische Heimat zurück. Seinen schweigsamen Gehilfen Ilija stellte Alen mit den Worten vor: »Er ist Serbe, also gefährlich.« Was ein Witz sein sollte, hat einen ernsten Hintergrund: Auch wenn der Kroatien-Krieg von 1991 bis 1995 Istrien verschonte, hat er das Klima zwischen Serben und Kroaten vergiftet. Bevor das gegenseitige Morden losging, wohnte man oft Tür an Tür. Zwar herrscht heute längst Friede, aber der Hass gärt unter der Oberfläche weiter. Nicht so bei Alen und Ilija. Letzterer wird mit dem Auto weiterfahren, während mich Alen auf dem Rad begleitet. In Koper beginnt der gemütliche Teil des Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse. Gemächlich pedalieren wir los. Vom Autoverkehr durch Oleander und Ginsterbüsche halbwegs abgeschirmt, zieht sich die erhöhte Radtrasse zwischen Meer und Straße Richtung Süden. Auf der brettebenen, geteerten Piste rollen unsere Trekkingbikes fast von alleine, die Bora, ein böiger Fallwind aus dem Karst, schiebt von hinten. Am Felsufer sitzen Angler, weit draußen pflügt ein Kreuzfahrtriese einen weißen Strich in die Adria. Entgegen kommt uns ein buntes Völkchen aus Skatern, Müttern mit Kinderwägen sowie braun gebrannten Senioren, die, tief über die Lenkstangen ihrer Rennräder gebeugt, ihr Tagespensum abspulen.
Der Radweg führt an den Salinen von Sečovlje vorbei. Auf dem über 500 Hektar umfassenden Gelände wird seit dem Mittelalter Salz gewonnen. Heute ist der größte Teil in einen Naturpark umgewandelt. Wie gebleichte Walknochen ragen die Ruinen von Arbeiterhäusern über den ehemaligen Salzbecken hervor, daneben staksen Seidenreiher durch das seichte Gewässer. Wir folgen mäandernden Wasserkanälen, in denen es träge gluckst. In Sečovlje leben die Menschen in modernen Einfamilienhäusern oder auf kleinen Bauernhöfen. Durch geöffnete Türen blicken wir auf Familien, die um den Küchentisch versammelt sind. Unter einem Scheunenvordach fläzt ein Kerl in einem ausgebauten Autosessel und blickt den vorbeiziehenden Radtouristen nach.
Bisher ging es über glatten, tellerflachen Asphalt. Nun rumpeln wir in weiten Schleifen über einen steinigen Weg bergan, die Reifen der Trekkingräder wühlen sich knirschend durch den Schotter. Es ist später Nachmittag, die Sonne spiegelt sich über der Bucht von Piran, die Macchia und die Weingärten ringsum leuchten honigfarben. Der Boden strahlt nun die tagsüber gespeicherte Wärme ab. Zum Glück beträgt die Steigung nie mehr als fünf Prozent, das ist leicht zu schaffen. Die Parenzana habe viel zur Entwicklung des isolierten Hinterlandes beigetragen, meint Alen und singt ein Loblied auf die Österreicher, die einst die Trasse klug anlegten. Kurz hinter der slowenisch-kroatischen Grenze überholen uns zwei schwer bepackte Langstreckenradler. Auch sie wollen die ganze Parenzana abstrampeln. »Aus Triest fanden wir mithilfe eines Kompasses heraus«, erzählen die beiden amüsiert, ein junges Paar aus Dresden. Alen und ich haben nur einen leichten Tagesrucksack geschultert. Unser Gepäck wird von Ilija zum Etappenziel Buje transportiert.
Über eine ehemalige Brücke auf der aufgelassenen Bahntrasse der Parenzana
Alen Auguštin betreibt eine Pension in einem ehemaligen Bauernhaus mit Blick auf die auf einem Hügel gelegene Kleinstadt Buje. Alen, der die »Casa Romantica« von einem Österreicher übernommen hat, weiß, was das Herz müder Radfahrer erfreut: gutes, reichliches Essen und, falls notwendig, einen Ersatzschlauch. Er tischt regionale Spezialitäten auf, Speck (Panceta) und hausgemachte Nudeln mit Wildspargelspitzen. Auf umgedrehten Kisten am Straßenrand sitzend, bieten Bäuerinnen die Spargel in Bündeln an, der Hausherr empfiehlt dazu einen strohgelben Muskateller vom Nachbarbauern. Alens Pension ist voller Österreicher in Radfahrermontur, die meisten sitzen noch spätabends bei einem Glas Treberbranntwein im Garten. In der Ferne schreit ein Esel, in den Bäumen über unseren Köpfen sägen Zikaden. Die Altstadt Bujes wirkt halb verlassen. Entlang buckliger Gassen bröckeln schmale turmähnliche Steinhäuser vor sich hin, einige mit zerschlagenen Fensterscheiben, auf den Dächern wächst Unkraut. Auf dem mit dunkelgrauen Steinplatten bedeckten Platz vor der Pfarrkirche spielt eine Mädchengruppe Fußball. Eine Bank auf der einen Seite sowie der Sockel eines Fahnenmastes mit steinernem Markuslöwen auf der anderen dienen als Tore. Oft sprintet eine Spielerin eine Gasse hinunter, dem Ball hinterher – es gibt wenige ebene Plätze in Buje. Ein alter Mann mit Schiebermütze erklärt mir auf Italienisch, dass die vielen leeren Häuser rundherum »Esuli« gehört hätten, nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Italienern. »Und dort, wo die Schuhe vor der Eingangstür aufgereiht sind, leben heute bosnische oder albanische Muslime.«
Grožnjan mit seinen ineinander verschachtelten Steinhäusern ist ein Juwel, dabei wäre es beinahe ausgestorben. Seine Wiederbelebung verdankt das Städtchen auf der Spitze eines Hügels der Initiative eines Bildhauers, der in den 60er-Jahren durchsetzte, dass Künstlerkollegen die verlassenen Gebäude unentgeltlich bewohnen durften – und sie im Gegenzug vor dem Verfall retteten. Heute verkaufen hier Kunsthandwerker ihre Waren. Touristenkolonnen quetschen sich durch die engen Gassen.
Ruhiger ist es in Završje – oder Piemonte d’Istria, wie der italienische Name lautet. Hier schwebt der Rauch von Holzfeuern zwischen den Ruinen, und alte Frauen in zerschlissenen Kleidern beugen sich über ihre Gemüsebeete. Mit mehreren Tunneln und Viadukten bildet die Etappe zwischen Grožnjan und Livade den spektakulärsten Teil der Parenzana und hier zeigt sich, wie gut die Mitnahme eines Mountainbikes war. Zwar geht es die meiste Zeit bergab, aber der naturbelassene Boden ist voller faustgroßer Steine, schlammige Pfützen zwingen zu Ausweichmanövern. Im 146 Meter langen Tunnel Freski spendet eine neue Fotovoltaik-Anlage Licht – bis vor wenigen Jahren war es hier stockdunkel, Wasser tropfte von der Felsdecke: Hier schlug das wilde Herz der Parenzana. Bleibt nur zu wünschen, dass nicht alles auf Hochglanz poliert wird, denn mancher lokale Tourismusbetreiber, hat Alen Auguštin erzählt, wünscht sich eine gepflegte Asphaltschicht, damit noch mehr Gäste kommen.
Vor der Konoba Dorjana in Livade
Dann würde man hier allerdings nicht mehr Leute wie Franko Basaneže treffen. Hinter einer Wegbiegung hat er seinen uralten Traktor geparkt, quer zur Fahrbahn liegt ein gefällter Baum. »Eine Kastanie, ich brauche sie als Rebstütze«, erklärt der Bauer und hat es überhaupt nicht eilig, den Weg freizumachen. Später, in der Konoba Dorjana in Livade, setzt sich Franko Basaneže an meinen Tisch unter der Pergola. Ich bestelle Fusi, runde Nudeln, mit Trüffeln, dazu Spargelsalat und Rotwein, alles Marke Eigenbau. Drei Hektar Wein gehören zu Frankos Landwirtschaft, außerdem züchtet er Trüffelhunde und ist selbst leidenschaftlicher Trüffelsammler. »Mein größter Fund wog ein halbes Kilo, aber weil er in der Mitte ein Maulwurfloch hatte, wollte ihn kein Händler kaufen.« Es war zwar schade um das verlorene Geld, grinst Franko, aber seine Familie habe einen Winter lang Nudeln mit durchlöchertem Trüffel gegessen – »bis er uns zum Hals heraushing«. Unterdessen habe ich einige Gläser Refosco geleert, die Beine unter dem Tisch ausgestreckt, beobachte ich die Schwalben, die aus ihren Nestern am Haus gegenüber schlüpfen: Es ist die leer stehende ehemalige Dorfschule.
Zirka 30 Kilometer sind es noch von Livade nach Poreč. Hier ist es vorbei mit der Ruhe. Das Küstenstädtchen ist ein quirliger Badeort, die Touristen besichtigen hier die Überreste römischer Tempel, eine Basilika mit goldenem Mosaik über dem Portal und lassen sich von livrierten Kellnern in überteuerte Restaurants locken. Die Radtour endet vor einem schlichten Häuschen aus hellem istrischen Kalkstein: der ehemalige Bahnhof, der aussieht wie alle anderen entlang der Parenzana. Hier wohnen Antonio und Rina Krisman. Der 91-Jährige und seine Frau haben die Schmalspurbahn noch erlebt. Rina erzählt, dass ihre Eltern damit an Markttagen von außerhalb in die Stadt fuhren, um Butter, Eier und Gemüse zu verkaufen. Eine Tante sei 1935, kurz vor der Schließung, mit der Parenzana nach Triest gefahren, wo sie mit ihrem Mann ein neues Leben anfing. Antonio weiß, dass die Gleise in den späten 1930er-Jahren abgebaut wurden und nach Abessinien gebracht werden sollten. »Damals war Krieg, das Schiff wurde von den Briten torpediert und ging unter.« So ist von der Parenzana nicht viel übrig geblieben außer Erinnerungen – sie ist längst zum Mythos geworden.
Eine Frage der Gerechtigkeit
Rovinj
Ein untergegangenes Passagierschiff und ein geplantes Denkmal für einen lokalen Tourismuspionier.
Mein Gespräch mit Milan beginnt harmlos, gleich kommt es jedoch knüppeldick. Der Zufallsbekannte lässt an seiner Heimat und den Landsleuten kein gutes Haar, klar, dass er nicht mit richtigem Namen zitiert werden will, er soll hier Milan heißen. An einem Sonntagabend kurz vor Weihnachten komme ich in Rovinj an. Nachdem ich einen Parkplatz gefunden habe, flaniere ich durch die Gassen. Jetzt sitze ich am Trg Maršala Tita, auf einer aus rohen Brettern gezimmerten Bank, die mitten auf dem Platz einen mit Lichtern behängten Polyesterchristbaum umrahmt. Aus Lautsprechern schallt in Endlosschleife Jingle bells, vor Christkindlmarktbuden stehen Erwachsene mit Glühweinbechern in der Hand. In der Luft schwebt Pommesgeruch. Nebenan kurven auf einem Eisplatz unter einem Plastikzelt Kinder mit geröteten Wangen auf Schlittschuhen herum. Dunkle Flecken sprenkeln die Bahn, kleine Wasserlachen bedecken das Eis, an seitlichen Traufen rinnt das Wasser zusammen.
Temperaturen um 18 Grad, dazu das Meer und südliches Ambiente – so habe ich die Vorweihnachtszeit selten erlebt. »Ist diese Hitze normal?«, frage ich Milan, der mit überschlagenen Beinen neben mir auf der Bank sitzt und an einer Zigarette saugt. »So ist bei uns der Winter«, erwidert der etwa 50-Jährige und sieht für einen Moment ziemlich stolz aus. Dann fährt er fort: »Ich verstehe nicht, was den Touristen an Rovinj gefällt. Gut, die Altstadt ist hübsch, aber wie in ganz Kroatien geht es hier seit Langem bergab.« Ein halb faschistisches Regime halte das Land in seinen Klauen, behauptet Milan, in einem korrupten, kleptokratischen System herrsche eine gierige Clique von Emporkömmlingen. »Sie fälschen Wahlen – sogar Tote gehen bei uns zur Abstimmung und sichern mit einem Kreuzchen deren Macht. Wäre ich jung, längst hätte ich das Weite gesucht.« Meine Frage, ob es denn wirklich so schlimm sei, wischt mein Gesprächspartner beiseite. »Du glaubst das nicht? Dort draußen«, sagt Milan und zeigt hinaus über das Hafenbecken, wo sich das Laternenlicht im Wasser spiegelt, dahinter das in Dunkelheit gehüllte Meer: »Dort draußen verschwand ein Polizist, eine Woche später fand man ihn auf einem Strand mit einer Kugel im Kopf. Der Mann musste sterben, weil er zu viel wusste.«
Milans Worte dröhnen noch in meinen Ohren, als ich später am Kreisverkehr vor Kukaleto zum Camping Veštar abbiege. Jetzt im Winter sind hier die Schotten dicht gemacht, ringsum tiefe Finsternis. Die Schranke am Eingang ist jedoch geöffnet. Daher passiere ich sie und steuere an leer stehenden Bungalows vorbei zur Mole hinunter. Dort huschen drei bärtige Kerle mit eingeschalteten Stirnlampen hin und her. Es sind Angler. Zack, mit einem Schwung aus dem Handgelenk sausen die Köder auf das gekräuselte Wasser hinaus. »Hello«, grüße ich mit erhobener Hand. Soll heißen: Von meiner Seite drohen keine Schwierigkeiten, vermutlich sind die Männer hier, so wie ich, nicht ganz legal eingedrungen. Ein paar Tintenfische, die auf dem Betonboden hilflos ihre länglichen Körper aufpumpen, sind den Anglern in die Fänge geraten.
Mit einem Kopfnicken zeigt mir einer mit Wollmütze, wo das Tauchcenter Scuba Rovinj zu finden ist. Betontreppen hinter einem mit Bauschutt gefüllten Container führen zu einer blau bemalten Hütte. »Wreck Baron Gautsch« lese ich an einer am hölzernen Vordach befestigten Tafel, darunter Fotos, die ein stählernes, mit Schwämmen, Algen und Muscheln überwuchertes Ungetüm zeigen: Ein gesunkenes Passagierschiff, das dort draußen auf dem Grund der Adria vor sich hin rostet. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden sämtliche Handels- und Passagierschiffe des Habsburgerreiches der k. u. k. Kriegsmarine einverleibt – auch das gut 80 Meter lange und knapp zwölf Meter breite Dampfschiff Baron Gautsch, eines von drei Linienschiffen des Österreichischen Lloyd. In den ersten Augusttagen 1914 transportierte das Schiff Versorgungstruppen nach Kotor im heutigen Montenegro, auf dem Weg zurück nach Norden Zivilisten, zahlreiche Frauen und Kinder, auf der Flucht vor den Kampfhandlungen. So war es auch am 13. August – mit mehreren 100 Passagieren nahm die Baron Gautsch Kurs auf Triest. Der Kapitän war gewarnt, an der Küste hatte man Minen verlegt, um feindliche Schiffe abzuhalten. Aus bis heute ungeklärten Gründen blieb die Baron Gautsch viel zu dicht am Festland. Ein Augenzeuge beobachtete gegen 14 Uhr, wie sich der Dampfer südlich von Rovinj einem Minenfeld näherte, er gab Warnsignale, die aber nicht beachtet wurden. Viel zu spät riss dann jemand das Ruder herum. Vergeblich: Eine Explosion erschütterte den Schiffsrumpf, die Heizkessel der Baron Gautsch flogen in die Luft, innerhalb von sieben Minuten ging das Schiff unter. 147 Passagiere und Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben. Sie waren die ersten zivilen Kriegsopfer an der Adria.
»Dort draußen liegt die Titanic der Adria«, sagt Stojan Babić. Damals in Kriegszeiten habe es als unpatriotisch gegolten, Kritik zu äußern, daher seien die Schuldigen glimpflich davongekommen. Der groß gewachsene Mann mit schwarzen Haaren ist Chef des Scuba Rovinj Tauchcenters. Für einen Lokalaugenschein in Kukaleto hatte Babić gestern keine Zeit. Deshalb treffe ich ihn am nächsten Morgen an der Ulica Giordano Paliaga am nördlichen Altstadteingang von Rovinj. »Sechs-, siebenhundert Passagiere, weit mehr als offiziell angegeben, befanden sich damals an Bord«, sagt Babić. »In jenen Jahren rüsteten Schiffe gerade von Kohle auf Diesel um. Viele Passagiere sind verbrannt, weil der auslaufende Treibstoff Feuer fing und die Wasseroberfläche in ein Inferno verwandelte.« Seit 20 Jahren arbeitet der gelernte Computerfachmann als Tauchlehrer. Auf dem Handy hat Stojan Babić Videos und zahlreiche Fotos gespeichert: Von der Baron Gautsch, wie sie einmal war, ein Prachtschiff mit eleganten Salons, geschwungenen Holztreppen und noblem Mobiliar. Die jugoslawische Marine habe das Wrack nach dem Ersten Weltkrieg schwer beschädigt, erzählt Babić. »Dann kamen die Plünderer.« Stojan Babić zeigt Fotos von nautischen Instrumenten, Tellern, Schüsseln, Besteck, glänzend poliert und mit dem Stempel des Österreichischen Lloyd – alles hätten Taucher mitgehen lassen. Ganz einfach ist es allerdings nicht, hinunterzugelangen. Die Baron Gautsch liegt in 30 bis 40 Metern Tiefe, 2019 endete ein Wrackausflug für eine junge Grazerin tödlich. Mindestens 30 Freiwassertauchgänge müssten seine Gäste vorweisen, bevor sie mit ihm zur Baron Gautsch dürfen, erklärt Stojan Babić. Dann zeigt er zur gegenüberliegenden Seite der Bucht von Rovinj: Der Gebäuderiegel hinter Palmen und Zypressen, heute das städtische Spital, sei 1888 als »Maria Theresia Seehospiz« eröffnet worden, wo arme, unter Skrofulose und Rachitis leidende Kinder aus dem ganzen Habsburgerreich Aufnahme fanden. »Seit 1876 gab es eine Bahnverbindung, mit den Österreichern fing hier der Tourismus an.«
Wie ein gekrümmter Daumen ragt Rovinjs Altstadt ins Meer hinaus. Gekrönt wird sie von der Kirche Sv. Eufemija mit einem Turm, der an die Markuskirche in Venedig erinnert. Der Weg zum Marktplatz führt mich vorbei an stattlichen Gebäuden, die mit ihren von Weinreben bewachsenen Pergolen und Holzstößen unter dem Vordach halb Stadtvilla, halb Landhaus sind. Vorbei geht es auch an einem hässlichen Betonklotz: Es ist eine stillgelegte Sardinenfabrik. Auf dem Marktplatz bieten Frauen Äpfel, Nüsse und Gemüse aus ihren Gärten an. Eine betonierte Fläche mit einem Denkmal für die Opfer des Faschismus wird von Buben zum Fußballplatz umfunktioniert, der Denkmalsockel ersetzt das Tor. Enge Gassen mit vor Feuchtigkeit schimmernden Steintreppen führen zur Kirche hinauf. An den Hausmauern, die sich einander zuzuneigen scheinen, hängen Rohre und Kabel herunter. In den höheren Stockwerken spannen sich mit Wäsche beladene Drähte von Haus zu Haus quer über die Gasse. Jeweils zwei Drähte, einer leer und einer behangen, verlaufen wie eine Seilbahn parallel über Rollen, die an der Mauer unter dem Fenster verankert wurden. Ich beobachte eine weißhaarige Frau, wie sie am leeren Draht ruckelt und so die Wäsche, die am anderen Draht über der Gasse schwebt, zu sich heranzieht. Vor der von Schirmpinien beschatteten Kirche blickt man auf die Hausdächer – wie Jahresringe winden sich die Gebäudezeilen um den Hügel herum zur Kirche herauf.
Stadtansicht von Rovinj mit dem alten Hafen
Vor dem Hotel Adriatic, dem ältesten der Stadt, bin ich mit Alberto Košara verabredet. Der Mittvierziger vermietet einige Wohnungen, außerdem ist er als Reiseleiter tätig. Etwa 200 Gruppen habe er im vergangenen Jahr durch Rovinj geführt, sagt Košara. »Vier Millionen Übernachtungen werden hier im Jahr gezählt. Im Winter leben wir, im Sommer wird Tag und Nacht gearbeitet.« Nach dem Kroatienkrieg, erzählt Košara, habe er im italienischen Udine gearbeitet. »Als ich dann zurückkehrte und auf dicke Hose machte, war es unmöglich, hier umgerechnet 50 Euro auszugeben – alles war unglaublich billig.« Eine Zeit lang habe er vorgehabt, in der Altstadt eine Pizzeria zu eröffnen, dann die Idee aber fallen gelassen, erzählt mein Begleiter. »Heute rennen hier alle dem Geld nach, der Neid ist groß.« Früher habe es mehr Solidarität gegeben, sagt Košara. »Wir genossen Freiheiten. Als ich meinen Führerschein in der Tasche hatte, bin ich mit Freunden zum Feiern nach Triest gefahren.« Die Istrier seien immer weltoffen gewesen, in seiner Familie gebe es Italiener, Kroaten und Slowenen, erzählt Alberto Košara. »Wir sind hier mit italienischem Fernsehen aufgewachsen. Beim Militär traf ich Gleichaltrige aus dem gebirgigen Landesinneren, die noch nie ferngesehen hatten.«
»Komm, machen wir eine Runde«, fordert mich mein Begleiter auf. Nach ein paar Schritten haben wir das Partisanendenkmal erreicht. Im Mittelalter, erfahre ich, sei Rovinj eine Metropole gewesen, auf einer Insel wie Venedig, mit mehr Einwohnern als Zagreb oder Triest. Als mehr Platz benötigt wurde, habe man den Kanal zugeschüttet, der die Insel vom Festland trennte: Entstanden ist die Fläche, auf der wir jetzt stehen. Als wir die Piazza Matteotti überqueren und gleich darauf die Piazza Tito, bemerkt Košara, dass er es richtig fände, die Namen von Plätzen und Straßen nicht zu ändern, auch wenn ein neuer Geist wehe. »Die Namen spiegeln die Geschichte: Giacomo Matteotti war der italienische Sozialistenführer, den die Faschisten ermordet haben. Und Tito wird hier bei uns in Ruhe gelassen, im Gegensatz zu manchen anderen Orten im Land, wo heute Partisanendenkmäler beschmiert werden.«
Alberto Košara zeigt mir die Ulica Grisia, wo einheimische Künstler und Handwerker ihre Werkstätten haben. Jetzt sind die Läden geschlossen. Nur Cerino, der letzte Schuster von Rovinj, hat geöffnet. Mit umgebundener Schürze steht Cerino in der Ladentür und plaudert mit einem Passanten. Als er Košara entdeckt, winkt er ihm zu. Im Weitergehen flüstert mein Begleiter: »Der 20-jährige Sohn Cerinos ist vor Kurzem bei einem Autounfall gestorben.« Dabei röten sich seine Augen. In Košaras Wagen fahren wir zum südlichen Stadtrand. In einem lang gestreckten Gebäude, an dem wir vorbeikommen, ging mein Begleiter zur Schule. Im Westflügel sei das italienische Gymnasium untergebracht gewesen, im Ostflügel das kroatische, erzählt er. »Wir waren oft bei den Italienern, sie hatten Computer, wir keine.« Dass sich damals, Ende der 1980er-Jahre, das politische Klima änderte, bemerkte Alberto Košara auch in der Schule: Manche Lehrer hätten plötzlich von der Eigenständigkeit der kroatischen Sprache geschwärmt. »Sie benutzten altertümliche, angeblich kroatische Wörter, die aber keiner verstand.« Vor einer Schranke stellt Košara seinen Wagen ab. Wir sind nun auf der Halbinsel Zlatni rt, dem »goldenen Kap«: einem großen, unter Naturschutz stehenden Park mit Spazierwegen, wo man auf sichelförmige Buchten und meerumspülte Felsen blickt.
Durch mediterranen Wald gelangen wir zu einem schmalen, turmähnlichen Gebäude, einem ehemaligen Försterhaus. Ein Stadtgärtner, der heute hier zuständig ist, öffnet uns die Eingangstür. Bis auf ein Sofa aus weinrotem Stoff ist das Häuschen leer – abgesehen von spinnwebenverhangenen Schwarzweißfotos sowie Bauplänen hinter Vitrinen, wo auch eine vergilbte Broschüre mit dem Titel »Klimatischer Kurort Cap Aureo« ausliegt, 1908 herausgegeben im Selbstverlag von Georg Hütterott: Er war der Tourismuspionier von Rovinj. Geboren wurde Johann Georg Hütterott 1852 im damals habsburgischen Triest als Sohn eines aus Kassel stammenden Kaufmannes, die Mutter war Frankfurterin. Wie hoch das Ansehen des Vaters Carl in Triest war, zeigt dort eine Marmortafel im Atrium des städtischen Krankenhauses, wo in der Liste der Wohltäter als einer der Ersten sein Name aufscheint. Sohn Georg gehörte ebenfalls zur ökonomischen Elite von Triest: Unter seiner Präsidentschaft entwickelte sich der Stabilimento Tecnico Triestino zur größten Schiffswerft der Monarchie. Außerdem war Georg Hütterott Aufsichtsratsmitglied der Riso SPA, der ersten Reismühle der Stadt – die Deutschen errichteten in den Fabriksgebäuden 1943 ein Konzentrationslager. Hütterott wurde 1898 für seine Verdienste in den Adelsstand erhoben, er war Mitglied des Herrenhauses im Reichsrat und erhielt hohe Auszeichnungen. 1890 erwarb Hütterott etliche Hektar Grund im Süden von Rovinj, außerdem vier vorgelagerte Inseln. Auf der größten, Sv. Andrija, baute er ein ehemaliges Kloster zum schlossartigen Wohnsitz seiner Familie um. Auf dem Festland gegenüber ließ der Geschäftsmann Spazierwege anlegen, Hotels und Villen sollten errichtet werden, die Keimzelle des Kurortes Cap Aureo – hier befinden wir uns gerade. Als Georg Hütterott 1910 starb, geriet das Projekt ins Stocken. Übrig geblieben ist nur der Park. Schautafeln erklären die Vegetation: Steineiche, Lorbeer, Myrte und Erdbeerbaum, auch an Hütterott wird mit einer Tafel erinnert. Von einem Felsvorsprung scheint die Insel St. Andreas ganz nahe. Man sieht rote, ineinander verschachtelte Ziegeldächer, ein weißes Gebäude, heute ein Hotel, sowie einen spitzen Kirchturm, der das Ensemble überragt: Die Überreste des unter Napoleon aufgelösten Klosters, wo Hütterott mit seiner Familie lebte. Hinüberzugelangen ist jetzt unmöglich. Fähren verkehren nur im Sommerhalbjahr. In der Blütezeit kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatten die Hütterotts illustre Gäste: Erzherzog Ludwig Salvator, Stephanie von Belgien, die Gattin von Kronprinz Rudolf, es kamen auch Industrielle und Wissenschaftler wie Arthur Krupp und Rudolf Virchow und begründeten den touristischen Ruhm Rovinjs. Auf der südlichen Nachbarinsel Maškin, durch eine Brücke mit Sv. Andrija verbunden, hat Georg Hütterott für sich und seine Familie ein Mausoleum errichtet. Am 29. Mai 1910 geben Maria de Hütterott und ihre Töchter Hanna und Barbara in Triest in italienischer Sprache eine Traueranzeige auf. »Nach kurzer Krankheit«, heißt es da, sei Georg Hütterott »im Alter von 57 Jahren« gestorben. Fünf oder sechs Zeilen umfasst die Auflistung all seiner Titel und Ämter. Ein zeitgenössischer Berichterstatter zählte fast 100 Kutschen, die dem Verstorbenen das letzte Geleit zum protestantischen Friedhof von Triest gaben. Geplant war eine spätere Überführung in das Familienmausoleum nach Rovinj, doch Georg Hütterott blieb für immer in Triest. Seine Witwe und die jüngere Tochter Barbara – die ältere, Hanna, hatte einen Österreicher geheiratet und starb 1960 kinderlos in Innsbruck – lebten nach dem Ersten Weltkrieg, als die Stadt mit Istrien an Italien fiel, weiter in Rovinj. Sie nahmen die italienische Staatsangehörigkeit an. Das »Schloss« auf St. Andreas, das noch den Glanz des untergegangenen Kaiserreiches erlebt hatte, verwandelte sich in einen Gutshof, wo die Mutter und ihre unverheiratete Tochter ein bescheidenes Auskommen fanden. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges erlitten Maria und Barbara einen gewaltsamen Tod. Was genau passierte, weiß Alberto Košara nicht. Er empfiehlt, im italienischen Zentrum für historische Forschung von Rovinj nachzufragen. Dort hüte man Dokumente.
Georg von Hütterott kaufte 1890 vier Inseln vor Rovinj und große Grundflächen am Goldenen Kap im Süden der Altstadt, um dort Hotels, Villen, Badestrände und Spazierwege zu errichten.
So komme ich ein weiteres Mal zur Piazza Matteotti, wo das Forschungszentrum seinen Sitz in einem wuchtigen Bürgerhaus hat. »Ja, es ist hier nicht schlecht«, brummt Direktor Raul Marsetić, nachdem ich unter Ausrufen von Bewunderung an seinem Schreibtisch Platz genommen habe. Im Raum mit altersdunklem Parkettboden schwebt der Geruch von Gelehrsamkeit und vergilbtem Papier. An den Wänden hängen zahlreiche historische Landkarten und Stadtpläne, Bücher stapeln sich bis zur Decke. Direktor Marsetić trägt teure Lederschuhe, der Anzug schmiegt sich eng an seinen schlanken Leib. Den Espresso, den mir eine Mitarbeiterin bringt, trinke ich aus einer edlen Porzellantasse. Raul Marsetić lebt in Pula und entstammt einer Familie, die in der Nachkriegszeit, als Titos Kommunisten die Macht übernahmen, »aus Überzeugung hier blieb.« Die Tragödie des »Esodo«, als etwa 350 000 Italiener nach dem Zweiten Weltkrieg Istrien, Rijeka und Dalmatien verließen, stellt nach Ansicht des Direttore keine organisierte Vertreibung dar. Es habe eine Vorgeschichte gegeben, sagt Marsetić: Mit antislawischer Hetze, brutaler Unterdrückung und Handlangerdiensten für Nazideutschland hätten die italienischen Faschisten das Klima vergiftet. »Und, ja, danach folgte die Rache, manche sprechen von ethnischer Säuberung.« Letztlich jedoch sei es die Ungewissheit, die Angst gewesen, die zum Exodus führte, behauptet Marsetić. »Keiner wurde zum Gehen gezwungen. Zum Glück blieben einige. Etwa 30 000 Italiener leben heute noch in Istrien.« Außerdem, erfahre ich, habe es sogar eine umgekehrte Wanderung gegeben: Die »Monfalconesi«, italienische Hafenarbeiter aus Monfalcone, zogen nach dem Zweiten Weltkrieg mitsamt ihren Familien nach Pula und Rijeka, weil sie glaubten, dort werde ihr kommunistischer Traum Gestalt annehmen. Nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin, als der jugoslawische Diktator echte und vermeintliche Stalinisten verfolgte, sollten viele Monfalconesi zu seinen Opfern gehören. Darunter auch ein Großonkel von Raul Marsetić, Ferruccio Nefat. Zweimal, sagt der Direttore, sei der Großonkel auf Goli Otok, der »nackten Insel« zwischen dem Festland und der Insel Rab, gewesen, als einer von etwa 16 000 politischen Gefangenen, die dort durch Prügel, Hunger und Krankheit »umerzogen« werden sollten. Mehr als 400 überlebten nicht. Raul Marsetić hat den Großonkel als Kind erlebt. »Ein scheuer, schweigsamer Mensch, der über seine Lagerjahre nie erzählen wollte. Klar war nur, dass er von allen Ideologien genug hatte.« Über knarrende Stiegen begleitet mich der Direktor zum Archiv im dritten Stock hinauf. Dort reihen sich in den Regalen mit Filzstift beschriftete braune Kartons mit Nachlässen aneinander. In einer Schachtel findet Marsetić Dokumente zur Familie Hütterott: Briefe und Fotos des Ehepaares Georg und Maria, von ihrem »Schloss« auf St. Andreas und der Dampfsegeljacht Suzume, mit der Hütterott zum Wegbereiter des Segelsports an der istrischen Küste wurde. »Ach, das hätte ich fast vergessen«, sagt der Institutsdirektor, schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn und eilt zu einer Vitrine. Zurück kommt er mit einem Buch voller Bilder, gemalt von Dilettantenhand. Zu sehen sind Gärten, Tempel, blühende Kirschbäume und Frauen im traditionellen Kimono. Georg Hütterott sei 1879 zum ersten japanischen Konsul in Europa ernannt worden – auch eine Japanreise hätten seine Frau und er gemeinsam unternommen, erzählt Marsetić, dabei seien vermutlich die hier aufbewahrten Bilder entstanden.
Vom Direttore erfahre ich, was Anfang Mai 1945 auf Sv. Andrija geschah: Maria und ihre Tochter Barbara wurden von Partisanen erschossen. Ihr Besitz wurde nationalisiert. »Es war ein Unrecht, sie waren unschuldig. Unter dem Kommunismus wurde darüber nicht gesprochen. Inzwischen ist viel Zeit vergangen«, sagt Marsetić. Richtig aufgearbeitet, so mein Eindruck, wurde das traurige Ende der Hütterotts in Rovinj nie. Gut, es gibt die Hinweistafel auf der Halbinsel Zlatni rt. Einige Gemälde aus dem Besitz der Familie befinden sich zurzeit im städtischen Heimatmuseum. Schön wäre es jedoch, wenn der gesamte Nachlass samt Hintergrundinformationen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht würde, immerhin stellen die Österreicher die viertgrößte Gästegruppe in Kroatien. Als Gedenkort böte sich das ehemalige Forsthaus im Park Zlatni rt an. Klar, von diesbezüglichen Plänen habe er gehört, sagt Direktor Marsetić, dann murmelt er etwas von fehlenden Mitteln. Mir fällt das Sprichwort ein: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auch in Rovinj scheint Gerechtigkeit kein Thema zu sein, das ganz oben auf der Prioritätenliste steht.
Mit Ankerketten um den hölzernen Schiffsbauch
Fažana – Brijuni
In der Seeschlacht von Lissa besiegten die Österreicher die weit überlegenen Italiener. Dabei sah es für sie gar nicht gut aus, als die kaiserliche Flotte aus dem Hafen von Fažana auslief.
Der Himmel über Fažana strahlt an diesem Wintertag blau wie im August. Noch besser ist, dass der Ort wie ausgewechselt anmutet. Ich kenne Fažana von früheren Besuchen, allerdings nur im Sommer, als ich stets einige Male um die Häuser kurven musste, bevor ich einen Parkplatz fand. Jetzt ist die Auswahl groß, Fažana ist angenehm leer und ruhig. In dem kleinen Küstendorf im Süden Istriens legen die Fähren nach Brioni ab, einem vorgelagerten Archipel aus 14 Inseln, von denen allerdings nur die größte, Veli Brijuni, zeitweilig bewohnt ist und besucht werden darf. Seit 1983 bildet die Inselgruppe einen Nationalpark. An der Brionska ulica, die zur Mole führt, wo jeder Brionibesucher im Büro der Parkverwaltung sein Ticket lösen muss, hatte sich bei meinen früheren Besuchen jedes Mal eine lange Warteschlange gebildet. An diesem Tag kurz vor Weihnachten herrscht Ebbe. Touristen: null. Antizyklisch reisen lohnt sich nicht nur, weil man so den Staus ausweicht. Man bemerkt auch Dinge, die einem sonst im Trubel leicht entgehen.
Landeinwärts vom Dorfeingang, wo ich mein Auto abgestellt habe, erstrecken sich Olivenhaine und Weingärten mit kupferroter Erde. Trockenmauern aus verwittertem Kalkstein umrahmen die Felder. An einem geschotterten Weg belädt ein Bauer seinen Traktor mit auseinandergesägten Baumstämmen, man riecht deren Duft etliche Meter im Umkreis. Richtung Dorf überwintern in Gemüsebeeten Kohl, Rote Beete und Porree, an zerfledderten Bambusstangen ranken verdorrte Tomatenstauden. Hausbesitzer sitzen unter Pergolen und beobachten aus dem Augenwinkel die Vorbeikommenden. Lebhafter geht es am Rand eines großen Parkplatzes zu. Von den hölzernen Marktständen, die hier fix stationiert sind, ist momentan nur einer besetzt. Drei Styroporkisten mit Sardinen umfasst das Angebot einer rundlichen Frau in Kittelschürze, die hinter der Theke steht. »Heute Morgen von meinem Mann gefangen«, erzählt sie, vornübergebeugt die nackten Unterarme auf das Holz stützend. Ihre Aufmerksamkeit gilt den Katzen, die auf der Mauer gegenüber sprungbereit lauern. Sobald die Frau mit Schnalzlauten eine Handvoll Sardinen auf die Straße wirft, stürzen sie sich wild fauchend auf die Beute. Den Fisch zwischen den Zähnen, sucht jede ein abgelegenes Plätzchen, wo sie ihn, zwischendurch böse knurrend, hinunterschlingt. Die Verkäuferin lächelt versonnen, sie hat hier viele Freunde.
Am Abend schwebt weißer Holzfeuerrauch über den zusammengedrängten Häusern. Am Lungomare haben einige Lokale geöffnet. Vor jenem, in dem ich gleich essen werde, sitzt eine Gruppe Männer in Blaumännern auf mit Schaffellen ausgekleideten Baststühlen. Es ist noch immer sehr mild. Das liege am Scirocco, der aus Afrika warme und feuchte Luft mitbringe, erklärt mir der Kellner, nachdem ich drinnen vor einem brennenden Holzofen mit Glasfenster Platz genommen habe: »In den vergangenen Wochen regnete es hier beinahe ununterbrochen – dank Scirocco!« Sardinen, obwohl auf der Speisekarte, bekomme ich keine. Doch auch die Goldbrasse vom Grill schmeckt, hinunter spüle ich sie mit goldgelbem Malvazija, der ringsum auf den Äckern heranreift. Der Kellner hockt an diesem Abend, mit seinem Handy beschäftigt, die meiste Zeit hinter der Ausschank. Außer mir speist hier nur ein Paar, beide Mitte vierzig: Sie, einheimisch, mit blonden schulterlangen Haaren, er Typ zerstreuter Professor, der Aussprache nach Deutscher. Meist redet er. »Hier ist das reale Leben!«, beteuert der Mann leidenschaftlich einige Male hintereinander, sich dabei einen kräftigen Schluck Wein gönnend. Die Frau wirkt nicht restlos überzeugt, sagt jedoch nichts. Offensichtlich kennt man sich noch nicht so lange. Als ich den Rückweg zu meiner Unterkunft antrete, blinzelt am Himmel zwischen Wolken der Vollmond hervor. Ein leises Klirren ertönt, als Metallteile gegen Bootsmasten schlagen. Während ein Möwenpulk im Tiefflug über das Hafenbecken segelt, wobei sich das weiße Gefieder über dem glatten Wasser abhebt, fallen mir die Worte des Deutschen von vorhin im Restaurant ein. Vielleicht hat er gar nicht so unrecht mit seiner Begeisterung?