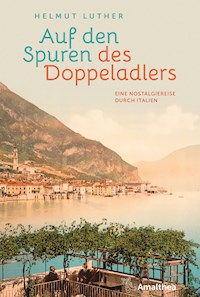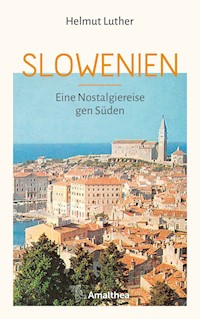
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roadtrip von den Karawanken bis zur Adria Hat der Teufel seine Hände im Spiel? Warum sonst liebäugelt Helmut Luther bei seinem Besuch in Piran mit der Idee, sich ausgerechnet dort niederzulassen, wo Giuseppe Tartini, der Schöpfer der Teufelstriller-Sonate, geboren wurde? Im Zwei-Millionen-Einwohner-Land Slowenien begegnet der Reiseautor nicht nur dem Hofimkermeister Maria Theresias und einer Partisanin, die zur zweiten Ehefrau Titos wurde, sondern auch den Erfindern der Briefmarke, von Parfumflakons und Nagellackpinseln: Von Ljubljana bis Maribor ist das Land voll von Spuren einer glanzvollen (habsburgischen) Vergangenheit und spannender Persönlichkeiten, die es zu entdecken gilt. Helmut Luthers atmosphärische Reisereportagen wecken die Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub ebenso wie den Wunsch, noch tiefer in die Geschichte Sloweniens einzutauchen. Und in Piran? Ist noch einmal alles gut gegangen. Mit zahlreichen Abbildungen und Karte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Luther
SLOWENIEN
Eine Nostalgiereisegen Süden
Mit 49 Abbildungen
Der Umwelt zuliebe #ohnefolie
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2023 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagabbildung: Piran © mauritius images/Archive PL/Alamy/Alamy Stock Photos
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11,5/14,77 pt Minion Pro und der Alegreya Sans
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-237-2
eISBN 978-3-903441-09-5
Inhalt
Vorwort
Karstianer sind dreisprachig
Štanjel – Kobdilj – Lipa
Star aus der Pampa. Und: Der Karst ist grün geworden
Divača – Komen
Charmanter Tausendsassa
Bistra – Bled
Posthumer Ruhm
Kranj
Den Deutschen erzähle ich das normalerweise nicht!
Radovljica – Begunje – Breznica
Knotenpunkt zwischen dem Meer, dem Karst und den Alpen
Kamnik
Strandbar – hoch gelegen
Velika planina
Und wieder ein Landsmann
Idrija
Aufklebbarer Brieftaxstempel
Polhov Gradec – Škofja Loka – Stari vrh
50 000 Lire Belohnung für einen Banditen
Podnanos – Vipava
Was zusammengehört
Gorizia – Nova Gorica
Mit den Waffen des Geistes
Celje – Pečovnik – Svetina
Dampf ablassen
Ljubljana
Urfixierung
Matavun – Škocjan – Postojna
Ein Sänger der Freiheit
Turjak – Leskovec – Ljubljana
Späte Heimkehr
Ljubljana – Grad Kodeljevo
War da etwas? Stadt ohne Wurzeln
Maribor
Prinzengarten
Maribor – Limbuš
Der Geist weht, wo er will
Sakušak
Wer zahlt die Zeche?
Kobarid – Kolovrat
Teufelskerl
Piran – Fiesa – Strunjan
Nachwort
Literatur
Bildnachweis
Namenregister
Der Autor
Vorwort
Podnanos in der Region Primorska ist ein kleines Dorf. Und Slowenien ist ein kleines Land. Im Vorfeld unserer Begegnung hatte mich der Tourismuspräsident von Podnanos gewarnt, dass es Verständigungsprobleme geben könnte, da ich leider kein Slowenisch spreche und seine Englisch- und Italienischkenntnisse eher zu wünschen übrig lassen. Daher brachten wir dann, als wir uns auf einer Barterrasse mit Blick auf Weinberge trafen, beide einen Übersetzer mit.
Der Tourismuschef hatte dort auf der Terrasse bereits vor unserer Ankunft seine Stellung bezogen. Eigentlich waren wir in seinem Büro verabredet, von der Terrasse aus hatte der Tourismuschef jedoch dessen Eingang gut im Blick und konnte unser Kommen beobachten. Nachdem wir, der Übersetzer und ich, auf die Klingel mit der Aufschrift »Turistično društvo Podnanos« gedrückt hatten und uns, als niemand öffnete, suchend umblickten – mit anderen Besuchern rechnete der Tourismuschef offenbar nicht –, winkte er uns mit einem Grinsen an seinen Tisch. Die Terrasse, wo die milden Sonnenstrahlen wärmten, und dann auch der Wein, den der Tourismuschef gleich für uns alle bestellte, waren ein guter Auftakt. In Podnanos ist nämlich die Melodie der slowenischen Nationalhymne entstanden, der Wein spielt darin eine tragende Rolle.
Ein Lebehoch den Völkern,
die sehnend nach dem Tage schau’n
an welchem […]
verjaget wird der Zwietracht Grau’n
wo […] zum Nachbar wird der Feind.
Mit kräftiger Stimme deklamierte der Tourismuschef den Text, als wir nach der Begrüßung mit den Gläsern anstießen. Sloweniens Nationalhymne, die Zdravljica, was übersetzt »Prosit« heißt, ist ein Trinkspruch. Schlaue Slowenen! Die Staatshymne eines Landes, in dem seit der Antike Wein angebaut wird, preist die Freiheit, die Freundschaft und den edlen Rebensaft.
Nach der zweiten Runde funktionierte dann auch die Verständigung wunderbar ohne Übersetzer, der Wein hatte unsere Spiegelneuronen auf Trab gebracht.
Den Slowenen und ihrem schönen Ländchen näherte ich mich mit der Ähnlichkeitsmethode. Wo ich hinkam, an vielen Orten und bei vielen Gesprächen, hatte ich das Gefühl, mich auf vertrautem Gelände zu bewegen. In Podnanos war es der Wein, der gleich für Anknüpfungspunkte sorgte – ich bin in einer Weingegend aufgewachsen. Da war auch der alte Bienenzüchter in der Oberkrain, der mir in seiner getäfelten Stube, wo der Kachelofen eine wohlige Wärme verbreitete, deutlich machte, worauf es in seinem Fach ankommt. Während wir Kekse knabberten, die uns seine Frau auf den Tisch gestellt hatte, erklärte der Imker, die Hauptsache sei, die Bienen zu lieben, nicht den Honig, sprich: den Gewinn. Und da war der Mann, die treibende Kraft zur Errichtung des Museums von Kobarid am Isonzo, dort hatten im Ersten Weltkrieg Hunderttausende ihr Leben verloren. Sein Museum, sagte der Gründer, solle kein Kriegs-, sondern ein Antikriegsmuseum sein. Weil ich zu seinen Worten nickte – auch bei uns hängen in jedem Dorf Tafeln, mit denen an die Opfer der Weltkriege erinnert wird –, fügte der alte Mann anerkennend hinzu: »Sie verstehen das. In Ihrer Heimat war es ja nicht anders!«
Das Verstehenwollen bildet die Basis – für ein Grundvertrauen, eine Grundsympathie, sie stärken das Verbindende.
Als ich in Podnanos zum Thema Wein und Nationalhymne recherchierte, hatten wir einen strahlenden Oktobertag. Kobarid besuchte ich im Sommer. Auch die Jahreszeiten spielen bei der Landeserkundung eine Rolle. Man sollte den Einfluss von Wind und Wetter auf das Gemüt nicht unterschätzen.
Mein Slowenien-Faible ist freilich auch praktischer Natur, es geht durch den Magen. Obwohl mir klar ist, dass meine Gattin dann daheim beim Auspacken mit ihren Augen rollen wird, decke ich mich, bevor ich nach einem Slowenienbesuch die Heimfahrt antrete, immer mit lokalen Delikatessen ein. Nach Ansicht meiner Frau, die über die meisten, jedoch nicht über alle Belange des gemeinsamen Lebens bestens Bescheid weiß, handelt es sich dabei um Hamsterkäufe, weil sich die Regale in unserer Vorratskammer ihrer Ansicht nach ohnehin schon unter Produkten made in Slovenia biegen.
Was man den Vorräten nicht ansieht, und hier irren die Gattin und die restlichen Familienmitglieder, die ganz ihrer Meinung sind, ist die Eigenschaft der Vorräte, die Essenz, den Geist des Herkunftslandes zu konservieren. Den Tischgenossen daheim ist nicht bewusst, dass sie mit dem guten Tropfen, der durch ihre Kehle rinnt, nicht nur zwölf oder 13 Volumenprozent Alkohol aufnehmen, sondern zugleich die ganze Wärme, die Farben und das Licht über jenen Weinbergen, wo ich die Flasche gekauft habe. Es überrascht mich daher nicht übermäßig, wenn die Kommentare der Familienmitglieder, etwa über den slowenischen Honig, den sie auf ihr Frühstücksbrot streichen, oder über den getrunkenen Wein zwar positiv, aber nicht begeistert ausfallen – für meine Begriffe etwas unterkühlt. Es mangelt den Angehörigen eben an tieferen Kenntnissen, ihren Geschmacksnerven fehlen die Augen der Liebe. Was will man da groß herausfinden! Auch der Geschmacksinn muss trainiert, akklimatisiert werden. Woraus folgt, dass die nächste Slowenienfahrt bald wieder fällig wird – da ja auch die heimische Vorratskammer schon wieder halb leer ist!
Karstianer sind dreisprachig
Štanjel – Kobdilj – Lipa
Zumindest war es zu Max Fabianis Zeiten so. Der im heutigen Kobdilj geborene Architekt und Mitarbeiter Otto Wagners gilt als ein Gründervater der Wiener Moderne.
Man kennt sich. Theodor Körner, der Bundespräsident und »rote Kaiser«, hatte im Ersten Weltkrieg als Generalstabschef des VII. Armeekorps das Verteidigungssystem an der Isonzofront geplant. Den Wiederaufbau der dort zerstörten Gebiete leitete dann Max Fabiani. Der Gesprächsstoff geht den rüstigen Greisen also bestimmt nicht aus, als sie sich 1952 anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Wien an den Architekten Fabiani im privaten Rahmen treffen. Aber entgegen der Erwartung des etwas jüngeren Bundespräsidenten schwelgt Fabiani – mit seinem weißen Spitzbart ähnelt er ein bisschen dem alten Sigmund Freud – keineswegs nostalgisch in Erinnerungen. Der frischgebackene Doctor honoris causa steckt voller Tatendrang! Seinen Malakka-Rohrstock mit verziertem Knauf scheint Fabiani nicht wirklich als Gehhilfe zu benötigen. Aus der Tasche ein Notizbuch sowie einen Stift hervorziehend, wirbelt er ihn wie ein Jungspund effektvoll durch die Luft, während er Theodor Körner erklärt, was man jetzt in Wien alles neu machen müsse – im Nullkommanix wirft er einen Plan für die städtebauliche Entwicklung der Hauptstadt auf das Papier: Die Stadtbahn sei auszubauen, in der Nähe der Bahnhöfe und am Ring sollten Wolkenkratzer mit billigen Wohnungen hochgezogen werden. Außerdem – Wien ist noch von den vier alliierten Siegermächten besetzt – rät Fabiani dem Bundespräsidenten, an die Errichtung eines effizienten Raketenverteidigungssystems zu denken. Das Staatsoberhaupt, der Antimilitarist, so stelle ich es mir vor, zuckt zusammen: Raketen! Und dann Hochhäuser vor dem Burgtheater! Bei aller Freundschaft, auch einem Genie geht manchmal ein Wurf daneben, mag der verdutzte alte Herr gedacht haben.
Der österreichisch-italienisch-slowenische Architekt Max Fabiani arbeitete in jungen Jahren im Atelier Otto Wagners mit, wo er am Bau der Wiener Stadtbahn beteiligt war. Später wirkte er in seiner Heimat am Karst.
Geboren wurde Fabiani 1865 in Kobdilj im slowenischen Karst, dort verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens, und dort wurde er schließlich in der Familiengruft beigesetzt. Seine Mutter entstammte einer Adelsfamilie aus Triest mit Tiroler Wurzeln. Im Haus Fabiani wurde Deutsch, Italienisch und Slowenisch gesprochen. Nach der Volksschule besuchte Max in Laibach die Oberschule, zum Studieren ging er nach Wien, wo er an der Technischen Hochschule von Karl König unterrichtet wurde, dem Erbauer des Palais Herberstein im 1. Bezirk. Nach einer dreijährigen Bildungsreise, die ihn unter anderem nach Italien und Griechenland führte, wurde Fabiani Mitarbeiter von Otto Wagner. Es folgten große Aufträge in Wien, etwa die Urania am Donaukanal, außerdem in Ljubljana, Triest und anderen Städten der Monarchie. Auch in den Dörfern im Karst hat der Architekt unermüdlich Projekte verwirklicht. Dort will ich mich auf die Spurensuche begeben.
Vor der Tankstelle an der Durchzugsstraße unterhalb von Štanjel sitzen, die ledernen Arbeitshandschuhe neben sich auf einem leeren Stuhl abgelegt, in der Hand einen G’spritzten, zwei verschwitzte Gemeindemitarbeiter in greller Schutzkleidung und blicken den wenigen vorbeifahrenden Autos nach. Richtung Dorf, das auf einem Hügel liegt, sticht ein Gebäude mit einem wie angeklebt wirkenden runden Turm hervor. »Wir sagen hier Mussolini-Haus dazu«, erklärt der ältere der beiden Männer, nachdem er sein Glas mit zwei großen Schlucken geleert hat, auf den Turm zeigend. »Dort war ja der Parteisitz der Faschisten, der Plan ist von Max Fabiani«, ergänzt der Jüngere, er hat seinen G’spritzten ebenfalls zügig getrunken und zündet sich nun eine Zigarette an. In den 1920er- und 1930er-Jahren, als in der Region die italienischen Faschisten herrschten, war Fabiani Bürgermeister von Štanjel.
Hinter dem nur teilweise restaurierten Schloss in der Dorfmitte habe ich ein Zimmer gemietet. Mit ihren Händen Zeichen gebend, lotst mich die Vermieterin im Auto durch das Stadttor. Ich passiere es mit angehaltenem Atem, zwischen die eingeklappten Seitenspiegel und den steinernen Torrahmen passt nämlich kein Blatt Papier. Dahinter winden sich die von grauen Steinhäusern gesäumten Gassen spiralförmig nach oben. Auf der Hügelkuppe, wo noch Reste der Stadtmauer stehen, befindet sich das Häuschen, in dem ich die Nacht verbringen werde. Die flachen Kalksteine, mit denen das Dach bedeckt wurde, wiegen vermutlich Tonnen. Hoffentlich wusste der Erbauer, warum er für die Last über meinem Kopf nicht dickere Balken ausgewählt hat, sinniere ich, als ich auf dem Bett erschöpft alle viere von mir strecke. Vor dem geöffneten Fenster sägen Zikaden. Der Blick schweift über silbrig schimmernde Steindächer.
Am nächsten Morgen stapfe ich über schief getretene Steintreppen hinunter zum Schloss. Etliche Häuser, an denen ich vorbeikomme, sind unbewohnt und fallen langsam auseinander. Vor jedem Gebäude gibt es eine runde Zisterne, in die früher über steinerne Rinnen das auf dem Dach aufgefangene Regenwasser geleitet wurde. Wegen der Korrosion des Gesteins fließt im Karst an der Oberfläche kein Wasser, es sucht sich einen unterirdischen Weg, daher war man hier bis zur Errichtung moderner Wasserleitungen auf das gesammelte Regenwasser angewiesen, jeder Tropfen war kostbar.
Auch vor dem Schloss steht eine Zisterne mit dem Wappen der Cobenzl, über Jahrhunderte die Herren von Štanjel. Im Ersten Weltkrieg wurde das Bauwerk von den Österreichern als Kaserne genutzt, im Zweiten Weltkrieg erlitt es große Schäden. In seiner Zeit als Bürgermeister richtete Fabiani im Schloss eine Bücherei ein, es gab auch eine Arztpraxis und einen Saal für Tanzabende, Kino- und Theatervorführungen. Heute sind im restaurierten Flügel ein Restaurant mit Café sowie das Tourismusbüro untergebracht, andere Gebäudeteile dämmern mit blinden Fensterhöhlen vor sich hin.
Um 10 Uhr bin ich mit der Leiterin des örtlichen Tourismusbüros verabredet. Weil noch etwas Zeit ist, trinke ich, mein Gesicht in die Morgensonne haltend, im geschotterten Innenhof des Cafés einen Cappuccino – am Nebentisch eine Gruppe Radfahrer, die ihre Vehikel vor der gegenüberliegenden Kirche des heiligen Daniel zusammengehängt haben.
Blick auf das Schloss Štanjel, wo Max Fabiani als Bürgermeister residierte
Die Leiterin des Tourismusbüros versicherte per E-Mail, mir in Štanjel, wenn ich zu Besuch käme, »alles zu zeigen«. Jetzt klaubt sie in der Ablage neben den Regalen, wo lokale Erzeuger Marmeladen und Trockenobst anbieten, zwei oder drei vergilbte Prospekte zusammen und drückt sie mir mit den Worten in die Hand: »Damit können Sie sich alles selbst anschauen.« Die Dame scheint es eilig zu haben. Als ich das Büro vorhin pünktlich betrat, war niemand da. Nach etwa zehn Minuten kam die Chefin angerannt – dieselbe Frau, die ich vorhin im Café mit dem Kellner herumturteln sah. Kaum hat sie mich hinauskomplimentiert, rennt sie erneut – es gibt eben Prioritäten – ins Café hinüber.
Zu meinem Glück hat eine Gruppe italienischer Blogger um halb zwölf eine geführte Besichtigung der Villa Ferrari gebucht, der wichtigsten Sehenswürdigkeit im Dorf. Barbara Jeicic, die Touristenführerin, hat nichts dagegen, dass ich mich dranhänge. Fabiani habe die Villa in seiner Zeit als Bürgermeister für seinen Schwager, den Arzt Enrico Ferrari aus Triest, umgebaut, erzählt Jeicic. Sie studierte in der Hafenstadt Übersetzen und Dolmetschen, jetzt lebt sie wieder im Heimatdorf Štanjel. Während wir, vorbei an einem algengrünen Teich, durch den mit künstlichen Grotten und Brunnen geschmückten Garten trotten, sucht Jeicic meinen Blickkontakt – ich bin ihr aufmerksamster Zuhörer. An meinem Akzent erkannte die Führerin sofort, dass ich kein waschechter Italiener bin. Als die anderen, die Köpfe über ihre Mobiltelefone gebeugt, immer mehr zurückfallen, zischt mir Jeicic erzürnt zu: »Die Italiener wollen, dass ich unser Dorf italienisch San Daniele nenne. Ich frage dann zurück, ob sie etwa für die Karstdörfer über Triest, wo im Gegensatz zu hier hauptsächlich Slowenen leben, den slowenischen Namen verwenden!« Noch immer, schimpft Jeicic, glaubten einige »Nostalgiker, dass Teile Sloweniens rechtmäßig zu Italien gehören!«.
Dass Max Fabiani vor einigen Jahren zum Ehrenbürger von Štanjel erklärt wurde, findet Barbara Jeicic eher problematisch. Ihre Großeltern seien von den Italienern als minderwertig behandelt worden, »das haben wir nicht vergessen«. Und Fabiani habe unter Mussolini für die Italiener gearbeitet! Barbara Jeicic ist jedoch für die Meinungsvielfalt. Ich solle Stanislava Pipon aufsuchen, eine entfernte Verwandte von ihr, die den Architekten noch persönlich gekannt habe. »Sie hält große Stücke auf ihn.«
Die 94-jährige Frau Pipon wohnt in einem kleinen Bauernhaus im wenige Gehminuten entfernten Kobdilj. Da sie mit Besuch nicht gerechnet hat, streicht die alte Frau mit einem schüchternen Lächeln zuerst die Schürze und dann ihre Haare glatt, bevor sie mich in die Küche bittet: »Bei mir bekommen Sie immer etwas«, sagt die Greisin, als eine grauweiße Katze durch ein rundes Loch in der Tür hereinschlüpft und nach Essensresten in einem Napf neben dem gusseisernen Herd schnappt. Am mit einem Wachstuch bedeckten Tisch unter dem Herrgottswinkel liegt eine Fliegenklatsche griffbereit. Ungläubig und ein bisschen stolz, dass ich den weiten Weg zu ihr gefunden habe, erzählt die alte Frau von der Zeit, als ihr Dorf zu Italien gehörte. Ihre Lehrer kamen alle aus Süditalien und konnten die slowenischen Namen der Dorfkinder nicht aussprechen. »Eure Sprache klingt verrückt!«, haben sie geklagt, erinnert sich Stanislava und klopft sich, um zu zeigen, wie unaussprechbar für italienische Zungen die slowenischen Namen waren, mit ihren gekrümmten, knochigen Fingern an die Stirn – sie ist so zerfurcht wie die Landschaft draußen. Offiziell, erzählt Stanislava Pipon, existierte damals, als Fabiani in Štanjel Bürgermeister war, das Slowenische nicht, aber unter den italienischen Beamten und Lehrern habe es eben solche und solche gegeben. »Mancher hat weggehört, wenn wir verbotenerweise untereinander slowenisch sprachen. Eigentlich hätte er uns bestrafen müssen.« Die Greisin beherrscht das Italienische besser als ich – eine Folge des Assimilierungsdrucks im Ventennio fascista, den zwei Jahrzehnten unter den italienischen Faschisten.
Von Max Fabiani weiß Pipon nur Gutes zu berichten: Als junges Mädchen half sie bei ihm im Haushalt mit, seine Frau Francesca und die Tochter Carlotta haben ihr manchmal Kleider geschenkt. »Es waren großzügige Menschen, obwohl ich ein dummes Ding war, liebten mich alle.« Max Fabiani, erzählt die alte Frau, während sie die Katze streichelt, die sich mit aufgestelltem Buckel an ihre Beine schmiegt, der berühmte Architekt, sei es gewesen, der dafür sorgte, dass Štanjel 1906 an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Fabiani verdanke Štanjel auch die öffentliche Trinkwasserleitung. Und dass ihr Dorf im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen nicht zerstört wurde, sei ebenfalls ein Verdienst Fabianis. »Er ging zum Kommandanten und behauptete, Hitler gut zu kennen. So wurden wir verschont.« Der deutsche Kommandant, sagt Pipon, habe dann, weil er es nicht glauben konnte, beim Führer angerufen: »Max Fabiani? Was will er? In Ordnung, Štanjel nicht anrühren!«, soll Hitler ins Telefon gebrüllt haben. Als der spätere Führer aller Deutschen nämlich noch als armer Schlucker in Wien gelebt hatte und Künstler werden wollte, so erzählte es Fabiani, hatte Hitler einige Monate als Zeichner in seinem Büro gearbeitet. Wie geschickt sich der Möchtegernkünstler angestellt hatte, ist nicht überliefert, bekanntlich entwickelten sich die Dinge später in eine andere Richtung – wäre Hitler nur Zeichner geblieben! »Wir hatten uns damals, als die Deutschen auf dem Rückzug waren, in den Wäldern versteckt. Als wir zurückkehrten, war unser Dorf niedergebrannt. Nicht von den Deutschen – es waren die Partisanen«, erinnert sich Stanislava Pipon.
Vorbei am ehemaligen Parteisitz der Faschisten zweige ich von der Hauptstraße ab, die weiter südlich zur Autobahn von Mailand nach Triest führt. Richtung Westen geht es durch Dörfer, deren Mitte, zusammen mit der Pfarrkirche, Tiefbrunnen aus dunkelgrauem Kalkstein bilden. Auf den Hügeln reift tiefblauer Teran heran, in Bodensenken umgürten bauchige Steinmauern Gemüsegärten. Hinter einer Kurve am Straßenrand verkauft ein Händler Pfirsiche und dunkelrote Kirschen. Da ich nichts zu Mittag gegessen habe, kaufe ich ein Kilo flaumiger Pfirsiche und folge dem Beispiel eines dünnen Kerls, der seinem Lkw entstiegen ist. Mit dem Händler scherzend, beißt er zwischendurch, den Oberkörper vornübergebeugt, in einen Pfirsich. Dabei tropft der Saft auf den Kies, einiges landet auch auf dem T-Shirt. Es wäre gelogen, wenn ich behauptete, dass mein Hemd unbekleckert blieb.
Nataša Kolenc ist Präsidentin der Max-Fabiani-Stiftung und hat in der Gegend verstreute Pläne des großen Architekten gesammelt.
Als ich wenig später mein Auto vor der Kirche von Lipa abstelle, wartet Nataša Kolenc bereits am Eingang des Nebenhauses. »Ich dachte mir, dass Sie das sind. So viele Autos mit ausländischem Kennzeichen fahren hier nicht vorbei«, lächelt die Architektin. Hinter der Kirche führt ein steiniger Pfad zum 643 Meter hohen Trstelj hinauf, der höchsten Erhebung im Umkreis. »Auf dem Berg wurde eine prähistorische Siedlung entdeckt, es soll hier Hunderte geben, aber das ist eine andere Geschichte«, erzählt Nataša Kolenc, nachdem wir unter einer Pergola vor ihrem Haus Platz genommen haben.
Die Architektin, sie ist Präsidentin der 1999 gegründeten Max-Fabiani-Stiftung, füllt Gläser mit selbst gemachtem Holundersaft. Den Ferrari-Garten, dessen Restaurierung sie leitete, bezeichnet Kolenc als Fabianis »Schwanengesang«. »Nach der faschistischen Machtergreifung 1922 durfte er nicht mehr offiziell als Architekt tätig sein.« Da der Garten seinem Schwager gehörte, habe man ihm dieses Projekt jedoch nicht verbieten können. »Fabiani mixte Modernes und Traditionelles«, sagt Kolenc. »Alte Gebäude restaurierte er sehr konservativ, gleichzeitig verwendete er damals noch seltenen Gussbeton.« Der große Architekt habe Respekt vor der Architektur des Karsts gehabt, so Kolenc.
Auch ihr Haus ist ein altes, typisches Karstgebäude, an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die gefürchtete Bora wehe hier immer von Osten, daher kehren die Häuser ihren Rücken der aufgehenden Sonne zu, erklärt Kolenc. »So bieten sie dem Wind wenig Angriffsfläche.«
Unterdessen ist Nataša Kolenc einige Male aufgesprungen, um aus ihrer Bibliothek Bücher und fotokopierte Blätter zu holen. Auf dem Tisch hat sich ein Stapel mit Gebäudeplänen Fabianis gebildet, an den Rand kritzelte der Architekt mit Bleistift Erläuterungen auf Italienisch und Slowenisch. Etwa 100 derartiger Pläne seien in den letzten Jahren in den Dörfern ringsum aufgetaucht, erzählt Kolenc. »Lange hieß es, es sei alles verschollen – dabei wussten die Hauseigentümer, in deren Schubladen die Sachen lagen, gar nicht, dass es sich um Arbeiten Fabianis handelt.«
Natürlich habe das Vergessen mit der Geschichte zu tun, sagt Nataša Kolenc. »Den Italienern galt Max Fabiani als Austriacante, als Austro- und Germanophiler. Die Slowenen hingegen misstrauten ihm, weil er gute Beziehungen zu den Italienern pflegte. Als dann die Kommunisten 1945 die Macht übernahmen, war er ihnen als Bürgerlicher suspekt. Daher zog er ins italienische Gorizia – bei uns war kein Platz mehr für ihn.«
Kolenc hingegen bewundert Fabiani. »Er war ein Visionär vom Kaliber Leonardo da Vincis. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Er ersann eine Methode, um die Luft im smoggeplagten Mailand zu verbessern, er tüftelte an einem kettenlosen Fahrrad, einem U-Boot und einer Flugmaschine.« Aber auch der Mensch Max Fabiani, findet meine Gastgeberin, nötige einem Respekt ab. Warum sei er nach dem Ersten Weltkrieg, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, zurück in den heimatlichen Karst gekommen? Warum habe er sich selbst auf ein Abstellgleis manövriert, fragt die Architektin und gibt gleich selbst die Antwort: »Er fühlte sich verpflichtet, das schon unter den Österreichern begonnene Werk des Wiederaufbaus in der kriegsverwüsteten Region fortzuführen!« Was den angeblichen Kollaborateur betreffe: Wenn man wie Fabiani als Bürgermeister Verantwortung trage, sei es da nicht klug, zu taktieren, nach einem Modus Vivendi zu suchen, um Schlimmeres zu verhindern? Natürlich könne man nichts beweisen, viele Dokumente seien verloren, sagt Kolenc. Aber dass Fabiani mittellos wie eine Kirchenmaus starb, zuerst in einem Armengrab in Gorizia beigesetzt wurde – sage das nicht einiges über seine Prioritäten? »Ein Karrierist war er jedenfalls nicht!«
Nataša Kolenc hat sich in Fahrt geredet, eine Anekdote muss sie unbedingt noch erzählen: Als Fabianis Mutter 1923 in Kobdilj starb, herrschten die Faschisten, die kein slowenisches Wort duldeten. »Und was machte Max Fabiani? In allen drei Sprachen, die in seiner Familie verwendet wurden, beschriftete er ihren Grabstein! Der Stein auf dem Friedhof ist noch erhalten!«
»Am besten, wir schauen uns ein bisschen um!«, erklärt die Architektin. »Die Gegend ist voller Fabiani-Hinterlassenschaften.« So fahren wir, als die Bücher wieder in den Regalen verstaut sind, nach Westen zur italienischen Grenze. Wir überholen Radfahrer, die, tief über die gebogenen Lenkstangen ihrer Rennräder gebeugt, eine Trainingsrunde abspulen. Die Sonne wirft jetzt lange Schatten, auf Kaminen blitzen Lamellenhauben aus Aluminiumblech im Gegenlicht.
Hinter einer Kurve spitzt aus dem Grün der Kirchturm von Temnica hervor. Der Weiler hockt an einer Geländekante mit atemberaubendem Blick auf die Adria. Rechts unten ragen im Hafen von Monfalcone die eisernen Hälse von Kränen empor. Im Ersten Weltkrieg war Temnica praktisch ausradiert worden. Fabiani baute die Kirche, das Pfarr- und das Gemeindehaus wieder auf. Entstanden ist ein steinernes Ensemble in L-Form um eine Piazza herum, samt Rundbogenfenstern, Balkonen mit Maßwerk sowie einer Loggia. »Die neoromanischen und neogotischen Elemente, das Pseudo-Alte waren ein Tribut an die Politik«, sagt Kolenc. Die Italiener haben der Gegend ihren Stempel aufprägen wollen: »Es sollte ein bisschen wie in Venedig aussehen!« Modern mutet hingegen das ebenfalls von Fabiani geplante Schulhaus etwa 100 Meter unterhalb der Kirche an: Ein schmuckloser zweistöckiger Kasten mit großen, nach Süden ausgerichteten Fenstern. Heute ist hier das lokale Tourismusbüro untergebracht.
Nataša Kolenc tritt vor das Schulgebäude. Das Gesicht dem Meer zugewandt, wirbelt ihr der Wind von hinten die roten Haare um die Ohren. Irgendwo dort unten, sagt die Architektin, ihren Arm Richtung Adria ausstreckend, sollte der Canale di Vipacco entstehen: »Eine Wasserstraße zwischen Triest und Wien. Die Idee gab es schon lange, Fabiani war von ihr besessen.« Als Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg kommunistisch geworden war, sich die ideologischen Konflikte zuspitzten, habe er sich an die politischen Autoritäten in Ljubljana gewandt: Die Errichtung eines Kanals zwischen der Donau und der Adria fördere die wirtschaftliche Entwicklung und diene dem Frieden, argumentierte Fabiani. »Im ideologisch aufgeheizten Klima nach dem Zweiten Weltkrieg betonte er die Gemeinsamkeiten, nicht die Gegensätze. Er kam 100 Jahre zu früh, seine Botschaft ist immer noch aktuell«, sagt Nataša Kolenc. Und fügt stolz hinzu, dass der Architekt bei aller Europa-Begeisterung eines stets vor Augen behalten habe: dass er ein Kind des Karsts sei. »Er bezeichnete sich als Karstianer!« Ein größeres Kompliment hätte Fabiani dieser zerklüfteten, rauen und doch irgendwie lieblichen Landschaft gar nicht machen können. Sie ähneln sich ja, bei Licht betrachtet, die Landschaft und die Bewohner – vielgestaltig ist Erstere und uneindeutig in ihrer kulturellen Identität sind Letztere. Echte Karstianer sind eben dreisprachig.
Star aus der Pampa. Und: Der Karst ist grün geworden
Divača – Komen
Mit Filmen wie Erotik und Frühlings Erwachen hat Ita Rina, der erste slowenische Filmstar, die Fantasie ihrer männlichen Landsleute erhitzt.
Wenn man die Kraška cesta, die Divača in zwei Hälften teilt, entlangwandert, wird schnell deutlich, dass das Dorf im Süden Sloweniens seine besten Tage hinter sich hat. An der schmalen Straße, Gehsteig gibt es keinen, reiht sich ein Sammelsurium aus Alt und Neu an das andere: Mehrfamilienhäuser mit frischem Anstrich, an der Einfahrt Stuckfiguren, die Wohlstand signalisieren, daneben Handwerksbetriebe, Garagen und Schuppen, wo sich Kisten oder Bretter übereinanderstapeln, außerdem kleine Bauernhöfe, wo längst kein Vieh mehr gehalten wird. Rumpelt ein Lkw an der Pfarrkirche vorüber, flattert der wilde Wein, der sich am Wegkreuz vor dem Eingang emporrankt, wie ein Vorhang im Fahrtwind – Fußgänger und auch der Herrgott im Holzkasten leben an der Kraška cesta gefährlich.
Wo die Straße eine Kurve macht, erblicke ich durch graue Lamellenvorhänge eines 1970er-Jahre-Baus etwa ein Dutzend Leute, jeder sitzt für sich an einem eckigen Tisch, während eine füllige, mittelalte Frau mit einer Rundschüssel aus Kunststoff durch die Reihen spaziert. Vor jedem pflanzt sie sich auf, um mit einer Kelle auf den ihr entgegengehaltenen Teller Eintopf zu schaufeln. »Armenspeisung!« – dieser Gedanke schießt mir durch den Kopf. Ein Vorurteil, wie sich herausstellt. Beim zweiten Hinsehen bemerke ich auf den Tischen Schrauben, Klemmen und Kupferdrähte. Offensichtlich machen hier Mitarbeiter eines Elektrotechnikbetriebs gerade Mittagspause.
»Muzej slovenskih filmskih igralcev« heißt es in Metallbuchstaben an einer Mauer ein paar Häuser unterhalb der Kirche. Durch den Toreingang strömt eine Touristengruppe. Ich habe das gleiche Ziel: das Museum der slowenischen Filmschauspieler im Škratelj-Haus. »Es ist zum Verrücktwerden«, sagt drinnen Tamara Udovič. An diesem Samstag hat sie bereits zwei Gruppen herumgeführt, eine weitere soll am Nachmittag kommen. Während der Corona-Pandemie habe sie versucht, über Social-Media-Kanäle mit dem kulturinteressierten Publikum Kontakt zu halten. »Es war nicht sehr erfüllend. Und nun rennen sie uns die Bude ein.« Klar sei das besser, sagt Udovič. Vor zehn Jahren wurde das Museum eröffnet, Udovič, sie studierte in Ljubljana Rechtswissenschaften, ist hier seit fünf Jahren die Verantwortliche. Das Škratelj-Haus, ein Ensemble geduckter steingemauerter Gebäude, blieb im Originalzustand aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Lange vor dem Anschluss an das Eisenbahnnetz war Divača bereits ein Knotenpunkt an der alten Reichsstraße zwischen Pula, Triest und Wien. Früher seien hier »Furmani«, Fuhrleute, abgestiegen, erzählt Udovič. Pferde und Knechte logierten in den Nebenhäusern. Dort werden jetzt Dokumente zur slowenischen Filmgeschichte gezeigt – im Hauptgebäude, das wie ein Hexenhäuschen anmutet, geht es um Ita Rina, den ersten slowenischen Filmstar.
Eingang zum Slowenischen Filmmuseum im Škratelj-Haus, wo früher die Fuhrleute abstiegen
Dass Ita Rina im Škratelj-Haus aufgewachsen sei, sei eine Legende, sagt Tamara Udovič, während wir über eine knarrende hölzerne Außentreppe in das Obergeschoss steigen. »Als gesichert kann gelten: Sie kam in Divača zur Welt.« Die spätere Schauspielerin wurde hier am 7. Juli 1907 als Ida Kravanja geboren. Vater Jožef kam aus Bovec am Isonzo und arbeitete wie ein Großteil der damaligen Bewohner Divačas bei der Eisenbahn. Die Mutter Marija entstammte einer Bauernfamilie aus der Nähe von Bovec. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges zog die Familie nach Ljubljana, wo Ida nach der Volksschule ein Mädchengymnasium besuchte. Ihre schulischen Leistungen scheinen nicht brillant gewesen zu sein: Die dritte Klasse musste Ida wiederholen, die vierte schloss sie nicht ab. Längst war das hübsche Mädchen für Tanz, Musik, Theater und Film entbrannt. Sie träumte von einer Schauspielkarriere.
Als der Vater starb, verlor die Familie den Ernährer. Um durchzukommen, musste die Mutter Zimmer an Studenten untervermieten. Ida fand Arbeit bei einer Bank. 1926, im Sterbejahr des Vaters, kündigte die Zeitung Slovenski narod einen Schönheitswettbewerb an, organisiert von einer amerikanischen Filmgesellschaft. Der Gewinnerin winkten ein beachtlicher Geldpreis sowie ein Filmvertrag in Amerika. Ida, offenbar kein Kind von Traurigkeit, beteiligte sich und landete im Finale der sieben Schönsten. Beflügelt vom Erfolg, nahm sie im Dezember am Schönheitswettbewerb Miss Yugoslavia im Balkan-Palace-Kino in Zagreb teil, wo sie enthusiastisch gefeiert wurde. Gewonnen hat eine andere. Der Kinobesitzer schickte jedoch Fotoaufnahmen von ihr an den deutschen Filmpionier Peter Ostermayr. Dieser lud sie zu Probeaufnahmen nach Berlin ein. Mit einer Notlüge – die Mutter verweigerte ihre Zustimmung – reiste Ida allein. »Ich konnte nur ein paar Wörter Deutsch. Das große Berlin, von dem ich träumte, lag nun vor mir. Ich tat kein Auge zu, weinte und wollte zurück nach Hause«, schrieb die Schauspielerin im Rückblick über ihre Nacht in einem Hotel nahe am Berliner Anhalter Bahnhof.
»Schicken Sie ein Telegramm heim, Sie sind engagiert«, erklärte Ostermayr nach den Probeaufnahmen: So begann Ida Kravanjas Aufstieg zur Leinwandheldin. Mit Erotik erlebte die ehemalige Bankangestellte, die sich nun Ita Rina nannte, 1929 ihren Durchbruch. »Es bleibt unangenehm deutlich, daß es sich in erster Linie um ein Spiel mit erotischen Sensationen handelt. Pikant und delikat aufgetischt, werden sie vielen schmecken«, urteilte das Hamburger Echo. Die Kirche schäumte – die Kinokassen klingelten. Für Ita Rina ging es nun steil nach oben: Frühlings Erwachen (1929), Der Walzerkönig (1930) und Wellen der Leidenschaft (1930) hießen die nächsten Filme.
»Kopf einziehen, die Menschen waren früher kleiner«, sagt Tamara Udovič, als wir im Haupthaus von einer winzigen Kammer in die nächste gehen. Zum rustikalen Ambiente passt die rußgeschwärzte Küche, wo über einer offenen Feuerstelle gekocht wurde. Das Plumpsklo wird heute als Besenkammer genutzt. An den Wänden hängen Bilder von berühmten Filmszenen. »Na ja«, sagt Tamara Udovič und zeigt auf ein sich küssendes Paar: »Verglichen mit heutigen Verhältnissen ist das harmlos. Andererseits: Meine Oma erzählte, dass der Pfarrer in ihrem Dorf die männliche Jugend gegen sie aufhetzte. Weil sie sich im nur knielangen Rock auf die Straße getraut hatte, gingen die Buben mit Brennnesseln auf sie los.«
Zu den vielen Schwarzweißfotos, die man hier von Rina im Familienkreis sieht, sagt Udovič, die selbst im nahen Postojna aufwuchs: »Von meiner Großmutter gibt es nur ein einziges Foto, Itas Familie muss relativ wohlhabend gewesen sein!« In einem Glasschrein liegt Rinas Taufurkunde, das »testimonium baptismi«. »Als legitime Tochter«, heißt es in lateinischer und slowenischer Sprache, sei Ida Kravanja am 18. Juli 1907 getauft worden. Ausgestellt sind hier auch Filmplakate aus den frühen 1930er-Jahren, als Ita Rina im Zenit ihres Ruhms stand. Kinomagazine wie das Mailänder Novella oder das französische Ciné-Miroir brachten ihr Gesicht auf dem Cover.
»1932 gab es eine abrupte Wende«, erzählt Tamara Udovič: Die gefeierte Schauspielerin heiratete den Serben Miodrag Đorđević und trat zum orthodoxen Glauben über. Mit dem Gatten, einem Ingenieur, zog Ita Rina nach Belgrad. Nur noch selten trat sie, sich fortan Tamara Đorđević nennend, vor die Kamera.
»Ihre Tochter Tijana erzählte, dass es in den Kriegsjahren endlose Familiendiskussionen gegeben habe«, sagt Udovič. »Die Eltern bereuten die Umsiedlung nach Belgrad, sie fühlten sich schuldig. Zwei Mal hatte Ita Rina ein Angebot von Hollywood ausgeschlagen.« Anstatt Ruhm und Reichtum in Amerika gab es im April 1941 die Bombardierung Belgrads, der große Teile der Stadt und viele Bewohner zum Opfer fielen. Ein letztes Mal spielte Ita Rina 1960 im Film Krieg (Atomic War Bride) eine kleine Rolle. Schon immer an Asthma leidend, zog sie sich zusammen mit ihrem Mann an einen Badeort an der montenegrinischen Adria zurück. Auf dem Belgrader Friedhof Novo Groblje wurde Ita Rina 1979 begraben. 2007, zu ihrem 100. Geburtstag, erschien eine große Monografie.
Ita Rina, der erste internationale Filmstar Sloweniens, machte mit gewagten erotischen Szenen Furore.
Ihre Filmbegeisterung sei durch die Tätigkeit im Museum enorm gewachsen, sagt Tamara Udovič, als wir im Nebengebäude Requisiten und Bilder betrachten, die vom Leben anderer slowenischer Filmgrößen erzählen. »Hier ist mir klar geworden, wie es hinter den Kulissen zugeht, mit welchem Aufwand Filme realisiert werden.« Als mir die Museumsleiterin zum Abschied Prospekte sowie eine Biografie Ita Rinas überreicht, hat sich vor der Kasse eine Warteschlange formiert. Eine Frau macht ein paar Tanzschritte, dazu summt sie ein Liedchen, woraufhin zwei Begleiterinnen begeistert einstimmen – eine in Slowenien populäre Filmmelodie. Die Beinahe-Hollywoodberühmtheit Ita Rina scheint Erinnerungen zu wecken. Beschwingt folgen die Besucher der Museumsleiterin in das Obergeschoss.
Am nächsten Morgen bin ich in Komen mit Andrej Bandelj verabredet. Das hübsche Karstdorf ist eine halbe Autostunde von Divača entfernt. Ich treffe Bandelj bei der Bäckerei am Hauptplatz, wo man auch Kaffee trinken kann. Bei der Begrüßung fängt der Anfangsvierziger mit Stoppelbart meinen Blick auf – er bleibt an seinen dunkelblauen Fingerkuppen hängen, sie sehen aus wie in Tinte getaucht. »Das kommt von den Trauben. Auch eifriges Schrubben hilft nichts, dabei habe ich extra Gummihandschuhe getragen«, erklärt mein Gegenüber. Seine Familie bewirtschaftet am Ortsrand anderthalb Hektar Weinfläche. »Die Landwirtschaft ist ein Zuerwerb. Gestern haben wir die Ernte abgeschlossen, es wurde spät.« Die Bandeljs bauen Teran an, die Rebsorte, die im benachbarten Friaul und in Istrien Refosco/Refošk genannt wird. Der Name Teran sei dem Italienischen entlehnt: terra rossa (rote Erde). Die typische Farbe des Karstbodens komme von Eisenmineralien im kalkhaltigen Gestein, erfahre ich von Bandelj, der in Ljubljana Geografie studiert hat und auf den Karst begreiflicherweise ziemlich stolz ist: Der Terminus sei genau hier entstanden. Unter »Karst« verstehen Wissenschaftler durch Lösungsverwitterung entstandene Landschaften, sagt Bandelj. »Im Keltischen bedeutet ›Ker‹ Fels, auch das Wort Doline, auf Slowenisch ›Tal‹, hat seinen Ursprung in unserer Region.«
Andrej Bandelj hat zu unserem Treffen ein Buch mit historischen Bildern mitgebracht, auf diesen sieht man, wie es im Karst vor 100 Jahren war: baumlose Ebenen, felsige Höhen und trockene, karge Weideflächen, gezeichnet von den Verwüstungen des Krieges. Das Gebiet rund um Komen bildete im Ersten Weltkrieg das Hinterland der Isonzoschlachten. Im »verdammten Karst«, wie ein italienischer Verbindungsoffizier sagte, hatte das habsburgische Heer ein weitverzweigtes Netz an Versorgungswegen und Reservestellungen errichtet, ganze Städte mit Kinos, Kirchen, Restaurants, auch Bordelle fehlten nicht.
Als ich am Vortag mit dem Auto herfuhr, ging es durch Wald und Wiesen. Wie Leuchttürme tauchten Kirchtürme aus dem grünen Pelz empor, Wegweiser, die zu Häuseransammlungen mit ummauerten Gemüsegärten führen. »Stimmt, man meint, da ist nichts außer Landschaft, und auf einmal steht da ein Dorf«, sagt Bandelj. Die Österreicher haben im Karst mit Aufforstungsprogrammen begonnen. »Meine Urgroßeltern bekamen Geld für das Pflanzen von Bäumen.«
Österreichische Spuren gebe es hier viele, sagt Bandelj, während wir über die Straße Nr. 617 Richtung Gorjansko kurven. »Etwa Friedhöfe aus dem Ersten Weltkrieg.« Erst nach der Loslösung Sloweniens aus dem Staatsverband Jugoslawien habe man angefangen, sich um die Friedhöfe zu kümmern, erzählt Bandelj. »Ist ja logisch: Im kommunistischen Jugoslawien dominierten die Serben. Und Serbien war Österreichs Gegner im Ersten Weltkrieg!« Noch etwas fällt meinem Begleiter ein: Sein Urgroßvater sei auf den Namen Alojz getauft worden. »Auf seinem Grabstein steht jedoch der Name Luigi – so musste er unter den Italienern heißen, die hier nach dem Ersten Weltkrieg die neuen Herren waren.«
Da ist sie wieder, die nicht vergangene Vergangenheit: Im Ersten Weltkrieg kämpften Italiener und Slowenen gegeneinander. Bandeljs Urgroßvater zog für den Kaiser ins Feld. »Wir müssen nach vorn schauen, bei den Älteren gibt es noch Vorbehalte, die Jungen jedoch sind unbefangener«, erklärt Andrej Bandelj. Früher habe man zum Beispiel kaum italienische Wanderer und Radfahrer im slowenischen Karst getroffen. Heute sei es anders: »Man isst und trinkt hier gut, es kostet deutlich weniger als jenseits der Grenze.« Das merke ich ebenfalls. Für unser Mittagessen, zwei Pizza Margherita, zwei Gläser Teran plus einen mit Wasser gefüllten Krug bezahlen wir zusammen 17 Euro.
An den Nachbartischen geht es laut und lustig zu: Italiener, die sich nach einer Radtour das zweite oder dritte Bier gönnen. Wie sehr der Kontakt zu den Nachbarn Teil seines Lebens geworden sei, habe er während der coronabedingten Grenzsperre gemerkt, sagt Bandelj. Irgendwann habe er es nicht mehr ausgehalten und sei auf sein Mountainbike gestiegen. »Zwar war es verboten, aber ich kenne ein paar Schleichwege. Ich musste einfach auf der Piazza Grande in Triest einen Café trinken. Richtigen Café gibt es nur bei den Italienern.«