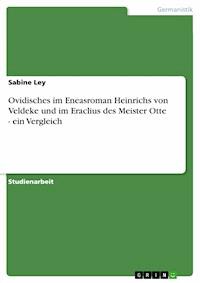
Ovidisches im Eneasroman Heinrichs von Veldeke und im Eraclius des Meister Otte - ein Vergleich E-Book
Sabine Ley
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2005
Studienarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Germanistisches Institut, Lehrstuhl für Ältere Deutsche Literatur), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich mit der Verwendung ovidischer Elemente in Veldekes Eneasroman und Meister Ottes Eraclius beschäftigen. Der Schwerpunkt soll auf der Liebesdarstellung, sowie einem Vergleich der Darstellungsweisen der Hauptfiguren liegen. Ich hoffe, daß sich aus diesem Vergleich Aufschlüsse über die eventuell unterschiedlichen Funktionen der ovidisch geprägten Darstellungsweisen, zum einen für die Handlungsebene, zum anderen für die Werkebene, ergeben. Auf den ersten Blick scheint ein Vergleich nicht besonders sinnvoll: Auf der einen Seite ein Antikenroman, dem die Forschung das Prädikat „frühhöfisch“ angeheftet hat, auf der anderen Seite ein Werk, das sich durch die Vielzahl der verwendeten Stoffe einer eindeutigen gattungsspezifischen Zuordnung entzieht und aufgrund der Thematik und Bearbeitung der geistlich bzw. religiös geprägten Dichtung zuzuordnen ist. Dennoch bietet sich der Vergleich aus mehreren Gründen an. Zum einen bedienen sich beide Autoren ovidischer Elemente und zwar auf stofflicher wie auf poetologischer Ebene. Dies soll anhand der Monologe, insbesondere ihrer Liebesdarstellung, aufgezeigt werden. Zum anderen ist die Ausgangsbasis beider Dichter ähnlich, da sowohl Veldeke als auch Otte nach einer französischen Vorlage arbeiten, so daß im Einzelfall entschieden werden muß, ob der Autor nur Vorgegebenes übernimmt, gegebenenfalls verändert oder selbständig auf antike Quellen zurückgreift. Die Ovidrezeption in Veldekes Eneasroman ist schon seit geraumer Zeit Gegenstandder germanistischen Forschung. Dem entsprechend steht hier eine Fülle von Untersuchungen zur Verfügung. Im Gegensatz dazu führt Ottes Eraclius in der Germanistik eine Art Schattendasein, so daß sich die Sekundärliteratur auf wenige Einzeluntersuchungen beschränkt. Aus diesem Grund werde ich mit meinem Vergleich auf gesichertem Terrain, d. h. bei Veldeke, beginnen und dann versuchen, die gewonnenen Erkenntnisse für eine Untersuchung der Athanaisepisode im Eraclius nutzbringend anzuwenden. Einleitend möchte ich mit einem kurzen Abriß der Ovidrezeption im 12. Jahrhundert, der sogenannten aetas ovidiana, beginnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Page 1
Germanistisches Institut der RWTH Aachen Lehrstuhl für Ältere Deutsche Literaturgeschichte Sommersemester 1999 Hauptseminar: DerEracliusdes Meister Otte
Ovidisches imEneasromanHeinrichs von Veldeke und imEracliusdes Meister Otte - ein Vergleich
Page 1
I. 1. Einleitung
Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich mit der Verwendung ovidischer Elemente in VeldekesEneasromanund Meister OttesEracliusbeschäftigen. Der Schwerpunkt soll auf der Liebesdarstellung, sowie einem Vergleich der Darstellungsweisen der Hauptfiguren liegen. Ich hoffe, daß sich aus diesem Vergleich Aufschlüsse über die eventuell unterschiedlichen Funktionen der ovidisch geprägten Darstellungsweisen, zum einen für die Handlungsebene, zum anderen für die Werkebene, ergeben.
Auf den ersten Blick scheint ein Vergleich nicht besonders sinnvoll: Auf der einen Seite ein Antikenroman, dem die Forschung das Prädikat „frühhöfisch“ angeheftet hat, auf der anderen Seite ein Werk, das sich durch die Vielzahl der verwendeten Stoffe einer eindeutigen gattungsspezifischen Zuordnung entzieht und aufgrund der Thematik und Bearbeitung der geistlich bzw. religiös geprägten Dichtung zuzuordnen ist. Dennoch bietet sich der Vergleich aus mehreren Gründen an. Zum einen bedienen sich beide Autoren ovidischer Elemente und zwar auf stofflicher1wie auf poetologischer Ebene. Dies soll anhand der Monologe, insbesondere ihrer Liebesdarstellung, aufgezeigt werden. Zum anderen ist die Ausgangsbasis beider Dichter ähnlich, da sowohl Veldeke als auch Otte nach einer französischen Vorlage arbeiten, so daß im Einzelfall entschieden werden muß, ob der Autor nur Vorgegebenes übernimmt, gegebenenfalls verändert oder selbständig auf antike Quellen zurückgreift.
Die Ovidrezeption in VeldekesEneasromanist schon seit geraumer Zeit Gegenstand der germanistischen Forschung. Dem entsprechend steht hier eine Fülle von Untersuchungen zur Verfügung. Im Gegensatz dazu führt OttesEracliusin der Germanistik eine Art Schattendasein, so daß sich die Sekundärliteratur auf wenige Einzeluntersuchungen beschränkt. Aus diesem Grund werde ich mit meinem Vergleich auf gesichertem Terrain, d. h. bei Veldeke, beginnen und dann versuchen, die gewonnenen Erkenntnisse für eine Untersuchung der Athanaisepisode imEracliusnutzbringend anzuwenden. Einleitend möchte ich mit einem kurzen Abriß der Ovidrezeption im 12. Jahrhundert, der sogenanntenaetas ovidiana,beginnen.
I. 2. Die Ovidrezeption im Mittelalter
In der Zeit der Spätantike und den folgenden Jahrhunderten des Frühmittelalters gerieten die Werke des einst vielleicht berühmtesten Dichters der Augusteischen Zeit, Publius Ovidius Naso (43 v. Chr.-17/18 n. Chr.), verursacht durch seine Tilgung aus dem Kanon
Page 2
der Schulautoren, weitgehend in Vergessenheit. Nur vereinzelt existieren aus dieser Zeit Zeugnisse für eine Ovidrezeption, welche sich auf den Westen Europas und die englischen Inseln beschränken: So beschäftigte man sich im Zuge einer ersten Wiederaufnahme der antiken Studien im Gelehrtenkreis um Karl den Großen auch eingehend mit Ovid, wobei seine Formkunst mehr Beachtung fand als der Inhalt seiner Werke. Auch in englischen Klöstern scheinen Ovids Werke im Grammatikunterricht noch zur Unterweisung herangezogen geworden zu sein. Sowohl der Verwendungszweck als auch die Auswahl der benutzten Werke deuten allerdings darauf hin, daß sich die Studien ebenfalls hauptsächlich auf die formalen Aspekte der Literatur beschränkten: Bei dem ersten, teilweise in der Volkssprache glossierten und lateinisch kommentierten ovidischen Text handelt es sich um das erste Buch derArs Amatoria,die wohl kaum als für tiefergehende Betrachtungen im Unterricht einer Klosterschule geeignet angesehen worden sein dürfte.
Aber auch im deutschsprachigen Raum war Ovid nicht gänzlich in Vergessenheit geraten. Die Bibliothekskataloge der Klöster Reichenau und Murbach verzeichnen schon im 9. und 10. Jahrhundert Handschriften derArs Amatoria,derMetamorphosenund derEpistulae Heroidum.Seit dem 11. Jahrhundert wuchs vor allem in den Klöstern des süddeutschen Raums dann die Anzahl der verzeichneten Ovidhandschriften stetig. Dies dürfte in direktem Zusammenhang mit der (Wieder-)Aufnahme Ovids in den Kanon der Schulautoren gegen Ende des 11. Jahrhunderts stehen, die zudem eine Fülle von Kommentaren, Accessus ad Auctores und Florilegien zu seinen Werken nach sich zog. Da aus der Antike kein einziger Kommentar zu den Schriften Ovids überliefert war, bestand dringender Bedarf an Verständnis- und Interpretationshilfen. Anhand der Accessus, die den Schüler zur Lektüre anleiten sollten, wird deutlich, daß auch hier die Beschäftigung mit den Werken anscheinend sehr vordergründiger Natur war: Sie wurden in erster Linie zur grammatischen Unterweisung benutzt. Der eigentliche Inhalt war eher sekundär und wurde (wenn überhaupt) meist in bearbeiteter Form hauptsächlich zur moralischen Unterweisung herangezogen. Dem gleichen Zweck dienten die Florilegien, die ausgewählte Exzerpte aus den Werken verschiedener Autoren sentenzenhaft zusammengestellt präsentieren und somit den Gehalt des ursprünglichen Werkes (im günstigsten Falle) verschleiern. Ganz allgemein sei bemerkt, daß die Bewertung antiker Werke im Mittelalter sehr unterschiedlich ausfiel; sie reichte von vollständiger Ablehnung und Verdammung (z. B. Honorius Augustodunensis) über skeptische Akzeptanz (man war für die Vermittlung von Bildung schließlich auf die heidnischen Autoren angewiesen) bis hin zur Antikenbegeisterung. Rüdiger Schnell gibt in seinem Aufsatz zur mittelal-
Page 3
terlichen Rezeption der Antike ein Zitat wieder, das die Funktion des heidnischen, antiken Bildungsgutes und seine Bewertung aufgrund der christlichen Lehre verdeutlicht: „Wenn wir in den Schriften der Heiden etwas Nützliches finden, verwenden wir es im Hinblick auf unsere christliche Lehre. Wenn aber etwas Unnützes über die Götzen, über Liebesaffären, über das Interesse an weltlichen Geschäften darin steht, dann radieren wir das aus.“2
Im 12. Jahrhundert begannen Gelehrte in Frankreich mit der allegorischen Ausdeutung derMetamorphosen,erschienen fiktive Vitae Ovids und fand sein Stil Eingang in die mittellateinische Dichtung. Kurzum: Ovid wurde in gebildeten Kreisen zum Allgemeingut.





























