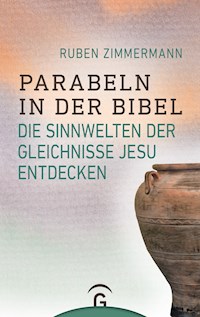
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Ein neuer, integrativer Ansatz der Gleichnisauslegung.« (Ruben Zimmermann)
Ob der verlorene Sohn, der Sämann oder der barmherzige Samariter - diese Figuren und Geschichten aus der Bibel kennen selbst Menschen, denen das Christentum fern ist. Erzählt wird von ihnen in den Gleichnissen Jesu. Diese gehören nach wie vor zum kulturellen Grundwissen der Gegenwart. Aber: Wie sind sie eigentlich zu verstehen und zu deuten? Ruben Zimmermann zeigt hier, wie es geht. In zahlreichen Beispielauslegungen erläutert er, wie der lebensdienliche Reichtum biblischer Gleichnisse neu entdeckt werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 878
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ruben Zimmermann
Parabeln in der Bibel
Die Sinnwelten der Gleichnisse Jesu entdecken
Ein neuer, integrativer Ansatz der Gleichnisauslegung Parabeln zählen zu den wirkmächtigsten Texten der Bibel.
Der »Verlorene Sohn« oder der »Barmherzige Samariter« sind geradezu sprichwörtlich gewordene Figuren aus den Parabeln Jesu, die sich tief in das kulturelle Gedächtnis der christlich geprägten Welt eingegraben haben.
Und doch versteht sich das allseits Bekannte nicht von selbst. Im Gegenteil: Die Gleichnistexte der Bibel sind oft viel sperriger und vielschichtiger, als es den Anschein hat. Man wird mit ihnen nicht schnell fertig, sie lassen sich nicht auf einen Nenner bringen.
Positiv gewendet bedeutet das aber auch: Man kann immer wieder Neues in ihnen entdecken.
Warum das so ist und wie der lebensdienliche und theologische Reichtum der biblischen Parabeln methodisch erschlossen werden kann, das zeigt dieses Buch.
Ruben Zimmermann
Dr. theol., geboren 1968, Dipl. Diakoniewissenschaftler und ordinierter Pfarrer, seit 2009 Professor für Neues Testament an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber
Copyright © 2023 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umsetzung eBook: SatzWeise, Bad Wünnenberg Umschlagmotiv: © Olaf Wandruschka – Adobe Stock.comISBN 978-3-641-21929-1V001www.gtvh.de
Inhalt
Vorwort
Teil I:Hermeneutik der Parabelauslegung
1. Kapitel: Die Sinnwelten der Parabeln entdeckenEine hermeneutische Hinführung
1.1. Die Parabeln Jesu – eine hermeneutische Herausforderung
1.2. Drei Perspektiven des BibelverstehensEine hermeneutische Grundorientierung
1.3. Auf der Suche nach einer integrativen Parabelhermeneutik
2. Kapitel: Verstehen von Parabeln im Licht der Forschung
2.1. Historische Zugänge
2.1.1. Die Parabeln des ›historischen Jesus‹
2.1.2. Sozial- und kulturgeschichtliche Arbeiten zu den Parabeln
2.2. Literarische Zugänge
2.2.1. Narrativität und Metaphorizität der Parabeln sowie Wiederentdeckung der Allegorie
2.2.2. Parabeln in einzelnen Makrotexten – Redaktionskritische Studien
2.2.3. Die Gattung der Parabel im literaturgeschichtlichen Horizont
2.3. Rezeptionsästhetische und theologisch-hermeneutische Zugänge
2.3.1. Hermeneutisch-rezeptionsästhetische Parabelinterpretation
2.3.2. (Praktisch-)Theologische Parabelinterpretationen
2.3.3. Polyvalente Deutungen und spezifische Rezeptionskontexte
3. Kapitel: Historische Sinnwelten Parabeln als Medien der Jesuserinnerung
3.1. Parabeln in der Suche nach dem historischen Jesus
3.2. Die Parabeln Jesu im Licht der literarischen Gedächtnisforschung
3.2.1. Der Jesus-Memory-Approach
3.2.2. Gattungen als Medien der Erinnerung
a) Die traditionsstiftende Funktion der Gattungen: Wiedergebrauchsformen
b) Die gemeinschaftsstiftende Funktion der Gattungen: Kommunikationsformen
c) Die sinnstiftende Funktion der Gattungen: Lebensformen
3.3. Die Funktionen der Parabeln als Medien der Jesuserinnerung
3.3.1. Die traditionsstiftende Funktion der Parabeln
3.3.2. Die gemeinschaftsstiftende Funktion der Parabeln
3.3.3. Die sinnstiftende Funktion der Parabel
4. Kapitel: Literarische Sinnwelten Die Gattung Parabel im literaturgeschichtlichen und gattungstheoretischen Kontext
4.1. Die klassische Gattungsdifferenzierung und deren Kritik
4.1.1. Die formgeschichtliche Differenzierung nach Adolf Jülicher und Rudolf Bultmann
4.1.2. Die Untergattung ›Bildwort‹ und ihre Kritik
4.1.3. Die Untergattung ›Beispielerzählung‹ und ihre Kritik
4.1.4. Die Unterscheidung von ›Gleichnis i. e. S.‹ und ›Parabel‹ als Untergattungen und ihre Kritik
4.2. Mashal, Fabel, Parabel – eine Spurensuche im Diskurs verwandter Gattungen
4.2.1. Parabel und jüdischer Mashal
4.2.2. Parabel und griechisch-römische Fabel
4.2.3. Parabel im Horizont antiker Rhetorik
4.2.4 Fazit zum literaturgeschichtlichen Vergleich
4.3. Die Gattung Parabel – ein Definitionsvorschlag
4.3.1. Gattungstheoretische Grundlagen
4.3.2. Ein Definitionsvorschlag zur Gattung ›Parabel‹
Ad 1) Die Narrativität der Parabel
Ad 2) Die Fiktionalität der Parabel
Ad 3) Der Realitätsbezug der Parabel
Ad 4) Die Metaphorizität der Parabel
Ad 5) Die deutungsaktive Appellstruktur der Parabel
Ad 6) Der Kontextbezug der Parabel
5. Kapitel: Rezeptionsästhetische Sinnwelten Polyvalente Deutungshorizonte, konkrete Theologie und narrative Ethik der Parabeln
5.1. Die rezeptionsästhetische Sprache der Parabeln: kognitive, emotive und kommunikative Funktion
5.1.1. Hermeneutische und literaturwissenschaftliche Rezeptionsästhetik
5.1.2. Die Rezeptionsästhetik der Parabeln
5.2. Appellstruktur: Konkrete Theologie und narrative Ethik
5.2.1. Die konkrete Theologie entsteht im Lesen
5.2.2. Vom Verstehen zum Handeln: Die narrative Ethik der Parabeln
5.3. Öffnung von Horizonten: Polyvalenz der Deutungen
5.3.1. Mehrdeutige Interpretationen jenseits der einen Wahrheit
5.3.2. Auslegungsvielfalt jenseits wilder Allegorisierung und Relativierung
5.3.3. Lesende Gemeinschaft jenseits der solitären Einzelinterpretation
Teil II:Die Parabeln Jesu nach Quellenbereichen
6. Kapitel: Grundorientierungen und Methodik zur Auslegung der Parabeln
6.1. Erste Orientierung in der komplexen Vielfalt der Parabeln Jesu
6.1.1. Die Anzahl der Parabeln
6.1.2. Systematisierungsvorschläge
6.1.3. Die Parabeln in ihren entsprechenden Quellen
6.2. Auslegungswege der Parabeln – ein integrativer Methodenvorschlag
6.2.1. Text: Sprachlich-narratologische Analyse
6.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse (Bildspendender Bereich)
6.2.3. Tradition: Analyse der Motive, Symbole und Bildfeldtradition
6.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
7. Kapitel: Parabeln in der Logienquelle Q und die Parabel vom verlorenen Schaf (Q 15,1–7)
7.1. Parabeln in der Logienquelle Q
7.1.1. Die Problematik der Wortlaut-Rekonstruktion (CEQ) und Q als ›Intertext‹
7.1.2. Die Anzahl und Anordnung der Q-Parabeln
7.1.3. Rhetorische Funktion und Theologie der Q-Parabeln
7.2. Die Parabel vom verlorenen Schaf (Q 15,1–7)
7.2.1. Text: Sprachlich-narratologische Analyse
7.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse
7.2.3. Tradition: Analyse der Motive, Symbole und Bildfeldtradition
7.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
Theologisch-Christologische Deutung
Soziopsychologische Deutung
Ethische Deutung
7.3. Tabelle: Die Parabeln in der Logienquelle Q
8. Kapitel: Parabeln im Markusevangelium und die Parabel vom Senfkorn (Mk 4,30–32)
8.1. Parabeln im Markusevangelium
8.1.1. Parabelbegriff und Parabelrede (Mk 4)
8.2.2. Parabeln in der Komposition des Markusevangeliums und »Parabeltheorie«
8.2. Die Parabel vom Senfkorn (Mk 4,30–32)
8.2.1. Text: Sprachlich-narratologische Analyse
8.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse
8.2.3. Tradition: Analyse der Motive, Symbole und Bildfeldtradition
8.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
Psychologisch-theologische Deutung
Eschatologisch-ekklesiologische Deutung
Soziologisch-politische Deutung
8.3. Tabelle: Die Parabeln im Markusevangelium
9. Kapitel: Parabeln im Matthäusevangelium und die Parabel von den klugen und dummen Jungfrauen (Mt 25,1–13)
9.1. Parabeln im Matthäusevangelium
9.1.1. Die rhetorische Eschatologie der Parabeln
9.1.2. Die implizite Ethik der Parabeln (Ethico-Ästhetik)
9.1.3. Die erinnerten Reich-Gottes-Parabeln
9.2. Die Parabel von den klugen und dummen Jungfrauen (Mt 25,1–13)
9.2.1. Text: Sprachlich-narratologische Analyse
9.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse
9.2.3. Tradition: Analyse der Motive, Symbole und Bildfeldtradition
9.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
Christologisch-eschatologische Deutung
Ethische Deutung
Feministische Deutung
9.3. Tabelle: Die Parabeln im Matthäusevangelium
10. Kapitel: Parabeln im Lukasevangelium und die Parabel vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30–35)
10.1. Parabeln im Lukasevangelium
10.1.1. Sprachliche Form und Komposition der Parabeln im Lukasevangelium
10.1.2. Theologie und Ethik der Parabeln im Lukasevangelium
10.2. Die Parabel vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30–35)
10.2.1. Text: Sprachlich-Narratologische Analyse
10.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse
10.2.3. Tradition: Analyse von Motiven, Symbolen und Bildfeldtraditionen
10.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
Theologische Deutung (Christologisch, eschatologisch)
Ethische Deutung
Ethnologisch-anthropologische Deutung
Diakonische Deutung
10.3. Tabelle: Die Parabeln im Lukasevangelium
11. Kapitel: Parabeln im Johannesevangelium und die Parabel von der gebärenden Frau (Joh 16,21)
11.1. Parabeln im Johannesevangelium
11.1.1. Das JohEv in der Gleichnisforschung
11.1.2. Johanneische Parabeln in der Forschung
11.1.3. Komposition und Theologie der Parabeln im JohEv
11.2. Die Parabel von der gebärenden Frau (Joh 16,21)
11.2.1. Text: Sprachlich-Narratologische Analyse
11.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse
11.2.3. Tradition: Analyse von Motiven, Symbolen und Bildfeldtraditionen
11.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
Christologische Deutung
Eschatologische Deutung
Feministische und anthropologische Deutung
11.3. Die Parabeln im Johannesevangelium
12. Kapitel: Parabeln im Thomasevangelium und die Parabeln von der Frau mit dem Mehlkrug (EvThom 97)
12.1. Parabeln im Thomasevangelium
12.1.1. Die Überlieferung der Parabeln im Thomasevangelium
12.1.2. Bestand, Komposition und theologische Leitlinien
12.2. Die Parabel von der Frau mit dem Mehlkrug (EvThom 97)
12.2.1. Text: Sprachliche und Narratologische Analyse
12.2.2. Realität: Kulturgeschichtliche Analyse
12.2.3. Tradition: Analyse der Motive, Symbole und Bildfeldtraditionen
12.2.4. Bedeutung: Entdeckung von Deutungshorizonten und Sinnwelten
Ethisch-gnostische Deutung
Feministisch-mystische Deutung
Eschatologisch-symbolische Deutung
12.3. Tabelle: Die Parabeln im Thomasevangelium
Epilog
Literaturverzeichnis
Stellenregister
Sachregister
Abbildungen und Tabellen
Abb. 1: Hermeneutisches Dreieck des Bibelverstehens
Abb. 2: Quintilians Systematik der Paradeigmata (Inst. V 11)
Abb. 3: Parabeln in der Komposition der Logienquelle
Abb. 4: Quellentext (griech.-deutsch) zur Parabel von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1–13)
Abb. 5: Thomasevangelium, NHC II, 49,7–15
Abb. 6: Keramion mit einem Henkel
Abb. 7: Zweihenkeliger Krug Karele
Tab. 1: Meshalim (Parabel, Fabel) im Alten Testament (Hebräische Bibel und LXX)
Tab. 2: Quellentext (griech.-deutsch) zur Parabel vom verlorenen Schaf (Q 15,1–7 durch Synopse Mt/Lk)
Tab. 3: Quellentext (griech.-deutsch) zur Parabel vom Senfkorn (Mk 4,30–32)
Tab. 4: Quellentext (griech.-deutsch) zur Parabel von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1-13)
Tab. 5: Gesamtablauf des jüdischen Eheritus
Tab. 6: Gesamtablauf des griechischen Eheritus
Tab. 7: Quellentext (griech.-deutsch) zur Parabel vom Barmherzigen Samariter (Lk 10,30–35)
Tab. 8: Parallele Doppelstruktur des Lehrgesprächs, Lk 10,25–37
Tab. 9: Quellentext (griech.-deutsch) zur Parabel von der gebärenden Frau (Joh 16,21)
Tab. 10: Quellentext (griech.-deutsch) zum Motiv von den Wehen der Gebärenden in Jer 6,24 und Jer 27,43
Tab. 11: Quellentext (griech.) zum Wechsel von Schmerz zu Freude in Joh 16,20–22
Tab. 12: Quellentext (koptisch-deutsch) zur Parabel von der Frau mit dem Mehlkrug (EvThom 97)
Vorwort
Parabeln zählen zu den wirkmächtigsten Texten der Bibel. Wer kennt etwa nicht den ›Barmherzigen Samariter‹ oder den ›Verlorenen Sohn‹ ? Hier handelt es sich um Texte, die sich tief in das kulturelle Gedächtnis der christlich geprägten Welt eingeschrieben haben und sogar als sprichwörtlich gewordene Chiffren weit darüber hinaus im Umlauf sind.
Was ist der Reiz dieser Miniaturerzählungen, wie funktionieren sie und warum sind sie 2000 Jahre nach ihrer Entstehung immer noch Gegenstand von wissenschaftlicher Beschäftigung, Predigt und Unterricht? Warum wird man mit ihrer Auslegung nicht fertig, warum provozieren sie unterschiedliche, zum Teil sogar konträre Deutungen und stimulieren in neuen Kontexten und mit neuen Methoden immer wieder auch ungeahnte neue Interpretationen?
Das vorliegende Buch hat zwei Ziele, die sich in den zwei Teilen des Buches abbilden: Teil I gibt Einblicke in die gegenwärtige (auch internationale) Gleichnis- bzw. Parabelforschung und zeigt Wege der Entdeckung verschiedener Sinnwelten der Parabeln auf. Technisch gesprochen, kann man also von einer Einführung in die Hermeneutik und Methodik der Parabelauslegung sprechen. Hierbei werden im z. T. kritischen Dialog mit der früheren Forschung Neuland erschlossen (so wird das Johannesevangelium einbezogen, eine literaturwissenschaftliche Gattungsdefinition angeboten oder die Suche nach dem ›echten‹ Jesusgleichnis zugunsten des Jesus-Memory-Approach aufgegeben), aber es werden auch viele Dimensionen früherer Forschung zu einem integrativen Auslegungsmodell zusammengeführt, das den Raum für eine polyvalente Deutung der Texte eröffnen möchte.
In Teil II werden dann – geordnet nach Quellenbereichen – Parabelinterpretationen vorgeführt, wobei jeweils nach einer knappen Einführung in die Parabeln einer Schrift (z. B. Parabeln im Matthäusevangelium) die ausführliche Auslegung eines Parabeltextes erfolgt, mit der die in Teil I erläuterte Methodik erprobt und vorgeführt wird. Jedes Kapitel schließt mit einer Tabelle aller in einer Schrift identifizierten Parabeln ab. Teil II bietet, so gesehen, schon einen Überblick über die frühchristlichen Parabeln, geht aber zugleich elementarisierend vor und beansprucht nicht, alle Parabeln des frühen Christentums zu erschließen. Wer diese Art umfassender Einzelauslegung möglichst aller Jesusparabeln sucht, sei nach wie vor auf das »Kompendium der Gleichnisse Jesu« (Gütersloh 22015) verwiesen.
Der Buchtitel »Parabeln in der Bibel« bedarf schon an dieser Stelle in mehrfacher Hinsicht einer Erklärung. Denn die Bibel als die Heilige Schrift der Christenheit vereint hebräische und griechische Schriften der jüdischen Tradition (Altes Testament) wie auch frühchristliche Texte (Neues Testament). Im Folgenden wird es fast ausschließlich um das Neue Testament gehen und das mit gutem Recht. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen (siehe dazu Kapitel 4.2.), finden sich Parabeln nur im zweiten Teil der Bibel. Die vergleichende Miniaturerzählung der biblischen Tradition ist ganz eng mit der Person Jesu verbunden. Jesus wurde bisweilen sogar als ›Erfinder‹ der Gattung Parabel angesehen. Diese Einschätzung wird im vorliegenden Buch zwar kritisch reflektiert, aber es bleibt doch unbestritten, dass innerhalb der biblischen Bücher vor allem Jesus als der Sprecher der Parabeln benannt wird. Die »Parabeln in der Bibel« sind deshalb fast deckungsgleich mit den »Parabeln Jesu im Neuen Testament«. Da innerhalb der frühchristlichen Überlieferung eine Fülle von Jesusparabeln im Thomasevangelium überliefert ist, erlaube ich mir, hier den traditionellen Bibelbegriff zu sprengen und über die ohnehin am Rand offenen Kanongrenzen hinaus noch die Parabeln des Thomasevangeliums mit einem eigenen Kapitel vorzustellen.
Wer innerhalb des theologisch-kirchlichen Lagers mit der Materie vertraut ist, wird sich ferner wundern, warum in dem Buch meist von »Parabeln« und nicht von den »Gleichnissen« die Rede ist. Die Gattungsbezeichnung »Gleichnis« stellt m. E. eine disziplinär und deutschsprachig verengte Begrifflichkeit dar, die hier aufgegeben werden soll. Diese Entscheidung wird in Kapitel 4 des Buches ausführlich begründet. Der Untertitel deutet zugleich an, dass solche Paradigmenwechsel in lange gepflegten Kulturtraditionen nicht 100 % durchzuhalten sind. So findet sich z. B. im Blick auf frühere Forschungen oder in synonymen Sammelbezeichnungen immer wieder auch der Begriff »Gleichnis«.
Diese und andere Weichenstellungen in diesem Buch sind aus meiner inzwischen 15-jährigen Forschung an den Parabeln erwachsen. Dass die von mir selbst mit Nachdruck vorgetragene Notwendigkeit der Polyvalenz und Unabgeschlossenheit der Deutung mich selbst einholen würde, zeigt sich daran, dass es in dieser Zeit immer wieder neue Perspektiven auf die Texte gegeben hat, die die Parabelinterpretation zu einem dynamischen Prozess haben werden lassen, der auch mit diesem Buch gewiss nicht zu Ende kommen wird. Gleichwohl gibt es auch viele Konstanten innerhalb dieser jahrelangen Beschäftigung mit Texten, die hier aufgenommen und monographisch präsentiert werden. Dies betrifft die literarisch-hermeneutische Funktionsweise der Parabeln einschließlich ihrer Gattungsmerkmale, die mehrperspektivische Annäherung (historisch, literarisch, rezeptionsästhetisch) oder die notwendige Öffnung für unterschiedliche Interpretationshorizonte. Diese Einsichten sind in verschiedenen früheren Publikationen zum Teil ausführlich diskutiert und begründet worden. Dabei sind drei Werke besonders zu nennen: Das »Kompendium der Gleichnisse Jesu« (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2007, 2. Aufl. 2015), der Sammelband »Hermeneutik der Gleichnisse Jesu. Methodische Neuansätze zum Verstehen urchristlicher Parabeltexte« (WUNT 231; Tübingen: Mohr Siebeck, 2008; Paperback 2011) sowie die englischsprachige Monographie »Puzzling the Parables of Jesus. Methods and Interpretation« (Minneapolis: Fortress, 2015). Das vorliegende Buch schöpft aus Einsichten und Formulierungen dieser Arbeiten. Es greift die hermeneutisch-methodischen Weichenstellungen für das Kompendium der Gleichnisse und seinen quellenbasierten Zugriff auf die Texte auf. Es basiert auf den in fünf eigenen Artikeln in der »Hermeneutik der Gleichnisse Jesu« vertieften Reflexionen zu historischen, literarischen und rezeptionsästhetischen Dimensionen der Texte. Es ist in seiner zweitteiligen Struktur und Auswahl der Beispieltexte in gewisser Weise die deutsche Fassung von »Puzzling the Parables«. Gleichwohl geht es auch in vielem darüber hinaus. In allen Kapiteln ist die neuere Forschung eingearbeitet, besonders der Überblick in Kapitel 2 versucht, die Parabelbücher bis 2022 international zu berücksichtigen. Die erst begonnene vergleichende Beschäftigung mit antiken Fabeln (u. a. im DFG-Forschungsprojekt 495720705, vg. https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/495720705) hat ihre Spuren hinterlassen. Die Hinführungen zu den Quellenbereichen sind ausgeweitet und um Überblickstabellen ergänzt. Im Johannes-Kapitel wird statt Joh 12,24 (Sterbendes Weizenkorn) nun die Parabel von der gebärenden Frau (Joh 16,21) beispielhaft interpretiert. Alle Kapitel sind hinsichtlich neuerer Literatur überarbeitet.
Die Parabelinterpretation war für mich immer ein dialogisches Geschehen. Parabeln sind »discussion starter« (Herzog), ihre Auslegung braucht das Gespräch mit anderen und die Erprobung in unterschiedlichen Lebenskontexten. Es war deshalb durchaus konsequent, das »Kompendium der Gleichnisse Jesu« als Sammelwerk mit ca. 50 Autor:innen und fünf Mitherausgebenden anzulegen. Jeder Text in diesem Buch war im gemeinsamen Revisionsprozess gereift und wurde somit selbst Ausdruck einer ›dialogischen Exegese‹. Auch wenn ich mit dem vorliegenden Buch nun als einzelner Autor auftrete, so hat sich an diesem Grundprinzip nichts geändert. Das Ringen um die Sinnwelten der Parabeln muss ein dialogisches Geschehen bleiben.
Entsprechend ist auch das vorliegende Buch aus vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt und über die Grenzen zwischen der deutschsprachigen und englischsprachigen Parabelexegese, oder der Disziplinen der Theologie, Altphilologie, Judaistik und Literaturwissenschaft hinweg erwachsen. Konkret möchte ich einige Gesprächspartner:innen auf diesem Weg benennen: Da ist zunächst das Mainzer Team mit Susanne Luther (jetzt Göttingen), Dieter T. Roth (jetzt Boston College), Tanja Smailus (geb. Dannenmann), Charlotte Haußmann, Julia-Maria Schenck zu Schweinsberg- Berlandi und Justin David Strong zu nennen. Mit Letzterem wird der Dialog im Rahmen des genannten DFG-Projektes zur »Antiken Fabeltradition und frühchristlichen Literatur« nun in eine neue Phase eintreten. Es gab aber auch viele weitere Gesprächspartner:innen aus unterschiedlichen Kontexten, wie (chronologisch) Kurt Erlemann (Wupptertal), Annette Merz (Groningen, NL), Christian Münch (Ludwigsburg), Detlev Dormeyer (Dortmund), Judith Hartenstein (Landau), Uta Poplutz (Wuppertal), Enno Edzard Popkes (Kiel), Karl- Heinrich Ostmeyer (Dortmund), Jan van der Watt und Ernest van Eck (Pretoria, ZA), Klyne Snodgrass (Chicago, US), Lauri Thurén (Joensuu, FI), Eric Ottenheijm, Jonathan Pater, Albertina Oegema, Martijn Stoutjesdijk und Lieve Teugels (Utrecht, NL), Konrad Schwarz und Jens Schröter (Berlin), Jochen Althoff (Mainz), Reuven Kiperwasser (Jerusalem, IL), Tom Goud (Saint John, New Brunswick, CA), Judith Gärtner (Graz, AT), Ellen Aasland Reinertsen und Marianne Bjelland Kartzow (Oslo, NO) und manche mehr. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für die offenen Ohren und die unterschiedlichen, auf je eigene Weise stimulierenden Anregungen!
Mein besonderer Dank geht ferner an die Mitarbeitenden bei der redaktionellen Überarbeitung der Texte und Hilfe bei der Registererstellung: Michel Gaffga, Sarah Tietgens, Michaela Mutschmann und besonderes auch Charlotte Haußmann und Zacharias Shoukry für ihren unermüdlichen Einsatz in der Endphase dieses Buches.
Nicht zuletzt danke ich sehr herzlich Diedrich Steen vom Gütersloher Verlag (Penguin Randomhouse Verlagsgruppe), der meine gesamte wissenschaftliche Beschäftigung mit den Parabeln seit dem Jahr 2005 bis heute begleitet hat. Er hat mich nicht nur zu diesem Buch ermutigt, sondern sein Erscheinen durch seine große Geduld und Beharrlichkeit überhaupt erst ermöglicht. Dafür bin ich ihm zu tiefem Dank verpflichtet.
Mainz, im Juli 2022Ruben Zimmermann
Teil I:Hermeneutik der Parabelauslegung
1. Kapitel:Sinnwelten der Parabeln entdeckenEine hermeneutische Hinführung
Die Parabeln Jesu sind rätselhaft. So ist es nicht ungewöhnlich, beim Lesen dieser Miniaturerzählungen auf Verstehensprobleme zu stoßen, ja, zugespitzt formuliert scheint Unverständnis geradezu der Normalfall, wenn es um die Parabeln Jesu geht. Nun könnte man vermuten, dass diese Verstehensprobleme insbesondere durch die zeitliche Differenz zur Entstehung der Texte zu erklären sind. Wenn wir nur umfassendere Einblicke in die Sprachformen der Antike oder die Lebenskontexte hätten, in denen sie entstanden sind, dann ließe sich dieses Unverständnis auflösen. Die wissenschaftliche Annäherung an die Parabeln hat teilweise derartige Einschätzungen vertreten.
So unbestritten es die Aufgabe der historischen und literarischen Bibelwissenschaft ist, durch vertiefte Kenntnisse in Sprachform und Lebenswelten Miss- und Unverständnis zu reduzieren, so wenig gelingt es doch, die Vieldeutigkeit von Parabeln aufzulösen oder zu konsensfähigen Interpretationen vorzudringen. Im Gegenteil. Trotz hochdifferenzierter Auslegungsmethodik finden sich auch in der modernen Exegese zum Teil konträre Positionen, so dass in derselben Parabel von den einen zentrale Aussagen zum Gottesbild erkannt werden, während andere sie als karikierendes ›Anti-Gleichnis‹ deuten. Einzelne Figuren in der Erzählung werden von der einen Auslegerin als Vorbilder wahrgenommen, von dem anderen hingegen als abschreckender ›Anti-Held‹. Wie kann so etwas sein?
Ich bin der Überzeugung, dass Rätselhaftigkeit und Unabgeschlossenheit wesentliche Bestandteile der Texte sind. Nicht nur Verstehensprobleme durch den Graben der Geschichte und die begrenzte Kenntnis der altgriechischen (Bilder-)Sprache sind Grund für das Unverständnis. Die Rätselhaftigkeit ist den Texten geradezu in ihre Textur eingewoben. Sie sollen nicht einfach und leicht interpretiert werden können.
Darauf deuten bereits die textimmanenten Äußerungen der ersten Quellen hin. Schon in den frühchristlichen Evangelienerzählungen lesen wir, dass die Hörer:innen von Jesu Worten die Parabeln nicht verstanden haben: »Und er (Jesus) sprach zu ihnen: Versteht ihr diese Parabel nicht, wie wollt ihr dann die andern alle verstehen?« (Mk 4,13; auch Joh 10,6). Auch die Jünger:innen müssen Jesus eigens bitten: »Deute uns die Parabel … !« (Mt 13,36; vgl. Mk 4,10), das heißt aber: Auch sie verstehen die Parabeln nicht oder zumindest nicht auf Anhieb. Die bildhafte Parabelrede ist unverständlich und mysteriös. Dies bringt auch der im Neuen Testament dominierende Gattungsbegriff παραβολή (parabole) zum Ausdruck, dessen traditionsgeschichtliche Ableitung aus dem hebr. מָשָׁל (mashal) diesen enigmatischen Charakter einfängt (z. B. Ez 17,2; Spr 1,6).1
Wenn es im Folgenden dennoch um die Entdeckung oder Erschließung von Sinnzusammenhängen geht, soll es nicht das Ziel sein, diese Unverständlichkeit in klare Interpretationen oder, sprachwissenschaftlich formuliert, in eindeutige Aussagesätze (Propositionen) zu überführen. Es geht vielmehr darum, sich durch die Rätselhaftigkeit der Parabeln anregen und zu einem Ringen um Verstehen herausfordern zu lassen. Parabeln laden zu einem Prozess des Verstehens ein, lassen sich aber zugleich nicht von den Interpretierenden vereinnahmen und einfangen.
1.1. Die Parabeln Jesu – eine hermeneutische Herausforderung
Das Verstehen2 der Gleichnisse ist offenbar nicht einfach, leicht und unstrittig.3 Das gilt für die komplexeren Parabeln ebenso wie für die kurzen Miniatur- Erzählungen, die in der Auslegungstradition als ›Bildwort‹ oder ›Gleichnis im engeren Sinn‹ bezeichnet wurden.4 Jülicher war der Meinung, dass sich bei Letzteren eine Deutung ohnehin erübrige, weil die Botschaft dieser Gleichnistexte sofort und unmittelbar einleuchte.5 Doch spätestens auf den zweiten Blick erweist es sich als problematisch, warum zum Beispiel der Sauerteig in einer so großen Menge Teig ›versteckt‹ wird, wie ein Senfkorn ›starke Zweige‹ für Vogelnester ausbilden kann oder wie das ›dumme Salz‹ seine Würze verlieren soll. Parabeln sind eben nicht klar und eindeutig. Sie folgen ebenso wenig den Gesetzen philosophischer oder mathematischer Logik, wie sie auch keine bloßen Binsenweisheiten formulieren. Nicht erst ein Blick in die Vielfalt späterer Auslegungs- und Rezeptionsgeschichte bestätigt diese Einschätzung.
Schon die markanten Unterschiede im Verstehen dieser Texte innerhalb der ersten Jahrzehnte der Rezeption, wie sie sich anhand der Parallelüberlieferungen von Mt, Lk oder EvThom ablesen lassen, dokumentieren eine beachtliche Deutungsvielfalt. Die Deutungsbedürftigkeit dieser Texte wird schon im ältesten Evangelium reflektiert (Mk 4,34) und zu zwei Parabeln werden auch explizit Deutungen als erklärende Jünger:innenbelehrung gegeben (zum Sämann: Mk 4,13–20par.; zum Unkraut im Weizen: Mt 13,36–43).
Was ist der Sinn, was die Intention dieser so rätselhaften Rede? Warum benutzte Jesus ausgerechnet diese Redeform und warum war sie bei der Formung frühchristlicher Überlieferung und Erinnerung so erfolgreich? Was garantiert ihren bleibenden Wert trotz dieser Deutungsambivalenz? Ist es lediglich die enge Verbindung zu Jesus als erinnertem Urheber dieser Texte, oder transportieren sie die Botschaft des Neuen Testaments in einer konzentrierten Form, die durch keine andere Sprachform zum Ausdruck gebracht werden kann? Wird religiöse Wahrheit durch diese literarische Form in besonderer Weise geformt?
Oder sind sie vielleicht gerade so formuliert, um nicht verstanden zu werden? Versuchen sie, explizit einen Schleier um Jesus zu hüllen und voreiliges Verstehen zu verwehren? Sind sie möglicherweise Teil einer Binnensprache von Eingeweihten, vergleichbar mit den Geheimtexten von Mysterienreligionen? So zumindest legt es Mk 4,11 nahe, wo davon die Rede ist, dass nur den Jünger:innen das Geheimnis (τὸ μυστήριον) anvertraut wird, nicht »denen draußen« (τοῖς ἔξω). Handelt es sich um eine bewusst verhüllende ›esoterische‹ Rede für einen inneren Zirkel von Jesusnachfolger:innen? Sollen die Außenstehenden, an die die Parabeln auch adressiert sind, bewusst im Unklaren bleiben oder gar hinters Licht geführt werden? Wollte das Markusevangelium sagen, »that imcomprehension was already there in response to Jesus’ message and Jesus therefore used riddle parables to increase and punish that incomprehension«6? Oder muss die in Mk 4,12 angesprochene, so genannte ›Verstockungstheorie‹ auf erzählpragmatischer Ebene bereits als theologische Verarbeitung der Deutungsambivalenz der Parabeln verstanden werden?7 Bedurfte es nicht nur eines eigenen Appells zu hören (Mk 4,9), sondern schon bald einer eigenen Erklärung dafür, warum ein Teil der Hörer:innen Jesu offenbar ›taub‹ war für die Botschaft und Bedeutung der Parabelrede?
Man mag die Rätselhaftigkeit der Gleichnisse relativieren, beklagen, wegdiskutieren oder verfluchen wollen. Es ist und bleibt gerade auch dieses Charakteristikum, das den Parabeln Jesu ihr ganz unverwechselbares Gepräge und ihre ansprechende Wirkung verleiht. Unverständlichkeit ist konstitutiver Teil der Parabelrede.
Doch diese Rätselhaftigkeit wird nicht zum Spiel oder gar zum Ärgernis der Leser:innen entwickelt. Parabeln stehen in Kommunikationszusammenhängen, die nach Sinn und zum Teil sogar nach eindeutigen Handlungsorientierungen verlangen: Sie sollen zum Beispiel ein Streitgespräch über die Tora weiterbringen, sie sollen Probleme des familiären Rollenspiels entlarven oder gesellschaftliche Missstände anprangern. Sie sollen zum Innehalten bewegen, zur Erkenntnis führen oder gar zum Handeln ermutigen. Parabeln wollen Verstehensprozesse auslösen, sie wollen bedeutsam werden in konkreten Situationen, wollen zur Entdeckung von Lebenssinn führen.8 Doch wie kann dies mit der genannten Unverständlichkeit und Rätselhaftigkeit zusammengebracht werden?
Die paradox anmutende innere Logik dieser widersprüchlichen Pragmatik besteht gerade darin, dass Parabeln durch ihre Rätselhaftigkeit Verstehensprozesse erwirken sollen. Durch das primäre Unverständnis wird ein Prozess des Fragens, Staunens und Suchens ausgelöst, der letztlich zu einem vertieften Verstehen führen kann. Parabeln sind unverständlich, um zum Verstehen zu führen.9 Genau diese hermeneutische Strategie ist beabsichtigt.10 Dabei darf der Prozess des Verstehens nicht auf eine individuelle Sinnfindung begrenzt werden. Obwohl Verstehen das Hauptziel des hermeneutischen Prozesses ist, ist es nicht möglich, eine Lösung wie beim Lösen von Mathematikaufgaben zu finden. Parabeln sind keine Gleichungen. Es kann mehrere Bedeutungen geben, die sich im Extremfall sogar widersprechen. Die Bedeutung einer Parabel wird sich je nach Zeit und Kontext immer wieder ändern. Diese Realität zeigt sich zweifellos anhand der Interpretationsgeschichte der Gleichnisse. Unterschiedliche Interpretationen derselben Parabel sind ebenso zu unterschiedlichen Zeiten der eigenen Lebensgeschichte denkbar.11 Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine dieser Interpretationen falsch sein muss. Darüber hinaus muss die Bedeutung nicht auf einen individuellen Entdeckungsprozess beschränkt bleiben: Parabeln fordern nicht nur den einzelnen Leser oder die einzelne Hörerin heraus. Sie regen in ihrer Deutungsaktivität auch zu gemeinsamen Verstehensbemühungen an. Durch die vielfach divergierenden Interpretationen rufen sie kontroverse Debatten hervor.12 Gerade so werden sie zu einem Lockmittel der Kommunikation und zum Anreiz einer kollektiven Sinnsuche ihrer Rezipierenden.
Was für eine erste Adressierten- oder eine spätere Leser:innengemeinde gilt, bleibt ebenfalls für den wissenschaftlichen Diskurs gültig. Tolbert kam bereits in den 1970er-Jahren zu einer bemerkenswerten Erkenntnis: Es finden sich nicht nur vielfältige Interpretationen, sondern auch »scholars who share the same assumptions concerning how one must hear the parables often present radically different interpretations of the same parable stories«13. Diese Verstehensambivalenz der Parabeln Jesu fordert in besonderem Maße die hermeneutische Reflexion heraus, was das Vorwort zu diesem Buch erklärt und zugleich begründet. Gerade weil das Verstehen der Parabeln strittig ist, stellt sich die Frage nach der Begründung der Verstehensvoraussetzungen und -möglichkeiten. Mit anderen Worten: Das primäre Unverständnis erfordert die Diskussion einer »Hermeneutik der Parabeln«14. Dabei können die Parabeln zu einem Lernfeld des Bibelverstehens überhaupt werden.
1.2. Drei Perspektiven des BibelverstehensEine hermeneutische Grundorientierung
Die Frage nach dem Verstehen der Parabeln führt zu der Grundfrage, wie sich ›Verstehen biblischer Texte‹ oder noch allgemeiner das ›Verstehen von Texten‹ überhaupt vollzieht. Die Hermeneutik der Parabeln Jesu bleibt insofern eingebunden in Grundfragen einer biblischen Hermeneutik, die ihrerseits eng mit dem hermeneutischen Diskurs von Nachbardisziplinen wie z. B. der Philosophie, Geschichtswissenschaft oder Literaturwissenschaft verschränkt ist.15 Es versteht sich von selbst, dass ich diese breite Diskussion hier weder hinsichtlich der Genese biblischer Hermeneutik16 noch hinsichtlich der Systematik und Einzelfragen führen kann,17 stattdessen möchte ich im heuristischen Sinn einige Aspekte benennen, die für das Verstehen von Parabeln in der hier vertretenen Weise weiterführend sind.
Zunächst ist hierbei der Begriff des Verstehens zu klären, der neuerdings z. B. in radikal konstruktivistischen (Luhmann), dekonstruktivistischen (Derrida) oder postmodernen (Mersch) Ansätzen in Frage gestellt wurde.18 Ist Verstehen überhaupt möglich, und was bedeutet es, wenn wir glauben, einen Text ›verstanden‹ zu haben?19 Mit Körtner können wir zwar zunächst konstatieren, dass beim Verstehen immer die Sinnfrage gestellt wird. »Verstehen heißt, den Sinn von etwas zu erfassen. Sinn und Bedeutung sind grundlegende Kategorien jeder Hermeneutik.«20
Doch sogleich stellt sich die Frage, auf welcher Ebene sich dieser Sinn manifestiert. Was soll konkret verstanden werden, wo werden Sinn und Bedeutung sichtbar? Soll die Intention des Autors bzw. der Autorin einer Schrift rekonstruiert werden, oder geht es darum, die in der Textstruktur inhärente Bedeutung zu decodieren? Oder aber sollen Lesende in der produktiven Auseinandersetzung mit einem Text Sinn entdecken?
Diese Fragen offenbaren drei Dimensionen bzw. Sinnwelten, die durch die Jahrhunderte hindurch den (bibel-)hermeneutischen Diskurs bestimmt haben, auch wenn sie jeweils in unterschiedlicher Weise fokussiert wurden. Konkret geht es hierbei um die (historischen) Autor:innen, den Text und die Lesenden.
Ausgehend von Dannhauers Definition der allgemeinen Hermeneutik als Anwendung methodischer Regeln, die der allgemeinen Auslegung von Texten dienen,21 wurde Hermeneutik lange Zeit als die methodisch geleitete Kunst der Auslegung eines Schriftwerks betrachtet. Ziel des Verstehensvorgangs war es folglich, durch die richtige Anwendung bestimmter Auslegungsregeln den im Text inhärenten Sinn zu erfassen, der mit der ursprünglichen Intention des/der Autor:in identisch sein müsse. Verstehen wurde hierbei ganz als rekonstruktiver Vorgang aufgefasst, bei dem das z. B. durch zeitliche Differenz zum Autor und zu der Textentstehung bestehende Verstehensdefizit ausgeglichen werden müsse. Im Vordergrund der Sinnsuche standen hier eindeutig der Text und sein:e Autor:in. Es war dann vor allem Schleiermacher, der die Zweipoligkeit des Verstehensvorgangs hervorgehoben und neben dem Text und seinem Autor auch die Interpretierenden bei der Sinnkonstitution eigens gewichtet hat. Hermeneutik sei deshalb sowohl als ›grammatisch-historische‹ wie auch als ›psychologische‹ Auslegung zu beschreiben.22 Die Interpretierenden treten nach Schleiermacher in eine Interaktion mit dem Text und seinem/seiner Autor:in, wobei die Auslegungskunst als (nach-)schöpferischer Vorgang beschrieben wird. Im Gefolge von Schleiermacher und Dilthey hat dann die phänomenologische Hermeneutik des 20. Jh.s das Verstehen als ›objektbezogenen Entschlüsselungsvorgang‹ vollends in Frage gestellt und stattdessen den subjektiven Prozess der Wahrnehmung bzw. Rezeption in den Mittelpunkt gerückt. So formuliert Gadamer: »Eine philosophische Hermeneutik (wird) zu dem Ergebnis kommen, daß Verstehen nur so möglich ist, daß der Verstehende seine eigenen Voraussetzungen ins Spiel bringt. Der produktive Beitrag des Interpreten gehört auf eine unaufhebbare Weise zum Sinn des Verstehens selber. […] Man kann diesen Sachverhalt auch so beschreiben, daß Interpret und Text je ihren eigenen ›Horizont‹ besitzen und daß jegliches Verstehen eine Verschmelzung der Horizonte darstellt.«23
In (post-)strukturalistischen und rezeptionsästhetischen Hermeneutiken führte die Hinwendung zu den Lesenden dann sogar zu einer expliziten Ablösung der Texte von ihren Autor:innen und ihren Entstehungssituationen, was Barthes in das bekannte Diktum vom ›Tod des Autors‹ gegossen hat.24 Der Text wurde hierbei als autonomes Kunstwerk betrachtet, das seinen Sinn erst im produktiven »Akt des Lesens«25 bzw. Interpretierens entfaltet. »Was der Text bedeutet, fällt nicht mehr mit dem zusammen, was der Autor sagen wollte.«26 Hermeneutik wird hierbei aus der Verengung auf die Textinterpretation herausgeführt und zu einer allgemeinen Verstehenslehre bzw. Lebenswelthermeneutik ausgeweitet. Ziel des hermeneutischen Prozesses ist dann nicht mehr die Dekodierung von Textsinn, sondern die umfassende Deutung von Selbst und Welt, die durch die Auseinandersetzung mit dem Text initiiert wird.27
Das unbestreitbare Verdienst der strukturalistischen und rezeptionsästhetischen Ansätze war es, die Eigenständigkeit des Textes auf der einen bzw. der Rezipierenden auf der anderen Seite hervorgehoben zu haben. Gleichwohl stellen sich auch hier Rückfragen: So ist gegenüber überzogen strukturalistischen Ansätzen zu fragen, wie der Sinn eines Textes ausgesagt werden kann, wenn nicht Lesende ihn zuerst entdecken und beschreiben? Eine autonome Struktur von Texten ohne Leser:in bleibt ohne Bedeutung. Aber kann umgekehrt die Sinnkonstitution ganz dem freien Spiel der Lesenden überlassen werden? Reduziert sich die Bedeutung – oder gar die Wahrheit des Textes somit nicht auf eine willkürliche subjektive Konstruktion? Wie bleibt gelingende Kommunizierbarkeit über (Text-)Sinn dann noch gewährleistet? In welcher Weise bleiben Sinnkonstruktionen noch berechtigt auf den Text bezogen und unterliegen nicht dem je und je neuen Akt des Sprechens oder der Kognition? Gibt es nicht wenigstens eine minimale Kontinuität im Verstehen eines Textes?
So hilfreich die Differenzierung der unterschiedlichen Perspektiven erscheint, so falsch wäre eine Trennung und Isolierung einzelner Aspekte. Schon U. Eco hatte gegenüber dekonstruktivistischen Ansätzen die Balance zwischen der intentio lectoris, der intentio auctoris und sogar einer intentio operis angemahnt.28 Entsprechend dürfen Sinn und Bedeutung nicht einseitig auf einen der drei Aspekte begrenzt werden. So ist der vorliegende hermeneutische Ansatz von der Überzeugung geprägt, dass historische:r Autor:in, Text und Rezipierende eng zusammengehören und gerade in ihrer wechselseitigen Verwiesenheit Sinn konstituieren. Die je verschiedenen Perspektiven bringen je komplexe Dimensionen mit ein, weshalb ich hier von ›Sinnwelten‹29 sprechen möchte.
Eine mögliche Vernetzung der drei Komponenten des Textverstehens kann durch eine Erklärung des hermeneutischen Prozesses im Modell der Kommunikation aufgezeigt werden. Während von Gadamer der Verstehensvorgang in der Metapher des ›Gesprächs‹ als ein Dialog der beiden Komponenten Text und Interpret:in in ihren jeweiligen Verstehenshorizonten beschrieben wurde,30 ist es in der historisch geprägten Bibelwissenschaft etabliert, die historischen Autor:inen bzw. allgemeiner den historischen Entstehungshorizont des Textes eigens in den Blick zu nehmen. In Anknüpfung an die Gesprächs- Metapher Gadamers kann das Verstehen des biblischen Textes folglich als ein Trialog oder dreistelliger Kommunikationsvorgang31 beschrieben werden, der gleichermaßen Text, Entstehungssituation und Gegenwartsrezeption miteinbezieht. In unterschiedlichen Publikationen habe ich dieses ›hermeneutische Dreieck‹ zugrunde gelegt und näher expliziert.32
Während man in früheren Ansätzen der Bibelhermeneutik streng zwischen methodischer Exegese und hermeneutischer Applikation unterschied,33 haben neuere Ansätze die enge Verschränkung zwischen Hermeneutik und Methodik wahrgenommen.34 Die Hermeneutik darf zwar nicht auf ein Methodenproblem reduziert werden, andererseits kann sich die Methodik der Auslegung nicht aus dem hermeneutischen Zirkel davonstehlen. Entsprechend gelingt es etwa Oeming oder Wischmeyer, den jeweiligen hermeneutischen Perspektiven auch einzelne Methoden der Bibelauslegung zuzuordnen.35 So lässt sich das hermeneutische Dreieck um die jeweiligen Methoden der Erschließung einer bestimmten Seite erweitern (Abb. 1). Um den Text sachgemäß interpretieren zu können, bedarf es sprachwissenschaftlicher Methoden. Um die Autor: innen in ihren historischen Kontext zu verstehen, können Methoden der Geschichtswissenschaft herangezogen werden, während die Rezipientenseite durch leser:innenorientierte Methoden zu erhellen ist. Entsprechend spielen drei Dimensionen bei der Entdeckung und Erschließung textlicher Sinnwelten eine Rolle:
Abb. 1: Hermeneutisches Dreieck des Bibelverstehens
Verstehen darf also weder einseitig als autor:innenfixierter Mitteilungsvorgang, noch als textbezogene Wirkungsgeschichte oder als leser:innengeleiteter Konstruktionsprozess missverstanden werden. Im Prozess der Sinnstiftung beeinflussen sich Entstehungssituation, Textgestalt und Akt der Rezeption wechselseitig. Der Sinngehalt wird zwar durch eine sprachliche Gestalt entscheidend vorgeprägt. Allerdings wird man ein historisches Textzeugnis kaum erschließen können, wenn man nicht auch den geschichtlichen Entstehungsrahmen kennt. Schließlich bringen auch gegenwärtige Leser:innen Vorverständnisse und Fragen in den Lesevorgang mit ein, die die Sinnstiftung zu einem produktiven und nicht nur rekonstruktiven Geschehen werden lassen.36 Jede Dimension hat ihren Eigenwert, steht aber zugleich in einer Wechselbeziehung zu den anderen Dimensionen, die sich in einem zirkulären bzw. spiralförmigen Prozess beeinflussen. Verstehen ereignet sich insofern erst im reziproken Zusammenwirken aller drei Komponenten.
Betrachten wir die Bibelhermeneutik im Modell eines Kommunikationsvorgangs, gelingt es folglich, die unterschiedlichen Perspektiven und Annäherungen, wie sie sich innerhalb der Geschichte der Textauslegung zeigen, in ein Gesamtmodell zu integrieren.37 So können die historischen Hermeneutiken, wie sie von Semler bis zur ›historisch-kritischen‹ Methode oder gegenwärtig in kulturgeschichtlichen Fragestellungen ihre Ausprägung finden, als Hinwendung zur Entstehungssituation des Textes betrachtet werden. Die im Zuge des linguistic turn entwickelten sprach- bzw. literaturwissenschaftlichen Auslegungsmethoden stellen den Text selbst in den Mittelpunkt, während leser:innenorientierte Annäherungen an den Text, wie sie in feministischen oder aktuell öko-hermeneutischen Ansätzen besonders deutlich und reflektiert zutage getreten sind, die Rezipierendenseite in den Blick nehmen. Die einzelnen Aspekte müssen aber nicht gegeneinander ausgespielt und abgegrenzt werden. Sie haben ihre je eigene Berechtigung, gelingt es doch mittels spezifischer Methoden, einzelne Aspekte in dem durch den Bibeltext evozierten Sinngeschehen besonders in den Vordergrund zu rücken. Jede einzelne Perspektive hat jedoch zugleich ihre Begrenzung, indem die Fokussierung auf einen Aspekt andere ebenso maßgebliche Aspekte in den Hintergrund treten oder gar unberücksichtigt lässt. Nur im Zusammenspiel der unterschiedlichen Perspektiven und Methoden ist somit ein sachgemäßes Verstehen des Bibeltextes möglich.
1.3. Auf der Suche nach einer integrativen Parabelhermeneutik
Die im Vorhergehenden dargestellten Zugänge des Bibelverstehens, die idealtypisch als historisch, literarisch und rezeptionsästhetisch betrachtet werden können, lassen sich in besonderer Weise beim Verstehen von Parabeln im Laufe der Interpretationsgeschichte nachweisen. Dass sich eine Parabelhermeneutik in dieser dreifachen Weise entwickeln konnte, wurde durch die Texte selbst evoziert. Die Parabeln lassen sich unter historischer Perspektive ebenso verstehen wie unter einer textbezogenen literarischen. Sie sind aber in hohem Maße auch leser:innenorientierte Texte, so dass den Rezipierenden gebührender Platz eingeräumt werden muss.
Auch der im Folgenden vorgestellte integrativ-hermeneutische Ansatz lässt sich hier anfügen: So geht es mir in historischer Perspektive nicht um die Rekonstruktion der authentischen Jesusworte und eines postulierten Überlieferungsweges. Gleichwohl werden historische Fragen gestellt, wenn sozialgeschichtlich nach dem ›bildspendenden Bereich‹ gefragt wird, wenn die Übertragungsvorgänge diachron in ›Bildfeldtraditionen‹ eingeordnet werden oder wenn mit der Parallelüberlieferung der Texte eine frühe Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte wahrgenommen wird.
Die literarische Fragestellung spielt insofern eine wichtige Rolle, als eine genaue, ›sprachlich-narratologische Analyse‹ der Texte gefordert wird. Hierbei spielt die Untersuchung der Erzählweise des Textes ebenso eine Rolle wie die Ermittlung von Transfer-Signalen und Interaktionsweisen, die seine Metaphorizität anzeigen. Daher müssen wir uns fragen, wie eine Metapher entdeckt wird und wie sie funktioniert. Man hält nach Signalen im Text bzw. nahen Paratexten Ausschau, die eine Bedeutungstransfer anzeigen (z. B. Das Königreich Gottes ist wie …) und die Art und Weise, inwiefern zwei semantische Felder innerhalb eines metaphorischen Textes zusammengebracht werden. Um den Text vor ideologischen Eintragungen und vorschnellen Aneignungen zu schützen, soll er möglichst genau erst einmal in seiner sprachlichen Gestaltung und ästhetischen Struktur untersucht und dargestellt werden. Gleichwohl werden die Parabeln dabei nicht als poetische ›autonome Kunstwerke‹ betrachtet, die isoliert verstanden werden können. Die Einordnung in den literarischen Kontext ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt der sprachlichen Analyse, die besonders als Zuordnung zum jeweiligen Quellenbereich verstanden wird.
Historische und literarische Aspekte sollen nicht zum Selbstzweck ermittelt werden, sondern dienen letztlich einem gegenwärtigen Verstehen. Im Akt des Rezipierens werden Deutungshorizonte eröffnet und Sinnzusammenhänge entdeckt. Die Analyse der historischen Entstehungszusammenhänge und der sprachlichen Gestalt der Parabel geben die Verstehensrichtung vor, so dass nicht beliebig in den Text hineininterpretiert werden kann. Sie bewahren den rezeptionsästhetischen Zugang vor einer einseitigen oder vorschnellen Vereinnahmung des Textes und machen sein Eigengewicht, seine Fremdheit deutlich. So wird der Auslegungsvorgang vorstrukturiert, muss aber letztlich von jedem Leser und jeder Leserin je neu vollzogen werden.
Die Kommunikationsstruktur von Parabeln ist komplexer als bei anderen Bibeltexten: Die Parabeln sind erzählte Erzählungen mit einem erzählten Erzähler und erzählten Adressaten. Mit Blick auf die Adressierten kann man drei Ebenen unterscheiden: 1) die Hörer:innen der Parabel in der erzählten Welt, 2) die Erstadressierten des Evangeliums sowie 3) die gegenwärtig Lesenden. Letztere sind bei einer rezeptionsästhetischen Sinnsuche primär fokussiert, allerdings können die anderen Adressierten- bzw. Rezipierenden eben Einfluss auf den aktuellen Prozess der Sinnkonstruktion nehmen. Die Wahrnehmung dieser komplexen Kommunikationsstruktur ist insbesondere relevant, wenn man nach Verstehensbedingungen und Verstehensschwierigkeiten von Gleichnissen fragt.
So hilfreich es im heuristischen Sinn ist, einzelne Positionen möglichst scharf gegen andere Zugänge abzugrenzen, so einseitig und unsachgemäß sind dann oft die Ergebnisse, sei es, dass sie andere Positionen in einer verzerrenden Weise karikieren, sei es, dass sie etablierte Methoden in vereinnahmender Weise der eigenen Position subsumieren. Verschiedene Zugänge im Verstehen der Parabeln Jesu müssen aber nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Unterschiedliche Perspektiven können in einer integrativen Hermeneutik vereint werden. Nicht die einzelnen Auslegungsschritte, die in den Kapiteln 7 bis 12 Anwendung finden, sind folglich Neuland des hier vorgestellten Ansatzes, vielmehr ist es eher die integrative Kombination unterschiedlicher Aspekte, die über frühere Interpretationen hinausgeht und zu einer multiperspektivischen, offenen – und damit postmodernen Hermeneutik führt. Bevor diese näher entfaltet wird, soll aber ein Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung gegeben werden.
Anmerkungen
1 In der LXX wird der Begriff מָשָׁל (mashal) gewöhnlich mit παραβολή (parabole) wiedergegeben; vgl. dazu Schöpflin, מָשָׁל; Schüle, Mashal.
2 Der folgende Abschnitt ist eine revidierte Fassung von Zimmermann, Spielraum, 3–13.
3 Ähnlich auch Wenham, Parables, 244: »But the parables are not so simple and unambiguous that no one could mistake their meaning.« Ferner Söding, Gottes Geheimnis, 60: »Es ist zugleich naiv anzunehmen, die Gleichnisse Jesu seien sonnenklar und kinderleicht.«
4 Diese Begriffe wurden durch die deutschsprachige Forschung geprägt: Bildwort (Bultmann) und Gleichnis im engeren Sinn (Jülicher).
5 Vgl. Jülicher, Gleichnisreden, I, 114: »Sie vertragen keine Deutung, sie sind so klar und durchsichtig wie möglich, praktische Anwendung wünschen sie sich. Wenn man […] jemandem einen Spiegel vorhält, dass er seine Hässlichkeit oder Schmutzflecke, die ihn entstellen, wahrnehme, so bedarf man dazu keines weiteren erklärenden Wortes; der Spiegel deutet eben besser, wie es in Wahrheit steht, als man es mit den längsten Beschreibungen zu Stande brächte.«
6 Crossan, Power, 21. Nach Crossan interpretiert Markus Jesu Parabeln als »punitive riddle parables for his opponents« (ebd.), aber dieses Vorgehen war »not appropriate or adequate to the intention of Jesus […] because it is contradicted by the very context of Mark 4, with, for example, its parable of the lamp. Parables are no more meant for noncomprehension than a lamp is intended for nonlight« (a. a. O., 26–27).
7 Vgl. dazu den Beitrag von Popkes, Mysterion; ähnlich auch Wenham, Parables, 244: »Jesus’ parabolic ministry therefore comes as God’s gift to some and as his judgement to others.«
8 Anders hierzu Hedrick, Many Things, 103: »They raise questions and issues but provide no answers.«
9 Ganz ähnlich kann auch die Pragmatik der johanneischen Missverständnisse beschrieben werden (vgl. dazu Rahner, Mißverstehen, um zu verstehen). Diese Strategie zeigt sich auch in den Wundergeschichten, weil sie bewusst das Absurde präsentieren. Sie versuchen, zu irritieren und Unverständnis hervorzurufen, weil sie über das Reale hinausgehen, um einen neuen Erkenntnisweg aufzuzeigen. Vgl. dazu meinen Artikel: Zimmermann, Wut des Wunderverstehens.
10 Vgl. auch Lohmeyer, Sinn der Gleichnisse, 156–157: »Parabelrede ist absichtliche Dunkelrede. […] Jede Parabel ist alsdann der Deutung fähig und bedürftig; sie mag im einzelnen leichter oder schwerer zu begreifen sein – selbst das bekannte Wort: ›Nur was aus des Menschen Herz kommt, macht ihn unrein‹ (Mt 15,11), ist eine Parabel und bedarf der Deutung –, solche Deutung braucht auch nicht immer ausgesprochen oder hinzugesetzt zu werden, wenn das Verständnis auch so gesichert ist (vgl. Mt 13,51), aber ohne Deutung ist grundsätzlich jede Parabel dunkel und undurchsichtig.«
11 Crossan spricht regelrecht von einem Prozess der »self-education«. »Parables were the special pedagogy of Jesus’ kingdom of God.« Crossan, Parables of Jesus, 253.
12 Crossan, Parables of Jesus, 253.
13 Tolbert, Perspectives, 15.
14 Hier werden Gedanken aus dem Sammelband Zimmermann, Hermeneutik der Gleichnisse Jesu, aufgenommen und fortgeführt.
15 Vgl. hier etwa den luziden Überblick über die Hermeneutik-Definitionen der einzelnen Disziplinen in: Wischmeyer, Lexikon der Bibelhermeneutik; ferner in Luther/Zimmermann, Studienbuch Hermeneutik, 13–71; sowie Zimmermann, Hermeneutik (WiReLex).
16 Vgl. dazu den Überblick in dem vierbändigen Werk von Reventlow, Epochen der Bibelauslegung; ferner Wischmeyer, Handbuch der Bibelhermeneutiken.
17 Vgl. dazu etwa Körtner, Einführung; auch Luther/Zimmermann, Studienbuch Hermeneutik.
18 Dazu mein Überblick über die sogenannte ›Antihermeneutik‹ und ›Posthermeneutik‹ in Zimmermann, Wut des Wunderverstehens, 37–41. Zur Gadamer- Derrida-Debatte, vgl. Michelfelder/Palmer, Dialogue and Deconstruction; aktueller dazu Gumbrecht, Production of Presence; Albert, Kritik der reinen Hermeneutik; Mersch, Posthermeneutik.
19 Ich konzentriere mich hier auf das Textverständnis, d. h. die Texthermeneutik, die jedoch nur einen Aspekt einer überspannenden Hermeneutiktheorie darstellt.
20 Vgl. Körtner, Einführung, 11. Entgegen radikal dekonstruktivistischen und interpretationistischen Ansätzen wird auch im philosophischen und literaturwissenschaftlichen Diskurs jenseits des Anspruchs von Objektivität und Einheitlichkeit an der Sinnfrage festgehalten oder zumindest eine gelingende, bedeutungsgerechte Kommunikation als Minimalforderung des Verstehens postuliert; vgl. etwa Schmidt, Rolle von Selbstorganisation, 293–333; ferner Hermeneutik.
21 Vgl. Sparn/Dannhauer, 189. Vgl. Ausschnitte der Idea boni interpretis (1630) in deutscher Übersetzung in Luther/Zimmermann, Studienbuch Hermeneutik (CD-ROM).
22 Schleiermacher gewinnt diese Einsicht, indem er den Entstehungsprozess einer Rede retrospektiv zurückverfolgt; entsprechend sei Verstehen ein Nach-Konstruieren von Sprache und Denken in der Rede; vgl. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 93–94.
23 Gadamer, Klassische und Philosophische Hermeneutik, 109.
24 Vgl. Barthes, La mort de l’auteur, 491.
25 Vgl. Iser, Akt des Lesens.
26 Ricour, Philosophische und Theologische Hermeneutik, 28.
27 Vgl. hier etwa Ricour, Philosophische und Theologische Hermeneutik, 28: Hermeneutik ziele »nicht eigentlich auf eine Hermeneutik des Textes, sondern auf eine Hermeneutik, die von dem durch den Text gestellten Problem ausgeht«.
28 Vgl. Eco, Die Grenzen der Interpretation, 35–39; Dalferth, Kunst des Verstehens, 293 f.
29 Vgl. zum Begriff der Sinnwelten auch ähnlich Dalferth, Kunst des Verstehens, 39–48.
30 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode, 391: »Es ist also ganz berechtigt, von einem hermeneutischen Gespräch zu reden. […] Auch zwischen den Partnern dieses ›Gesprächs‹ findet wie zwischen zwei Personen eine Kommunikation statt, die mehr ist als bloße Anpassung. Der Text bringt eine Sache zur Sprache, aber daß er das tut, ist am Ende die Leistung des Interpreten. Beide sind daran beteiligt.«
31 Zur deskriptiven Erschließung dieses Sinngeschehens habe ich an anderer Stelle das von K. Bühler entwickelte so genannte ›Organon-Modell‹ (vgl. Bühler, Sprachtheorie, 24–33) herangezogen und das Verstehen eines historischen Textes als verzögerten Kommunikationsvorgang beschrieben. Vgl. Zimmermann, Spielraum, 10–11.
32 Vgl. etwa die Struktur der »Hermeneutik der Gleichnisse Jesu«, der »Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen« oder in Luther/Zimmermann, Studienbuch Hermeneutik, 59–64; Zimmermann/Luther/Roth, Kunst der Auslegung.
33 Vgl. etwa Weder, Neutestamentliche Hermeneutik, 5; Berger, Hermeneutik des Neuen Testaments, 108–124.
34 So mit Nachdruck O. Wischmeyer, die »programmatisch davon aus (geht), dass die Exegese, d. h. die methodengeleitete Auslegung der neutestamentlichen Texte, auch das sachgemäße Instrument des Verstehens dieser Texte sei. Ein Verstehen der neutestamentlichen Texte an ihrer methodischen Auslegung vorbei ist ein nonsense.« Wischmeyer, Hermeneutik, IX-X. Ähnlich Luz, Theologische Hermeneutik, 21f., 88–93 (mit Verweis auf Oeming und Pokorný).
35 Vgl. bei Oeming das zusammenfassende Schaubild mit der Zuordnung von 14 Auslegungsmethoden zu den vier Polen des Verstehensprozesses; vgl. Oeming, Biblische Hermeneutik, 176; auch O. Wischmeyer integriert die Methoden der Bibelauslegung in die Hermeneutik, die ähnlich wie bei Oeming als »A Historisches Verstehen« (21–59), »B Rezeptionsgeschichtliches Verstehen« (61–125), »C Sachliches Verstehen« (127–171) und »D Textuelles Verstehen« (173–209) strukturiert wird: Wischmeyer, Hermeneutik; ferner spricht Backhaus von der »rekonstruktiven« bzw. »applikativen Hermeneutik«, vgl. Backhaus, Die göttlichen Worte, 153–160.
36 Dieser Ansatz wurde in der neueren Literaturwissenschaft vor allem durch die Rezeptionsästhetik etabliert und in verschiedenen Arbeiten für das Verstehen biblischer Texte fruchtbar gemacht. Vgl. dazu Warning, Rezeptionsästhetik; Iser, Akt des Lesens; Nisslmüller, Rezeptionsästhetik; Körtner, Der inspirierte Leser; Parris, Reception Theory and Biblical Hermeneutics. Weitere Einzelheiten dazu siehe Kapitel 5.
37 Vgl. auch Oeming, Biblische Hermeneutik, 175: »Es zeigte sich einerseits, dass jede der Methoden bestimmte Facetten des Bibeltextes besonders klar erhellen kann und somit ein relatives Recht hat, dass aber andererseits jede ihre blinden Flecken hat und somit der kritischen Ergänzung bedarf.«
2. Kapitel:Verstehen von Parabeln im Licht der Forschung
Parabeln provozieren Auslegungen. In ihrer Rätselhaftigkeit und Deutungsoffenheit verweigern sie sich enggeführten Interpretationen. Vielmehr fordern sie in unterschiedlichen Kontexten und Zeiten immer wieder neu zur Auslegung heraus, lassen mit neuen Methoden auch neue Facetten ihrer Sinnwelten zum Vorschein kommen. Parabeln verstehen zu wollen heißt im Licht der hermeneutischen Horizontverschmelzung Gadamers1 deshalb auch immer, sie im Horizont ihrer Auslegungsgeschichte wahrzunehmen. Dies rechtfertigt eine etwas ausführlichere Darlegung der Forschung. Allerdings möchte ich hier keine umfassende Auslegungsgeschichte durch die Jahrhunderte2 präsentieren, vielmehr geht es um die Interpretationsansätze in der neueren Forschung seit Jülicher, der einen Meilenstein innerhalb der modernen Gleichnis- bzw. Parabelforschung gesetzt hat. Dabei sollen die in Kapitel 1 dargelegten drei Perspektiven leitend für eine systematische Darstellung sein.3 Auch wenn einzelne Autor:innen zum Teil mehrere Aspekte erfassen,4 zeigen sich doch in der Regel klare Positionierungen in der Auslegung, so dass das Werk vereinfachend einem bestimmten Typus zugeordnet werden kann; teilweise werden verschiedene Werke eines Autors/einer Autorin an unterschiedlichen Stellen genannt.
Der Forschungsüberblick versucht zugleich, eine Brücke zwischen der oft nebeneinander bestehenden englischsprachigen und deutschsprachigen Parabelforschung zu schlagen. Neuere Werke werden mit einer größeren Ausführlichkeit dargestellt.
2.1. Historische Zugänge
Die Dominanz historisch-kritischer Fragestellungen in der Exegese des letzten Jahrhunderts hat auch im Parabelverstehen die historische Annäherung lange Zeit in den Vordergrund rücken lassen. Dabei war die Parabelforschung eng mit der Frage nach dem historischen Jesus verbunden.5 Durch alle Phasen der historischen Jesusforschung hindurch wurde immer an dem Grundbekenntnis festgehalten, dass die Parabeln zum »Urgestein« der Jesusüberlieferung zählen. Mit den Parabeln glaubte man besonders nah an den so genannten ›historischen Jesus‹ und seine Verkündigung heranzukommen. Die einzelnen historischen Annäherungen können dabei durchaus unterschiedliche Akzente setzen.
2.1.1. Die Parabeln des ›historischen Jesus‹
Im Zuge der Forschungsperspektive des ›historischen Jesus‹ versuchen Parabelforscher:innen immer wieder, den ursprünglichen Bestand der Parabeln Jesu in den Blick zu nehmen und Umfang und Form bis hin zu Wortlautfassungen der Parabeln zu rekonstruieren. Ziel der Auslegung war es hierbei, zur Parabelrede Jesu vorzudringen, die in den biblischen Texten nur noch mittelbar erhalten sei. Diese Form historischen Arbeitens reicht von Adolf Jülichers Opus Magnum6 über Joachim Jeremias’ Suche nach der »ipsissima vox«7 und der »Originalbedeutung«8 oder nach der »authentic voice«9 bei Jonathan Breech und den frühen Arbeiten von John D. Crossan10 bis hin zu dem von Robert W. Funk gegründeten »Jesus Seminar« am Westar Institute, das sich noch zum Ende des 20. Jh.s zum Ziel gesetzt hatte, die authentischen Jesusworte – und dabei besonders auch die authentischen Parabeln – zu bestimmen.11Bernard Brandon Scott,12 selbst Gründungsmitglied des Jesus Seminars, konzentrierte sich in seiner Monographie entsprechend auf die vom Seminar als authentisch befundenen Parabeln.13 Gleichzeitig versuchte er, unter Einbeziehung der Oralitätsforschung in einem methodischen Dreischritt die »ipsissima structura«14 der Jesusparabeln herauszuarbeiten.15
Weniger die Rede Jesu als vielmehr die Ursprungssituation wurde von dem britischen Parabelforscher Charles H. Dodd in den Mittelpunkt gerückt: In welcher geschichtlichen Situation (»setting in life«16) wurden diese Texte gesprochen, wie ist der historische Kontext zu bestimmen? Dodd – und ihm folgend auch Jeremias – unterschied hier deutlich zwischen der Situation im Leben Jesu und der des frühen Christentums, wobei das Ziel der Auslegung gerade darin bestehe, zum ursprünglichen Kontext zurückzugelangen. »We shall sometimes have to remove a parable from its setting in the life and thought of the Church, as represented by the Gospel, and make an attempt to reconstruct its original setting in the life of Jesus.«17
Auch in der neueren Parabelforschung begegnet noch dieser klassisch rekonstruktive Ansatz, ja, wird zum Teil sogar in extremer Weise umgesetzt. So hat John P. Meier in Band 5 seiner umfangreichen Studie zum historischen Jesus (The Marginal Jew) einen Paukenschlag in der Parabelforschung gesetzt.18 In Anwendung seiner seit Band 1 grundgelegten Echtheitskriterien19 kam er zu dem Ergebnis, dass nur vier Parabeln den Test der Authentizität bestehen.20 Damit legte er Dynamit an ein Grundbekenntnis der Jesus- und Parabelforschung. Man könne nach Meier deshalb nicht mehr einfach behaupten, dass der historische Jesus bevorzugt in Parabeln gesprochen habe, selbst wirkmächtige Texte wie die Parabel vom Barmherzigen Samariter scheitern z. B. am Kriterium der Mehrfachbezeugung.21
Nach Amy-Jill Levine sei es notwendig, die »original provocation« und den »initial context« der Stimme des jüdischen Rabbi Jesus wiederzugewinnen,22 da die Evangelisten die Parabeln Jesu ›domestiziert‹ hätten. Der originale Kontext sei vor allem ein jüdischer, so dass das Ziel der Auslegung sei, die Botschaft zu hören, die »a first-century Jewish audience would have heard«23.
Einen kreativen Versuch, diachrone historische Rückfragen mit narratologischen Methoden zu verknüpfen, wurde von Stephen I. Wright vorgelegt. Er arbeitet sich in den großen Teilen des Buches von der Evangelienüberlieferung (»Part 2: Hearing the Stories through the Gospels«24) zur Rezeption der Parabeln von potenziellen Hörer:innen in Galiläa, auf dem Weg (»on the way«) und in Jerusalem (»Part 3: Hearing the Stories with the First Listeners«25) voran, um erst im Schlusskapitel zu »Jesus the Storyteller«26 (Part 4) zu gelangen. Jeweils werden die narratologischen Kategorien »setting, point of view, character and plot«27 zur Analyse herangezogen, denn – ob nun mündlich oder schriftlich – die Parabeln blieben in erster Linie Erzählungen, die durch narrative Elemente ihre Wirkung entfalten. Gegenüber einer exegetischen oder dogmatischen Vereinnahmung sei die Praxis des »Storytelling« selbst das wesentliche »datum of his way of operating«28.
2.1.2. Sozial- und kulturgeschichtliche Arbeiten zu den Parabeln
Die sozio-kulturellen Bedingungen und Kontexte sind seit Längerem auch im Fokus der Parabelforschung. Während einige Autor:innen wie Kenneth Bailey und Richard Rohrbaugh primär den galiläisch-bäuerlichen Hintergrund beschrieben,29 verbanden andere die Analyse des sozio-kulturellen Settings mit der Zuschreibung einer politischen Funktion der Parabeltexte.30 Für William R. Herzog II31 können die Parabeln Jesu nur vor dem Hintergrund einer genauen sozialgeschichtlichen und soziologischen Analyse ihres Kontextes angemessen verstanden werden. Gerade weil Parabeln vom täglichen realen Leben erzählen, müsse der gesellschaftliche Kontext ausgeleuchtet werden, und zwar der Mikrokontext etwa der galiläischen Kleinbauern ebenso wie der Makrokontext der antiken mediterranen Gesellschaft. Herzog fragte: »How do the social scenes and social scripts of the parables disclose and explore the larger social, political, economic, and ideological systems of Palestine during the time of Jesus?«32 Die Parabeln erfüllen nach Herzog geradezu eine befreiungspädagogische33 Funktion für die Ersthörer:innen, indem sie zum Spiegelbild und Analyseinstrumentarium der gesellschaftlichen Wirklichkeit werden. Im Gewahrwerden und Entlarven sozialer Unterdrückungssituationen verhelfen diese Texte ihren Leser:innen zu einer alternativen sozialen Konstruktion und werden dabei zur subversiven Rede (»subversive speech«), die die gängigen Weltbilder in Frage stellt.34
Auch für Luise Schottroff35 ist ein Verständnis der Gleichnisse nur über eine genaue Situierung der Texte bzw. ihrer Ersthörer:innen in einer sozio-kulturell bestimmten Gesellschaftssituation möglich. Die soziale Wirklichkeit wird aber durch die Gleichniserzählung zugleich theologisch gedeutet.36 Schottroff möchte dabei den »theologischen Dualismus«37 überwinden, den sie in der »Opposition von Reich Gottes und Diesseits«, in der »Trennung von Himmel und Erde«, von »Heil und Geschichte«, von »Seele und Körper«, von »Ewigkeit und Vergänglichkeit« erkennt. Nach Schottroff führt dieser Dualismus im Extrem zu zwei Fehldeutungen: einerseits einer Ent-theologisierung der Wirklichkeit, andererseits einer falschen Identifizierung von Gott und Wirklichkeit. Mit Bezug auf konkrete Gleichnisse heißt das: Zum einen habe zum Beispiel das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg dann nichts mehr mit der realen Arbeitswelt zu tun. Es gehe hier nur noch um theologische Rede. Zum anderen kann der Weinbergbesitzer bei den bösen Winzern vorschnell mit Gott identifiziert werden. Wenn sich die Gleichnisfigur im Laufe der Erzählung als äußerst brutaler Despot erweist, der den Weinberg (nach Mk 12) oder die Stadt (nach Mt 22) verwüsten kann, werde damit Gewalt religiös überhöht. Schottroff schreibt: »Horrorgeschichten von Gewaltherrschern (werden) als Bildmaterial für Gott, Christus und Gottesreich genommen.«38 Doch »Gott ist nicht so!«39 Und folgerichtig trägt die Freund:innen-Festschrift aus dem Jahr 2014 den Titel: »Gott ist anders. Gleichnisse neu gelesen auf der Basis der Auslegung von Luise Schottroff.«40 Gott lädt ein, Gott ruft und sucht – wie menschliche Herren; aber der weitere Verlauf der Gleichniserzählungen führt oft auch die unüberwindlichen Unterschiede zwischen Gott und menschlichen Herrschern vor Augen. »Gott und Gottes Handeln (basileia) sind unvergleichbar mit den Menschen«,41 schreibt Schottroff – und das gilt im Positiven wie im Negativen. Entsprechend versteht sie einen Großteil der Gleichnisse als »antithetisch«42 oder sogar als regelrechte »Anti-Gleichnisse«: So geht es nicht im Reich Gottes zu, und so soll es nicht unter euch zugehen.
Der Realitätsnähe der Parabel auch durch die Materialität der Quellenbasis Rechnung zu tragen, ist eines der Verdienste von John Kloppenborg für die Parabelforschung. Er wertet insbesondere die reichlichen Papyrusfunde für die Parabelexegese aus, die in Gestalt von Verträgen, Rechnungen, Rechtsurteilen etc. einen vertieften Einblick in die realen Lebensabläufe bieten. Exemplarisch hat er diesen Ansatz durch die monographische Auslegung der Parabel von den bösen Winzern (Mk 12) vorgeführt,43 aber darüber hinaus auch für viele weitere Einzelstudien nutzbar gemacht.44
Der südafrikanische Exeget Ernest van Eck45 sieht sich explizit dem Ansatz von Kloppenborg wie auch der früheren soziologisch-sozialgeschichtlichen Forschungen von Malina und Rohrbaugh46 verpflichtet. Um die Parabeln Jesu zu verstehen, müssen sie im Kontext der sozialen Gegebenheiten der mediterranen Kultur gelesen werden, wie sie mittels der sozial- und realgeschichtlichen Forschung rekonstruiert werden kann. Van Eck möchte möglichst viel Material zusammentragen, das die Alltagswelt der Parabeln besser verstehen lässt. Dies führt zu drei methodischen Konsequenzen: van Eck möchte die Parabeln »within the political, economic, religious, and sociocultural context of the historical Jesus (27–30 CE) (…) not the literary context in which the parables have been transmitted«47 analysieren. Als angemessene Methode nennt er den »Socio- scientific Criticism«48, wobei den Überrestquellen wie Archäologie, Kleinmaterial und besonders den Papyri zentrale Bedeutung für die Auslegung zukomme.49 Auf der Basis einer soziologischen Analyse palästinischer Gesellschaft im 1. Jh. kommt er z. B. bei der Parabel von den anvertrauten Pfunden (Lk 19,12–27) zu dem Schluss, dass die Parabel Ausbeutungsverhältnisse anprangert und gerade die Kluft zwischen überschüssigem Reichtum und Abhängigkeit unterwandern will. Der reiche und hartherzige Geldbesitzer kann unmöglich mit Gott identifiziert werden. Der dritte Sklave ist kein Versager, sondern in seiner subversiven Haltung der eigentliche Held der Erzählung. Van Eck resümiert wie folgt: »(Jesus) criticizes the use of honor to enhance power and privilege, class, status and wealth. He also criticizes the economic exploitation of the peasantry by the ruling elite.«50 Für van Eck ist die Sozial- und Gesellschaftskritik die eigentliche Botschaft der Parabeln Jesu. Entsprechend schreibt er im Schlusswort: »(Jesus) parables were political stories about God’s Kingdom, ›not earthly stories with heavenly meanings, but earthly stories with heavy meanings,‹51, exploring how human beings could respond to an exploitative and oppressive society created by the power and privilege of the elite.«52 »Kingdom« wird dann von van Eck auch ohne »of God« erläutert als »a society that posed a real threat to Rome’s and the temple’s rule«53.
Einen durchaus vergleichbaren Versuch hat Charles W. Hedrick unternommen, der mit seinem neuesten Sammelband »Parabolic Figures or Narrative Fictions?« (2016) ein aktuelles Resümee seiner früheren Arbeiten präsentiert.54 Auch für Hedrick ist die Parabelüberlieferung, wie sie uns in den kanonischen Schriften begegnet, eine ungebührliche Einengung der ursprünglichen Parabeln Jesu. Durch die Einbettung in eine Makro-Erzählung, durch die Glaubensüberzeugung der Evangelisten und des frühen Christentums werden die einfachen fiktionalen Erzählungen Jesu erst zu metaphorischen oder allegorischen Texten mit theologischer oder ethischer Bedeutung. Er möchte die Texte hingegen wieder einfach (»simply«) als »first-century Palestinian fictional narratives«55 verstehen. »The proper way to read them is not to ask about their meaning but rather to ask, what is going on in the narrative.«56 Für Hedrick ist jede Form von theologischer Deutung, ja, sogar die Einbettung tragender Metaphern wie Weinberg oder Hirte in eine geprägte religiöse Bildfeldtradition eine spätere Re-interpretation, die die ursprüngliche Bedeutung verstellt.57 Er spricht stattdessen von einer »secularity of the stories«58, der konfessionelle oder gar christologische Deutungsmuster untergeordnet werden müssten. Parabeln seien eben nicht mehr und nicht weniger als narrative Fiktionen, die fragmentarisch Jesu Sicht auf die Wirklichkeit widerspiegeln,59 aber keine transzendenten Bezüge oder moralische Lehren ausdrücken wollten.60
Obgleich ebenso einer historischen Hermeneutik verpflichtet, kommt Gerhard Lohfink mit seinem im Jahr 2020 publizierten Gleichnisbuch, das inzwischen schon in die 6. Auflage gelangt ist,61 zu ganz anderen Ergebnissen. Er schlägt einen Bogen zu Jülicher und Jeremias: »Es geht (in diesem Buch) um den Ursprung. Es geht um die älteste Form der Jesusgleichnisse und um ihre ursprüngliche Aussage.«62 Während die frühere Parabelforschung diese Fragerichtung mit einer Abwertung der so genannten kirchlichen Überlieferung verbunden hatte, ist die kanonische Überlieferung hingegen für Lohfink selbst wertvoll, wie die Fassung für einen Edelstein. Inhaltlich hätten die Gleichnisse »ohne Ausnahme das Kommen der Gottesherrschaft bzw. des Reiches Gottes zum Thema«63. Dieses übergreifende Thema schließt jedoch christologische Dimensionen mit ein: »Sie [die Gleichnisse] sprachen, indem sie vom Reich Gottes redeten, auch vom Geheimnis Jesu, von seiner Sendung und seinem Heilshandeln.«64 Auch wenn Jesus nur im Winzergleichnis (Mk 12) »klar und dezidiert von sich selbst gesprochen hätte«65, geben nach Lohfink auch die anderen Gleichnisse doch immer etwas über Jesus preis, wie z. B. seine Kühnheit, oder verschränken das Handeln Gottes mit Jesu eigenem Wirken.66 Lohfink nennt dies die »christologische Inklusion«67. Lohfink verbindet somit historische Fragestellungen mit theologischen bzw. explizit christologischen.68
Die bei Lohfink nur angedeutete traditions- bzw. überlieferungsgeschichtliche Fragestellung stand bei Studien wie von Michael G. Steinhauser zu den Doppelbildworten69 sowie von Hans Weder zu synoptischen Gleichnissen explizit im Fokus des Interesses.70 Auch Jacobus Liebenberg hat den Überlieferungsweg einzelner Gleichnisse von der Logienquelle Q über die Synoptiker bis zum Thomasevangelium nachgezeichnet, um die je spezifischen Nuancen der Veränderung sichtbar zu machen.71
Schließlich zeigt der von Konrad Schwarz, Soham Al-Suadi und Jens Schröter herausgegebene Sammelband »Gleichnisse und Parabeln in der frühchristlichen Literatur«72 ein explizit diachron-historisches Interesse. Die dem Band zugrunde liegende Tagung verfolgte das Ziel, die Erforschung parabolischer Texte im frühen Christentum aus der Engführung auf Jesus und die synoptischen Evangelien herauszuführen und in einen weiten historischen und literaturgeschichtlichen Kontext zu stellen. Entsprechend vollzogen die Herausgebenden eine Horizonterweiterung sowohl in Richtung antiker Philosophie, Rhetorik und frühjüdischer Texte73 ebenso wie in Richtung verschiedener kanonischer und außer-kanonischer Schriften des frühen Christentums.74 Der Band »versteht sich vor diesem Hintergrund als ein Beitrag zur Rezeption der Gleichnisse Jesu im frühen Christentum«75.
2.2. Literarische Zugänge
Einen zweiten Bereich der Parabelforschung kann man unter der Überschrift literarische Zugänge zusammenfassen, die sich besonders im Zuge der sprachlichen Wendung (des linguistic turn) der Exegese etabliert haben. Eine bahnbrechende Wirkung hatten hier Arbeiten, die unter dem Label »literary turn in parable studies« zusammengefasst werden können; beispielhaft etwa die Studien von R. W. Funk und D. O. Via, die zugleich die zwei Hauptarbeitsfelder sprachlicher Verstehensraster markieren. Während Via in strukturalistischer Perspektive die Narrativität der Gleichnisse hervorhob, rückte Funk die Metaphorizität in den Mittelpunkt.
2.2.1. Narrativität und Metaphorizität der Parabeln sowie Wiederentdeckung der Allegorie
Einen ersten Reflex auf die Literarästhetik der Parabeln stellt die Arbeit von Geraint V. Jones dar,76 die dann von Dan O. Via77 in bewusster Abkehr vom historischen Paradigma aufgenommen und wesentlich erweitert wurde. Nach Via sind Parabeln »genuine works of art, real aesthetic objects«78. Entsprechend versucht er, eine Methode der Interpretation zu entwickeln, die diesem ästhetischen Charakter gerecht wird.79
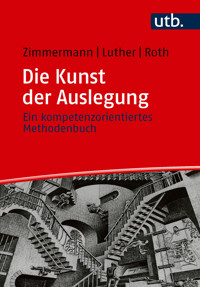
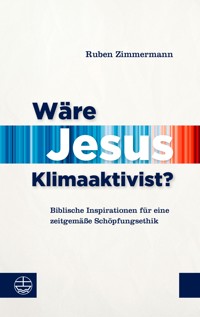
![Warum weniger gut sein kann. Eine Ethik des Verzichts. [Was bedeutet das alles?] - Ruben Zimmermann - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/640fef1328fe7d059b09e5a3d1656efe/w200_u90.jpg)


























