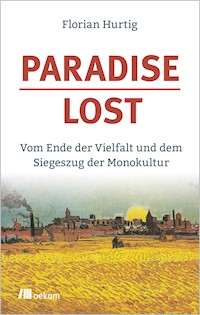1.KAPITEL
Am Anfang war die Esskastanie
Die Polytechnikder Jäger und Sammler
»Gute Geschichten verlängern sich in eine reiche Vergangenheit hinein, um eine dichte Gegenwart zu nähren, die wiederum die Geschichte für diejenigen, die danach kommen, weitererzählbar macht.«
DONNA HARAWAY
Am Anfang war die Polytechnik. Der Mensch konnte seine spezifische Lebensweise nur durch die Ausweitung der Techniken seiner Subsistenz ausformen: Die Stärken des Menschen waren von Anfang an weder Kraft noch Schnelligkeit, sondern seine Kreativität bei der Lösung von Problemstellungen, sein Erfindungsreichtum und dadurch seine Anpassungsfähigkeit. Durch das Vervielfältigen der Techniken der Ernährung, der Bekleidung, der Behausung, der sozialen Interaktion und schließlich auch der Kultur erschloss er sich immer weitere Lebensräume. Die Nutzung des Feuers brachte eine schier unendliche Zahl neuer technischer Möglichkeiten mit sich, die vom Braten über das Wärmen bis hin zur Landschaftsgestaltung reichten.
Je karger die Landschaft wurde, in die der Mensch vordrang, desto ausgeklügelter und vielfältiger mussten seine Strategien werden. In unwirtlichen Gebieten reichte es nicht aus, sich auf einige wenige Subsistenztechniken zu verlassen. Auch die stark ausgeprägten Jahreszeiten in den nördlicheren Gebieten verlangten nach einer Ausweitung der Verfahren: Den unterschiedlichen Bedingungen musste der Mensch mit unterschiedlichen Techniken der Ernährung begegnen. Und er merkte, dass seine Überlebensfähigkeit mit zunehmenden Ernährungsmöglichkeiten stieg: Fällt eine Nahrungsquelle vorübergehend aus (etwa durch Witterung, Pflanzenkrankheiten, Überjagung der Wildbestände), kann er einfach auf eine andere zurückgreifen. Die Erfindung einer ausdifferenzierten Sprache ermöglichte einen regelrechten Boom der Subsistenzstrategien und ebenso eine Ausdifferenzierung der dazu notwendigen Techniken, die (nun) auch immer Techniken sozialer Verbindungen waren. Durch diese Ausweitung der Techniken, der dazugehörigen Fähigkeiten und des nötigen Erfahrungswissens kristallisierte sich eine Soziologie der Polytechnik heraus: eine soziale Förderung und Anreizsetzung zur Entwicklung besonderer Fähigkeiten. Diese Soziologie der Polytechnik ist freilich vollkommen anders geartet als die heutige Fachidiotie und zeichnet sich im Gegensatz zu dieser durch eine Verwobenheit der Techniken und des Wissens aus. Durch die große Bedeutung der gemeinsamen Tätigkeit entsteht ein breiter Sockel gemeinsamen Erfahrungswissens, aus dem die spezialisierten Techniken der Einzelnen herausragen, um damit die Potenziale des gemeinsamen Tuns zu erhöhen.
Jäger-und-Sammler-Gesellschaften werden heute meistens nur negativ bestimmt: durch die Abwesenheit des Acker- und – fälschlicherweise – des Pflanzenbaus. Es wird also danach gefragt, was diesen Gesellschaften fehlt(e), anstatt danach zu fragen, worüber sie verfügten, was ihre Lebensweise ausmachte. Dabei scheint klar, dass die Lebensweise der Jäger*innen und Sammler*innen derjenigen der Ackerbäuer*innen unterlegen war: »Weil die Vorzüge des Ackerbaus sogar für die Menschen erkennbar waren, die noch auf die Jagd gingen und Pflanzenteile sammelten, stellten sie das System ihrer Landnutzung um. Das heißt, sie zogen nicht mehr hinter Jagdbeute her, sondern ließen sich nieder, bauten Korn an und hielten Tiere.«1 So stellt sich die verbreitete – nicht nur vereinfachte, sondern schlicht falsche – Perspektive auf die frühen menschlichen Gemeinschaften dar. Denn entgegen der früheren Ansicht, wonach Jäger*innen und Sammler*innen nur Konsument*innen einer zufälligen Landschaft waren, nicht selbst gestaltend Eingriff nahmen und kaum planvoll mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgingen, mehren sich Belege für vielfältige Formen planvoller Subsistenzstrategien. Beides – Sammeln und Jagen – waren keine zufälligen Prozesse, sondern sehr viel geplanter, als landläufig angenommen. Schon lange vor dem Aufkommen des Ackerbaus im Nahen Osten um 10.000 v. Chr. gestalteten Menschen die Landschaft entsprechend ihrer eigenen Subsistenzinteressen um.
Eine beliebte Methode war das Unterstützen ertragreicher Vegetation. Indem jene Bäume für den Holzbedarf gefällt wurden, die am wenigsten Nahrungsertrag für den Menschen lieferten, verbesserten sich die Wachstumsbedingungen für die verbliebenen Nuss- und Obstbäume. Die Konkurrenz um Sonnenlicht und Wurzelraum sank, der Ertrag dieser ausgewählten Pflanzen mit besonders großen und wohlschmeckenden Früchten stieg. Ein weiteres Beispiel ist das gezielte, kleinräumige Abbrennen der vorhandenen Flora, um anschließend auf dem fruchtbaren, aschegedüngten Boden die Vegetation zu unterstützen, die die brauchbarsten Früchte für die Menschen bereitstellte: krautige Gemüsepflanzen, Beerensträucher, Nussbäume, aber auch Getreidepflanzen, Linsen und Bohnen. Wuchs die gewünschte Vegetation nicht von alleine, wurde sie angepflanzt.
Welche Subsistenzstrategien dabei die höchste Nahrungsverfügbarkeit bei geringstem Arbeitseinsatz erzeugten, hing natürlich auch immer davon ab, welche Pflanzen regional verfügbar waren. Die Indigenen Nordamerikas konnten sich zum Beispiel der Dienste der Knollenpflanze Topinambur (Helianthus tuberosus) erfreuen, die die nützlichen Eigenschaften besitzt, dass sie mehrjährig ist und schon aus dem Bruchstück einer Rhizomknolle erneut wuchern kann. Im heutigen Gartenbau kann das zum Problem werden, weshalb Topinambur dort als invasive Pflanze angesehen wird, für eine Subsistenzstrategie in der offenen Landschaft war das aber ideal: Man konnte jährlich kohlenhydratreiche Wurzelknollen ernten und musste nur einen Teil der Pflanze zurücklassen, auf dass diese im nächsten Jahr erneut wuchs und die Menschen ohne weitere Pflege erneut mit reicher Ernte beschenkte. Die Flächenerträge sind bis zu viermal so hoch wie diejenigen der bereits extrem produktiven Kartoffel. Gelagert wurden die Knollen am besten, indem sie einfach bis kurz vor dem Verzehr im Boden gelassen wurden. Es ist kein Wunder, dass die Indigenen Nordamerikas Topinambur schon früh domestizierten und ihn auch außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes der Pflanze anbauten.2 Neben dieser krautigen, mehrjährigen Knollenpflanze waren es meist Nuss- und Obstbäume, die den höchsten Ertrag bei geringstem Arbeitseinsatz erbrachten.
Das Kultivieren von Pflanzen wurde eben nicht erst mit dem Aufkommen des Ackerbaus um 10.000 v. Chr. »erfunden«, wie wir später noch ausführlicher sehen werden. Vielmehr war das Wissen um die Möglichkeit der Vermehrung von Pflanzen durch das Aussäen von Samen und die Domestikation von Pflanzen sehr viel älter und schon lange Teil des Repertoires einer Polytechnik. Die Archäologin Melinda Zeder vom Smithsonian National Museum of Natural History schreibt: »Stabile und hochgradig nachhaltige Subsistenzwirtschaftsweisen, basierend auf einer Mischung aus undomestizierten, gemanagten und voll domestizierten Ressourcen, scheinen schon 4000 Jahre oder länger etabliert gewesen zu sein, bevor sich im Mittleren Osten eine landwirtschaftliche Wirtschaftsweise herausbildete, die hauptsächlich auf domestizierten Pflanzen und Tieren basierte«.3
Zeder definiert Domestikation als einen kumulativen Prozess, in dem sich beide Partner einer Symbiose durch ihre gegenseitige Abhängigkeit wechselseitig aneinander anpassen und verändern.4 Wenn der Mensch Pflanzen und Tiere domestiziert, verändert nicht nur er diese, diese verändern auch ihn – auch der Mensch wird gewissermaßen domestiziert: Er stellt seinen Lebensalltag um, um sich dem Anbau und der Haltung der Pflanze zu widmen, ja, er passt sich sogar über Generationen hinweg biologisch an diese Gegebenheiten an. Natürlich sind die Wirkungen unterschiedlich, je nachdem um welche domestizierten Lebewesen es sich handelt.
Auch in Amerika wurden Pflanzen wohl nicht zuerst im Hochland Mexikos und in den Anden domestiziert – wo später ackerbauliche Kulturen entstanden. Anna Roosevelt, Carl Sauer und später Dolores R. Piperno und Deborah Pearsall konnten nachweisen, dass der erste gezielte Pflanzenbau in den tropischen Waldgärten des Amazonas stattfand. In dieser ersten Phase wurden vor allem essbare Pflanzen konzentriert auf eine Fläche gepflanzt, die im Regenwald vorzufinden waren und die zuvor wild gesammelt wurden. Darunter waren Bäume der verschiedenen Wuchsschichten, Kletterpflanzen, krautige Bodenpflanzen und solche, die aufgrund ihrer essbaren Wurzeln gepflanzt wurden. Dabei gab es viele Zwischenstufen zwischen wilder Sammlung und einer gezielten Kultivierung.5 Waren diese Pflanzensammlungen einmal angelegt, war die bewusste Auslese guter Sorten der nächste, fast zwangsläufig stattfindende Schritt, der die Pflanzendomestikation perfektionierte. Ob sogar der Mais ursprünglich aus solchen frühen Anbausystemen im Amazonas stammt, ist heute umstritten.
Diese Techniken von Pflanzenbau und -domestikation wurden wohl immer dann angewandt, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll erschienen, beispielsweise wenn das Anpflanzen bei gleichem Arbeitsaufwand produktiver war als das wilde Sammeln. Das ist aber längst nicht immer der Fall. Deshalb wäre es ein Fehler, eine lineare Abfolge von Entwicklungsstufen zu sehen: vom Sammeln zum Kultivieren. Wenn das Sammeln weniger zeitaufwendig ist, ist es nur logisch, dieses dem Anbau vorzuziehen, selbst wenn diese Kulturtechnik längst bekannt ist.
Beim gezielten Aussäen von Pflanzen macht es für die Bilanz von Energieinput und Energieoutput allerdings einen erheblichen Unterschied, ob einjährige Pflanzen ausgesät werden oder mehrjährige. Während bei einjährigen kultivierten Pflanzen für jede Jahresernte auch einmal ausgesät werden muss, kann bei Bäumen eine Saat zweihundert und mehr Ernten hervorbringen. So wird die nahe des Ätna auf Sizilien stehende Castagno dei cento Cavalli (»Kastanie der hundert Pferde«) auf etwa zwei- bis viertausend Jahre geschätzt und brachte schon dementsprechend viele Jahresernten hervor, nur durch die Mühe, die sich vor langer Zeit jemand machte, indem er oder sie eine Esskastanie in den Boden steckte – falls sie sich nicht selbst ausgesät hatte. Einjährige Pflanzen müssen ganzjährig gegen Pflanzenkonkurrenz, Schädlinge, Verbiss und Ähnliches geschützt werden. Hat sich ein Baum hingegen einmal durchgesetzt und wurde vielleicht bis in das Ertragsalter gepflegt, ist er sehr robust – ja, er dominiert seine Umwelt ökologisch und mitunter sogar bodenchemisch –, und am Ende seines Lebens lässt sich das Holz des Baumes noch durch den Menschen nutzen. Während der Anbau von einjährigen Pflanzen also aus gutem Grunde dort vermieden wurde, wo es sich vermeiden ließ, war das gezielte Anpflanzen von Nutzbäumen vermutlich eine gängige und bewährte Methode, wie wir im Folgenden sehen werden.
In der Mittelsteinzeit (dem Mesolithikum), also nach dem Ende der letzten Eiszeit, veränderten sich die Subsistenzstrategien vieler Menschengruppen: Von der Großwildjagd gingen sie zur Nutzung von Nussfrüchten und anderen Pflanzen über. Im Nahen Osten, wo der Einfluss der letzten Eiszeit weniger prägnant war als im nördlichen Eurasien, war die Nutzung von Pflanzen und speziell von Nussbäumen durchgehend von Bedeutung. Ausgrabungen in Israel belegen die Nutzung von Eichen, Pistazien, Wein, Getreiden, Linsen und vermutlich auch Oliven bereits vor mindestens vierzigtausend Jahren.6 Ebenfalls in Israel konnten Archäologen einen noch viel älteren, vormenschlichen Fund machen: 780.000 Jahre alte Überreste von Pistazien, Mandeln, Eicheln und anderen Nüsse wurden hier ausgegraben – neben Steinen zum Nussknacken, die offensichtlich von den Vorfahren des Menschen benutzt wurden.7
Allerdings gab es eine breite Palette unterschiedlicher Subsistenzstrategien. Fischen und Jagen gehörten genauso dazu wie slash and burn, also der Brandfeldbau mit seinen ganz unterschiedlichen Praktiken, die vom einfachen Abbrennen des Unterwuchses eines Nusshaines bis zur Brandrodung von ganzen Waldstücken zur Nutzung der neu aufkommenden Pflanzen reicht, die Ernte wild wachsenden Getreides oder die shifting cultivation, das heißt der Wanderfeldbau. Eine weitreichende Polytechnik also, bei der es nur eine Frage der Zeit war, bis sie sich in polykulturellen Anbausystemen – etwa Waldgärten – lokal manifestieren sollte.
Lewis Mumford vermutet: »Der Gartenbau, bei dem es auf schöne Einzelexemplare ankommt, ist dem Ackerbau, der größere Erträge verspricht, vorausgegangen und hat diesen erst möglich gemacht. Die wichtigsten tropischen Nahrungsmittel, Taro, Maniok, Kokosnuss, Brotfrucht, ganz zu schweigen von Banane, Mango und Durian, haben ihre weiteste Verbreitung in der Südsee«8 – was darauf schließen lässt, dass sie schon sehr lange Zeit angebaut und ihre Samen verbreitet wurden.
Von den japanischen Inseln, die während der letzten Eiszeit bewaldet waren, haben wir neue und die bisher wohl beeindruckendsten Erkenntnisse, die belegen, dass lange bevor Menschen anfingen, Getreide auf monokulturellen Äckern anzubauen, sie schon Nussbäume in polykulturellen Waldgärten kultivierten. Hier verdichteten sich die Polytechniken des Selektierens, Unterstützens und Domestizierens einer wilden Vegetation lokal so sehr, dass Polykultursysteme entstanden, deren Produktivität die Sesshaftwerdung möglich machte. Die erste menschliche Kultur, für die eine dauerhafte Sesshaftigkeit nachweisbar ist, ist die Jōmon-Kultur in Japan.9 Die Sesshaftwerdung fand hier völlig unabhängig von der häufig als grundlegend betrachteten Getreidekultivierung statt.
Im Buch Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Steinzeit behauptet Waltraud Sperlich: »Sesshaftigkeit heißt, dass die Menschen Bauern werden, Äcker bestellen und Tiere halten.«10 Leider löst sie damit jedoch mitnichten einen der angekündigten Irrtümer auf, sondern schafft selber einen, denn Sesshaftigkeit heißt nicht per se, dass man Äcker anlegt und Tiere hält. Der Begriff bezeichnet zunächst lediglich den Umstand, dass Menschen viele Jahre lang am gleichen Ort verweilen. Dazu muss die Umgebung genügend Nahrung bieten, um weite Streifzüge zu erübrigen. Sperlichs Irrtum liegt darin, die Nahrungsgrundlage sesshafter Menschen ausschließlich in auf Äckern kultivierten Pflanzen und domestizierten Tieren zu erblicken. Sesshaftigkeit ist jedoch nicht an eine bestimmte Form der Nahrungsgewinnung geknüpft, sondern lediglich an eine ausreichende Menge verfügbarer Nahrung pro Fläche – gleich, welchen Ursprungs.
Neben der Sesshaftigkeit fanden sich bei den Jōmon in Japan weitere dem Neolithikum zugeschriebene Merkmale. Bereits deutlich früher als im Nahen Osten (circa 8000 v. Chr.) und an anderen Orten, an denen später Getreide angebaut wurde, stellten die Jōmon (13.700 bis 10.500 v. Chr.) kunstvoll gefertigte Schnurkeramiktöpfe her, in denen nachweisbar Baumfrüchte und vermutlich viele andere Produkte aus ihren Polykulturen aufbewahrt wurden. Die Schnurbandkeramiker*innen lebten sesshaft in Dörfern von bis zu dreihundert Menschen und besiedelten Japan während einer unglaublichen Zeitspanne von 13.000 bis 300 v. Chr. Dass ihre Kultur sich mehr als zwölftausend Jahre standorttreu halten konnte, zeugt von einer enorm nachhaltigen Wirtschaftsweise. Möglicherweise trug die Kombination von neolithischen Merkmalen (Sesshaftigkeit, Keramik, größere Lebensverbände) und solchen, die dem Mesolithikum zugeordnet werden (Sammeln, Anbau von Baumfrüchten statt Getreidebau, Jagen statt Domestikation von Tieren, keine ausgeprägte soziale Stratifizierung der Gesellschaft), dazu bei.
Während Europa bis etwa 12.000 v. Chr. baumfrei war, wiesen die japanischen Inseln die meiste Zeit über eine flächendeckende Bewaldung auf. Seit etwa zwanzigtausend Jahren herrscht eine ähnliche Vegetation wie heute – und diese beinhaltet die Japanische Esskastanie (Castanea crenata), die Japanische Walnuss (Juglans ailantifolia) oder die Japanische Rosskastanie (Aesculus turbinata), die vor dem Essen entbittert werden muss, dann aber gut genießbar ist. Noch heute wird sie als Spezialität in den bewaldeten Bergregionen, in denen sie heimisch ist, zubereitet. Kekse, Kuchen und Bonbons aus Rosskastanien sind beliebt. Essensvorräte für Krisenzeiten werden in Japan heute noch »Rosskastanien auf dem Speicher« genannt.11 Das rührt wohl von der im Vergleich zur Esskastanie besseren Lagerfähigkeit der unbehandelten Rosskastanie her. Die Esskastanie wiederum, die mit der Rosskastanie weder verwandt noch verschwägert ist, enthält Stärke, die unbehandelt verzehrt werden kann. Zur Lagerung musste die Esskastanie also zwar behandelt werden, aufgrund der einfacheren Verwendung zum direkten Verzehr hatte sie aber wohl eine größere Bedeutung für die Jōmon. Sie gilt als die seit der Altsteinzeit am meisten verwendete Nutzpflanze in Japan12 – mindestens aber seit der Mittelsteinzeit.
Die Existenz nahrhafter, kalorienreicher Baumfrüchte erlaubte hier wohl schon in der Altsteinzeit eine Lebensweise, wie sie in anderen Teilen der Nordhemisphäre erst in der Mittelsteinzeit üblich werden sollte. Anhand von DNS-Analysen der Japanischen Esskastanie konnte nachgewiesen werden, dass der Beginn ihrer Kultivierung in einen ähnlichen Zeitrahmen fiel wie die erstmalige Keramikherstellung.13 Somit sind nicht die Getreidegräser im Nahen Osten die Pflanzen, die nachweislich zuerst für die menschliche Ernährung gezüchtet und angebaut wurden, sondern die Esskastanie in Japan.14
Eine Kombination des Esskastanienanbaus (und des Anbaus weiterer Nussbäume) mit der Nutzung aquatischer Ressourcen wie Fisch, Algen und Muscheln sorgte im mittelsteinzeitlichen Japan für eine gute Nahrungsgrundlage, sodass Sesshaftigkeit möglich wurde. Die Archäolog*innen sind sich einig, dass die Esskastanie die Nahrungsgrundlage der Jōmon-Kultur bildete, auch wenn darüber hinaus einige Wurzelgemüse genutzt wurden sowie insgesamt ein recht breites Nahrungsspektrum existierte, wie es in polytechnischen Gesellschaften üblich ist. Vermutlich entstand hier eine Waldgartenkultur: Gärten, in denen die Esskastanienbäume (und andere Bäume), die eigentlich dichte Wälder bilden, die Grundlage darstellten, aber so weit auseinander gepflanzt (beziehungsweise stehen gelassen) wurden, dass unter ihnen andere Nutzpflanzen gedeihen konnten. Hier wurden dann alle möglichen Pflanzen kultiviert, die einen Nutzen für die Menschen boten, Holunder, Trauben, Maulbeeren und Wein etwa. Die Früchte wurden roh gegessen und in Gemeinschaftsarbeit zu Obstwein versaftet. Auch der älteste Fund von kultivierten Pfirsichen stammt aus dem Japan der Jōmon (4700 bis 4400 v. Chr.).15
Als Gemüsepflanze wurde in den Waldgärten zum Beispiel die Japanische Pestwurz (Petasites japonicus) angebaut, die attraktiver aussieht und besser schmeckt, als ihr Name vermuten lässt. Mit ihren riesigen Blättern erzeugt sie eine Bodenschicht im Wald, die tropisch anmutet. Die einzelnen Blätter sind so groß, dass sie in Japan traditionell als Regenschirme für Kinder benutzt wurden. Gegessen werden hingegen ihre Stängel (ähnlich wie bei Rhabarber) und die Blütenstände, die im Frühjahr ähnlich groß sind wie eine Artischocke. Auch die sehr stärkehaltige Knollenpflanze Kudzu (Pueraria montana) wurde angebaut sowie Taro (Colocasia esculenta) und die Lauchart Allium macrostemon. Auch das Sammeln (und vielleicht das Fördern) von Pilzen in den Waldgärten spielte eine wichtige Rolle für die Ernährung der Jōmon.
Das Durchstreifen der Wälder auf der Suche nach einer bestimmten Medizinalpflanze beziehungsweise nach Wurzelgemüsen, Früchten oder Salatpflanzen entfiel weitgehend durch die angelegten Waldgärten. Generell hatte die gemeinsame Arbeit für die Anlage eines Gemeindevorrats einen wichtigen Stellenwert. Alles wuchs nun im direkten Umkreis der Dörfer in den Waldgärten: eine Manipulation der Natur, die doch so nahe an der natürlichen Vegetation lag, dass sie keine negativen Auswirkungen auf die Böden oder das Kleinklima erzeugte, geschweige denn auf das globale Klima. Der Umwelthistoriker Joachim Radkau schreibt: »Demjenigen Naturliebhaber, der sich einseitig auf das Ideal der Wildnis fixiert, entgeht jene Anti-Wildnis, wo der Mensch seit sehr alter Zeit ein besonders intimes und zugleich kreatives Verhältnis zur Natur ausbildete: Der Garten!«16
Das »Mit-Werden« der Baumkulturen
Die Walnuss- und Esskastanienbäume der Jōmon ermöglichten also eine vielfältige und sogar etagenweise mehrfache Unternutzung. Aus genau diesem Grund sind diese Nusskulturen für uns so interessant. Die Baumkulturen bilden einen Kontrapunkt zu den Monokulturen, die wir später analysieren wollen. Sie tendierten traditionell fast immer dazu, in Polykulturen angelegt zu werden, weil sich durch die Vertikalität der Bäume verschiedene Stockwerke ergeben, auf denen jeweils unterschiedliches Nutzbares erzeugt werden kann, ohne dass die verschiedenen Kulturen in Konkurrenz zueinander geraten würden.
Eine vom Menschen bewusst erzeugte Vielfalt entsteht, indem er verschiedene Kulturen zusammen auf engem Raum anbaut, aber sie entsteht auch, weil die Vielfalt des Lebens hier nicht den Interessen oder einer bestimmten ideengeschichtlichen Prägung des Menschen entgegensteht. Denn eine Polykultur ist kein ausschließendes, sondern ein integrierendes System. Sie schafft eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Sie erlangt ihre Produktivität nicht durch Negierung von vielfältigem Leben und seinen Verbindungslinien, sondern genau durch dessen Unterstützung. Wie diese Produktivität der ineinandergreifenden Vielfalt zustande kommt, kann vielleicht am besten anhand der Lebensweise der Fruchtbäume als Holobionten und Symbionten gezeigt werden.
Bäume sind Lebewesen, die niemals unabhängig von anderen Arten und Lebensformen wachsen, sondern immer in ein breites Netzwerk des Lebens eingebunden sind, das sie selbst schaffen, auf das sie für ihr eigenes Überleben jedoch auch angewiesen sind. Die unterirdische Aufnahme von Wasser und Nährstoffen könnten die Bäume beispielsweise gar nicht alleine über ihre Wurzeln bewerkstelligen. Sie sind angewiesen auf Pilze, mit deren Hyphen sie innerhalb oder außerhalb der Feinwurzeln spezielle Grenzflächenstrukturen ausbilden. Da der Baum und der Pilz in Kommunikation zueinander stehen, kann der Pilz dem Baum durch seine größere Oberfläche diejenigen Nährstoffe beschaffen, die der Baum benötigt – im Gegenzug bekommt der Pilz Kohlenstoff, welchen er nicht selbst produzieren kann.
Die mykorrhizierenden Pilze sind oftmals beliebte Speisepilze. Alleine schon durch sie wird eine Baumkultur oft zu einer Polykultur, wirft also mehrere nutzbare Erträge ab. Dennoch unterschätzen wir die Pilze, wenn wir in ihnen nur die herbstlichen Leckerbissen sehen. Denn sie sind mindestens so entscheidend für das Ökosystem Wald (oder Waldgarten) wie die Bäume selbst. Sie bilden weitverzweigte Hyphensysteme, die mehrere Hektar umfassen können, und gehen dabei Verbindungen mit einer Vielzahl von Bäumen und anderen Pflanzen auf dieser Fläche ein. Den Bäumen dient der Pilz als Kommunikationsmedium untereinander (»Wood Wide Web«), aber auch zum Austausch von Nährstoffen. Doch damit nicht genug: Die Hyphen stellen auch eine Infrastruktur dar, die wiederum von kleineren Lebensformen wie Bakterien und anderen Mikroorganismen billiardenfach besiedelt und als »Straßennetzwerk« genutzt wird. Bakterien sind neben Baum und Pilz der dritte entscheidende Partner, um den Nährstoffkreislauf eines Waldes zu organisieren. Denn die Bakterien stehen im Stoffaustausch mit dem Pilz, liefern diesem die gewollten Nährstoffe und bekommen dafür als Gegenleistung die vom Baum produzierten Kohlenstoffe vom Pilz weitergeleitet. Baum, Pilz und Bakterien sind somit in einem Wald(-Garten) als Protagonisten einer gigantischen Symbiose anzusehen. Diese Basis wird wiederum um ein weitläufiges Netzwerk weiteren Lebens ergänzt: Insekten, die bestäuben und viele andere Funktionen übernehmen, Vögel und Säugetiere, die zusätzlich zum Menschen ihre bevorzugten Pflanzenarten verbreiten, Regenwürmer, die Experten darin sind, fruchtbare Ton-Humus-Komplexe aufzubauen und damit sowohl das Mikrobodenleben als auch das Pflanzenwachstum zu fördern. Durch diese Komplexe steigt der Humusanteil eines Bodens – und damit sein organischer, lebendiger Gehalt.
Dieses Lebensnetzwerk ist alles andere als stumm; fast alles kommuniziert mit fast allem. So gut wie jede Pflanze ist etwa an das Mykorrhizanetzwerk angeschlossen, steht also sowohl in Kommunikation als auch im Stoffaustausch mit dem Gesamtsystem. Aber auch überirdisch findet Kommunikation statt, nämlich über bestimmte Substanzen oder elektromagnetische Signale, welche die einen Pflanzen ausstoßen und die anderen erkennen und auswerten können. »Pflanzen kommunizieren auf vollkommene Art und Weise in einer riesigen Bandbreite terrestrischer Modalitäten; sie produzieren und vermitteln Bedeutung inmitten einer erstaunlichen Galaxie von Assoziierten quer durch alle Taxa lebendiger Wesen. […] Sie erlauben den Tieren, mit der abiotischen Welt zu kommunizieren: mit der Sonne, mit Gasen, mit dem Stein«, schreibt Donna Haraway.17
Zwischen Säugetieren (speziell auch Menschen) und Pflanzen findet zudem eine nicht materielle Kommunikation statt, wie wir seit Cleve Backster wissen, der für die CIA an Lügendetektoren forschte und aus Jux oder Langeweile 1966 einen dieser Detektoren an seine Zimmerpflanze anschloss. Alleine die Gedanken daran, der Pflanze Schaden zuzufügen, führte zu heftigen Ausschlägen des Detektors, während er ansonsten ruhig blieb. An dieser Stelle ist kein Platz, die neueren Erkenntnisse über die vielfältigen Kommunikationsweisen der verschiedenen Lebensformen näher auszuführen. Jedoch vieles deutet darauf hin, dass die komplexen Beziehungsweisen in Wäldern und auch Waldgärten flankiert sind von einer kommunikativen Ebene.18 Auch die Anpassung und Abstimmung der verschiedenen Arten aufeinander durch die Prinzipien der Symbiose, aber auch der Konkurrenz im Evolutionsprozess können als eine Form der Kommunikation betrachtet werden.
Wer das System Wald(-Garten) in diesem Sinne als Netzwerk des Lebens und der Lebensformen begreift, muss an der darwinistischen Darstellung zweifeln, nach der die unterschiedlichen – klar voneinander getrennten – Arten lediglich und vor allem in eine durch Konkurrenz geprägte Beziehung zueinander treten würden, eine Auffassung, die im Lichte aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht mehr zu halten ist.19 Gerade der Pilz widerlegt diese Annahme am eindrücklichsten, denn er stellt im Wald nicht nur die Infrastruktur für Kooperation bereit, sondern er tendiert zusätzlich – wie die Bakterien – zum horizontalen Gentransfer, das bedeutet, dass Pilze in nicht reproduktiven Begegnungen untereinander Gensequenzen austauschen. Die säuberliche Trennung der Arten scheint der Wissenschaft also deutlich wichtiger zu sein als den »Arten« selbst – Pilze und Bakterien tendieren mehr zum »Genkommunismus«: Nützliche Gensequenzen werden weitergegeben an jene, die sie benötigen. Der Tibetische Raupenpilz beispielsweise entlarvte sich bei der Untersuchung durch Wissenschaftler*innen als ein genetisches Wirrwarr verschiedenster Arten.20
Anders als die moderne Wissenschaft es in den vergangenen Jahrhunderten sah, ist Leben nicht etwas, das sich sauber nach Arten getrennt in »Autopoiesis« – also einer von anderen Arten abgegrenzten Selbstorganisation – reproduziert. Der Biologe Scott Gilbert verwendet stattdessen den Begriff der »Symbiopoiesis«, um die Symbiosen als entscheidende Kraft bei der Weiterentwicklung der Arten in den Vordergrund zu stellen: »Die Symbiose scheint mehr und mehr die ›Regel‹ und nicht die Ausnahme zu sein. […] Die Natur trifft ihre Selektion wahrscheinlich nicht so sehr auf Grundlage von Individuen und Genomen, sondern von ›Beziehungen‹.«21 Die Entwicklung der Arten ist also keine objektive Angelegenheit, sondern das Ergebnis von zwischenartlichem Zusammentreffen. »Zwischenartliche Begegnungen sind […] immer Ereignisse, ›Dinge, die passieren‹, historische Einheiten.«22
Symbiopoietische Systeme sind »kollektiv produzierende Systeme, die über keine selbst definierten räumlichen oder zeitlichen Begrenzungen verfügen«.23 Vielleicht klingen Ihnen diese Ausführungen zu sehr nach Naturromantik und Harmonie; doch um Harmonie geht es gerade nicht – sondern um eine Vereinigung der Gegensätze zu einem stabilen Ganzen. Wo harmonische Stabilität herrschen würde, wäre kein Platz für Ereignisse, für »Geschichten«. Diese entstehen aus Spannungen, aus Ungewissem. Und das sind nicht immer die Geschichten, die wir von der Natur gerne erzählt bekommen wollen. Manchmal ist der Pilz eben ein Hallimasch, der quadratkilometerweise Wald vernichtet (dabei aber wiederum Raum für neue, aufbauende Geschichten schafft).
Wenn wir hingegen den Waldgarten als ein Netzwerk des Lebens betrachten, als ein artenübergreifendes »Miteinander-Werden«, das sich in seinen wechselseitigen, geschichtlichen Beziehungen weiterentwickelt, dann stellt sich natürlich die Frage: Welche Rolle spielt der Mensch in dieser Geschichte? Wir sind es gewohnt, den Menschen als ein Wesen außerhalb der Natur zu begreifen: Wo der Mensch seinen Einfluss walten lässt, da dränge er zwangsläufig die Natur zurück, sein Tun sei nicht verwoben mit den komplexen Beziehungsverhältnissen der Natur und habe sich weitgehend unabhängig von diesen entwickelt. Diese Betrachtung scheint aus heutiger Perspektive Sinn zu ergeben, da das (von der Wertlogik geordnete) menschliche Tun tatsächlich fast immer gegen die nicht menschliche Umwelt gerichtet ist. Aber ist sie zwangsläufig? Könnte das menschliche Tun nicht eingebettet in ein Netzwerk des »Tuns« der verschiedenen Arten gedacht werden?
Die Polykultur des Waldgartens legt diese Betrachtung nahe: Denn was ist der Unterschied, ob ein Eichhörnchen eine Esskastanie pflanzt (indem es die Nüsse im Versteck »vergisst«), um in Zukunft mehr Kastanien ernten zu können, oder ob der Mensch das Gleiche tut? Oder ob der Bär Äpfel züchtet oder der Mensch? Denn die Entstehung des Kulturapfels ist so eine artenübergreifende Geschichte: Im heutigen Kirgistan war eine Form des Wildapfels beheimatet, die nicht wie seine Verwandten in anderen Gegenden klein und holzig blieb, sondern groß, süß und saftig wurde. Und zwar, weil der Braunbär ihn als Leckerbissen entdeckte und sich immer die größten, schönsten und süßesten Äpfel zum Fressen aussuchte. Mit dem Kot an günstige Orte gesetzt, wurden den Samen dieser Auslesen wunderbare Pflanzbetten bereitet. Bär und Apfel passten sich also an die jeweils anderen Bedürfnisse an und profitierten gegenseitig von dieser Allianz. So entstand eine Population die man »Petz’ Beste« nennen könnte – und die auch der Mensch irgendwann höchst spannend fand. Von der Armee Alexanders des Großen wurde diese Frucht dann entdeckt und nach und nach in alle Welt verbreitet. Apfelwälder oder -gärten wurden nun nicht mehr nur von Bären gepflanzt, sondern auch vom Menschen, der nahtlos an die Tätigkeit des Auslesens von Meister Petz anknüpfte (und sie um die Technik des Veredelns erweiterte). Ein grundsätzlicher Unterschied besteht nicht.
Die Natur ist eben nichts Determiniertes, ihre Ausformungen sind immer ein Ergebnis der Interaktion und des Tuns verschiedener Arten (das längst nicht immer harmonisch sein muss). Das Ereignis dieses Aufeinandertreffens schafft dynamische Entwicklung. Es spricht nichts dagegen, den Menschen als einen Teil dieser Dynamik von Ereignissen und Prozessen zu begreifen – solange er selbst diese Dynamik nicht zerstört, sondern das weitere Aufeinandertreffen des Tuns der verschiedenen Arten ermöglicht. Bei Polykulturen wie den Waldgärten der Jōmon war dies der Fall.
Die Kunst, einen Wald in ein Waldgartensystem zu verwandeln, besteht denn auch darin, sich in das Netzwerk der komplexen Beziehungen und Kommunikationen einzuklinken und als ein Teil des Systems Einfluss darauf zu nehmen. Die Komplexität dieses Netzwerkes ist dabei nicht in erster Linie zu verringern, sondern so zu beeinflussen, dass möglichst viele der Prozesse etwas für die menschliche Gemeinschaft Nutzbares hervorbringen. Der Mensch bleibt in diesem System also ein Gestalter unter vielen. Anna Lowenhaupt Tsing überträgt hier den von Hart und Negri geprägten Begriff der »Multitude« (als eine Vielheit der Subjektivitäten) auf die Natur mit ihrer Vielzahl von handelnden Individuen.24
Pflanzen, Tiere und selbst Bakterien werden als Subjekte begriffen. Vor allem wird der Blick darauf geworfen, was zwischen diesen Lebensformen passiert, auf die Verbindungen und Beziehungen. Die Akteur-Netzwerk-Theorie, die schon seit einiger Zeit in der Soziologie Aufmerksamkeit erfährt, schließt in diesem Sinne bewusst nicht menschliches Leben in ein Netzwerk des Tuns mit ein.25 Sie richtet die Aufmerksamkeit nicht auf einzelne, zu identifizierende Subjekte, sondern auf die Verbindungslinien, die Beziehungsweisen zwischen den Elementen lebendiger Systeme.
Ob der Mensch oder der Pilz nun einen größeren Einfluss auf das Gesamtsystem haben oder am Ende die Bakterien, die so fern unserer Vorstellungswelt agieren, ist eine müßige Frage; am Ende beeinflussen all diese unterschiedlichen Arten das Gesamtsystem von ihrem jeweiligen Standpunkt, mit ihren ganz unterschiedlichen Möglichkeiten und Interessen, sodass sie gar nicht notwendig in Konkurrenz zueinander geraten müssen. Wenn westliche Menschen ein Problem damit haben, die eigene Gattung nur als einen gleichwertigen Bestandteil von symbiopoietischen Systemen zu betrachten, dann liegt das an einer ideengeschichtlichen Tradition des Exzeptionalismus. Dessen Fehler liegt darin, die menschliche Intelligenz als allgemein überlegen zu betrachten, anstatt anzuerkennen, dass jede Art eine bestimmte Form der Intelligenz kultiviert, die ihre Lebensart bestimmt. Wenn die Pilze Netzwerke generieren können, in denen die Nährstoffe eines Waldes optimal verteilt werden, wenn Vögel mit verschiedenen navigatorischen Fähigkeiten zielsicher zehntausend Kilometer entfernte Orte auffinden, dann übersteigt die Intelligenz auf diesem Gebiet mit Sicherheit diejenige des Menschen.
Das Geniale an symbiopoietisch organisierten Systemen ist, dass diese verschiedenen Formen der Intelligenz sich verweben und gegenseitig unterstützen. Das Gesamtsystem gelangt dadurch zu so etwas wie einer zirkulierenden »Superintelligenz«. Freilich meine ich damit keine Superentität in dem Sinne, wie Lovelocks »Gaia« missverstanden wurde. Vielmehr geht es dabei um eine Gaia, wie Lovelock sie tatsächlich beschrieben hat und wie Bruno Latour sie rehabilitiert: um ein Netzwerk, ein Wissen, das in diesen Verbindungen, Bereichen, Rhizomhyphen zirkuliert, aber nie als ein Gesamtes greifbar wäre. So ist das Ganze weniger als seine Teile, die Teile aber mehr als isolierte Individuen. Solange der Mensch mit Polykultursystemen wirtschaftete, war er in dieses Netzwerk der zirkulierenden Superintelligenz eingebettet und unterstützte es mit seinen zweifelsfrei beeindruckenden Fähigkeiten.
Eine Unterscheidung zwischen Kultur und Natur oder zwischen Subjekt und Objekt konnte es nicht geben, solange der Mensch sich nicht ausschloss und sich seinem Narzissmus hingab. Erst mit dem späteren Anlegen von Monokulturen klinkte der Mensch sich aus diesem Netzwerk aus, vergaß erst diese Vielfalt der Intelligenz, um sie später zu negieren, aus ihr »die Natur« zu machen, von der er sich als kulturelles Wesen abgrenzte. Wie arm, wie einsam ist die Welt der Menschen seither geworden! Ein um sich selbst kreisender Kosmos der Arroganz. Wenn das Aufeinandertreffen der Arten in den symbiopoietischen Systemen Geschichten generierte, dann verarmte der Mensch mit dem Anlegen der Monokulturen, verlor zuerst diese überartlichen Geschichten und – wie wir noch sehen werden – auch von zwischenmenschlichen Geschichten.
Kommen wir noch einmal zurück zum Pilz: Seine weitverzweigte Hyphenstruktur ist für uns aus einem weiteren Grund interessant. Denn dieses Strukturprinzip ist nicht hierarchisch organisiert, sondern in Form eines horizontalen Netzwerkes strukturiert. Die Hyphen treffen sich an Knotenpunkten, von denen sie sich wieder in alle Richtungen verzweigen, bevor sie auf einen erneuten Knotenpunkt treffen. Durch diese Struktur ist eine ideale Vernetztheit möglich, ohne dass es einer zentralen Steuerungseinheit bedarf, ohne die das System nicht mehr funktionieren könnte. Eine Schwachstelle im System kann leicht über den nächstliegenden Knotenpunkt ausgeglichen werden.
Die Soziologen Deleuze und Guattari stellten dieses Strukturprinzip des Rhizoms dem der Hierarchie gegenüber. Bei der hierarchischen Struktur, die sie anhand des Beispiels der Gliederung eines Baumes beschreiben, ist das System in verschiedene Ordnungen eingeteilt. Der Stamm spaltet sich auf in starke Äste, die wiederum in schwächere Äste und Zweige verschiedener Ordnungen übergehen und so weiter. Der kleinste Zweig ist somit nur der Endpunkt eines ganzen Systems der Gliederung. Er hat keine Querverbindungen zu anderen feinen Ästen der gleichen Ordnung.
Dem Strukturprinzip des Baumes entspricht das Prinzip der überwundenen hochmodernen Wissenschaft, in der Gattungen sich in Arten und Unterarten gliedern – alle schön säuberlich isoliert voneinander und ohne Querverbindungen. Wie gesehen, ist das tatsächliche Strukturprinzip der Natur viel eher das eines Rhizomes. Polykulturen orientieren sich an dieser Rhizomstruktur, während Monokulturen durch die Umwandlung des Rhizomcharakters in ein hierarchisches Strukturprinzip entstehen. Auch menschliche Gesellschaften können entweder nach dem Strukturprinzip des Baumes (vertikal) oder eines Rhizomes (horizontal) organisiert sein. Staatliche Gebilde ordnen gerne alles nach einem klar hierarchisierten Prinzip ohne Querverbindungen zwischen den einzelnen Ordnungen. Nicht staatliche Gesellschaften hingegen zeichnen sich durch ihre Vernetztheit aus. Interessant ist nun, und damit nähern wir uns der Grundthese dieses Buches, dass Gesellschaften, deren Subsistenzstrategie auf Anbausystemen beruht, die der Multitude interartlicher Subjektivität Raum geben, auch ihre Gesellschaft nach dem horizontalen Muster eines Rhizomes gestalten, während Gesellschaften, deren Anbausysteme auf dem Ausschluss der Intersubjektivität beruhen, zu hierarchischen Strukturen tendieren.
Denn wie in der Natur das Tun einer Lebensform an das vorherige Tun anderer Lebensformen anknüpft und außerhalb dieses Flusses unterschiedlichen Tuns gar nicht existieren könnte, so sind meist auch die Beziehungsgeflechte nicht staatlicher, polytechnischer Gesellschaften in einen Fluss gesellschaftlichen Tuns gebettet: Das Tun der einen schließt sich in freier und kreativer, oft symbiotischer Weise an das zuvor Getane an. Tun manifestiert sich also stofflich wie ideell zu Getanem, welches gesellschaftlich zugänglich bleibt und nicht, wie in späteren Gesellschaften, von den Tuenden getrennt wird.26 Gleichzeitig ergibt sich dieses Gesellschaftsprinzip aus der Komplexität der Anbausysteme, in der eine Soziologie der Polytechnik weit erfolgreicher ist, als eine interessensgeleitete Vereinheitlichung und Regulierung des Tuns.
Noch ein Aspekt der Polykulturen ist entscheidend für dieses Buch: Durch das gemeinsame Wachsen eines Netzwerks der unterschiedlichen Pflanzenarten auf engem Raum wird das Sonnenlicht in optimaler Weise ausgenutzt, da jede Pflanze einen anderen (Höhen- und Tiefen-)Raum besiedelt. Einige Pflanzen spezialisieren sich zum Beispiel darauf, einen minimalen Rest diffusen Lichtes noch auszunutzen, den die oberen Blätterschichten der Bäume hindurchlassen, während sich andere auf die optimale Ausbeute des vollen Sonnlichtes spezialisieren. Deshalb kann in Polykulturen die Sonnenenergie effizienter aufgefangen und in nutzbare Produkte umgewandelt werden als in Monokulturen, die immer nur einen bestimmten Raum besiedeln (und das in der Regel auch nur während eines kurzen Zeitraums im Jahr). Obwohl das Land in der Polykultur also extensiver genutzt wird, weniger stark dem menschlichen Regime unterworfen wird, kann es mehr Menschen versorgen als die intensiver das Land (ver-)nutzende Monokultur. Dieser Aspekt ist grundlegend und wäre auch heute wieder der Schlüssel, um zu einer umweltverträglichen Versorgung der großen Bevölkerungen zu gelangen.
Nachhaltigkeit in den Waldgärten der Jōmon
Aufgrund der Landnutzung, die eng an die natürliche Vegetation angelehnt war, konnte sich die Kultur der Jōmon in Japan über die Jahrtausende entwickeln, ohne Umweltprobleme zu provozieren, wie sie später durch den Ackerbau entstanden. Trotz der Sesshaftigkeit und der guten Nahrungsgrundlage nahm die Bevölkerung nicht so sprunghaft zu wie in Ackerbaukulturen. Es dauerte ganze zehntausend Jahre, bis in der Zeit zwischen 3000 und 2000 v. Chr. die Siedlungen zunahmen und zentrale »Städtchen« entstanden, die als Umschlagplätze, kulturelle und auch spirituelle Zentren dienten. Eine dezentrale, rhizomförmige Zivilisation entstand, die zum Beispiel ausgeklügelte Formen der Astrologie und des Kalenders kannte und sich nie aus der Vernetztheit mit der sie umgebenden Umwelt löste. Im Vergleich zu den vielen Zivilisationen, die uns bekannt sind und die wir später noch behandeln werden, sind die Jōmon nicht an einer Übernutzung der Umweltressourcen zugrunde gegangen.
Dass die Jōmon – neben den Bergen – vor allem besondere Bäume verehrten, nimmt nicht weiter wunder, war doch vor allem ihnen das vergleichsweise angenehme Leben mit wenig Arbeit und guter Versorgung zu verdanken. Dass in Japan noch heute etwas von dieser besonderen Bindung der Menschen zu den Bäumen und Wäldern vorhanden ist, merkt man spätestens dann, wenn man mit einem psychischen oder physischen Leiden einen japanischen Arzt aufsucht und von ihm das »Waldbaden« verschrieben bekommt: einen Aufenthalt im Wald, der sowohl zur geistigen als auch zur körperlichen Heilung beitragen soll. Der Nutzen dieser traditionellen medizinischen Praxis ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, so sollen von den Bäumen ausgestoßene Botenstoffe unter anderem krebsvorbeugend wirken.27 Das Waldbaden ist nicht nur in Japan anerkannter Mainstream, sondern wird mittlerweile auch in Deutschland zunehmend populärer.
Die Natur nehme in Japan seit Jahrhunderten jene Stellung ein, die Religion und Philosophie in Europa beanspruchten, erklärte der Bürgermeister von Nagasaki 1989 einem deutschen Interviewer. In den Grundschulen von Nagasaki beginne »jede Schulhymne mit einem Vers über die Berge hinter der Schule, über den schäumenden Bach davor und die Kirschblüte daneben«.28
Auch die unter Holzhandwerker*innen auf der ganzen Welt bewunderte Holzbaukunst der Japaner*innen könnte ihren Ursprung schon in der Jōmon-Zeit haben. Da die Nahrungsversorgung auf Waldgärten basierte, war – anders als in Ackerbaugesellschaften – Holzknappheit nicht bekannt. Vor allem Esskastanienholz wurde meist zum Bauen genutzt. Durch den Kastanienanbau war es in großen Mengen vorhanden und hatte zudem den Vorteil, besonders witterungsbeständig zu sein. Die über tausendjährige Kulturperiode ohne Störungen und Verluste an Wissen hat sicherlich dazu geführt, dass die Techniken des Handwerks stetig weiterentwickelt wurden und zu einer enormen Breite der Polykultur beitrugen. Da die Eisenverhüttung noch nicht bekannt war, waren die Holzhandwerker*innen auf raffinierte Holzverbindungen ohne Nägel und Schrauben angewiesen. Diese haben sich bis heute erhalten. Die japanische Holzbauweise gilt nicht nur als ausgesprochen ästhetisch, sondern, da sie ohne Metall auskommt, auch als besonders ökologisch.
Nicht durch eine staatliche Organisation, sondern durch die Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung, durch Prozesse von unten, entstanden in der Jōmon-Zeit technische und soziale Fortschritte und ein geografisches Muster aus sozialen Netzwerken größerer und kleinerer Siedlungen. Weder gibt es archäologische Zeichen für Ungleichheit (die einzigen Hütten, die in ihrer Größe herausstachen, waren spirituelle Zentren), noch für kriegerische Auseinandersetzungen unter Menschengruppen (die aufgefundenen Waffen werden allesamt als Jagdwaffen identifiziert).29 Damit stehen sie im Kontext einer generellen Tendenz der vorstaatlichen Gesellschaften, über die Richard Lee schrieb: » Vorstaatliche Gesellschaften kannten keine übergeordnete politische Autorität. […] Es gab kein Privateigentum an Land; Land wurde stattdessen gemeinsam besessen, beispielsweise von allen, oder von Familien, Besitz von Einzelnen war rar. Produziert wurde für den Verbrauch, anstatt für den Austausch. Märkte gab es nicht und keine [ökonomisch-monetäre] Währung.«30 Friedrich Engels sprach hier einst vom Urkommunismus, den er als eine generelle Entwicklungsstufe der Menschheit ansah. Auch wenn menschliche Gesellschaften schon immer sehr unterschiedliche Entwicklungspfade einschlugen, so ist doch tatsächlich zu sehen, dass es in vorstaatlichen Gesellschaften fast immer die Tendenz zu Kooperation und ökonomischer Gleichberechtigung gab. Warum ist aber trotz der archäologischen Evidenz so wenig zu lesen über die Jōmon-Kultur, die offensichtlich lange vor den Kulturen im Nahen Osten Sesshaftigkeit, Pflanzenzüchtung und Töpferei »erfand«?
Der westlichen populären Erzählung der Geschichte und Menschheitsentwicklung scheinen eher die von Sklav*innen erbauten Tempel und Herrschersitze als Zeichen von Fortschritt zu gelten, die Amphitheater, in denen sich versklavte Menschen gegenseitig unter den Augen des Volkes und der Herrscher abschlachteten, als die Rundhütten einer egalitären Gesellschaft. Die brutalen Kriege der antiken Stadtstaaten und Reiche scheinen ihr mehr Beleg für Zivilisation zu sein, als das Leben der Jōmon-Kultur, die vermutlich in ihrer zwölftausendjährigen Geschichte keine Waffen gegen Menschen richtete. Dass die Abwesenheit von Kriegen und König*innen zu einer gewissen Langeweile unter Historiker*innen und Archäolog*innen führt, ist nachvollziehbar – die Militärtaktik eines Cäsar zu studieren, mag vielleicht aufregender erscheinen, als die Analyse der Anbautechnik von Esskastanien und Waldgartensystemen. Womöglich aber sollten wir unser Verhältnis zur Beschäftigung mit der Vergangenheit überdenken. Denn deren sozialer Nutzen liegt nicht in erster Linie in der guten Unterhaltung, sondern darin, Lehren für die Gegenwart und die Zukunft zu erzeugen. Vor allem in Zeiten wie den unseren, in denen wir drängende Probleme zu lösen haben.
Haselnusskultur in Mitteleuropa
Ganz entgegen dem gängigen Bild des Steinzeitmenschen als keuleschwingendem, jagendem Primitivling, hielt nach der Eiszeit auch in Europa eine Kultur Einzug, deren Ernährung sich hauptsächlich auf Nüsse, insbesondere Haselnüsse, stützte. Auch auf diese Gesellschaften wäre der Engels’sche Begriff des Urkommunismus anwendbar. Und auch hier gab es feste Siedlungen, die über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte von den gleichen Familien genutzt wurden, wenn auch nicht das ganze Jahr über.
War das Leben in Europa bis etwa 10.000 v. Chr. viel stärker als in Japan vom eiszeitlichen Klima geprägt, so deuten die Fundorte von Siedlungen an den Flussläufen auf eine fundamentale Änderung der Lebensweise zu dieser Zeit hin. Die Großwildjagd nahm ab und der Fischfang gewann an Bedeutung. Solange die Gewässer nicht überfischt wurden, was für diese Zeit kaum anzunehmen ist, lieferten sie regelmäßige Erträge, sodass ein stetes Umherziehen überflüssig wurde. Vielmehr ging es nun darum, sich gute Standorte an Flüssen zu sichern. Neben den Fischen wurde nun auch die Vegetation der umliegenden Landschaft für Nahrungszwecke interessant.
Dass die Haselnuss in der Steinzeit eine wichtige Nahrungsquelle war, ist allgemein bekannt. Meist stellt man sich das aber in etwa so vor: Die Menschen zogen durch die Gegend, lebten in erster Linie von der Jagd und sammelten das, was sie vorfanden – Nüsse und Beeren. Natürlich weiß man, dass diese nur zu bestimmten Jahreszeiten vorhanden sind – und meist sind Eichhörnchen oder Insekten schneller und übrig bleiben fast nur hohle Nüsse. So stellt man sich die vegetarische Nahrungsgrundlage der Mittelsteinzeit sehr spärlich vor und vermutet, dass die Jagd auf das Eichhörnchen, das soeben die letzten Haselnüsse weggeschnappt hat, ergiebiger gewesen sei.
Auch dieses Bild der Mittelsteinzeit ist freilich falsch: Weder zogen die Menschen in dieser Zeit in erster Linie umher, noch war die pflanzliche Ausbeute spärlich, noch wirtschafteten die Menschen ohne Blick in die Zukunft. Denn in diesem Bild fehlt die Haselnuss. Pollendiagramme aus Seesedimenten geben einen ziemlich genauen Eindruck davon, wie sich die Vegetation nach dem Ende der Eiszeit in Europa entwickelte: Etwa ab 10.000 v. Chr. setzten sich hier die Pionierbaumarten Birke, Weide und Kiefer durch. Diese Baumarten haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Haselnuss: Ihre Samen werden mit dem Wind kilometerweit verweht, sie können sich also extrem schnell verbreiten. Die schwere Haselnuss ist hingegen auf die viel langsamere Verbreitung durch Tiere angewiesen. Es ist also kein Wunder, dass Birke und Weide ganze zwei Jahrtausende vor der Haselnuss zurück in Europa waren und Standorte besetzten, die die Haselnuss als Pionierpflanze ebenfalls hätte besiedeln können. Aufgrund ihres höheren Wuchses haben diese einen Vorteil gegenüber der Hasel und lassen sich normalerweise nicht von ihr verdrängen. Lediglich im Unterholz oder am Waldrand konnte sie seit etwa 8300 v. Chr. Fuß fassen.
Wie Pollendiagramme zeigen, geschah dann etwas Bemerkenswertes, etwas, das als das »größte Rätsel der europäischen Vegetationsgeschichte«31 bezeichnet wird: Die Birken-, Weiden- und Kiefernpollen gingen über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten bis um 8000 v. Chr. stark zurück – und zwar zugunsten einer überraschenden Zunahme der Haselnuss. Wie es zu dieser Zunahme kam, ist umstritten, es ist aber nicht abwegig, dass sie auf einer Änderung der menschlichen Lebensweise und der Inkulturnahme der Hasel beruhte. Da bekannt ist, dass der Mensch in dieser Zeit in Mitteleuropa siedelte und bedeutende Funde von Haselnussschalen in Siedlungsresten ausgegraben wurden, lässt sich darauf schließen, dass die Haselnuss – neben dem Fisch – zur wichtigsten Nahrungsquelle wurde. Da wir auch wissen, dass der Mensch damals schon einen starken Holzverbrauch hatte, scheint es plausibel, dass der Mensch der Haselnuss durch Einschlag der anderen Baumarten zu größerer Verbreitung verhalf.
Warum die Haselnuss für den mittelsteinzeitlichen Menschen eine so große Bedeutung gewinnen konnte, wird deutlich, wenn man sich ihre Zusammensetzung ansieht: Sie hat große Anteile von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten und enthält zudem große Mengen wichtiger Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Das heißt, dass der Mensch sich notfalls lange Zeit alleine von der Haselnuss hätte ernähren können. Da mit dem Aufkommen der Wälder die Großwildherden weiter nach Norden zogen, war diese neue Nahrungsquelle mehr als willkommen. Sie konnte die Menschen über den Winter bringen und ihnen über Phasen des Wildmangels hinweghelfen. Haselnüsse dienten wohl als Grundnahrung, waren aber nur in den wenigsten Zeiten wirklich die einzige Nahrungsquelle. An den Flüssen und Seen war der Fischfang wichtig, die Jagd bereicherte nach wie vor den Speisezettel und das Sammeln von grünen Spinat- und Salatpflanzen, Wurzeln, Beeren und Samenpflanzen sorgte für reiche Abwechslung. Aber das Überleben garantierte wohl zunehmend die Haselnuss, weswegen sich das Leben auch mehr und mehr um die Notwendigkeiten des Nüssesammelns drehte und möglicherweise auch um das Pflegen der Nussstrauchbestände.
Eine wichtige Rolle bei der Rekonstruktion der mittelsteinzeitlichen Nahrungsversorgung spielt ein Fundort am heute verlandeten Duvensee in Schleswig-Holstein: Hier wurden Siedlungsplätze am Seeufer gefunden, die über zweitausenddreihundert Jahre hinweg saisonal bewohnt wurden. Über all die Zeit diente die Wohnstätte nachweislich in erster Linie dem Sammeln, Knacken, Haltbarmachen und Weiterverarbeiten von Haselnüssen. »Entsprechend ist es sicher kein Zufall, dass die frühesten Siedlungsnachweise gleichzeitig mit dem ersten Auftreten von Corylus [der Haselnuss; FH] in den Pollenprofilen im späten Präboreal fassbar sind«,32 so Daniela Holst, die die ausführlichsten neueren Forschungen zur Nussnutzung am Duvensee geleitet hat. Die dafür notwendigen Werkzeuge wurden gefunden – etwa Steine zum Knacken der Nüsse und komplexe Röststätten. Sie zeigen, dass es einen ausgeklügelten Verarbeitungsprozess gab, bei dem das Rösten eine zentrale Rolle spielte. Durch das Knacken und Rösten konnte das Transportgewicht der Nüsse halbiert werden, was wichtig ist, wenn wir davon ausgehen, dass die Röstplätze nur zur Ernte und Verarbeitung aufgesucht wurden und anschließend mit den haltbaren Haselnüssen im Gepäck weitergezogen wurde. Außerdem wurden die Nüsse wohl vor Ort verarbeitet und veredelt: »Eine weitere Verarbeitung der Nüsse zu Pasten, Mehl oder Öl ist nicht nur durch ethnographische oder volkskundliche Parallelen zu vermuten […], sondern durch die Funde entsprechender Felsgesteinartefakte archäologisch gesichert […]. Das große Potential solcher konzentrierten Nussprodukte für die Ernährung illustriert die Bedeutung von Haselnussöl im Mittelalter, das zusammen mit Bucheckernöl die Hälfte des Ölbedarfs deckte.«33
Die enorme Bedeutung der Haselnuss wurde am Duvensee aber nicht nur anhand verwendeter Werkzeuge deutlich, sondern auch durch die »ungeheuren Mengen Haselnussschalen«34, die in der Umgebung gefunden wurden und ganze Bodenhorizonte dominierten. Da die Haselnussschalen eine größere Energiedichte als Holz besitzen, wurde der Großteil der Schalen wohl verbrannt. Die aufgefundenen Schalen stellen trotz ihrer großen Menge nur einen Bruchteil der tatsächlich angefallenen dar. Hochrechnungen der jährlichen Haselnussernte zeigen dennoch, dass es möglich war, einen ausreichenden Jahresvorrat für die Bevölkerung anzulegen: »Bei einem angenommenen Tagesbedarf von 2.500 kcal bräuchte eine Person weniger als drei Tage, um ihren Monatsbedarf (75.000 kcal) zu erwirtschaften, wollte sie sich ausschließlich von Nüssen ernähren. Geht man von einer Erntesaison von 14 Tagen aus, könnte eine Person in dieser Zeit gut 44 Prozent ihres Energiejahresbedarfs allein durch Haselnüsse decken! Die konservative Hochrechnungsweise macht wahrscheinlich, dass die tatsächlich am Duvensee gewonnenen Haselnussmengen sogar noch deutlich höher waren!«35 Und sie hätten sogar noch höher sein können, denn das Erntepotenzial lag wohl noch höher, als die tatsächlich geerntete Menge.36 Wir haben es hier also mit einer Ökonomie des Überflusses statt einer des Mangels zu tun.
Über die Haselnussnutzung im Holozän schreibt Daniela Holst: »Durch seine markanten Innovationen in Subsistenzweise und Landschaftsnutzung unterscheidet sich damit bereits das frühe Mesolithikum deutlich vom Paläolithikum und nimmt im weiteren Sinne – bei ganz eigenem Charakter – aus dem Neolithikum bekannte Verhaltensweisen vorweg.«37 Mit anderen Worten: Zeitgleich mit der Kultivierung des Getreides und anderer einjähriger Pflanzen im Nahen Osten fand in Europa eine ganz ähnliche Entwicklung statt, nur dass hier nicht einjährige Pflanzen in Monokultur nutzbar gemacht wurden, sondern die mehrjährige Haselnuss in Polykultursystemen. Diese andere Nahrungsgrundlage im Neolithikum hatte auch andere Konsequenzen für das Leben der Menschen: Die Haselnussanlagen mussten nicht wie die Kornfelder im Nahen Osten ganzjährig betreut werden. Das heißt, dass es keine Notwendigkeit gab, das ganze Jahr am gleichen Ort zu bleiben – wichtig war nur, im Herbst zur Ernte und zur Verarbeitung vorbeizukommen. Das restliche Jahr konnten andere Quartiere aufgesucht werden und die Haselnusserzeugnisse mitgenommen werden.
Womit sich natürlich die Frage aufdrängt, warum die Menschen nicht einfach vor Ort blieben: Mit der Lage am See, der das ganze Jahr über Fischfang ermöglichte, und den großen Haselnussvorräten wäre es möglich gewesen, vollkommen sesshaft zu werden. Waren es also eher Traditionen, die die zuvor umherschweifenden Menschen dazu brachten, die alten Gewohnheiten nicht aufzugeben? Waren es rituelle Plätze, die aufgesucht wurden? Oder trieben sie Langeweile und Neugier, so wie wir heute die freie Zeit nutzen, um in den Urlaub zu fahren, etwas Neues zu sehen? Tatsächlich gehen Archäolog*innen davon aus, dass mit dem Beginn der Haselnussverarbeitung der Bewegungsradius der Menschen deutlich geringer wurde. Vermutlich gab es sogar andere Hauptsiedlungen, die für den Rest des Jahres bewohnt wurden.
In den Polykultursystemen am Duvensee hatte die Haselnuss eine wichtige Stellung als nahrhafteste Frucht, muss aber im Kontext eines breiteren Spektrums an Pflanzen gesehen werden, die unterstützt oder angebaut wurden und die der menschlichen Nahrung dienten. So war zum Beispiel der Rohrkolben in das System integriert, eine dem Schilf ähnliche Wasserpflanze, von der das Mark der Stängel und die Kolben selbst gegessen werden können, deren stärkehaltige Rhizome aber am nahrhaftesten sind: »Ein Hektar sumpfiges Gelände liefert bis zu acht Tonnen Mehl. Das ist mehr als unser Hochleistungsweizen in der intensiven Landwirtschaft zu bieten hat! Ein besonderer Vorteil der Rohrkolben ist: Die Rhizome können, aber sie müssen nicht, im Herbst geerntet werden, sie sind auch im Winter noch verfügbar.«38
Die hohe Produktivität kommt, ganz ohne Züchtung, dadurch zustande, dass der Rohrkolben im Seerandbereich immer ausreichend Wasser zur Verfügung hat und oberhalb der Wasserfläche das Sonnenlicht ungehindert aufnehmen kann, das sogar vom Wasser noch gespiegelt wird. Wasserrandgebiete sind deshalb immer die produktivsten Zonen. In vielen indigenen Landnutzungssystemen wurden diese Gebiete genutzt. In Ackerbaugesellschaften hingegen werden sie regelmäßig entwässert, um Getreidefelder anlegen zu können, was gerade unter Klimagesichtspunkten verheerend ist. Am Duvensee wurden in den Röstanlagen für die Haselnüsse auch Spuren von Rohrkolben gefunden. Es ist also möglich, dass es gar nicht nur die Haselnuss war, die die Besiedelung des Standortes begünstigte, sondern dass die Seelage in erster Linie aufgrund der Möglichkeit, dort Rohrkolben zu ernten (oder anzubauen), gewählt wurde und dass die Erträge an Rohrkolben ähnlich relevant waren wie die der Haselnuss – nur blieben von ihnen keine Reste in großen Mengen zurück, weil sie weniger widerstandsfähig sind als die Schalen der Haselnüsse. Jedenfalls ergänzte der Rohrkolben den Speiseplan der Mittelsteinzeit und wäre auch heute noch eine interessante mehrjährige Alternative oder Ergänzung zu Getreide.
Auch Rosensträucher machten sich die Menschen des Mesolithikums zunutze, deren Hagebutten sie schon früh verwendeten, um schmackhafte Süßspeisen herzustellen, wie archäologische Funde beweisen.39 Wenn die menschlichen Siedlungen in der Steinzeit also von Haselnusspflanzungen umgeben waren, viele andere Nutzpflanzen in Gärten angebaut wurden und in den Gewässern der Rohrkolben – war dann das steinzeitliche Europa also gar keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft, in der sich ein permakultureller Waldgarten an den nächsten reihte? War das Leben damals gar nicht so hart, ein täglicher Kampf um die Nahrung, wie wir heute für gewöhnlich glauben? Wuchs die Nahrung stattdessen auf den Bäumen und die Menschen mussten sie nur sammeln und lagern? Vieles spricht dafür. Und es gibt sehr wenige archäologische Anhaltspunkte, die für diese Zeit vor einem staatlichen »Gesellschaftsvertrag« den Hobbes’schen »Krieg aller gegen alle«40 belegen würden.
Namhafte Ur- und Frühgeschichtler*innen wie Eleanore Leacock oder Marshall Sahlins gehen vielmehr von einer extrem egalitären Gesellschaftsformation in dieser Zeit aus.41 Da durch die mehrjährigen Nahrungspflanzen ein relativ hoher Energieoutput bei relativ geringem Arbeitsinput möglich war, wurde es möglich, dass alle Familien zu einem gewissen Wohlstand fanden. Weil die Tätigkeiten zusätzlich abwechslungsreich und in das soziale Leben der Gemeinschaft eingebettet waren, ergaben sich keine Anreize oder Notwendigkeiten, die Arbeitskraft anderer auszubeuten. Vermutlich gab es noch gar kein ideelles Konzept einer Trennung von Arbeit und Freizeit. Und zwar nicht, weil rund um die Uhr gearbeitet werden musste, sondern weil die Arbeit selbstbestimmt und befriedigend war. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ein weiterer entscheidender Grund ist vermutlich darin zu sehen, dass der Nutzwert eines Gegenstandes noch nicht von einem Tauschwert überlagert war (was nicht heißt, dass es zu jener Zeit noch keinen Austausch von Waren gegeben hätte).