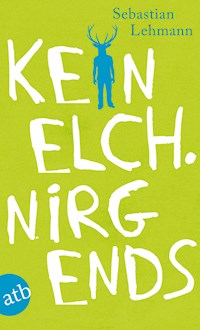Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Alles scheint sich zusammenzufügen, alles passt, wie eine perfekte Gerade, eine Strecke von A nach B. Aber je länger ich auf das brennende Haus starre, desto unklarer und verworrener wird es wieder. Die gerade Linie verwickelt sich, verknotet sich wie ein loser Faden. Und ich weiß auf einmal nicht mehr, wo der Anfang liegt und wo das Ziel, wann es losging und ob es jetzt zu Ende ist." Paul Ferber lebt mit seiner Familie in Berlin und sollte eigentlich seine Doktorarbeit über Liebe in der Literatur zu Ende schreiben. Doch inzwischen hat er genug von der Universität. Und auch das Thema seiner Arbeit überzeugt ihn nicht mehr. Stattdessen diskutiert er mit dem legendären Professor Emrald tagelang über die unendliche Wut Thomas Bernhards oder die richtige Mischung von Rum und Kaffee. Als er Lea begegnet, beginnt er zu verstehen, dass man keine Entscheidungen trifft. Entscheidungen widerfahren einem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Verlag Voland & Quist GmbH, Dresden und Leipzig, 2017
© by Verlag Voland & Quist GmbH
Korrektorat: Annegret Schenkel
Umschlaggestaltung: Lisa Bender
Satz: Fred Uhde
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
E-Book: zweiband.media, Berlin
ISBN: 978-3-86391-192-8
www.voland-quist.de
Sebastian Lehmann lebt in Berlin. Für radioeins und SWR3 schreibt er Kolumnen über Elternanrufe und Jugendkulturen. Er ist Teil der Lesebühne Lesedüne, die auch als Bühne 36 im Fernsehen und auf Netflix lief. Zuletzt erschien die Geschichtensammlung »Ich war jung und hatte das Geld – Meine liebsten Jugendkulturen aus den wilden Neunzigern« bei Goldmann.
»Er träumte niemals von ihr. Sie träumte niemals von ihm. Sie wurden nur geträumt, jeder für sich, von dem, der jeder von ihnen gern für den andern gewesen wäre.«
Maurice Blanchot
Inhalt
Titel
Impressum
Autoreninfo
Zitat
Erster Teil: Gerade
Zweiter Teil: Parallele
Dritter Teil: Abstand
Vierter Teil: Im Unendlichen
Epilog
Danksagung
Erster Teil
Gerade
Die Sirenen kommen näher. Lange wird es nicht mehr dauern. Ich blicke zum See, die Flammen spiegeln sich im dunklen Wasser, das von einem Schwarz ist, noch undurchdringlicher als der Nachthimmel in Brandenburg.
»Was haben Sie denn gemacht?«
»Nichts.«
Und es stimmt.
Unser Nachbar, der neben mir steht, starrt gebannt auf die erstaunlich hohen, grellorangen Flammen. Der Feuerschein taucht den Wald in flackerndes Licht. Es riecht nach Lagerfeuer.
»Eigentlich sieht es sogar schön aus.« Ich muss lachen, leise und freudlos.
Er schüttelt ungläubig den Kopf, murmelt irgendetwas Unverständliches und verschwindet in seinem Haus.
Alles scheint sich zusammenzufügen, alles passt, wie eine perfekte Gerade, eine Strecke von A nach B. Aber je länger ich auf das brennende Haus starre, desto unklarer und verworrener wird es wieder. Die gerade Linie verwickelt sich, verknotet sich wie ein loser Faden. Und ich weiß auf einmal nicht mehr, wo der Anfang liegt und wo das Ziel, wann es losging und ob es jetzt zu Ende ist.
Natürlich hatte mich Professor Emrald gewarnt, es ist noch gar nicht lange her.
»Wenn Sie weitermachen wie bisher, wird Sie das alles irgendwann heimsuchen – und dann ist es wahrscheinlich zu spät«, sagte er, als wir wieder einmal in seinem Büro saßen. »Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche, ich kämpfe schon lange mit Gespenstern, die sich nicht abschütteln lassen.«
Unser Nachbar, zurück auf seiner Veranda, wirkt noch aufgeregter. Seine Hände zittern. Erst jetzt bemerke ich das Mobiltelefon, das er an sein Ohr hält. Er flüstert die Worte wie ein Mantra: »Es brennt. Es brennt. Ja, wirklich, es brennt.«
Inzwischen kann ich auch das zuckende Blaulicht erkennen, nicht mehr weit entfernt auf der Bundesstraße.
Sie sind fast da.
Mir kommt wieder einmal diese Mathestunde vor vielen Jahren in der Schule in den Sinn, an die ich in letzter Zeit oft gedacht habe. »Bei zwei parallelen Geraden ist der Abstand aller Punkte auf diesen Geraden konstant. Sie sind immer gleich weit voneinander entfernt«, sagte unser erstaunlich junger, stets motivierter Mathelehrer. Das leuchtete sogar mir ein. Ich zählte nicht gerade zu den Mathe-Cracks und war immer froh, wenn ich eine Vier schaffte. Verschmitzt fügte er allerdings hinzu: »Im Unendlichen schneiden sie sich doch.« Das klang nach Science-Fiction, aber die Nerds in der Klasse nickten grinsend. »Wenn man zwei parallelen Linien mit den Augen folgt, scheinen sie sich aufeinander zuzubewegen«, erklärte unser Lehrer und schrieb einen kryptischen Beweis an die Tafel. Parallelität existierte also nicht, wenn ich das richtig verstand. Doch was sollte das bedeuten: »im Unendlichen«? In der Praxis hatte das schließlich keine Auswirkungen, selbst wenn es so »aussah«, es passierte ja nicht wirklich.
Als ich schließlich die Feuerwehrautos sehe, das brennende Haus vor mir, weiß ich, dass mein Mathelehrer recht behalten hat.
1
Wie jeden Morgen fuhr ich mit der U-Bahn zur Freien Universität, die am Stadtrand lag, tiefes Westberlin, eine Gegend, in die man sich kaum verirrte, wenn man nicht hier arbeitete oder studierte. Ich schlenderte zum Hauptgebäude, einem hässlichen, silbernen Raumschiff, in den fernen siebziger Jahren gelandet zwischen Gründerzeitvillen, schmucken Einfamilienhäusern und kleinen Parks. In einer knappen Stunde würde mein Seminar zur deutschen Nachkriegsliteratur beginnen, das ich jedes Semester anbot, den Titel variierte ich, die Inhalte blieben weitgehend dieselben. Bis jetzt hatte sich noch niemand beschwert.
Professor Emrald stand draußen vor dem unscheinbaren Eingang des Raumschiffs, das zum Großteil das Germanistik-Institut beherbergte, und rauchte einen Zigarillo. Er hatte vor ein paar Wochen verkündet, endlich damit aufzuhören, ich bemerkte jedoch keine Änderung. Er rauchte seine nach Vanille stinkenden Zigarillos einfach weiter. Wenn man ihn darauf ansprach – was ich natürlich nie getan hätte, doch Kollegen, mit denen ihn weniger verband, taten es manchmal – winkte er ab und sagte, es komme nur darauf an, was man sage, und nicht, was man tue. Die Kollegen lachten, weil sie dachten, er hätte einen seiner Scherze gemacht, aber ich wusste, dass er es ernst meinte.
Emrald glaubte nicht daran, dass Taten irgendwelche Konsequenzen nach sich zogen, wenn man nicht darüber redete. Also galt das ebenso umgekehrt: Wenn man lange genug über etwas sprach – dann trat es auch ein. Logik hielt er für überschätzt, er lebte sein Leben lieber, als schriebe er einen Roman. Und Romane sind selten logisch. Seinen Arzt, der ihm dringend nahegelegt hatte, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, würde diese Argumentation natürlich kaum überzeugen, doch wie ich Emrald kannte, hatte er auch für ihn eine passende Erklärung parat.
»Ferber«, rief er, als er mich sah, »ich muss dringend mit Ihnen sprechen.«
Emrald musste fast jeden Tag »dringend« mit mir sprechen, selten war es wirklich von Bedeutung, unterhaltsam war es so gut wie immer. Ich lehnte mich an die Eingangstür und atmete den widerlichen Vanillegestank ein. Studenten strömten an uns vorbei, manche nickten Emrald zu, er ignorierte es, so gut es ging. »Verbrüdern Sie sich nie mit Ihren Studenten!«, lautete einer seiner häufigsten Ratschläge an mich.
»In Leipzig findet eine Konferenz statt, an der Sie teilnehmen werden«, brummte er zwischen zwei Zigarillo-Zügen.
Wenn ich eins hasste, dann Konferenzen. Den Uni-Alltag in Berlin meisterte ich routiniert, darin hatte ich Übung. Lehranstalten in anderen Städten funktionierten nach ihren eigenen Gesetzen, die ich nicht kannte und auch nicht kennenlernen wollte.
»Es handelt sich genau um Ihr Thema.«
»Was ist denn mein Thema?«
Emrald schnaubte verächtlich und blickte einer jungen Studentin nach, die sich lächelnd an mir vorbeidrängte.
Mit meiner Promotion ging es seit nunmehr zwei Jahren nicht mehr voran, und Emrald musste sich bei der Institutsleitung ganz schön ins Zeug legen, um meinen Mitarbeitervertrag Jahr für Jahr zu verlängern. Sein Einsatz war keinem Altruismus oder anderen sentimentalen Gefühlsregungen geschuldet, jedenfalls nicht nur. Schließlich entlastete ich ihn mit meinen Seminaren nicht unerheblich, wie er vor jedem Semester freimütig zugab: »Ein Seminar, das Sie geben, muss ich nicht geben, Ferber! Und jedes Seminar, das ich nicht gebe, ist ein gutes Seminar. Vielleicht nicht für die Studenten, aber für mich und die kosmischen Energiefelder dieser Universität!«
Mir machte das Unterrichten nichts aus, es lenkte mich von meiner Doktorarbeit ab. Ich glaubte nicht mehr an das Thema, über das ich schon fast vierhundert Seiten geschrieben hatte: Konzeptionen der Liebe in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Ich hatte genug von der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Und der andere Teil des Titels überzeugte mich ebenfalls nicht mehr.
»Sie werden nach Leipzig fahren, mein Lieber. Nächstes Wochenende. So etwas finden die einfältigen Bürokraten von der Institutsleitung immer gut.«
»Das ist selbst für Ihre Verhältnisse recht kurzfristig.«
»Ich schätze, ich hätte Ihnen das schon früher sagen sollen.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung und grinste mich jovial an. »Das habe ich wohl vergessen.«
»Nachkriegsliteratur, vermute ich?«
»Das volle Programm, Ost und West. Hört sich alles sehr langweilig an. Immerhin gibt es einen Beitrag über Thomas Bernhard. Sie müssen selbst nur einen kurzen Vortrag halten, das Übliche. Nehmen Sie einfach irgendein altes Kapitel aus Ihrer komischen Arbeit, hört sowieso keiner zu.«
»Nächstes Wochenende ist wirklich sehr schlecht«, murmelte ich, wohl wissend, dass ich aus dieser Nummer ohnehin nicht mehr rauskam.
»Vergessen Sie’s. Schenker hat Sie längst angemeldet.«
Schenker war Emralds Sekretär. Der einzige männliche Büroleiter an der ganzen Universität – behauptete Emrald. Schenker schien für den Posten als seine rechte Hand wie geschaffen, stoisch ertrug er noch den seltsamsten Arbeitsauftrag, nichts und niemand konnte ihn aus der Ruhe bringen. Von seinem Privatleben wusste ich nichts, ich bezweifelte, dass er eines hatte. Er fuhr jeden Tag als Letzter nach Hause, mit seinem scheckheftgepflegten Rennrad, und betrat morgens als Erster das Institut. Trotz seines gelben Fahrradhelms saß sein Scheitel immer perfekt. Ohne Schenker, das wusste jeder, konnte Professor Emrald nicht überleben. Er überwachte sogar seine privaten Finanzen und schrieb die Weihnachtskarten an seine drei Ex-Frauen.
»Eigentlich habe ich da schon andere Pläne, Familie und so«, startete ich einen letzten Versuch.
»Oho, der Herr hat Familie!«, rief Emrald aus. »Wenn Sie nicht nach Leipzig fahren, dann haben Sie bald eine Familie und keinen Job mehr, um sie zu ernähren, Ferber. Wenn es nach mir ginge, dann könnten Sie bis zur Pension an Ihrer sinnlosen Dissertation rumschreiben. Und noch länger! Leider sehen das hier nicht alle so.«
Er blies den Rauch theatralisch in die Luft und rollte mit den Augen. Mit der Unileitung stand er traditionell auf Kriegsfuß, Autorität vertrug Emrald nämlich ausgesprochen schlecht. Obwohl er selbstverständlich all seine Mitarbeiter autoritär behandelte, bisweilen sogar mich. Zum Beispiel gerade jetzt. Ein Widerspruch, der ihm natürlich bestens gefiel.
»Ich tue doch alles, um Sie glücklich zu machen.« Eine Familie schützte nicht mehr, inzwischen war eine Familie zu einem Druckmittel geworden.
Emrald drückte den Zigarillo mit spitzen Fingern im Aschenbecher aus, als würde er einen Käfer zerquetschen. »Ich habe jetzt eine Vorlesung zu halten. Wie immer bin ich nicht im Geringsten vorbereitet. Und wie immer wird es brillant werden.« Er lachte hustend oder hustete lachend, strich über seine zerknitterte Krawatte und verabschiedete sich in Richtung Vorlesungssaal.
Ich blieb noch eine Weile vor dem Raumschiff stehen und beobachtete die zu spät kommenden Studenten, die außer Atem die Steinstufen hinaufhasteten. Sie schienen von Jahr zu Jahr jünger zu werden, aber natürlich wusste ich, dass ich es war, der immer älter wurde.
Die Universität bedeutete für mich einen Ruheraum, ich fühlte mich wohl hier – in den muffigen Gängen, in der Bibliothek, in meinem winzigen Büro, das ich mir mit einem anderen Doktoranden teilte, der höchstens einmal im Monat vorbeischaute, um seine Post abzuholen, und ansonsten zu Hause bei seinen Eltern unterm Dach hauste, eine immer wilder wuchernde Arbeit über Robert Musil schreibend. Oder war es Rilke? Sie würde auf jeden Fall genial werden, und er verschlang ein Stipendium nach dem anderen.
Sogar in der meist nach Bratensoße oder verbrannten Kartoffelpuffern stinkenden Mensa aß ich gern, saß an den weißen, langen Tischen bei den Fenstern und sah hinaus auf die Studenten und Dozenten, die gelangweilt vorbeischlenderten. Auch nach fast fünfzehn Jahren hatte ich nicht ergründen können, warum alle Gerichte einen penetranten süßen Honiggeschmack aufwiesen. Schlechter Geschmacksverstärker, vermutete ich. In Restaurants wunderte ich mich immer, wenn dieser Honiggeschmack fehlte.
Ich hatte an dieser Universität studiert, als Hiwi ganze Bücher kopiert und arbeitete jetzt schon fast vier Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich war hier zu Hause.
Eine Studentin, maximal einundzwanzig, rannte direkt an mir vorbei. Ich kannte sie, sie hatte letztes Semester eines meiner Seminare besucht, jedenfalls sporadisch. Außer an Stiller von Max Frisch hatte sie keinerlei Interesse gezeigt. An ihren Namen konnte ich mich nicht mehr erinnern, nur an ihre kurzen blonden Haare.
»Ich bin nicht zu spät«, rief sie mir grinsend zu und verschwand im dunklen Gang. Aber ich, dachte ich und folgte ihr ins Gebäude.
Robert schlief schon, als ich nach Hause kam. Er war vor ein paar Wochen fünf geworden und durfte jetzt bis neun wach bleiben, was ihn mit niedlichem Stolz erfüllte, da die meisten seiner Freunde aus der Kita schon um acht ins Bett mussten. »Höchstens halb neun«, hatte er kürzlich verkündet. Mittwochs schaffte ich es trotzdem nicht rechtzeitig nach Hause, um ihn ins Bett zu bringen und noch ein wenig aus Jim Knopf vorzulesen. Mein zweites Seminar endete erst kurz vor acht, und danach saß ich meistens noch ein wenig mit Emrald in seinem Büro, so auch heute wieder. In einem Schrank neben seinem Schreibtisch bewahrte er einige stets gut gefüllte Flaschen Rum auf, und wir genehmigten uns zum Feierabend gern einen kleinen Schluck, den wir in den übrig gebliebenen Kaffee vom Nachmittag schütteten. Dazu hielt Emrald einen seiner Privatvorträge, die mindestens so unterhaltsam waren wie seine offiziellen Vorlesungen – die Themen waren allerdings weniger wissenschaftlich. Vorhin hatte er über die attraktive spanische Gastdozentin gesprochen, die in druckreifen Sätzen sprach, deutsch und englisch, ohne erkennbaren Akzent. »Vielleicht ist sie in Wirklichkeit gar keine Spanierin«, mutmaßte Emrald, »sondern spielt nur die Rolle einer Gastdozentin.« Jedenfalls sei sie literarisch erstaunlich gut informiert, besonders was Thomas Bernhard anginge. »Ich konnte es gar nicht glauben, der alte Österreicher wird sogar in Spanien gelesen.«
Bernhard war einer seiner liebsten Autoren. »In seiner Unehrlichkeit ehrlich«, pflegte er über ihn zu sagen. »Ein Schwaller, der nie schwallt.« Wie gesagt, Emrald liebte Paradoxien: »Wie wollen Sie sonst eine widersprüchliche Welt beschreiben? Hören Sie mir auf mit Vernunft und Dialektik!«
Johanna saß auf dem Sofa in unserem Wohnzimmer, den Laptop auf dem Schoß, kleine Kopfhörer steckten in ihren Ohren. Der Bildschirm tauchte ihr Gesicht in bläuliches Licht. Wenn sie mich bemerkt hatte, ließ sie sich nichts anmerken.
Sie arbeitete viel von zu Hause aus, auch spätabends noch, seit sie vor einem halben Jahr ihren neuen Job bei einem kleinen Berliner Hörbuchverlag begonnen hatte. Im Grunde war sie für alles zuständig: Sie suchte Bücher aus, die eingelesen werden sollten, sie lektorierte die Manuskripte und überwachte die Produktion. Es gab ein winziges Büro im Prenzlauer Berg, das sie ein- oder zweimal pro Woche aufsuchte, um sich mit der Chefin des Verlags, der einzigen anderen Festangestellten, zu besprechen. Den Rest der Zeit arbeitete sie in unserem Wohnzimmer oder stritt sich in Tonstudios mit uneinsichtigen Regisseuren und besserwisserischen Sprechern. Trotzdem schien sie zufrieden, auch wenn die Bezahlung selbstverständlich miserabel war. Nach ihrem Volontariat hatte sie sich jahrelang mit befristeten Stellen durchgeschlagen, die teilweise nur ein paar Monate dauerten. »Diese ganzen Artikel über die mobile und flexible Arbeitswelt, die sind alle über mich«, hatte sie kürzlich gesagt. Im Gegensatz dazu war mein Arbeitsplatz an der Universität fast schon komfortabel, auch wenn Emrald mich zwang, an langweiligen Konferenzen teilzunehmen.
»Arbeitest du noch?« Ich ließ mich neben Johanna aufs Sofa fallen. Sie lächelte mich an, nahm die Kopfhörer aus den Ohren und drehte den Bildschirm in meine Richtung. Eine Serie lief auf einer illegalen Seite. Johanna stoppte die Wiedergabe. Ein Mann und eine jüngere Frau standen eingefroren auf einem Steg, der ins Wasser führte, und sahen sich verliebt an, aber gleichzeitig auch ängstlich.
»Dann bin ich beruhigt«, sagte ich. »Sonst würde ich mich wieder schlecht fühlen, weil ich den ganzen Tag nichts Sinnvolles geschafft habe.«
»Immerhin hast du heute zwei Seminare gehalten.« Sie klappte den Laptop zu.
»Eben, nichts Sinnvolles. Ich höre mir schon selbst nicht mehr zu, wenn ich den Studenten zum hundertsten Mal das Gleiche über Max Frisch oder Martin Walser erzähle. Und sie mir natürlich ohnehin nicht.«
Sie strich mir über den Kopf. »Du armer, missverstandener Literaturwissenschaftler.«
»Ach, das wäre schön, missverstanden zu werden. Leider verstehen mich alle immer genau richtig. Ich bin einfach sehr leicht zu durchschauen. Deswegen werden sie auch an der Uni bald merken, dass ich meine Diss nie fertig schreiben werde.«
»Das stimmt nicht, nur ich verstehe dich richtig. Und du verstehst dich schon gar nicht selbst.« Sie starrte mich ernst an.
»Das verstehe ich nicht.«
Johanna rollte mit den Augen.
»Was für ein Hörbuch produziert ihr gerade?«, fragte ich.
»Es geht um einen Mittdreißiger, der in einer Werbeagentur arbeitet, unheimlich viel Sex hat und in einer Sinnkrise steckt, da er sein Leben für bedeutungslos hält. Er beschließt alles hinzuwerfen, in den Kongo zu reisen und seine wahre Bestimmung zu suchen. Leider wird er sofort von Rebellen als Geisel genommen und in einem Erdloch gequält, bis sich eine schüchterne, aber wunderschöne Rebellin in ihn verliebt und schließlich befreit. Sie fliehen in ihr Heimatdorf, tief im Dschungel, wo sie sieben Kinder bekommen und glücklich in Einklang mit der Natur leben.«
Ich blickte Johanna ungläubig an. »Das hast du dir doch gerade ausgedacht.«
»Ich bitte dich, das ist ein Bestseller in Frankreich. Wir haben ganz schön viel Geld für die Rechte hingeblättert.« Sie lachte, während ich weiter den Kopf schüttelte. Das kam häufig vor. Sie tischte mir dreiste Lügengeschichten auf, stets mit einer Unschuldsmiene, die ich nach fünf Jahren immer noch nicht recht deuten konnte. Meinte sie es ernst, oder wollte sie sich über mich lustig machen? Zu diesem Spiel gehörte auch, dass es keine Auflösung gab. Sie hielt so lange daran fest, bis ich es glaubte – oder eben nicht. Oder ich spielte einfach mit.
»Das will ich unbedingt hören, wenn es fertig ist.«
Sie nickte, stand auf und stellte sich ans Fenster. »Ich bin unendlich müde. Und morgen muss ich den ganzen Tag ins Studio.«
»Ich bin hellwach, ich habe gerade mit Emrald fünf Tassen Kaffee getrunken. Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen können.«
Natürlich stimmte das nicht. Der Rum hatte mich viel müder gemacht als der Kaffee wach. Fünfzehn Jahre an der Uni – ich war im Grunde immun gegen Koffein. Wie immer würde ich kurz nach Johanna einschlafen, ihr gleichmäßiges Atmen strahlte solch eine Vertrautheit und Geborgenheit aus, dass ich allein kaum noch schlafen konnte.
Wir schlichen durch den Flur zu unserem Schlafzimmer, um Robert nicht aufzuwecken. Die alten Holzdielen knarrten trotzdem. Wir lugten durch den offenen Türspalt in sein Kinderzimmer. Man sah ihn kaum, so sehr hatte er sich in seine Decke gewickelt. Er schien nicht aufgewacht zu sein.
»Er kommt nach dir«, sagte ich, »schläft genauso fest und tief.«
Johanna nahm mich in den Arm, und wir beobachteten eine Weile, wie Robert ruhig in seinem Bett lag und schlief.
In diesem Moment war ich mir absolut sicher, dass mein Leben für immer so weitergehen würde.
In der Nacht lag ich wach. Das kannte ich schon, ich konnte zwar einschlafen, nach einer Stunde wachte ich jedoch wieder auf, unendlich müde, trotzdem nicht imstande wieder einzuschlafen. Ich starrte zur Decke, das gleichmäßige Atmen Johannas neben mir. Meine Arme und Beine fühlten sich von mir losgelöst an. Der Körper schien weiterzuschlafen, mein Kopf blieb wach.
Ich konnte mich nicht mehr an den Zeitpunkt erinnern, ab dem sich dieses Gefühl der Taubheit auszubreiten begann, das ich erst nur nachts gespürt hatte. Behutsam, aber unaufhaltsam strömte es durch mich, wie das Morphin, das ich einmal im Krankenhaus nach einer Operation durch eine Kanüle direkt in mein Blut geleitet bekam. Als würde sich alles immer langsamer bewegen, schließlich zum Stillstand kommen, und ich wäre dazu verurteilt, nur noch zu reagieren, oder besser: mich anzupassen an Gegebenheiten, die ich nicht beeinflussen konnte. Oft fand ich diese Vorstellung nicht einmal unangenehm, es bedeutete ja Berechenbarkeit und damit – Sicherheit.
Die Symptome hatten schon vor ein paar Jahren eingesetzt, das erste deutliche Anzeichen war wahrscheinlich das langsame Versiegen der Ideen für meine Dissertation gewesen. Noch ein paar Monate lang versuchte ich weiterzuschreiben, obwohl ich bereits ahnte, dass ich den Faden verloren hatte. Kapitel wurden zu Ruinen, Absätze zu Fragmenten, am Ende konnte ich nicht einmal mehr einen Satz zu Ende schreiben.
Kurz vorher war ich mit Johanna und Robert, ihrem Sohn aus einer anderen Beziehung, zusammengezogen. Hatte es damit zu tun? Das konnte ich mir nicht so recht vorstellen, denn ich fühlte mich wohl, ich war glücklich in unserer neuen, gemeinsamen Wohnung. Außerdem hatten wir auch schon davor fast jeden Tag zusammen verbracht.
Trotzdem verwirrte mich der Gedanke, dass dies nun mein Leben sein sollte, dass ich eine Entscheidung getroffen hatte, ohne sie wirklich zu treffen. Wie hatte ich mir meine Zukunft früher vorgestellt? Gar nicht, wenn ich ehrlich war. Wahrscheinlich dachte man mit siebzehn oder achtzehn einfach nicht weiter als ein halbes Jahr.
»Wenn man erwachsen wird, merkt man, dass man gar nicht erwachsen werden kann.« Emrald hatte das einmal gesagt. Paradox, ja. Aber gab es einen Ausweg? Konnte man sich, wie Kafka geschrieben hatte, »in die Büsche schlagen«? Lief nicht alles auf eine simple Frage hinaus (»Keine Angst vor der Banalität!«, höre ich Emrald rufen): Musste man sich immer entscheiden?
Ich sah zu Johanna, konzentrierte mich auf ihr gleichmäßiges Atmen und schlief schließlich wieder ein.
2
Der Leipziger Hauptbahnhof war im Grunde ein riesiges Einkaufszentrum, die üblichen Mode- und Imbissketten reihten sich auf mehreren Stockwerken aneinander. Draußen erwarteten mich grauer Himmel, breite Straßen und ein paar beeindruckende Gründerzeitgebäude. Obwohl Leipzig nur eine knappe Stunde Zugfahrt von Berlin entfernt lag, hatte ich es noch nie hierher geschafft.
Die Universität lag nicht weit vom Bahnhof entfernt. Ich irrte durch die unübersichtlichen Gänge, bis ich schließlich einen der Räume fand, in denen die Konferenz stattfinden sollte. Es war nicht viel los, nur eine andere vermeintliche Teilnehmerin der Konferenz stand vor der Tür und starrte auf ihr Smartphone.
»Nachkriegsliteratur?«, fragte ich halblaut.
Sie sah auf und nickte undeutlich. Die halblangen braunen Haare fielen ihr über die Stirn, und sie strich sie hinter die Ohren. Ihr Gesicht wirkte auf eine seltsame Art gleichzeitig verschlossen und offen. Mir fiel dafür nur ein altmodisches Wort ein: schelmisch. Sie trug einen viel zu großen olivgrünen Armeeparka mit einer fellbesetzten Kapuze. Als ich es schon fast nicht mehr erwartete, steckte sie ihr Handy in die Jackentasche, lächelte mich an, zeigte ihre weißen Zähne, und der ironische Ausdruck in ihrem Gesicht gewann die Oberhand. Ich fand sie sofort sympathisch.
»Ich bin auch Nachkriegsliteratur«, sagte sie und lachte ein wenig zu laut.
Ich stellte mich etwas zu förmlich vor (mit Nachnamen), und sie sagte, sie heiße Lea. Nach einer leicht peinlichen Gesprächspause betraten wir schließlich den Seminarraum.
Die Konferenz begann noch eintöniger, als ich es befürchtet hatte. Sogar der Vortrag über Bernhard zog sich zäh dahin, der Referent hatte offensichtlich nichts verstanden. Ein Schwaller, der schwallt. Ich dachte an Emrald, er hätte es hier keine zehn Sekunden ausgehalten und wahrscheinlich unter lauten Flüchen den Raum verlassen – und damit immerhin einen seiner Eklats erreicht.
Mein eigener Vortrag stand erst morgen an, und so döste ich vor mich hin. In der ersten Pause trank ich drei Tassen Kaffee, die mich kaum wacher werden ließen. Ich rief Johanna an.
»Was macht ihr?«, fragte ich.
»Ich räume auf. Brauchst du eigentlich noch diese komischen Figuren?«
»Jetzt geht das wieder los.«
»Star Wars? Hallo, das ist für Kinder.«
»Ich werde diese Diskussion nicht mehr führen, es ist eine intelligente politische Utopie.« Ich musste lachen. »Räum bitte nicht auf, wenn ich weg bin. Sonst schmeißt du bestimmt noch meine ganzen CDs weg.«
»Paul, niemand hört mehr CDs.«
»Ich schon.«
»Glaub mir, das ist mein Job. Alle downloaden nur noch. Oder streamen. Schon mal davon gehört?« Sie räusperte sich. »Wie ist es bei dir auf der Konferenz?«
»Das Übliche. Ich will nicht darüber reden. Die Konferenz zu erleben ist schon langweilig genug.«
»Robert ist jetzt doch bei Lars. Anscheinend haben sich Elke und Jon wieder zusammengerauft. Als ich ihn hingebracht habe, grinsten sie mich beide an, als würden sie bei einer Vorabendserie über junge, glückliche Pärchen mitspielen. Bald kaufen sie sich bestimmt einen Volvo und einen niedlichen Schäferhundwelpen und ziehen auf einen Bauernhof in Brandenburg. Das perfekte Familienglück. Man könnte glatt vergessen, dass mir Elke noch vor einer Woche erzählt hat, dass sie sich schon nach einer eigenen Wohnung umschaue. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.«
»Ich wäre jetzt gern bei dir.«
»Schleimer.«
»Ich wäre jetzt überall lieber als hier.«
»Ich dachte schon, du wolltest mal was Nettes zu mir sagen.«
»Ich sage oft nette Sachen zu dir.«
»Dass ich ein wenig wie Prinzessin Leia aussehe?«
»Das habe ich nie gesagt! Außerdem ist das natürlich ein Kompliment. Und wir wollen doch nicht so werden wie Elke und Jon …«
»Da besteht keine Gefahr, Paul. Wir haben ja nicht mal das Geld für einen Volvo.«
»Ich muss dann mal wieder rein, es geht gleich weiter. Bis morgen.«
»Bring doch einen Hundewelpen mit!«
Ich lachte und legte auf. Die Konferenzteilnehmer strömten zurück in den Vorlesungssaal. Lea schien nicht unter ihnen zu sein, vielleicht wohnte sie in Leipzig und war längst nach Hause gegangen.
Der nächste Vortrag sollte von Martin Walsers späten Romanen handeln, ich hatte keinen von ihnen gelesen und würde es auch nicht tun, obwohl es für mein Doktorarbeitsthema natürlich relevant gewesen wäre.
Als Letzter betrat ich den Saal und setzte mich ganz nach hinten. Ich dachte an meine Schulzeit. Konnte man nicht schon damals die Guten von den Schlechten anhand ihres Sitzplatzes unterscheiden? Die Schlechten saßen selbstverständlich hinten, mit möglichst viel Distanz zwischen sich und dem Lehrer. Natürlich bewunderten alle die Coolen aus der letzten Reihe. Sie fuhren mit Mountainbikes zur Schule, rauchten in der Hofpause verstohlen Zigaretten und lasen Comics unter dem Tisch. Ich saß früher immer in der Mitte. Ich bin mir sicher, dass Johanna zu der Letzte-Bank-Riege gehört hatte, als einziges Mädchen.
Nach dem Walser-Vortrag stand ich etwas abseits auf dem Flur und pumpte an einer riesigen Kaffeekanne, aus der allerdings nur noch ein kümmerliches Rinnsal schwarzer Flüssigkeit tropfte. Einen letzten Vortrag musste ich noch überstehen. Danach konnte ich in meinem Hotelzimmer verschwinden, mich auf dem Bett ausstrecken, das wahrscheinlich nach Desinfektionsmittel riechen würde, und irgendeine Doku über den Ersten Weltkrieg oder die Eröffnung eines Wellnessresorts an der Ostsee ansehen.
»Die ist leer.«
Ich sah auf, Lea stand neben mir und deutete auf die Kaffeekanne, deren Pumpmechanismus ich immer noch stoisch bewegte, obwohl der Kaffeefluss längst versiegt war.
»Paul war dein Name, oder?«
Ich nickte und unterdrückte ein Gähnen, das anonyme Hotelzimmer immer noch vor meinem inneren Auge.
»Hältst du auch einen Vortrag?«, fragte ich, weil mir nichts Besseres einfiel. Immerhin hörte ich auf, imaginären Kaffee zu pumpen.
»Nö.« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Ich bin einfach nur so vorbeigekommen, um mich von meiner langweiligen Diss abzulenken.«
Jetzt drängten sich natürlich die Anschlussfragen auf: Über was schreibst du deine Doktorarbeit? Und warum findest du sie langweilig? Kann überhaupt etwas langweiliger sein als diese Konferenz? Doch ich kam nicht dazu. Eine Frau trat zu uns, nickte uns schlecht gelaunt zu, wuchtete die leeren Kannen auf ihren Wagen und verschwand wieder.
»Das war’s dann wohl mit Kaffee für heute.« Lea lachte. »Wovon handelt dein Vortrag?«
»Liebe«, antwortete ich und kam mir unfassbar bescheuert vor. »Also … Konzeptionen der Liebe in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur.«
Jetzt, wo es keinen Kaffee mehr gab, könnte ich ja fragen, ob wir nicht zusammen einen trinken gehen wollten, schoss es mir durch den Kopf, einfach so, doch Lea wandte sich schon ab.
»Der nächste Vortrag geht los«, sagte sie, zum Glück ohne auf mein Dissertationsthema einzugehen, und ging zurück zum Seminarraum. Ich blieb einfach stehen, mein Kopf völlig leer, gedankenlos. Nach ein paar Metern drehte sie sich um und schaute zu mir zurück. »Kommst du mit?«
»Ja, klar, ich komme«, sagte ich und folgte ihr.
Rituale beruhigten mich. Jeden Morgen der Weg zur Universität, mit der altehrwürdigen U3 durch Westberlin. Die monumentalen Bahnhöfe – Heidelberger Platz, Rüdesheimer Platz, Breitenbachplatz. Wie es oben aussah, was für Plätze sich hinter den Namen versteckten, ich hatte keine Ahnung. Manchmal, auf der Rückfahrt, überlegte ich, einfach auszusteigen, aber tat es nie.
Diese Routine, jeden Tag die gleiche Strecke zu fahren, manchmal sogar die gleichen Gesichter in der U-Bahn zu sehen, bereitete mir ein seltsames Hochgefühl, das ich mit nichts vergleichen konnte außer anderen Routinevorgängen: zum Briefkasten gehen, die Zeitung aufschlagen, der erste Schluck Kaffee morgens im Stehen, aus dem Küchenfenster blickend. Sogar so etwas wie die Schuhe parallel ausgerichtet neben der Wohnungstür anzuordnen, vermochte dieses sanfte Glücksgefühl auszulösen. Ich schämte mich für diese kleinen Freuden, obwohl es Johanna ähnlich ging, wie sie freimütig zugab. Wenn sie zum Beispiel jeden Morgen sorgfältig das Bett machte oder das Besteck im Geschirrspüler sortierte. »Ich komme mir schon fast vor wie meine Mutter«, sagte sie. »Deine Mutter ist eine esoterische Alt-Achtundsechzigerin und besitzt nicht mal einen Geschirrspüler«, antwortete ich.
Mein liebstes Ritual wurde der kurze Weg von der U-Bahn-Haltestelle zum Institut. Die Luft schien mir reiner, und es war stiller als in der Innenstadt, trotz der Studenten, denen man hier überall begegnete. Wenn man nur eine Querstraße von den üblichen Wegen abwich, fand man sich plötzlich allein zwischen scheinbar unbewohnten Villen wieder. Auf den Gehwegen sammelte sich im Herbst das Laub der hohen Bäume, die jede der kleinen Straßen säumten, und morgens roch es fast das ganze Jahr über nach feuchtem Gras.
An diesem Morgen in Leipzig, eingesperrt in ein viel zu kleines Zimmer eines Billighotels, sehnte ich mich nach meinen morgendlichen Ritualen, nach dem Blick aus dem Küchenfenster, dem Weg zur Uni.
Ich duschte in einer Art Plastikkabine, in der ein blaues Neonlicht ansprang, wenn man die Dusche anstellte. Das ganze Zimmer war nur mit unglaublich hässlichen, wahrscheinlich wahnsinnig energiesparenden Lichtquellen ausgestattet und verströmte die Atmosphäre einer Leichenhalle. Kaum erfrischt stieg ich wieder aus der Kabine und sah mir mein Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken an. Im unerbittlichen Licht der Energiesparlampen wirkte es noch fahler, als es ohnehin schon war. Weiß wie Wachs. Dieses Gesicht mir gegenüber im Spiegel passte überhaupt nicht in diese fremde Umgebung, in dieses Plastikbadezimmer. Als hätte jemand mit einem schlechten Graphikprogramm ein Foto von mir in eine Computerlandschaft versetzt. Und wann hatte ich eigentlich angefangen, graue Haare zu bekommen? Ich fand nicht viele, vielleicht vier oder fünf an jeder Schläfe. Immerhin verlor ich meine Haare noch nicht.
Der erste Vortrag (schon wieder Walser, wie ich entsetzt feststellte) sollte um Viertel nach acht beginnen, und als ich mich kurz vorher im Seminarraum einfand, sah ich Lea nirgendwo. Nur langsam füllte sich der Raum mit müden Konferenzteilnehmern, wie ich brachte jeder einen Pappbecher mit Kaffee mit. Niemand von diesen übernächtigten Zombies würde im normalen Arbeitsmarkt bestehen (und ich als Letzter).
Ich bemerkte sie erst, als sie sich direkt hinter mir auf einen Stuhl fallen ließ und ihren Pappbecher auf den Tisch knallte.
»Guten Morgen«, rief sie und wirkte viel wacher als alle anderen. Ihre Haare trug sie heute als Pferdeschwanz, ein riesiger Schal, den sie kunstvoll um ihren Hals arrangiert hatte, verdeckte fast ihr ganzes Gesicht. Den Parka hängte sie über ihre Stuhllehne.
»Danach bist du dran, oder?«
Ich nickte müde und nahm einen Schluck aus meinem Becher.
Der Vortrag über Walser ließ sich überraschenderweise furios an. Dieses Mal ging es um Ein fliehendes Pferd, das einzige Buch von ihm, das ich halbwegs erträglich fand.
Diese ganzen Bücher verschwommen zusehends. Ich konnte mich kaum noch an die Handlung erinnern, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen hatte, schon gar nicht an den Anfang. Einmal begann ich aus Versehen ein Buch ein zweites Mal zu lesen, das ich vielleicht zwei Monaten vorher beendet hatte – es fiel mir erst nach hundertfünfzig Seiten auf. Also hatte ich beschlossen, einfach keine Bücher mehr zu lesen, beziehungsweise: Es war natürlich kein bewusster Entschluss gewesen – ich las einfach nicht mehr. Mein ganzes Leben lang hatte ich Bücher verschlungen, doch seit etwa einem Jahr rührte ich kein Buch mehr an. Ich wollte einfach keine Geschichten mehr hören. Ziemlich schlecht für einen Literaturwissenschaftler.
Der Vortrag handelte hauptsächlich von Liebe. Von sterbender Liebe. Mein Thema. Leider. Die alternden Pärchen am Bodensee, das verlogene Leben, der spießige Habitus, ich dachte an Elke und Jon – zu meiner Überraschung fand es der Vortragende allerdings gar nicht hoffnungslos. Das eine Paar fände einen Ausweg aus der peinlichen und festgefahrenen Situation, indem sie am Ende wieder miteinander reden würden. »Frei und wie gleichberechtigte Partner«, sagte er mit leuchtenden Augen. Beinahe hätte ich mich gemeldet und ihn darauf hingewiesen, dass das alles doch die immer gleichen, hilflosen Ausbruchsversuche seien, da gebe es ja wohl schon von Anfang an keine Hoffnung.
Der Referent schien tatsächlich begeistert von seinem Thema, er mochte dieses Buch wirklich und zitierte ständig irgendwelche Sätze Walsers, die er besonders treffend fand. »Man ist ja viel länger tot als lebendig«, zum Beispiel. Das hätte Emrald auch nicht besser sagen können. Leidenschaft für ein Thema findet man selten an der Uni. Dabei sah der Vortragende mit seiner blassen Haut und dem ausgebeulten Cordanzug wie ein Bilderbuch-Akademiker aus. Und mehr graue Haare als ich hatte er auch.
Ich war plötzlich viel wacher. Gespannt folgte ich den Ausführungen über den schrecklichen Walser und hätte mir beinahe sogar Notizen gemacht – wenn ich einen Stift dabeigehabt hätte. Ich spürte Leas Augen auf mir, auch wenn ich mich nicht traute, mich umzuschauen und ihren Blick zu erwidern. Falls sie mich überhaupt ansah. Ihre Gegenwart hatte mich wacher gemacht, als zwei Liter Kaffee es vermochten.
Der fünfundvierzigminütige Vortrag mit anschließender Fragerunde (Lea fragte nichts, ich natürlich auch nicht) verging wie im Flug, schon bedankte sich der Cord-Akademiker, und wir klopften anerkennend auf die Tische. Schließlich drehte ich mich doch zu ihr um, sie war bereits aufgestanden und wechselte ein paar Worte mit dem Referenten, sie schienen sich zu kennen. Sie verabschiedete sich schnell von ihm, wandte sich um und sah zu mir herunter, ich saß ja noch immer. Ruckartig stand ich auf – und plötzlich waren wir uns viel zu nah.
Wenn ich mich jetzt nach vorn beugte, hätte ich sie küssen können.
Warum dachte ich das?
Mir kam ein besonders schlimmer Satz aus dem Vortrag in den Sinn: »Jeder noch lebendige Mann will sich von seiner Frau trennen, nur Tote sind treu.«
Walser kotzte mich wirklich an.
Mein Vortrag sollte ebenfalls eine Dreiviertelstunde dauern, danach Fragen, wenn es welche gab – und es gab immer welche. Falls sich niemand von den Zuhörern meldete, improvisierte grundsätzlich einer der Organisatoren der Konferenz eine allgemeine Frage. Auch der Unibetrieb wird von Ritualen beherrscht.
Ich hielt den gleichen Vortrag wie immer, änderte bei jeder Konferenz nur den Titel, variierte die Reihenfolge und manchmal die besprochenen Texte. Ein Prinzip, das sich bei meinen Seminaren in Berlin bewährt hatte. Die Wiederholung brachte auch den Vorteil mit sich, dass ich gelassen und kompetent wirkte. Bloß nicht den Faden verlieren und anfangen zu stottern, sonst dachte jeder, man wäre schlecht vorbereitet oder noch schlimmer: dumm. Inhalte wurden überschätzt, denn, Emrald hatte es gesagt, es hört ohnehin keiner zu.
Heute lief mein Vortrag allerdings nicht ganz so rund. Ich versprach mich immer wieder und musste mich korrigieren, weil ich im Manuskript verrutschte. Fahrig manövrierte ich mich durch meine Argumentation, und als ich zum Ende kam, schielte ich zum ersten Mal auf mein Handy. Es war schon kurz vor zwölf. Gut, ich hatte aus dem Stegreif einen Exkurs zu Bernhards Holzfällen eingefügt, das ich gerade im Seminar besprach und das eigentlich überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun hatte; aber das sollte eine Viertelstunde Überlänge verursacht haben?
»Tut mir leid«, stotterte ich und blickte auf die etwa dreißig anwesenden Zuhörer, weniger als gestern Nachmittag, das gleiche Phänomen bei jeder Konferenz: Am Morgen des zweiten Tages erscheint nur noch ein Bruchteil. Sie starrten mich apathisch an. »Gibt es noch Fragen?«
Murmeln setzte ein, und ich hoffte inständig, dass niemand meine Berechtigung, Holzfällen in einen Vortrag mit dem Titel Konzeptionen der Liebe aufzunehmen, kritisierte. Tatsächlich rang sich nicht einmal einer der Organisatoren zu einer Frage durch, vielleicht war gar keiner anwesend. Nach einem kurzen Blick in die Runde beendete ich die Sitzung.