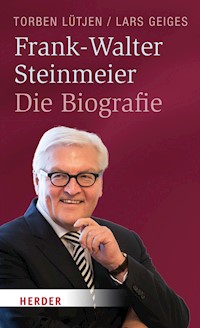12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Von den Kreuzzügen des George W. Bush über die schrillen Attacken der »Tea Party« bis hin zur populistischen Mobilisierung Donald Trumps: Amerikas Konservative halten die USA in Atem. Für viele Europäer handelt es sich um ein verstörendes Phänomen, da die Kombination aus radikalem Individualismus, tiefer Religiosität und Hyperpatriotismus hierzulande in dieser Form kaum existiert. Das Buch zeichnet die Formierung einer politischen Bewegung nach, die vom Rande des politischen Geschehens in den letzten Jahrzehnten in das Zentrum der amerikanischen Politik gelangte - und fragt schließlich nach der Zukunft einer Partei, die den Vormarsch des Außenseiters Donald Trump nicht zu stoppen vermochte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Ähnliche
TORBEN LÜTJEN
Partei der Extreme: Die Republikaner
Über die Implosion des amerikanischen Konservativismus
[transcript]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2016 transcript Verlag, Bielefeld
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Korrektorat: Katharina Rahlf, Demian-Noah Niehaus Print-ISBN 978-3-8376-3609-3 PDF-ISBN 978-3-8394-3609-7 EPUB-ISBN 978-3-7328-3609-3
Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
Inhalt
1. Der Geist, den sie riefen
Die Geschichte des amerikanischen Konservativismus als Geschichte eines Kontrollverlustes
2. »The Global March to Socialism«
Der New Deal und die Anfänge des amerikanischen Konservativismus
3. Markt, Gott, Antikommunismus
Zur intellektuellen Formierung einer Bewegung im Schatten des Kalten Krieges
4. Go West … and South
Barry Goldwater und die Transformation der Republikanischen Partei
5. 1968 und die Silent Majority
Wie die Republikanische Partei den Populismus entdeckte
6. Kulturkrieg
Der Aufstieg der Religiösen Rechten
7. »It’s Morning in America«
Ronald Reagan und die unvollendete Revolution
8. American Angst
9/11, die Kreuzzüge des George W. Bush, der amerikanische Konservativismus als Parallelgesellschaft und der Aufstand der Tea Party
9. Wer dem Affen zu viel Zucker gibt …
Donald Trump und die Auflösung einer politischen Bewegung
Danksagung
Literatur
1. Der Geist, den sie riefen
Die Geschichte des amerikanischen Konservativismus als Geschichte eines Kontrollverlustes
All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure. MARK TWAIN
Am 12. Mai 2016 ließ sich der Journalist der Washington Post, Dana Milbank, ein ganz besonderes Mahl kredenzen, zubereitet vom Starkoch Victor Albisu und ausgestrahlt im Livestream der Zeitung: Zusammen mit einem Glas Weißwein verspeiste Milbank in mehreren Gängen ein Stück kleingehäckselte Zeitung. Es war nicht irgendeine Zeitung, sondern die seines Arbeitgebers, der Washington Post. Und auf seinem Teller befand sich auch nicht irgendeine Seite, sondern seine eigene Kolumne vom Oktober des Vorjahres. Ein Genuss sei es nicht gewesen, gab er hinterher zu, aber durchaus nicht so furchtbar wie zuvor gedacht.
Milbank hatte weder den Verstand verloren, noch glaubte er, auf diese Weise einen besonders hippen kulinarischen Trend ins Leben rufen zu können. Er war einfach nur ein Mann, der sein Wort hielt. Denn in der besagten Kolumne vom Oktober 2015 hatte der Journalist nicht nur kurz und knapp erklärt, dass Donald Trump niemals, und zwar wirklich niemals, die Nominierung als Republikanischer Präsidentschaftskandidat würde erringen können. Er hatte auch ein im Rückblick leichtsinniges Versprechen abgegeben: »The day Trump clinches the nomination I will eat the page on which this column is printed.«1
Mit dieser speziellen Wette stand Milbank zwar allein; ansonsten aber war er in guter Gesellschaft. Trumps Aufstieg ist nicht zuletzt eine schwere Niederlage für die Klasse der amerikanischen (und ausländischen) Politikdeuter. Würde man alle medialen Abgesänge auf den Kandidaten Trump sammeln und veröffentlichen: Man hätte gewiss schnell den Umfang der Marx-Engels-Gesamtausgabe beisammen. In diesem Fall darf man ganz undifferenziert feststellen: Auch und gerade die vermeintlich Besten und Klügsten ihrer Zunft lagen allesamt und ausnahmslos daneben. Im Sommer 2015, der Trump-Hype war erst ein paar Wochen alt, sprach David Remnick, Herausgeber des New Yorker, vom »Trump Balloon«, aus dem schon bald die Luft entweichen werde; die ganze Sache würde vorüber sein, bevor in Iowa (wo traditionell die erste Vorwahl stattfindet) der erste Schnee gefallen sei.2 In die gleiche Kerbe schlug James Fallows, der für den Atlantic seit Jahrzehnten amerikanische Wahlkämpfe beobachtet: »Donald Trump will not be the 45th president of the United States. Nor the 46th, nor any other number you might name. The chance of his winning the nomination and election is exactly zero.«3
Im Herbst 2015 aber führte Trump die Umfragen noch immer an. Die meisten nahmen es trotzdem noch nicht ernst. Ende November (in Iowa war der erste Schnee schon wieder geschmolzen) platzte Nate Silver, dem beizeiten schon kultisch verehrten Datenguru des Blogs FiveThirtyEight schließlich der Kragen, weil einige Kollegen meinten, das Ganze könne vielleicht doch irgendetwas zu bedeuten haben. Sein Appell: »Dear Media, Stop Freaking Out About Donald Trump’s Polls«4. Und so ging es weiter. Selbst nachdem Trump die ersten Vorwahlen für sich entschieden hatte, blieben nicht wenige dabei, dass so jemand niemals von der sogenannten Grand Old Party nominiert werden würde.
Indigniertes Naserümpfen aus dem universitären Elfenbeinturm ist gleichwohl gänzlich unangebracht. Denn auch die Politologen (einschließlich des Autors, den aber zum Glück niemand öffentlich um seine Meinung gebeten hat) sahen lange Zeit nicht, was da auf das Land zurollte. Schließlich hatte sich schon seit Längerem die Meinung durchgesetzt, dass die amerikanischen Parteien trotz der parteiinternen Vorwahlen ziemlich effektiv in der Lage seien, Außenseiter von der Nominierung fernzuhalten: »The Party Decides«, wie ein oft zitiertes Buch über die Gesetzmäßigkeiten amerikanischer Primariesheißt.5 Und noch aus einem anderen Grund hielt man Trumps Kandidatur für eine Totgeburt. Denn in einem Land, in dem sich beide Parteien über Jahrzehnte hinweg ideologisch hochgerüstet hatten und sich permanent ihrer weltanschaulichen Prinzipienfestigkeit rühmten (und die Republikaner taten das noch weitaus mehr als die Demokraten), schien es unmöglich, dass die Republikanische Parteibasis einen solch unverblümten Anbeter des politischen Nihilismus (und ansonsten seiner selbst) auf ihr Schild hieven würde. Die Republikaner waren im Verlauf der letzten fünf Jahrzehnte eine sehr konservative Partei geworden, konservativ freilich in einer sehr spezifisch amerikanischen Variante: als Partei eines weitgehend deregulierten Kapitalismus und einer Befürwortung des globalen Freihandels, einer traditionellen christlichen Sozialmoral und einer auf militärische Stärke und Interventionismus setzenden Außenpolitik. Wer in der Partei Karriere machen wolle, so hieß es, der sei gut beraten, diese Parteilinie nicht in Frage zu stellen.
Doch dann kam Trump, den das meiste davon entweder einen feuchten Kehricht kümmerte oder der sogar offen gegen diese Programmatik verstieß. Stattdessen hantierte er mit den Versatzstücken eines xenophoben und teilweise auch offen rassistischen Identitätspopulismus, der Europäern seit geraumer Zeit nur allzu vertraut ist. Und entgegen aller Wahrscheinlichkeit und Theorie funktionierte es.
Angesichts einer solchen kollektiven Fehlinterpretation scheint eine Inventur der Gründe seines Aufstiegs umso dringlicher. An jenem Tag im Trump Tower, als der Immobilien-Tycoon die Rolltreppe herunter(!)fuhr, um seine Kandidatur bekanntzugeben, und Mexikaner als »Mörder« und »Vergewaltiger« bezeichnete, hatte er eine kleine und spontan improvisierte Probebohrung auf dem Grund des amerikanischen Bewusstseins durchgeführt. Und alle waren überrascht – vermutlich auch Trump selbst –, auf welch ergiebige Quelle er dabei gestoßen war und wie kräftig sie fortan sprudeln würde. Amerika wird noch lange brauchen, um das Bohrloch wieder zu versiegeln; aber wir tun gut daran, zuerst zu verstehen, welche Art von Vorkommen Trump dabei angezapft hat.
Wie so häufig bei plötzlichen Paradigmenwechseln gilt auch hier Tocquevilles Ausspruch über die Französische Revolution: so unvorhergesehen – und doch so unvermeidlich. Denn mittlerweile gibt es selbstverständlich eine Fülle von Erklärungen für Trumps Aufstieg. Im Großen und Ganzen laufen sie jedoch auf drei Grundinterpretationen hinaus – die sich freilich nicht gegenseitig ausschließen müssen.
Die eine Möglichkeit, auf ein unerwartetes, theoriewidriges Ereignis zu reagieren, ist, es einfach zur Ausnahme zu erklären. Die erste Erklärung für Trump lautet daher: Trump. Nun fühlen sich Sozialwissenschaftler mit einigem Recht dazu angehalten, strukturelle Gründe zu identifizieren, langfristige, soziale und kulturelle Entwicklungen einzubeziehen. Und doch sollte man dieses Argument nicht leichtfertig als banale Personalisierung der Medien abtun. Denn es stimmt ja, dass der New Yorker in vielerlei Hinsicht eine singuläre Figur ist, für die sich kaum ein Pendant findet, weder in den USA noch anderswo. Seit mehr als dreißig Jahren ist Trump Teil der amerikanischen Unterhaltungs- und Alltagskultur, bekannt wie sonst nur Schauspieler, Rockstars, Sporttitanen und, man traut es sich kaum zu sagen, Präsidenten. Das bedeutet auch: dreißig Jahre Training vor der Kamera. Etwas mehr als zehn Jahre war er der Star der Scripted Reality-Show »The Apprentice«; und wie, wenn nicht als Scripted Reality, soll man die Vorwahlkämpfe der Republikanischen Partei beschreiben? Diese mediale Dauerpräsenz sicherte Trumps Provokationen und Tabubrüchen von Anfang an eine Aufmerksamkeit und eine Sendezeit, die andere Kandidaten nie erhalten hätten. Schon zu Beginn der Vorwahlkämpfe hatte Trump zudem ca. fünf Millionen Follower auf Twitter – eine Zahl, die mehr als drei Mal so hoch ist wie die Auflage der New York Times.
Und doch ahnen wir, dass Trumps Aufstieg Teil von etwas Größerem ist; nicht nur, weil es derzeit eine Reihe verwandter politischer Phänomene in anderen Demokratien gibt, über die noch zu reden sein wird. Hätte Trump seinen Aufstieg primär seinem Celebrity-Status zu verdanken, hätte sich seine Methode vermutlich schnell erschöpft. Trump wird getragen von einer so unverhohlenen und mit den Händen greifbaren Stimmung der Wut und des Zorns, dass diese sich vermutlich auch ohne ihn irgendwie Bahn gebrochen hätte. Auch andere Kandidaten ritten auf dieser Welle; nur eben nicht so virtuos und erfolgreich wie Trump.
Die zweite Erklärung setzt genau bei diesen Emotionen an – sie ist die fraglos geläufigste, auch und gerade in deutschen Medien. Der Erfolg der Trump-Kampagne, so heißt es, sei ein Symptom der tiefen sozialen Ungleichheiten, welche die USA prägen, Trumps Wähler seien eine Schar frustrierter Angehöriger der weißen Arbeiterklasse. Ökonomisch abgehängt, in ihrem Status als Mehrheitskultur im Land bedroht und zutiefst hadernd mit dem kulturellen Wandel des Landes, hätten sie sich schließlich dem Mann in die Arme geworfen, der ihrem Zorn die lauteste Stimme verleihen konnte.
In der Tat hat die Finanzkrise 2007/08 für eine nochmalige Verschärfung der sozialen Disparitäten im Land gesorgt und vor allem viele Mittelklasse-Amerikaner unter enormen ökonomischen Druck gesetzt. Häufig wird pauschal konstatiert, dass der amerikanische Traum zerbrochen sei; doch eigentlich muss die Frage lauten: für wen eigentlich? Seit Jahrzehnten werden die Amerikaner von Meinungsforschern befragt, ob sie glauben, dass es ihren Kindern einmal bessergehen werde als ihnen selbst. Bis vor Kurzem lautete die mehrheitliche Antwort noch immer »Ja« – bis 2011. In diesem Jahr verneinte zum ersten Mal das Gros der Amerikaner diese Frage. Der Punkt war jedoch: Eine Majorität von Afro-Amerikanern, Hispanics oder Asian-Americans gab nach wie vor eine positive Antwort – es ist somit vor allem ein Teil des weißen Amerika, der den Glauben an den eigenen sozialen Aufstieg und den seiner Kinder verloren hat.6 Der Begriff der White Working Class ist auch in den USA nicht besonders präzise und eher diffus. In jedem Fall aber ist er etwas weiter gefasst als in Deutschland oder Europa im Allgemeinen. Gemeint sind damit in der Regel solche US-Bürger, die in Beschäftigung sind, aber über keinen College-Abschluss verfügen.7 Es sind die Amerikaner aus diesem schrumpfenden, aber quantitativ noch immer bedeutenden gesellschaftlichen Segment, für die Trumps nostalgische Losung »Make America Great Again« ein Versprechen auf eine versunkene Vergangenheit ist, auf die »gute alte Zeit« – wobei sich freilich schwarze Amerikaner aus dem Süden der USA fragen mögen, wann diese Zeit denn gewesen sein soll.
Auch diese Interpretation hat viel Plausibles für sich. Mehr noch: Ohne sie ergäbe keine andere Interpretation einen Sinn. Doch nur für sich genommen, ist sie unvollständig. Man kann dabei noch beiseite lassen, dass Trumps Unterstützer dem populären Bild eines verarmten »Trumpenproletariats« nicht wirklich entsprechen, es sich in Wahrheit eher um die sprichwörtliche Mitte der Gesellschaft handelt8 – denn Abstiegsängste sind stets subjektiver Natur und betreffen oft gerade jene, die noch einiges zu verlieren haben.
Das wirkliche Problem mit dieser Interpretation ist ein anderes: Es handelt sich um eine deterministische und mechanische Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen sozialen und gesellschaftlichen Zuständen und der Entstehung von Protest oder der Artikulation politischen Unbehagens. Natürlich ist für jedermann offensichtlich, dass Angst und Verunsicherung, Bitterkeit und Zorn eine große Rolle bei Trumps populistischer Sammlung spielen. Nur: Warum manifestiert sich die Wut der Trump-Wähler dann gerade auf diese Art und Weise und nicht anders? Auch die Wähler von Bernie Sanders, der ebenfalls mit dem Etikett des Populisten belegt worden ist, sind wütend; aber offenkundig artikuliert sich ihre Wut anders, kennt andere Adressaten und glaubt auch, sich auf andere Art und Weise Abhilfe verschaffen zu können.
Man kann es sogar noch weiter zuspitzen: Aus Wut alleine folgt nichts. Sie muss in bestimmte Bahnen gelenkt, muss geformt werden und eine eigene Sprache finden. Im politischen Feuilleton der Gegenwart hat die Wut momentan verständlicherweise keinen guten Leumund, da sie derzeit (anders noch als zu Beginn der Finanzkrise) primär aufseiten der Reaktion, der Gegenaufklärung, der Gegner von Toleranz und Liberalität zu stehen scheint. Doch so muss es nicht sein. Am Anfang aller politischen Bewegungen, auch jener, die ein großes emanzipatorisches Potenzial entfalteten, stand immer die Wut, ausgelöst durch Herabsetzungen und Demütigungen, welche die menschliche Würde und den Stolz verletzten: Das war bei der Arbeiterbewegung nicht anders als bei der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder bei den Bewegungen für die Rechte von Frauen oder Homosexuellen. Aber der Wut muss ein Ziel gegeben werden, das sie in eine spezifische Richtung lenkt. Daraus kann dann, wie gerade angedeutet, auch ein positives Ethos erwachsen. Fehlen allerdings diese Wegweiser, kann die Wut in ganz und gar destruktive Bahnen abdriften.9
Die Geschichte der Wut, der Trump seinen Aufstieg zu verdanken hat, ist im Grunde die dritte Erklärung dieses Phänomens. Es ist zugleich die Ebene, um die es in den folgenden Kapiteln dieses Buches gehen soll. Denn der Zorn der Trump-Wähler ist natürlich nicht über Nacht gekommen. Trump hat die Wut nicht geschaffen; er bedient sie nur. Und sie war auch schon lange vor der Finanzkrise da; es hatte sie schon gegeben, bevor ein Schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Die Wut ist seit über fünf Jahrzehnten Teil der konservativen Bewegung. Deren Akteure und Vordenker haben sie gehegt und gepflegt, sie für ihre Zwecke abgerichtet und damit Wählerschichten erreicht, die ihnen allein als Partei von Small Government oder als Verteidiger christlicher Moralwerte niemals zugefallen wären.
Die Geschichte dieser Wut soll in diesem Buch erzählt werden. Es ist zugleich die Geschichte eines Kontrollverlusts. Genauer gesagt: des Verlusts der Deutungsmacht der Republikaner über die eigene Erzählung. Die Partei hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte so hemmungslos einer populistischen Rhetorik bedient, hat sich so andauernd als Anti-Establishment-Partei inszeniert und so permanent gegen ein vermeintliches Elitenkartell agitiert, dass sich diese Erzählung am Ende verselbstständigt hat – und schließlich gegen ihre eigenen Urheber richtete.
Ein wenig ähnelt die Grand Old Party des Jahres 2016 Goethes Zauberlehrling, der die einmal entfesselten Kräfte nicht mehr kontrollieren kann. In den USA ist das natürlich eine recht unbekannte kulturelle Referenz; aber manche Beobachter dort haben andere literarische Analogien zu Trumps Aufstieg gefunden. Robert Kagan etwa, ein neokonservativer Intellektueller, der Trump vehement ablehnt, hält es mit Mary Shelleys »Frankenstein«: Trump, schreibt Kagan, »is the party’s creation, its Frankenstein’s monster, brought to life by the party, fed by the party and now made strong enough to destroy its maker«10.
Und es ist nicht die Wut alleine, die in dieser Kampagne kulminiert. Es ist ja kein Zufall, dass Trumps Selbsterfindung als Politiker im Jahr 2011 – obgleich er seit zwei Jahrzehnten mit einer Kandidatur als Präsidentschaftskandidat geflirtet hat – erst im Fahrwasser der Birthers richtig begonnen hat: jener Verschwörungstheoretiker, die überzeugt sind, Obama sei von Geburt kein Amerikaner, seine Geburtsurkunde gefälscht und er insofern eigentlich illegitim im Amt. Auch dieser Hang zur Paranoia ist tatsächlich keine Innovation der Obama-Jahre, sondern sogar noch älter als der Populismus der Republikanischen Partei: »There is indeed little new under the wingnut sun«, wie es der Historiker Rick Perlstein in Bezug auf die Wiederkehr einer radikalen amerikanischen Rechten ausdrückt.11 Dieses Buch soll sich auf die Spur machen nach den Wurzeln der Wut und des Zorns, auch der Paranoia, denen Trump seinen Aufstieg zu verdanken hat.
Allerdings: Es soll nicht alles monomanisch auf die oben angedeuteten Motive verkürzt werden. Dieses Buch soll in pointierter Form zugleich eine allgemeinere Geschichte der konservativen Bewegung der USA sein – von ihren Anfängen im New Deal bis in die Gegenwart. Eine solche eher ganzheitliche Betrachtungsweise hat zum einen ganz pragmatische Gründe, da in deutscher Sprache bislang nicht sehr viel über die US-Rechte, den amerikanischen Konservativismus oder die Republikanische Partei veröffentlicht worden ist, und einige der existierenden Arbeiten auch schon eine Weile zurückliegen.12 Der viel wichtigere Grund aber ist, dass man damit auch dem Gegenstand insgesamt eher gerecht wird. Denn Geschichte läuft ja niemals linear auf einen Punkt zu – so wie die Geschichte der Republikanischen Partei nicht zwangsläufig auf Donald Trump hinausläuft. Der amerikanische Konservativismus verkörpert zahlreiche Widersprüche und bündelt extrem komplementäre Tendenzen: Da ist eine ideenzentrierte Bewegung, die stark von Intellektuellen geprägt worden ist – und parallel existiert ein scharfer, beißender Anti-Intellektualismus, der sich in der Gegenwart bis hin zur dreisten Wirklichkeitsverneinung gesteigert hat. Einerseits zeichnet die Bewegung ein ganz »antikonservativer« Fortschrittsglaube und Optimismus aus; dann wieder dominiert, wie momentan, andererseits eine extrem pessimistische, ja fast schon apokalyptische Weltsicht. So ist die Republikanische Partei in der Tat eine »Partei der Extreme«.
Warum sich am Ende die eine Tendenz und nicht die andere durchsetzt: Das lässt sich nur erklären mit dem Wechselspiel singulärer historischer Ereignisse und spezifischer Handlungen und Entscheidungen der Akteure des amerikanischen Konservativismus. Kurzum: Auch wenn viele Malaisen der konservativen Bewegung eine umfangreiche Vorgeschichte haben – lange Zeit war es eine Geschichte mit offenem Ausgang, die es mitsamt ihrer Um- und Abwege zu verstehen gilt.
Noch eine Vorbemerkung: In den deutschen Medien, oft auch in der deutschsprachigen politikwissenschaftlichen Literatur, wird all das hier gerade Skizzierte unter dem Sujet »Republikanische Partei« subsumiert. Damit der Leser weiß, was für ein Buch er in den Händen hält, taucht der Parteiname daher auch im Titel dieses Bandes auf. Doch wie die vorangegangenen Überlegungen bereits deutlich gemacht haben, ist der eigentliche Gegenstand der amerikanische Konservativismus als intellektuelle und soziale Bewegung. Heute, da sich die Republikaner – jedenfalls bis auf Weiteres – klar als Partei des Konservativismus verstehen, mag man beides für synonym halten. Ursprünglich aber war die Republikanische Partei eine breite Sammlungspartei mit sehr verschiedenen und disparaten Elementen (für die Demokraten gilt dies ebenso). Das blieb so, bis die Grand Old Party von konservativen Intellektuellen und Politikern für ihre Zwecke gekapert wurde. Deswegen aber wäre kaum sinnvoll, die Suche nach den Wurzeln der Gegenwart mit einem Parforceritt durch die Parteigeschichte der Republikaner zu beginnen und bei Abraham Lincoln anzusetzen. Stattdessen sollte man dort anfangen, wo sich die ersten Umrisse jenes Phänomens zeigen, das heute in den USA als Conservatism firmiert. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht gar so weit in der Geschichte zurückzugehen braucht; es sind gerade einmal achtzig Jahre. Denn der amerikanische Konservativismus ist eine Krisengeburt: Er nimmt seinen Ausgang in den 1930er Jahren.
1 | Dana Milbank: Trump Will Lose, or I Will Eat This Column, The Washington Post, 2. Oktober 2015. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-will-lose-or-iwill-eat-this-column/2015/10/02/1fd5c94a-6906-11e5-9ef3-fde182507eac_story.html?utm_term=.51d6ee117d98 [eingesehen am 03.10.2016].
2 | Vgl. David Remnick: The Trump Balloon, The New Yorker, 8. Juli 2015. URL: www.newyorker.com/news/daily-comment/the-trump-balloon [eingesehen am 03.10.2016].
3 | James Fallows: 3 Truths About Trump, in: The Atlantic, Juli 2015. URL: www.theatlantic.com/politics/archive/2015/07/3-truths-about-trump/398351/ [eingesehen am 03.10.2016].
4 | Nate Silver: Dear Media, Stop Freaking Out About Donald Trump’s Polls, in: FiveThirtyEight, 23. November 2015. URL: http://fivethirtyeight.com/features/dear-mediastop-freaking-out-about-donald-trumps-polls/ [eingesehen am 03.10.2016].
5 | Marty Cohen et al.: The Party Decides: Presidential Nominations Before and After Reform, Chicago 2008.
6 | Vgl. Ronald Brownstein: The White Working Class: The Most Pessimistic Group in America, in: The National Journal, 27. Mai 2011. URL: www.theatlantic.com/politics/archive/2011/05/the-white-working-class-the-most-pessimistic-group-in-america/239584/ [eingesehen am 03.10.2016].
7 | Vgl. Dennis Gilbert: The American Class Structure, New York 1998.
8 | Nate Silver: The Mythology Of Trump’s ›Working Class‹ Support, in: FiveThirtyEight, 3. Mai 2016. URL: https://fivethirtyeight.com/features/the-mythology-of-trumps-working-class-support/ [eingesehen am 03.10.2016].
9 | Vgl. Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit: politisch-psychologischer Versuch, Frankfurt a.M. 2006.
10 | Robert Kagan: Trump is the GOP’s Frankenstein Monster, in: The Washington Post, 25. Februar 2016.
11 | Rick Perlstein: The Grand Old Tea Party, in: The Nation, 6. Novermber 2013. URL: https://www.thenation.com/article/grand-old-tea-party/ [eingesehen am 03.10.206].
12 | Vgl. ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Claus Leggewie: America First? Der Fall einer konservativen Revolution, Frankfurt a.M. 1997; Thomas Greven: Die Republikaner: Anatomie einer amerikanischen Partei, München 2004; Michael Minkenberg: Die neue radikale Rechte im Vergleich: USA, Frankreich, Deutschland, Opladen/Wiesbaden 1998; Patrick Keller: Neokonservatismus und amerikanische Außenpolitik: Ideen, Krieg und Strategie von Ronald Reagan bis George W. Bush, Paderborn 2008.
2. »The Global March to Socialism«
Der New Deal und die Anfänge des amerikanischen Konservativismus
Im kollektiven, generationenübergreifenden Gedächtnis politischer Bewegungen bleibt der Moment ihrer Gründung noch lange gespeichert. Besonders gilt dies für politische Formationen, die sich angesichts einer akuten äußeren Bedrohung oder im Augenblick der moralischen oder gesellschaftlichen Abwehrstellung formieren. Sie kultivieren noch lange das Unterlegenheitsgefühl, inszenieren sich weiterhin, auch wenn sie längst zur faktischen Mehrheit avanciert sind, beharrlich als verfolgte Minderheit.
So ist es auch beim amerikanischen Konservativismus gewesen. Auch er entstand in der Defensive und wuchs auf dem Boden einer lang anhaltenden Serie deprimierender Niederlagen. Diese Erfahrung völliger Deklassierung und Isolation prägte fortan das Selbstbild der Bewegung – und blieb sogar dann noch wirkungsmächtig, als Konservative längst die politischen Kommandohöhen in Washington und anderswo im Land erobert hatten. Auch als dominante politische Formation der USA der 1970er, 1980er und 1990er Jahre konnten Amerikas Konservative nie gänzlich das Gefühl abstreifen, von einem feindlichen Heer umstellt zu sein. Daher rührt der latent paranoide Zug der Bewegung, der ihr von Beobachtern schon früh unterstellt worden ist1 und der mit Beginn der Präsidentschaft Barack Obamas lawinenartig fast alles andere unter sich begraben hat.
Die Phase der Niederlagen und der Depression, des schier endlosen Marschs durch die Wüste, das waren die 1930er bis 1960er Jahre. In diesen rund drei Jahrzehnten wurde der moderne amerikanische Konservativismus geboren, und zwar unter zum Teil schweren Geburtswehen. Zuvor jedenfalls hatte der Begriff im politischen Diskurs des Landes kaum eine Rolle gespielt. Das lässt sich leicht erklären: Eine konservative Partei oder Bewegung nach europäischem Vorbild hatte sich in den USA schließlich nicht etablieren können und wäre auch nachgerade systemwidrig gewesen.2 Die Amerikanische Revolution – oftmals auch schlicht als Rebellion von Kolonialisten3 bezeichnet oder aber mit dem paradoxen Begriff der »konservativen Revolution«4 belegt – hatte, anders als sein französisches Pendant, keinen Kampf gegen eine mit der Krone alliierte Staatskirche zu führen, weshalb den Gründervätern der USA jede antiklerikale Haltung fremd war. Dadurch aber fehlte auch das polarisierende Gegenüber: Wo es keinen Robespierre gab, da konnte es auch keinen de Maistre geben. Ebenso wenig existierte eine entmachtete Aristokratie, die auf die Wiederherstellung der Feudalherrschaft hätte dringen können – da es eine solche nie gegeben hatte (die 70.000 Tories, also jene Kolonialisten, die während des Unabhängigkeitskrieges zur britischen Krone gehalten hatten, verließen nach der besiegelten Niederlage des Unabhängigkeitskrieges die Neue Welt und kehrten in den Schoß ihres Mutterlandes zurück). Zwar trauerten auch Europas Konservative nicht auf ewig ihren Königen, Fürsten oder Kaisern nach, sondern standen bald für abstraktere Werte wie Religion, Vaterland und Ordnung ein. Doch in jedem Fall blieb die Französische Revolution der Urkonflikt der Alten Welt, an dem entlang sich die Lager dann zwei Jahrhunderte lang in Gegner und Befürworter von Aufklärung, Fortschritt und Emanzipation sortierten. Für die Amerikanische Revolution aber galt das alles nicht. Anders als die Revolution von 1789 in Europa war das Erbe von 1776 in den Vereinigten Staaten wenig umstritten und die Interpretation der Revolution im Kern nicht umkämpft, wodurch sie völlig unproblematisch als Quelle nationaler Identität dienen konnte. Edmund Burke, der mit seinen »Betrachtungen über die Französische Revolution« das Genre konservativer Fortschrittskritik aus der Taufe hob, fand somit auch an der Amerikanischen Revolution wenig auszusetzen.
Doch Conservatism in den USA ist – wie in der Einleitung bereits angedeutet – ohnehin eine ideologische Kreuzung ganz eigener Art. Und die historischen Splitter dieses modernen amerikanischen Konservativismus sind nun wiederum unschwer überall verstreut in der amerikanischen Geschichte zu finden. Von der gewaltigen Angst vor einer zu starken Zentralregierung über den rauen Individualismus und die missionarische, sendungsbewusste Religiosität bis hin zur Sakralisierung des freien Marktes und der Glorifizierung des kapitalistischen Wettbewerbs: Für all dies finden sich Traditionslinien, die weit in die Geschichte des Landes und seiner nationalen Mythen zurückreichen. Doch formierte sich eben aus diesen disparaten Mentalitätssträngen in den ersten 150 Jahren nach der Staatsgründung keine einheitliche politische Bewegung. Amerika hatte zwar, wie zwei britische Journalisten einmal treffend bemerkten, »konservative Instinkte«5, lange Zeit aber keine konsistente ideologische Bewegung – geschweige denn eine als konservativ zu bezeichnende Partei. Dafür mussten erst einige der genannten Überzeugungen in die Defensive geraten und herausgefordert werden; erst unter diesem Druck konnten sich diese eigentlich konträren Elemente langsam zu einer wirklichen Weltanschauung verdichten. Der Weg des amerikanischen Konservativismus begann daher in der Ära des New Deal.
Der historische Rahmen des Dramas ist bekannt: Als Reaktion auf die seit dem New Yorker Börsensturz von 1929 ausufernde Krise des kapitalistischen Systems leitete der im Januar 1933 eingeschworene Präsident, der Demokrat Franklin Delano Roosevelt, einige einschneidende Maßnahmen zur Überwindung der »Depression« in die Wege, nicht wenige davon gleich in den atemlosen und sprichwörtlich gewordenen »ersten 100 Tagen«6 der neuen Regierung. Neben Bankenregulierung, Arbeitsbeschaffungsprogrammen, staatlicher Kontrolle der Industrieproduktion und Preiskontrollen in einzelnen Wirtschaftssektoren legte Roosevelt in diesen Jahren außerdem den Grundstein für einen Wohlfahrtsstaat europäischen Vorbildes und führte mit dem »Social Security Act« eine bundesstaatliche Renten- und Arbeitslosenversicherung ein. Im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern blieb der amerikanische Sozialstaat zwar bescheiden; aber der entscheidende Schritt vom Laissez-faire-Nachtwächterstaat zum modernen Interventionsstaat war damit getan. Und so hat es seine Berechtigung, wenn der New Deal – gleich nach der Einführung einer bundesweiten Einkommenssteuer 1913 – heute vielen Konservativen als »Sündenfall« in der Geschichte amerikanischer Innenpolitik gilt.
Fraglos sah sich Roosevelt – und das gilt gewiss auch für die meisten anderen Personen im Umfeld seiner Administration – als Reformer und Bewahrer des Kapitalismus und nicht als dessen Gegner oder gar Totengräber. Überhaupt war der neue Präsident, wenngleich zweifellos ausgestattet mit phänomenalen politischen Instinkten, kein Mann tiefschürfender intellektueller Reflektionen. »Philosophy? Philosophy? I am a Christian and a Democrat – that’s all«7, entgegnete Roosevelt einmal ein wenig ratlos einem Reporter, der sich nach seiner »Regierungsphilosophie« erkundigen wollte. Der New Deal war eine Abfolge von Trial and Error, ein Sammelsurium durchaus disparater Reformvorstellungen unterschiedlichster Provenienz – ein »Experiment«, in Roosevelts eigenen Worten, kein rigide vollstreckter Masterplan: »What the country needs is bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it; if it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something.«8
Doch um sich die größtmögliche Legitimität zu sichern und um seine Politik so fest wie nur irgend denkbar an die Traditionslinien amerikanischer Politik zu koppeln, bezeichnete Roosevelt seine eigene Politik schließlich als »liberal« – und seine Gegner als »konservativ«.9 Das war ein Versuch, via Sprache politische Hegemonie zu erlangen. Roosevelts Feinde wehrten sich zunächst und beharrten darauf, dass schließlich sie die wahren Erben der Liberal Tradition seien, Liberale im Sinne John Lockes.10 Irgendwann aber begannen sie, den Vorwurf ins Positive zu wenden und übernahmen ihn als willkommene Selbstbeschreibung. Damit vollzog sich eine folgenschwere Begriffsumkehrung, die bei Europäern immer wieder für transatlantische Sprachverwirrungen sorgt: In den USA wird als »Liberaler« heute jemand bezeichnet, der tendenziell zu staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft tendiert, und als »Konservativer« jemand, der die Abstinenz staatlichen Handelns einfordert.
Der New Deal war jedenfalls populär bei den Amerikanern. Und doch ist wenig erstaunlich, dass sich im Land eines bis dahin wenig regulierten Kapitalismus auch rasch eine feindselige, hochalarmierte Opposition formierte. Allein die National Recovery Adminstration (NRA) beschäftigte bald zehntausende Mitarbeiter, die massiv in die unternehmerische Freiheit eingriffen und Produktionszahlen sowie Preiskontrollen durchsetzten. Wenig überraschend ist daher auch, wo sich der Widerstand zuerst formierte: Vor allem die wirtschaftlichen Eliten des Landes sahen den New Deal als Bedrohung ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Machtposition. Sie waren der eigentliche Nukleus dessen, was wir heute als amerikanischen Konservativismus kennen.
Wie so oft, hängt auch in diesem Fall alles von der Fallhöhe ab. Noch in den prosperierenden 1920er Jahren hatten sich die Unternehmer auf dem Höhepunkt ihres Ansehens befunden. Nicht zufällig spricht man für diese Zeit vom Cult of Business. Amerikas Wirtschaftsführer hatten an der Spitze der sozialen und politischen Hierarchie des Landes gestanden, ihnen wurde auch von den Republikanischen Präsidenten jenes Jahrzehnts wie Calvin Coolidge gehuldigt: »The man who builds a factory builds a temple, the man who works there worships there.«11 Doch von dieser gottgleichen gesellschaftlichen Position waren die Unternehmer plötzlich zu den Sündenböcken der Nation abgestiegen. Und der neue Präsident ließ keinen Zweifel daran, dass die Krise des Landes vor allem die Schuld einer gierigen Clique von Plutokraten sei. Damit verursachte er eine tiefe Kränkung; und die hatte Folgen.
Paradigmatisch dafür steht etwa die Du-Pont-Familie. Die drei Brüder Pierre, Irénée und Lammot standen einer der größten und reichsten Industriellendynastien des Landes vor – auf einer Stufe mit den Rockefellers, Vanderbilts und Morgans. Einen großen Teil ihres märchenhaften Vermögens hatten die du Ponts mit Munitionsherstellung während des Ersten Weltkrieges gemacht. Zudem fanden sich die Produkte ihres riesigen Industriekonglomerats in beinahe allen modernen amerikanischen Konsumgütern; und auch Hollywood drehte seine Filme auf Zelluloid, das in du Pont’schen Fabriken produziert wurde. Als sie dann in den 1920er Jahren die Mehrheit an der Automobilforma General Motors erwarben, stiegen sie endgültig zur größten Unternehmerfamilie des Landes auf. Die Produkte der du Ponts waren Embleme amerikanischer Modernität, sie selbst jedoch pflegten in ihren großen, verschwenderischen Landsitzen, die sich über Delaware und den Süden Pennsylvanias erstreckten, einen geradezu aristokratischen Lebensstil.12
Wie einige andere Unternehmer waren auch die du Ponts anfänglich durchaus vorsichtige Unterstützer Roosevelts gewesen, hatten teilweise noch 1932 für ihn und nicht für seinen Republikanischen Widersacher Herbert Hoover gestimmt, der bis zum Schluss darauf bestand, bei der Weltwirtschaftskrise handle es sich nur um eine vorübergehende Konjunkturdelle, die man auszusitzen habe (»Prosperity ist just around the corner«, hatte der Slogan seiner Kampagne zur Wiederwahl in jenem Jahr gelautet). Auch in der Business Community lagen die Nerven nach drei Jahren der Depression völlig blank, sodass alles besser schien als der Attentismus des herrschenden Wirtschaftsliberalismus, der darauf beharrte, alles käme schon wieder von ganz allein ins Lot.
Es war nur ein kurzer Honeymoon. Innerhalb weniger Monate wandelten sich die du Ponts – und mit ihnen viele andere Industrielle – zu erbitterten Gegnern Roosevelts und sahen die von der »Verfassung garantierte Freiheit« in Gefahr. Bald waren sie gar der Meinung, der New-Deal-Liberalismus sei »nothing more or less than the Socialist doctrine called by another name«.13 Auch andere Industrielle und konservative Politiker bedienten sich dieser alarmistischen Rhetorik – und kaum jemand so hemmungslos wie Herbert Hoover, Roosevelts Vorgänger im Präsidentenamt. Dass Amerika keiner grundlegenden Reform bedürfe und Roosevelt mit seiner Politik die Einzigartigkeit des »amerikanischen Individualismus« bedrohe, das hatte Hoover seit 1933 immer wieder verlauten lassen.14 1940 ging er noch etwas weiter: Die »New Deal Party« habe eine Machtkonzentration erreicht wie die NSDAP in Deutschland, die Faschisten in Italien oder die Kommunistische Partei in der Sowjetunion. Auch die USA befänden sich nun auf dem »global march to Socialism«15.
Das klingt nach dem Sound der politischen Gegenwart der USA. Unweigerlich denkt man bei diesen Worten an jene insbesondere für europäische Ohren undifferenzierte Gleichsetzung jeder staatlichen Intervention mit dem Schreckgespenst des Sozialismus, die seit dem Aufstieg der Tea Party