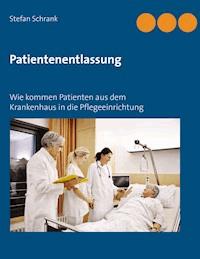
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über die Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus wird ein kurzer Abriss über die Gesundheitsversorgung im angloamerikanischen Sprachraum gegeben. Untersucht wird die Entlassung von Patienten, wenn diese nach dem Krankenhausaufenthalt entweder in ein Pflegeheim verlegt oder nach Hause entlassen werden und von Angehörigen oder einer Sozialisation versorgt werden. Es wird angenommen, dass die Entlassungsprozesse, die allgemein oft etabliert sind, noch Störungen aufweisen, die eine nahtlose Überleitung behindern. Was verhindert eine optimale Entlassung oder umgekehrt, was sorgt für mehr Zufriedenheit bei der Entlassung? Es wurden hierzu drei Erhebungsbereiche festgelegt, die mit der Entlassung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Dies waren in den Krankenhäusern die an der Entlassung der Patienten beteiligten Pflegekräfte, in Pflegeheimen und Sozialstationen die an der Aufnahme der Patienten beteiligten Pflegekräfte sowie die Gruppe aktuell entlassene Klienten bzw. deren Angehörige. Als methodische Grundlage dieser Arbeit wurde ein quantitativ-induktiver Ansatz gewählt, welcher für jeden Bereich einen eigens entwickelten Erhebungsbogen hatte. Dieser wurde durch Experteninterviews, welche einer qualitativen inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen wurden, ergänzt. Zum Schluss werden die in diesem Buch gefilterten Störfaktoren aufgezeigt sowie ein zukünftiger Lösungsansatz vorgestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine empirische Analyse und eine explorative Studie in Deutschland
“Trenne Dich nie von Deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst Du zwar weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.”
Mark Twain
Dieses Buch ist meinen Eltern
- Ursula Schrank, geb. Feuerbach
und
- Karl Schrank
gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Summary
Vorwort
Einleitung
I. Die Situation
II. Problemstellung
III. Ziele und Erwartungen
IV. Erhebungsbereiche der Arbeit
Kapitel I
1. Background
1.1. Darstellung der gesundheitssystemischen und konzeptionellen Grundlagen des Entlassungsmanagements
1.1.1. Managed Care
1.1.2. Case Management
1.1.3. Clinical bzw. Critical Pathways
1.1.4. Zusammenfassung
1.1.5. Pflegeüberleitung
1.1.6. Pflegerische Aufnahme nach Krankenhausentlassung
1.2. Gesundheitssysteme
1.2.1. Gesundheitssystem in Deutschland
1.2.2. Gesundheitssystem in Österreich
1.2.3. Gesundheitssystem in der Schweiz
1.3. Geschichtlicher Rückblick
1.3.1. Geschichtlicher Rückblick Deutschland
1.3.2. Geschichtlicher Rückblick Österreich
1.3.3. Geschichtlicher Rückblick Schweiz
1.3.4. Zusammenfassung
1.4. Beschreibung der spezifischen Systemausprägungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
1.4.1. Klientenentlassungsprozess in Deutschland
1.4.1.1. Entlassungsprozedere in Deutschland
1.4.2. Klientenentlassungsprozess in Österreich
1.4.2.1. Entlassungsprozedere in Österreich
1.4.3. Klientenentlassungsprozess in der Schweiz
1.4.3.1. Entlassungsprozedere in der Schweiz
1.4.4. Zusammenfassung
1.5. Darstellung des Standes der Forschung national und international
1.5.1. Nationaler Stand der Forschung
1.5.1.1. Deutschland
1.5.1.2. Österreich
1.5.1.3. Schweiz
1.5.2. Internationaler Stand der Forschung
1.5.2.1. Niederlande
1.5.2.2. Belgien
1.5.2.3. Großbritannien
1.5.2.4. Vereinigte Staaten
1.5.2.5. Australien
1.5.3. Zusammenfassung
1.6. Integrativer Bereich der Pflege
1.6.1. Pflegeumfeld
1.6.2. Die Bündelung von Kompetenzen
1.6.3. Vernetzung
2. Prozessanalyse
2.1. Grundannahmen
2.2. Prozesskette eines Klientenpfades aus Deutschland
2.3. Beschreibung der Prozesskette in Deutschland
2.4. Kritische Punkte der Befragung in Deutschland
2.5. Kritische Punkte im Vergleich der drei Länder
2.6. Darstellung des Forschungsraumes
Kapitel II
3. Quantitativer Forschungsteil
3.1. Methodik
3.1.1. Methodisches Vorgehen
3.1.1.1. Hypothesen
3.1.1.2. Befragungsinhalte
3.1.2. Erhebungsbögen
3.1.2.1. Erhebungsbogenkonstruktion zur 1. Erhebung (Teil A)
3.1.2.2. Forschungsfrage (Teil A)
3.1.2.3. Erhebungsbogenkonstruktion zur 2. Erhebung (Teil B)
3.1.2.4. Forschungsfrage (Teil B)
3.1.2.5. Erhebungsbogenkonstruktion zur 3. Erhebung (Teil C)
3.1.2.6. Forschungsfrage (Teil C)
3.1.3. Stichprobe
3.1.4. Einleitung der Befragung
3.1.4.1. Methodik und Datenerhebung (Teil A)
3.1.4.2. Methodik und Datenerhebung (Teil B)
3.1.4.3. Methodik und Datenerhebung (Teil C)
3.2. Ergebnisse
3.2.1. Quantitative Datenauswertung
3.2.1.1. Ergebnisse der Klinikbefragung (Teil A)
3.2.1.2. Ergebnisse der Klientenbefragung (Teil B)
3.2.1.3. Ergebnisse der Einrichtungsbefragung (Teil C)
3.2.1.3. Ergebnisse der Durchgangsbefragung aus den Teilen A, B und C
3.2.1.3.1. Teil A Krankenhaus
3.2.1.3.2. Teil B Klient
3.2.1.3.3. Teil C stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste
3.2.1.4. Ergebnisse der Forschungsfragen aus den Teilen A, B und C
3.2.1.4.1. Antworten zur Forschungsfrage (Teil A)
3.2.1.4.2. Antworten zur Forschungsfrage (Teil B)
3.2.1.4.3. Antworten zur Forschungsfrage (Teil C)
3.2.1.5. Induktive Auswertung
3.2.1.5.1. Klassifikationstabelle
3.3.1. Hypothesenabgleich
Kapitel III
4. Qualitativer Forschungsteil
4.1. Beschreibung des Forschungsvorhabens
4.2. Methodik
4.2.1. Methodisches Vorgehen
4.2.2. Befragungsinhalte
4.2.2.1. Fragestellung des Leitfadens / Hypothese
4.2.2.2. Forschungsmethode
4.2.2.3. Dokumentation
4.2.3. Stichprobe
4.2.3.1. Interviews Leitfaden
4.2.3.2. Zielpunkt der Erhebung
4.2.3.3. Einleitung der Befragung
4.2.3.4. Durchführung der Interviews
4.2.3.5. Feldzugang / Stichprobe
4.2.3.6. Forschungsprozess
4.2.3.7. Definition des Begriffes Patientenentlassung
4.2.3.8. Hinderungsgründe für eine optimale Entlassung
4.2.4. Das Leitfadeninterview
4.2.4.1. Erläuterung zur Auswertung
4.3. Ergebnisse
4.3.1. Qualitative Datenauswertung
5. Zusammenfassung der Ergebnisse
6. Diskussion
6.1. Probleme bei der quantitativen Datenerhebung
6.2. Probleme bei der qualitativen Datenerhebung
7. Schlussfolgerungen
7.1. Der Wandel optimiert
7.2. Internationale und europaweite Betrachtung
7.3. Ansätze für die Zukunft
7.4. Eine Zukunftsvision in der Umsetzung
7.5. Die Pflegekonferenz: Ein Ergänzungsmodul als Lösung
7.5.1. Ausblick: Überleitungs- Coach Modell nach Schrank
8. Abbildungsverzeichnis
9. Tabellenverzeichnis
10. Anlagenverzeichnis
11. Abkürzungsverzeichnis
12. Literaturverzeichnis
12.1. Rechtsquellen
12.2. Regelwerke
12.3. Produkte
Genehmigungen
Danksagung
Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus wird ein kurzer Abriss über die Gesundheitsversorgung im angloamerikanischen Sprachraum gegeben. Untersucht wird die Entlassung von Patienten, wenn diese nach dem Krankenhausaufenthalt entweder in ein Pflegeheim verlegt oder nach Hause entlassen werden und von Angehörigen oder einer Sozialisation versorgt werden.
Es wird angenommen, dass die Entlassungsprozesse, die allgemein oft etabliert sind, noch Störungen aufweisen, die eine nahtlose Überleitung behindern.
Was verhindert eine optimale Entlassung oder umgekehrt, was sorgt für mehr Zufriedenheit bei der Entlassung?
Es wurden hierzu drei Erhebungsbereiche festgelegt, die mit der Entlassung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Dies waren in den Krankenhäusern die an der Entlassung der Patienten beteiligten Pflegekräfte, in Pflegeheimen und Sozialstationen die an der Aufnahme der Patienten beteiligten Pflegekräfte sowie die Gruppe aktuell entlassene Klienten bzw. deren Angehörige.
Als methodische Grundlage dieser Arbeit wurde ein quantitativ-induktiver Ansatz gewählt, welcher für jeden Bereich einen eigens entwickelten Erhebungsbogen hatte. Dieser wurde durch Experteninterviews, welche einer qualitativen inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen wurden, ergänzt.
Zum Schluss werden die in dieser Forschungsarbeit gefilterten Störfaktoren aufgezeigt sowie ein zukünftiger Lösungsansatz vorgestellt.
Summary
This thesis offers an overview of the health care systems in Germany, Austria and Swizzerland as well as an abstract of medicare in the Anglo-American language area. On focus: the discharge of patients from hospital to a special-care home or to home with care by relatives or ambulant welfare centres.
It is based on the assumption that the common discharge processes are not unobstructed but with obstructions that prevent a seamless transfer.
What is the reason for the obstruction of an optimal discharge or, in other words, leads to more satisfaction concerning the discharge?
The survey is classified in three different sectors directly connected to the discharge: for hospitals the nurses, for special-care homes or ambulant welfare centres the health-workers participating in the transfer and as third sector the discharged persons and their relatives.
The thesis is based on a quantitative-inductive method with a data entry form created for each sector. Interviews with experts and their qualitative content analysing interpretation are added.
At the end the carved out disruptive factors are focused and a future solution statement is presented.
Vorwort
In den Jahren meiner beruflichen Tätigkeit spezialisierte ich mich im Bereich der ambulanten Krankenpflege. So war ich in einer bundes- bzw. weltweit tätigen gemeinnützigen kirchlichen Organisation beschäftigt, anfänglich als Pflegedienstleiter und später als Geschäftsstellenleiter mit mehreren ambulanten Diensten. In dieser Tätigkeit war ich für die Bereiche Personalbeschaffung und Personaleinsatz und darüber hinaus auch für die Leistungsabrechnung mit den Kostenträgern verantwortlich. Als Teil der Gesundheitsversorgung in Deutschland - und somit als Bindeglied zwischen der stationären Versorgung im Krankenhaus und der häuslichen Versorgung der Klienten - war ich täglich mit Problemen und Fragestellungen der Überleitung konfrontiert. Auf die immer wieder kehrenden selben Probleme, folgten immer wieder aufs Neue Versuche, den Strukturproblemen Herr zu werden. Dieses scheiterte aber jedes Mal wieder an der Tatsache, dass sich jede „Prozesseinheit“ wie z. B. Kostenträger, Hausarzt, Sanitätshaus, usw. an die für ihren Bereich geltenden Gesetze und Bestimmungen hielten. Jeder logisch Denkende würde jetzt doch sofort protestierend einschreiten und von einem einwandfreien Vorgehen der einzelnen Parteien ausgehen. Natürlich möchte ich hier auf keinen Fall einer „Prozesseinheit“ unterstellen, dass diese sich nicht an geltende Gesetze und Bestimmungen halten und somit geltendes Recht brechen würden. Es bleibt aber die Frage im Raum stehen, warum gerade dann nicht die optimale Versorgung beim Patienten ankommt. Eigentlich wäre es doch ideal, wenn jeder Versicherte im Falle einer Inanspruchnahme der Versorgung durch das System ein „Rundum-Sorglos-Paket“ bekommen würde. Vom Grundgedanken der Erfinder dieses Systems über die Entwicklungs- und Bewährungszeit bis heute hätte bei jedem normal greifenden Lern- und Erfahrungsprozess heute eigentlich kein Klient irgendein Problem. Wie gesagt „eigentlich“.
Diese Tatsache hat mich bewogen, in diesem Bereich meinen Forschungsschwerpunkt zu suchen. Und so habe ich mir für diese Arbeit zur Aufgabe gemacht, verschiedene Überleitungssysteme zu analysieren und einen Lösungsansatz zu finden, der für alle einen gangbaren Weg aus diesem circulus vitiosus zeigt.
Stefan Schrank · Patientenentlassung · Wie kommen Patienten aus dem Krankenhaus in die Pflegeeinrichtung?
Einleitung
Eigentlich sollte alles so schön harmonisch zusammen passen und stimmig ineinander greifen. So würde ein niedergelassener Arzt seinen Patienten zur speziellen Behandlung in eine Klinik einweisen. Das Krankenhaus würde den zugewiesenen Patienten aufnehmen, versorgen und nach Möglichkeit optimal Versorgt in das bereitstehende Versorgungs- und Pflegenetz entlassen. Danach würde eine weiterbehandelnde Einrichtung der Rehabilitation oder der pflegerischen Versorgung unter optimalen Bedingungen den Patienten aufnehmen und der weiteren Genesung bzw. Erhaltung des Status Quo zuführen. Der niedergelassene Arzt würde seine weitere Verlaufstherapie durchführen. Das ganze würde ohne jeglichen Zeitverlust und bürokratischen Aufwand für den Patienten geschehen und ähnlich wie bei dem in der Betriebswirtschaftslehre bekannten „Homo oeconomicus“ optimal versorgt werden. Und zu guter Letzt würden diejenigen, die an der Gesundheitsversorgung des Patienten beteiligt sind, durch die Kranken- und Pflegekassen adäquat vergütet. Eine Vorstellung, die zum Träumen einlädt und bei jedem, der an einer Gesundheitseinrichtung tätig ist und für die Gesundheitsversorgung verantwortlich zeichnet, zur inneren Sehnsucht nach optimaler Erfüllung seiner berufsständischen Ethik führt. Doch auch Träume gehen irgendwann einmal zu Ende und somit ergibt sich nach einem Erwachen ein verzerrtes Bild, welches die Realität wieder spiegelt. Ein niedergelassener Arzt würde gerne seinem Patienten die optimale Therapie sowie die hierfür erforderlichen Verordnungen zur ergänzenden Heilversorgung zu kommen lassen, wird dann aber durch ein ihm auferlegtes Budget in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt und bei Zuwiderhandlung um sein Honorar gebracht. Es gibt aber wenig Anlass zu Hoffnung, auch wenn die Forderung der KBV „Weg mit den Budgets“ lautet. So wurde zeitgleich im Bundesgesundheitsministerium über eine Honorardeckelung nachgedacht (Bodemer Alexandra, 2006). Das Krankenhaus darf im Jahr nur noch eine vorbestimmte Anzahl von Patienten aufnehmen und muss diese in einem festgelegten Zeitkorridor abarbeiten § 5 KHEntgG. Pflegeeinrichtungen können am Patienten erst nach Genehmigung durch die Kostenträger in einem bestimmten Rahmen ihre Tätigkeit ausüben. § 37 SGB V Abs. (3) sowie zur Durchführung in § 92 SGB V u.a. Abs. (6) Nr. 4, Abs. (7) Nr. 2 u. 3. Den Pflegekräften sind somit die Hände gebunden und sie dürfen das in einer sehr langen und qualifizierten Ausbildung vermittelte Handlungsspektrum nicht anwenden, ohne dass ein Arzt jede behandlungspflegerische Tätigkeit angeordnet hat - und dieses auch erst dann, wenn diese Tätigkeiten durch eine Krankenkasse in einem Prüfungsverfahren und möglicherweise mit zusätzlichen Einschränkungen genehmigt wurden. Anbieter von Heil- und Hilfsmitteln dürfen nicht das für die individuellen Anliegen des Patienten optimale Versorgungspotential ausschöpfen. § 92 SGB V Abs. (6) Nr. 1, 2, 3 u. 4. Es hängt demnach weniger am Wollen als am Können bzw. dürfen, wenn die Leistungen von einem gesetzlichen Kostenträger übernommen werden sollen. Es kann davon unberührt immer eine Leistung gegen Privatberechnung vom Klienten eingekauft bzw. von Dienstleistern angeboten werden.
Die o.g. Probleme werden auch aktuell festgestellt und diskutiert. (http://www.mdr.de) Das Gesundheitssystem - und somit die Kostenträger - haben hiervon eine Kostenersparnis und können somit das System in der Kostenrechnung stabil halten, indem es einige Leistungen durch eine Deckelung der Kosten sowie eine künstlich aufgebauschten Bürokratie im Antrag- und Genehmigungsverfahren legt. In der Umkehr versucht jede Einrichtung - durch Abrechnungsoptimierung - ihr Überleben zu sichern und jeden Cent aus dem System zu ziehen. Dies wiederum verschlingt wertvolle Personal- und Systemressourcen, welche nicht beim Patienten ankommen. Die im Gesundheitssystem arbeitenden Menschen und die Patienten sind gleichermaßen unglücklich. Als eine solche Herausforderung sieht auch Ohnimus et al. die langwierigen Genehmigungsverfahren der Kostenträger (Ohnimus Hartmut, Schellerer Susanne, 2005, S. →). Auch wird ein beträchtlicher Formalismus bestätigt (Ohnimus Hartmut, Schellerer Susanne, 2005, S. →).
Die o. g. Probleme werden auch aktuell festgestellt und diskutiert. So gilt:
"Im Widerspruchsverfahren, im Klageverfahren und evtl. auch im Berufungsverfahren gibt es immer Antragssteller, die dann resigniert aufgeben. Und das sind Kosten, die werden einfach gespart."
Michael Morgenroth, Fachanwalt für Sozialrecht
(http://www.mdr.de)
Dem entgegen spricht nach Aussage der Kostenträger:
"Es braucht eine Dokumentation. Wir müssen deutlich machen, was gemacht worden ist. Wir müssen auch nachträglich noch fragen können: War das alles notwendig? Weil wir einfach wissen, dass in diesem System eine ganze Reihe von ökonomischen Anreizen besteht, oftmals mehr zu machen als notwendig ist"
Prof. Dr. Gerd Glaeske, Gesundheitswissenschaftler
(http://www.mdr.de)
Es werden seit Jahren in regelmäßigem Abstand politische Schritte unternommen, um mit groß angekündigten und vielversprechenden Reformen Kosten einzusparen. Diese Einsparungen werden natürlich in den großen Kostenblöcken der ambulanten ärztlichen und der Krankenhausversorgung vorgenommen. Nach einem Kostenanstieg auf 6,7% im Jahre 2007 (Statistisches Bundesamt Deutschland, Pressemitteilung Nr.136) wird versucht zu sparen wo es nur geht. Und das ist neben dem kleineren Block der Hilfsmittel auch der noch kleinere Block der ambulanten pflegerischen Versorgung (Statistisches Bundesamt Deutschland, Pressemitteilung Nr. 136), obwohl vor einigen Jahren der gesetzliche eingerichtete Slogan „ambulant vor stationär“ geregelt im SGB V § 37 Abs. 1 als Lösung eingeführt wurde. Und nun wird genau dieser ambulante Bereich wegen des Kostenanstieges, wie oben bereits erwähnt, in seiner Handlungsfähigkeit gebremst, in dem u.a. das bis dato in der Behandlungspflege ruhende Genehmigungsverfahren vor einer jeden Leistungserbringung vor der dem Millennium wieder reaktiviert wurde. Als weitere Optimierungsmaßnahme wurde die Möglichkeit geschaffen, dass private Pflegedienstanbieter mit den Kostenträgern Einzelverhandlungen über Verträge und Vergütungen führen können, siehe hierzu SGB XI §§ 85 u. 89, was in einem konkreten Fall zu einem Paradoxon führte: So war z.B. bei einem ambulanten Zentrum für Langzeitbeatmete ein stationärer Krankenhausaufenthalt teilweise für die Kostenträger billiger als die weitere Versorgung durch den ambulanten Intensivbeatmungsdienst sicherzustellen. (Aussage: Aus qualitativen Interviews) Generell scheint mit dem Gedanken kokettiert zu werden, dass ein Patient ohnehin in einem Beschwerdeverfahren nicht lange durchhält bzw. diese durch ein Versterben desselbigen sowieso im Sande verläuft. „Manche Kostenträger spekulieren darauf, dass Menschen aufgeben“ (Hüppe Hubert, 2011). Ethisch betrachtet ein Unding und für einen Sozialstaat eigentlich undenkbar und unwürdig.
Nach Feststellung des Sachverständigenrates besteht hier noch ein „Innovationsstau“. (Sachverständigenrat, Sondergutachten 2009, Punkt 89) Zusätzlich werden die verschiedenen Berufsgruppen sowie die darin enthaltenen Berufsbezeichnungen ad absurdum geführt. Es wird immer behauptet, es seien zu wenige Pflegekräfte vorhanden. Daher hat man diese mit einer künstlichen Einschränkung in den Versorgungsverträgen mit den Kostenträgern entmündigt: § 2 (2) im Rahmenvertrag nach § 132 a SGB V über die Versorgung mit häuslicher Krankenpflege. Ebenfalls wird ein Engpass bei der Behandlungspflege bestätigt (Ohnimus Hartmut, Schellerer Susanne, 2005, S. →). Die Macht der Kostenträger, die sich gegen alles und jeden in ihren Versorgungsverträgen absichern wollen, bewirkt vermutlich gerade das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte. So sind auch die Erstattungen der Kostenträger nicht kostendeckend (Ohnimus Hartmut, Schellerer Susanne, 2005, S. →). Weiterhin wirken sich Zeitdruck und der ständig steigenden Aufwand negativ auf die einzelnen Pflegekräfte aus, dies führt oft zu Fehlern bei der Informationsübergabe. Aus diesen ergeben sich wiederum Koordinationsschwierigkeiten. Daraus folgt ein Mangel im patientenorientierten Arbeiten am Klienten, der unweigerlich zur Unzufriedenheit bei den Pflegekräften führt (Baumer Eva-Maria, Bischof Barbara, Findl Inga et al. 2000, S. →).1 So eingeschränkt verwundert es nicht, dass medizinisches Hilfspersonal sein berufliches Glück in anderen Arbeitsbereichen sucht und somit dem Pflegesektor nicht mehr zu Verfügung steht. So wollten Fleischer, N. et. al.: in ihrer Arbeit „Psychische Belastungen und Beanspruchungen des Pflegepersonals in einer stationären Altenpflegeeinrichtung“ herausfinden, wie hoch die psychische Belastung der Pflegekräfte in den einzelnen Bereichen ist und ob es in den verschiedenen Bereichen Unterschiede gibt. In der Gesamtbewertung erhielten die Forscher den Eindruck, dass sich die Beanspruchungssituation der Pflegekräfte in den letzten Jahren verschlechtert hat. Auch nahmen Entlastungstendenzen, die die Belastung kompensieren sollten, zunehmend ab (Fleischer Nadine, Klewer Jörg, 2010). Ein sichtbarer Trend ist z.B. dass viele Pflegekräfte versuchen mit einem der zahlreichen Möglichkeiten fachbezogen zu studieren, ihr berufliches Los zu verbessern (Spicker Ingrid, Mai 2001, S. →). Politischer Diskurs2
I. Die Situation
In den letzten 10 Jahren wurde mit dem Schnittstellenmanagement in Deutschland ein System implementiert, welches zu einer besseren Verknüpfung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung führen soll. „Erste Überlegungen hierzu gehen schon auf das Jahr 1975 zurück“ (Wagner Karin, 2007: aus WSI 1975, S. →). „Im Jahre 1999 weist die Reformdebatte bereits die Gesundheitspolitik darauf hin, dass Versuche zur Einführung der integrierten Versorgung durch den Gesetzgeber gefördert werden sollten“ (Wagner Karin, 2007, S. →). „Nach Maßgabe der Gesundheitsreform 2000 §140 a-h SGB V, (… …) waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Implementierung dieser innovativen Versorgungsform nicht gegeben“ (Wagner Karin, 2007, S. →). „Mit der Neufassung des (§140a-d SGB V) in der Gesundheitsreform von 2004 wurde in Bezug auf das Schnittstellenmanagement das erstmals liberalisierte Versorgungsstrukturrecht festgehalten, dessen Ausgestaltung ausschließlich auf der freien Vertragsgestaltung zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern basiert“ (vgl. Wagner Karin, 2007, S. →-→). Gleichzeitig zeigte die Entlasssituation am Beispiel einer unfallchirurgischen und orthopädischen Abteilung, dass es in der Praxis immer noch zu Problemen in der praktischen Umsetzung kommt (Lautzschmann Kathrin, Martin Andreas, Rafler Henry et al. 2000, S. →). So zeigt sich, dass „zwischen intra- und extramuraler Versorgung“, „der Übergang“ „nicht bruch- und lückenlos“ verläuft. Die Bereiche arbeiten meist „insular“, was zu Problemen bei der „Behandlungs- und Versorgungsdiskontinuität“ führt (Schaeffer Doris, Moers Martin, 1994, S. →). Dazu kommt für die Krankenhäuser zusätzlich der Kostendruck hinzu, der im positiven Sinne dazu führt, dass sich Kliniken bereits bei der Aufnahme eines Klienten mit dessen Entlassung und der damit verbundenen Planung beschäftigen müssen (Baberg Henning T., De Zeeuw, Justus, 2005, S. 365).
Um diese Problemstellung im Bereich der Überleitung von der stationären Versorgung in die ambulante bzw. stationäre pflegerischen Versorgung zu eruieren, habe ich diese Arbeit auf Grundlage einer Erhebung in den klinischen und pflegerischen Versorgungseinrichtungen in der Metropolregion Rhein-Neckar erstellt. Die hierfür ausgewählten Erhebungsschwerpunkte wurden auf die drei Bereiche, die in einer Verlegungsbeziehung bei der Klientenversorgung stehen, zentriert. So wurden als Hauptakteure das Krankenhaus, der im Mittelpunkt der Prozesse stehende Klient und die für die weitere Versorgung zuständigen Bereiche der ambulanten bzw. stationären Pflegeeinrichtungen in die Erhebung mit einbezogen. Es wurden in allen drei Bereichen an dem Entlassungsprozess Beteiligte sowie Klienten, die eine Entlassung durchlaufen hatten, befragt. Für jeden dieser Bereiche wurde ein quantitativer Erhebungsbogen erstellt. Zusätzlich wurden noch 9 qualitative Interviews mit beteiligten Fachkräften geführt.
Anmerkungen des Autors3
II. Problemstellung
Die Schnittstellenübergabe vom Krankenhaus in die externen Bereiche basier im Wesentlichen auf der dort implementierten Entlassungsplanung. So sind unterschiedliche Vorgehensweisen bei Verlegungsprozessen möglich. Wo die Verantwortlichkeiten und schließlich die Zuständigkeit in der Organisation und Durchführung liegen, ist zunächst nicht verbindlich definiert. Dangel stellt hier die Frage, wem die Aufgabe der Entlassung zufällt, es könnte eine pflegerische aber auch eine Aufgabe des Sozialdienstes sein. Nach ihrer Auffassung gibt es auch keine „geborene“ Zuständigkeit für die Entlassungsplanung. Selbst eine Regelung zu den Leistungsinhalten gäbe es nicht. Auch sei eine zuständige Berufsgruppe nicht definiert (Dangel Bärbel, 2004, S. →). Letzteres führte bereits nach der Einführung der neueren Studiengänge wie z.B. Diplom-Pflegepädagoge bzw. Diplom-Pflegewirt bei den bisherigen Diplom-Sozialpädagogen und Diplom-Sozialarbeitern zu einem Konkurrenzdenken und Ängsten hinsichtlich der Streitigmachung der Arbeits- und Zuständigkeitsbereiche.
„Die Diskussion um die Qualität der Entlassungsplanung führt oft zu der Frage nach der Zuständigkeit: ist die Entlassungsplanung eine pflegerische Aufgabe, oder fällt sie in das Aufgabengebiet des Sozialdienstes?“ (Dangel Bärbel, 2004, S. →).
So wurde in einem Projekt in Österreich empfohlen, dass alle Mitarbeiter die für die Entlassung erforderlichen Abstimmungsprozesse ermöglichen (Baumer Eva-Maria, Bischof Barbara, Findl Inga et al. 2000, S. →). Nach der Auffassung von Dangel, haben die Hochschulen wenig dazu beigetragen, die fachliche Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen zu stärken (Dangel Bärbel, 2004, S. →). Weiter hätten Tätigkeiten, die mit einer Entlassungsplanung einhergehen, nur einen geringen Stellenwert bei Pflegekräften. In Krankenhäusern wird die Pflegekraft immer noch bei ihren originären Aufgaben gesehen. Auch richteten sich die Ziele immer noch nach den Behandlungszielen der Ärzte. Ebenso fehle eine Einbeziehung des pflegerischen und sozialen Umfeldes (Dangel Bärbel, 2004, S. →). Sie kommt daher zu dem Schluss, dass Pflegefachkräfte auf Grund ihrer regelmäßigen Kontakte mit dem Patienten bzw. dessen Angehörigen eher geeignet seien, diese herausragende Funktion des multidisziplinären Entlassungsprozess zu erfüllen (Dangel Bärbel, 2004, S. →). Dieses war nach Schaeffer auch bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Kritik und führte zu politischer Diskussion und Angriffspunkten (Schaeffer Doris, Moers Martin, 1994, S. →).
Praktiker bemängeln häufig den Übergang von Krankenhaus zu ambulanter Behandlung. So enthalten Entlassungsberichte oft weder die erforderlichen Informationen noch Genehmigungen der Kostenträger, die eine nahtlose Versorgung ermöglichen würden (Ohnimus Hartmut, Schellerer Susanne, 2005, S. →). Demnach kann davon ausgegangen werden, dass ältere Menschen nach ihrer Entlassung anfälliger für die Folgen des Krankenhausaufenthaltes sind als andere Personengruppen. Sie tragen sowohl bei als auch nach einem Krankenhausaufenthalt mit höherer Wahrscheinlichkeit bedauerliche und oft vermeidbare Schädigungen davon. Ältere Patienten sind bei einer frühen Entlassung in ihrem Genesungsprozess noch nicht soweit vorgeschritten wie ein viel jüngerer Patient. Ferner sind ältere Menschen während und nach einem Krankenhausaufenthalt häufiger in höherem Maße abhängig von äußerer Hilfe (vgl. Dangel Bärbel, 2004, S. → - →). Zudem hat nach Zeller et.al. jeder Pflegebedürftige ein Bedürfnis nach Sicherheit und dass seine Fähigkeiten wie auch die Defizite erkannt und in der weiteren Versorgung beachtet werden. So setzt ein gutes Betreuungskonzept eine ebenso gute Kommunikation voraus. Zu beachten ist auch, dass pflegende Angehörigen nicht überlastet werden (Zeller Bernhard, Neubauer Gabriela, Gatterer Gerald, 2007, S. 336-337).
„Wichtig erscheint auch eine Abkehr von einer Trennung zwischen intramuraler und ambulanter/ extramuraler Betreuung mit den entsprechenden Grenzen. Hier wären für die Zukunft fließende Übergänge im Sinne einer „transmuralen“ Betreuung und Vernetzung zielführend. Konkurrenz zwischen den Trägerorganisationen sowie zwischen professioneller und nicht professioneller Betreuung führt primär zu Spannungen und einem Sinken der Betreuungsqualität.“
(Zeller Bernhard, Neubauer Gabriela, Gatterer Gerald, 2007, S. 336-337)
Doch das Entlassungsmanagement leidet an den immer kürzer werdenden Liegezeiten, um überhaupt tätig werden zu können (Müller - Hirth Valeria, 2004, S. →, aus Arnold in: Badura et al., 1993, s.→ f.). Als Problem werden in den letzten Jahren die immer kürzer werdenden Liegezeiten in den Krankenhäusern wahrgenommen bei gleichzeitiger Zunahme der Fallzahlen (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2012, S. →). Wo es in Deutschland 1991 noch durchschnittlich 14,00 Liegetage waren, sind diese bis 2010 auf 7,9 Tage gesunken. Die Fallzahlen stiegen kontinuierlich bundesweit von 14.576.613 Fällen auf 18.032.903 Fälle im Jahr 2010 (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2012, S. →). Bei den Fachabteilungen der Geriatrie lag die durchschnittliche Verweildauer bei 16,3 Tagen, und ist mit Abstand die längste Liegezeit von allen Fachabteilungen. Damit sind nicht automatisch nur Pflegebedürftige von geriatrischen Abteilungen gemeint, sondern es kann auch angenommen werden, dass ein gewisser (in der Bundesstatistik jedoch nicht erhobener) Anteil an pflegebedürftigen Patienten auf anderen Fachabteilungen gewisse Liegezeiten haben, wobei diese Liegezeiten sich um den Durchschnitt von 7,9 Tagen bewegen. So liegen diese bei Neurologischen Fachabteilungen bei 8,1 Tagen und auf Internistischen Fachabteilungen allgemein bei 6,5 Tagen. Dem entgegen ist der Anteil der Patienten, welche von Krankenhäusern in ein Pflegeheim entlassen wurden, ermittelt und lag im Jahre 2010 bundesweit bei 21.667 Patienten. (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2012, S. →) Bei den Pflegebedürftigen nach Versorgungsart gab es im Jahre 2009 insgesamt 2,34 Millionen Pflegebedürftige bundesweit. Zu Hause versorgt wurden 1,62 Millionen (69 %), in Heimen vollstationär versorgt waren 717.000 (31%), durch Angehörige allein wurden 1,07 Millionen Pflegebedürftige und zusammen mit einem ambulanten Pflegedienst 555.000 versorgt (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2011, S. →).
III. Ziele und Erwartungen
Diese Arbeit soll mittels einer Erhebung in Krankenhäusern und ambulanten bzw. stationären Pflegeeinrichtungen der Metropolregion Rhein-Neckar die dortige Situation bei Entlassungsprozessen erfragen. Gleichzeitig soll die Sichtweise von Klienten erfragt werden, um so beide Seiten, die des Entlassenden und die des Entlassenen, zu beleuchten. Idealerweise lassen sich daraus Faktoren zur Verbesserung der Entlassungsplanung bzw. Prozessoptimierung ableiten. Eine regionale Vereinfachung in der Umsetzung der Entlassungsplanung und ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch der Fachbereiche kann ein Ziel dieser Arbeit im Sinne des besseren Verständnisses des Gegenübers und somit die Grundlage für ein besseres Miteinander sein.
IV. Erhebungsbereiche der Arbeit
Da in einem Entlassungsprozess des Klienten verschiedene Einzelbereiche ineinander greifen, wurde die Arbeit in drei Bereiche gegliedert.
Diese sind:
das
Krankenhaus
als entlassende Einheit (Teil A)
der
Klient
bzw. dessen
Angehörige
um die Prozesse in ihrer Umsetzung zu bewerten (Teil B)
das
Pflegeheim
und
Sozialstation
als aufnehmende Einheit (Teil C)
Für jeden Bereich wurde für die Befragung ein eigener Erhebungsbogen erstellt und in den jeweiligen Bereichen verteilt. Die gewonnenen Ergebnisse wurden nach der Auswertung in die jeweiligen Verhältnisse gesetzt.
1 Meinung des Autors: Unzufriedene Mitarbeiter und ein Mangel am patientenorientierten Arbeiten wirkt sich unweigerlich auf das Arbeitsumfeld in dem sich auch die Klienten befinden, aus. Ein Informationsmangel wirkt sich auf jedem Prozessablauf negativ aus, vor allem in Prozessen der Vorbereitung wie z.B. Entlassungsvorbereitungen.
2 Meinungen anderer: Bei der Ärzteschaft zeigt sich, dass dort gerne auch Stellen in der Pharmaindustrie angenommen werden, weil dort bessere Vergütungen zu erzielen sind. Ähnlich verhält es sich für niedergelassene Ärzte in ländlichen Gegenden, wo man sich ernsthaft politisch darüber unterhält, dass der Landarzt ja auch Geld verdienen soll/ darf: „Er soll auch davon leben können“. So ist nach Meinung der KV-RLP die wohnortnahe Versorgung durch niedergelassene Ärzte bereits gefährdet. (Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz: 20. Oktober 2011). Ein großes Wehklagen wird immer wieder vernommen, sei es von der Ärzteschaft oder seien es in den verschiedenen Pflegeberufen. Zudem kommen nach Einführung der DRGs jetzt noch die Krankenhäuser hinzu, die gerade in den ländlichen Regionen um ihre langjährige Existent bangen müssen. Dazu kommen nach Aussage der DKG noch ein sich manifestierender Ärztemangel und eine steigende Bürokratie (Die Deutsche Krankenhausgesellschaft: 29. September 2010).
3 Anmerkungen des Autors: Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass nicht alle angefragten Einrichtungen mit Begeisterung an den Erhebungen teilnehmen wollten. Teilweise war man nicht bereit, die Bögen zu verteilen bzw. gänzlich mitzuwirken. Besonders große Ablehnung erhielt ich von den Rettungsleitstellen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die eine regelrechte Angst vor Einblicken befürchteten und mit abstrusen Ausreden versuchten, mich von meinem Vorhaben abzubringen. Dieses galt nicht für die zuständigen Ministerien der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Diese waren zur Teilnahme an der Studie bereit und an den Ergebnissen interessiert und haben somit ihre Erlaubnis zur Durchführung der Studie erteilt.
Kapitel I
1. Background
1.1. Darstellung der gesundheitssystemischen und konzeptionellen Grundlagen des Entlassungsmanagements
In diesem Kapitel soll zur Einordnung der zentralen Fragestellung ein Überblick über die wissenschaftlichen Gesamtzusammenhänge geschaffen werden. Der Aufbau der Gliederung dieses Kapitels geht über eine kurze Zusammenfassung der Bereiche des Managed Care, Case Management sowie des Clinical bzw. Critical Pathway und soll einen generellen situativen Überblick über den Prozess geben.
1.1.1. Managed Care
Managed Care ist eine u.a. in Amerika verbreitete Art der Systemstruktur im Zusammenspiel von stationären Einrichtungen im Gesundheitswesen und Kostenträgern. In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick gegeben. Dieser soll als Grundlageninformation dienen, um die gegenwärtige Situation u.a. in Deutschland zu verstehen.
„Eine einheitliche Definition für diesen Begriff zu finden ist nicht einfach; vielleicht auch deshalb, weil sich die strukturellen und organisatorischen Sachverhalte in ständigem Fluss befinden. Managed Care steht für eine geführte Versorgung [24], wobei der Kostenträger, also die Krankenkasse, die Führung übernimmt. Sie lenkt die Versicherten gezielt zum ausgewählten Arzt/ Therapeuten und/ oder führt sie durch finanzielle Anreize und Bonusvereinbahrungen. Die Managed-Care-Organisation, sprich die Krankenkasse, wählt die Leistungserbringer sorgfältig aus (s. auch SGB V § 137f.), organisiert den Behandlungsablauf nach der Primärarztstruktur, setzt ökonomische Anreize, orientiert sich an Behandlungsrichtlinien und bewertet technische Verfahren streng nach Wirtschaftlichkeitskriterien. Nicht mehr der Arzt entscheidet darüber, was medizinisch notwendig ist, sondern letztendlich die Krankenkasse. ‘Managed Care steht in den USA für etwas, das stark kommerzialisiert ist und von privaten, teilweise börsennotierten Unternehmen marktwirtschaftlich ausgestaltet wird [3]. Da die Krankenkassen nicht nur in den USA auf einen möglichst hohen Anteil an finanzkräftigen Beitragszahlern angewiesen sind, müssen sie eine Palette von attraktiven Leistungsangeboten zusammenstellen, um potenzielle Kunden zu interessieren. In der sich entwickelnden Konkurrenzsituation werden sie verstärkt zur Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gezwungen sein.“ (Lusiardi Susanne, 2004, S. →)
Nach Amelung geht es allerdings nicht nur um finanzierbare Lösungen sondern um ein ökonomisches Vorgehen. Mischfinanzierungen werden zunehmend wichtiger. In der Schweiz werden bereits 29% der Gesundheitskosten von den Patienten getragen. So geht er davon aus, das „Basic-Benifit-Packages“ weiter an Bedeutung gewinnen (Amelung Volker Eric, 2007, S. →). So sieht er auch die Ärzte einem Kostendruck ausgesetzt, der die Entscheidungsautonomie eines Arztes mehr und mehr einschränkt. Der Arzt werde zum Händler, welcher die Dienstleistung Gesundheitsleistung vertreibe. Ebenfalls ist die Technologie einem schnell voranschreitenden Wandel unterzogen. Eine Digitalisierung von Patientenakten oder Befundbildern ist mittlerweile Standard (Amelung Volker Eric, 2007, S. →). Managed Care ist kein urtypisches amerikanisches System, sondern kann mit seinen Instrumenten und Organisationsformen auch in Deutschland Anwendung finden (Amelung Volker Eric, 2007, S. →). Bereits 1996 konnten in der Schweiz die Kosten durch Leitungserbringer reduziert werden. Dieses konnte dadurch erreicht werden, dass man die Wahlfreiheit bei den Leistungserbringern einschränkte. Dieses hatte Anreize zum wirtschaftlichen Umgang mit den Versicherten zur Folge. Bei den Leistungsanbietern konnten nun mit Versorgungsverträgen die Kosten niedrig gehalten werden (Wichmann Michael, 2003, S. →).
Abbildung 1 In der folgenden Darstellung wird das Ineinandergreifen von Managed Care als Organisation und Instrument dargestellt.
Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de
Abbildung 1 zeigt die Struktur von Managed Care
1.1.2. Case Management
Im Case Management (Fallmanagement) geht es um eine einrichtungsübergreifende Weiterführung der Versorgungssteuerung. Diese Methode kann ein Ansatz zur kasuistik-bezogenen Klientenversorgung sein, sie birgt jedoch auch die Gefahr von nachteiligen Aspekten. Dieses soll im Folgenden dargestellt werden und als Grundlage für den Betrachter dienen.
Lusiardi beschreibt das „Fallmanagement“ als Garant für eine klinikübergreifende Therapiefortführung (Lusiardi Susanne, 2004, S. →). Es werden hierbei von den Akteuren gemeinsame Ziele auf Grundlage des Gesamtkontexts vereinbart. Diese sollen in einem vorab festgelegten Zeitkorridor die weitere medizinische Betreuung garantieren. (Lusiardi Susanne, 2004, S. →, aus DKG Version2.0, Januar 2002) Lusiardi beschreibt die Diskussion um die Zuständigkeiten der „Krankenkassen, Ärzte und Pflegekräfte, Sozialarbeiter“ und die noch offene Frage über neue berufliche Fachbereiche im Beratungssektor, der „nach Ansicht der American Nurses Association (ANA 1991)“ für Angehörige von Bedeutung ist. Sie stellt darüber hinaus den „Expertenstandard Entlassungsmanagement“ für die Pflegekräfte als wichtigen Baustein im Entlassungsprozess dar (Lusiardi Susanne, 2004, S. →-→). Klie und Monzer diskutieren in ihrer Arbeit die flächendeckenden Strukturen, die um das Case Management angelegt wurden. Diese sollen zur besseren Kooperation und Koordination der einzelnen Akteure um die Pflege führen (Klie Thomas, Monzer Michael 2008, S. →). So kommen sie zu der Erkenntnis, dass die sog. Pflegestützpunkte auf unterschiedliche Strukturen sowie Akteure treffen, die in einer neuartigen Kooperationsbeziehung zueinander finden sollen. Die Implementierung von Case Management auf den einzelnen Fallebenen in Organisationen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine Pflegeunterstützung ist aber eine umfassende Schnittstellenarbeit, die bei den unterschiedlichen Akteuren, wie auch bei Ehrenamtlichen auf ein multidisziplinäres Verständnis für einheitliche Qualitätsmaßstäbe setzen muß (Klie Thomas, Monzer Michael 2008, S. →-→). Im Case Management werden innerhalb von 24 Stunden Aufenthalt im Krankenhaus anhand eines Assessmentinstruments Informationen über einen Patienten gesammelt. Dieses kann unter Zuhilfenahme von Fragebögen geschehen. Der Case Manager soll dann binnen 48 Stunden mit den nahen Angehörigen in Verbindung treten. Bei der Erstellung eines Versorgungsplanes werden nicht nur die Maßnahmen sondern auch die Netzwerkpartner festgelegt. Der Patient und die nahen Angehörigen haben hierzu ihre Zustimmung gegeben (von Reibnitz Christine, Meeßen Susanne, Heßler Anke et al. 2009, S. →). Nach dem aufgeführten Ablaufplan wird allerdings immer noch der Hausarzt Rezepte am Entlassungstag ausstellen (von Reibnitz Christine, Meeßen Susanne, Heßler Anke et al. 2009, S. →). Dieses wird im dargestellten Weg des Patienten durch eine Klinik (auf Seite →) allerdings als Problem aufgezeigt. Dieser juristische Entlassungspunkt darf ohne Zweifel als Problempunkt bezeichnet werden, denn er verhindert ein rechtzeitiges Intervenieren des Hausarztes per Gesetz verhindert. Ein rechtzeitiges Intervenieren wäre aber genau das, was in dieser Stelle erforderlich wäre. Nur dadurch könnten nämlich einige vorbereitende Maßnahmen vorab auf den Weg gebracht werden. Es ist nicht damit getan, für den Entlassungstag eine Verordnungserlaubnis zu erteilen, denn die Prüfung durch die Kostenträger einerseits sowie die Beschaffung und eventuell Montagen von Hilfsmittel andererseits, verschlingt gerne auch Vorbereitungszeit. Dieser wichtige, von Müller – Hirth benannte Punkt wird gerne von allen Beteiligten vergessen und das ist es, was letzten Endes Verzögerungen in der Versorgung verursacht. (Müller – Hirth Valeria, 2004, S. →-→) Vor allem die Kostenträger haben kein ursächliches Interesse an einer Änderung dieses Sachverhaltes, denn es ist zu vermuten, dass diese eine Kostenerhöhung durch die vorzeitige Verordnung von Hilfsmitteln befürchten.
Dabei ist nach Müller- Hirth davon auszugehen, dass das Gegenteil der Fall wäre. So könnte eine rechtzeitige und sinnvolle Abstimmung der Hilfsmittel einerseits unnötige Reibungsverluste verhindern und andererseits die Kosten senken, weil Hilfsmittel nicht überstürzt beschafft werden, sondern dann zur Verfügung gestellt werden, wenn diese vom Patienten benötigt werden. (Müller – Hirth Valeria, 2004, S. →-→) In der Zukunft wird das Überleitungsmanagement immer mehr an Bedeutung gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass dann die ambulanten Pflegedienste möglichst schnell die erforderlichen Daten vom Krankenhaus erhalten. Es ist festzustellen, dass noch keine Einheitlichkeit bei den Überleitungsbögen besteht. Es ist zwar grundsätzlich egal, welcher Bogen zur Datenübermittlung Verwendung findet, aber es sollten dennoch Standards für die Pflegeüberleitung definiert werden (Höfert Rolf, Meißner Thomas, 2008, S. →). Im Gegensatz zu einer Versorgung im Krankenhaus kommen bei einer ambulanten Versorgung der Patienten mehrere Anbieter zum Einsatz. Darum kommt es hier oft zu „interorganisatorischer und interprofessioneller Schnittstellenproblematik“. Eine „anwaltschaftliche Funktion des Case Managers ist hier besonders gefragt“ (von Reibnitz Christiane, 2009, S. →). Eine fallbezogene Versorgung ist daher in Deutschland durchaus organisierbar, wenn ein Umdenken in den Versorgungskonzepten stattfindet und sich mehr an den Bedürfnissen der Patienten orientiert (von Reibnitz Christiane, 2009, S. →). Dettmers schreibt über die Situation der Sozialdienste und das daraus resultierende Spannungsfeld durch gestiegene Fallzahlen bei gleichbleibender Personalbesetzung. Er beschreibt in vier Punkten die Probleme von Sozialarbeit, die im quantitativen Anteil im Krankenhaus extrem gering ist. Eine patientenorientierte Überleitung ist wenig möglich, da eine geringe Entscheidungsbefugnis vorliegt. Seines Erachtens müsste ein Case Manager hier sektorübergreifend stationär als auch poststationär agieren können (Dettmers Stephan, 2010, S. →-→). Der Sozialdienst und die Überleitungspflege haben mit der DRG-Problematik zu kämpfen, wo Liegezeiten auf das Nötige beschränkt werden. Daher gilt es in einem Versorgungsforum die Patienten wieder in ihr Lebensumfeld zu überführen (Dettmers Stephan, 2010, S. →). Dettmers ist darüber hinaus der Meinung, dass immer ein grundständiges Studium im Gesundheitsbereich erforderlich ist, um sich der Tragweite der Aufgabe im Klaren zu sein. Dieses geht einher mit einer Erweiterung der Kontextualisierung mit anderen Professionen wie die Pflege und der Medizin (Dettmers Stephan, 2010, S. →). Für externe Leistungsanbieter bedeutet die Begrifflichkeit des Case Managements immer auch eine Eintrittskarte zur wirtschaftlichen Teilhabe an poststationärer Patientenversorgung (Dettmers Stephan, 2010, S. →). Dettmers sieht das Case Management aber auf keinen Fall als Substitut oder neue Profession zur sozialen Arbeit, da es sonst ohne ernsthaften Wirkungsgrad wäre (Dettmers Stephan, 2010, S. →).
Folgende Abbildung 2 zeigt die Struktur des Case Management. Sie stellt die Systemebene und die Fallebene dar. Beide Ebenen werden durch die Effektivitätsund Effizienzsteigerung mit dem daraus resultierenden Qualitätsmanagement verknüpft.
Quelle: http://www.beta-institut.de
Abbildung 2 Darstellung der Case Management-Struktur
Das Case Management (Fallmanagement) hat im Gegensatz zum Care Management Einfluss auf den Einzelfall und kann darüber hinaus Einfluss und Gestaltung auf die regionalen Strukturen und Netzwerke ausüben (Klie Thomas, Monzer Michael 2008, S. →). Care Management (Versorgungsmanagement) will im wesentlichen Überbzw. Unterversorgung vermeiden, und bei gleichzeitiger Kostenoptimierung die Bedürfnisse der Klienten berücksichtigen. Um auf Probleme des Gesundheitswesen einzuwirken, wurde Care Management in der 90er Jahren in Großbritannien eingeführt (Schaeffer Doris, 2000, S. →-→). Einer der Wichtigsten Punkte im Case Management für Entlassung des Klienten ist, dass unter dem Axiom „ambulant vor stationär“ rechtzeitig und umfassend die Angehörigen im Assessment mit einbezogen werden. (Dörpinghaus, Sabine, Grützmacher Sabine, Werbke Sebastian et al. 2004, S. →)
1.1.3. Clinical bzw. Critical Pathways
Die Möglichkeit des Clinical bzw. Critical Pathway ist in der Klientenversorgung in den letzten Jahren vermehrt an Krankenhäusern zu finden und soll das Durchschleusen des Klienten an den Schnittstellen in einer Gesundheitseinrichtung optimieren. Dieses soll dem Betrachter organisationsinterne Schwierigkeiten darlegen.
„Um den Klinikaufenthalt so effizient wie möglich zu gestalten, werden Clinical Pathways (klinische Behandlungspfade) oder Critical Pathways (kritische Behandlungspfade) entwickelt. Mit Hilfe dieses Instrumentariums soll der Patient zügig durch die Klinik geschleust werden, wobei die Berufsgruppen übergreifenden Schnittstellen beachtet sowie Wartezeiten und unnötige Liegezeiten vermieden werden. Ein Pfad beschreibt alle Tätigkeiten, die pro „Fall“ durchzuführen sind, also sämtliche diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen von der Aufnahme bis zur Entlassung. Er legt fest, wer wann welche Leistung zu erbringen hat und wie sich, je nach Ergebnis, der weitere Durchlauf durch die Klinik gestaltet. Clinical Pathways beruhen in ihren Eckpunkten (Diagnose und Therapie) auf Evidenz basierten Leitlinien. Die Abläufe müssen organisatorisch und strukturell immer auf die einzelnen Klinik abgestimmt werden.“ (Lusiardi Susanne, 2004, S. →)
Romeyke und Stummer kommen in ihrer Arbeit zu der Erkenntnis, dass die Clinical Pathways für komplexe Prozeduren die Verweildauer reduzieren und nicht die medizinische Infrastruktur u.a. senken (Romeyke Tobias, Stummer Harald, 2010, S. →). Wichtig ist vor allem, dass hier die teilweise sehr kostenintensiven Doppeluntersuchungen vermieden werden können, was zu einem immensen Einsparpotenzial führen würde. Zusätzlich sind Untersuchungen auch immer mit einer Belastung und/ oder Nebenwirkungen für den Klienten verbunden. Daher bestätigt Göbel, dass es bei der Wahl der ärztlichen Therapie, trotz unterschiedlicher Therapierichtlinien, zu bestimmten Behandlungsalgorithmen kommt. Diese müssen mit den Patientenbedürfnissen in Bezug gesetzt werden, um für die individuelle Therapie zu festgelegten Behandlungspfaden zu kommen (Göbel H., Heinze A. Heinze-Kuhn K., 2010, S.→





























