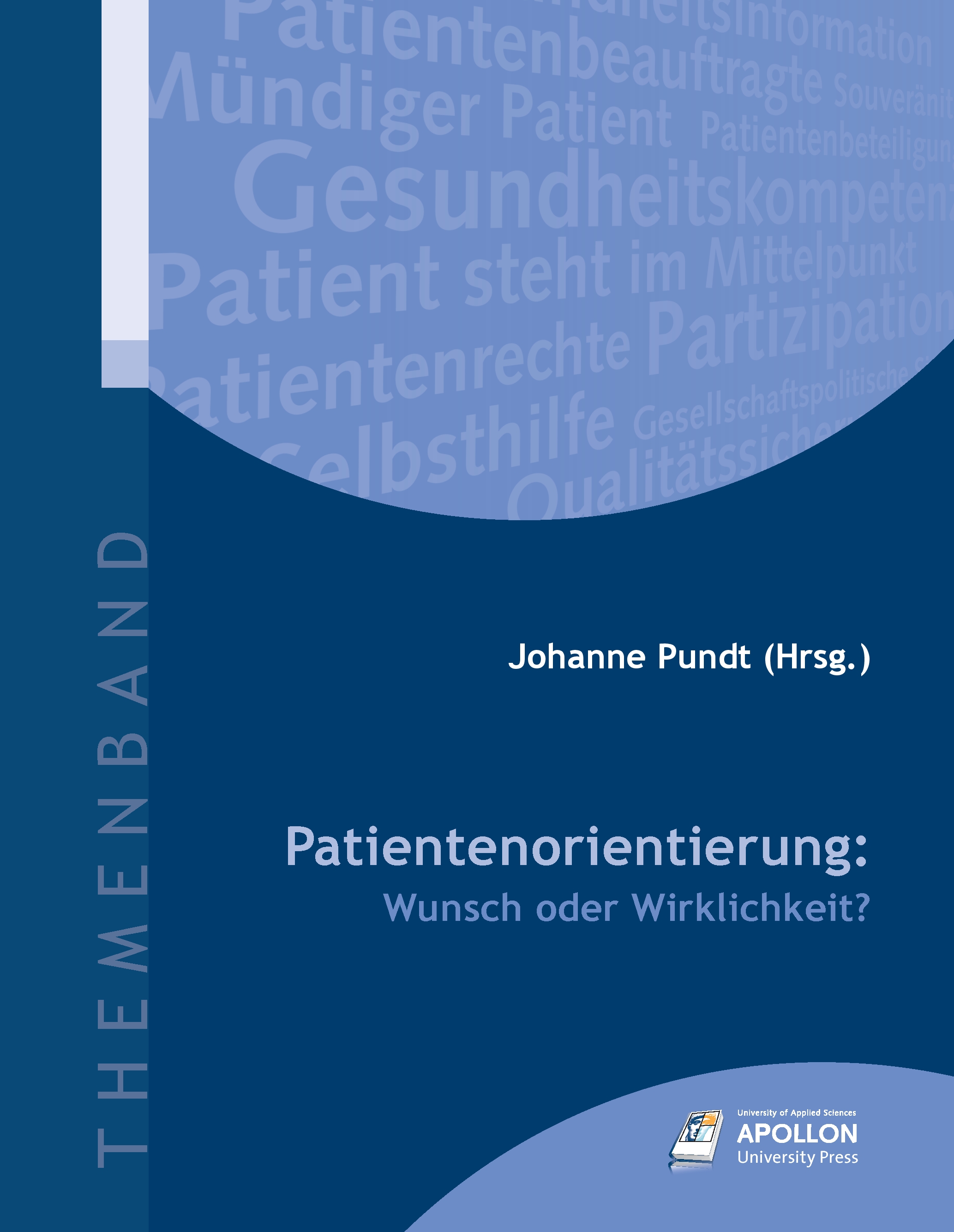
Patientenorientierung: Wunsch oder Wirklichkeit? E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Thema Patientenorientierung ist in aller Munde: Ob vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung oder von Selbsthilfeorganisationen; seit Jahrzehnten werden Maßnahmen und Initiativen gestartet, um den Patienten in den Mittelpunkt des Versorgungsprozesses zu rücken. Dieser Fokussierung auf den Patienten mit seiner spezifischen Rolle, seinen (subjektiven) Bedürfnissen, Rechten und (objektiven) Interessen widmen sich in diesem Themenband namhafte Autoren der Gesundheitsszene kritisch. Inwieweit die hohe Aufmerksamkeit für das Thema eher "Wunsch oder Wirklichkeit" darstellt, wird in den vielfältigen Dimensionen der Beiträge diskutiert, die sich auf ökonomische, ethische, soziologische und versorgungspolitische Komponenten beziehen. Der Themenband richtet sich sowohl an Studierende als auch an Wissenschaftler und Praktiker, die sich im Berufsalltag mit dem Thema befassen, um zukünftig einer wohlgemeinten Patientenorientierung hohe Priorität einzuräumen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Patientenorientierung: Wunsch oder Wirklichkeit?
(Johanne Pundt)
Politische Rahmenbedingungen für Patientenorientierung
1 Patientenrechte als Mogelpackung. Die mündige Patientin und das Patientenrechtegesetz
(Christoph Kranich)
1.1 Was ist das für eine Denkfigur, die „mündige Patientin“?
1.2 Neue Wege
1.3 Was hat das alles mit dem neuen Patientenrechtegesetz zu tun?
2 Kunden- und Patientenorientierung im GKV-Wettbewerb
(Herbert Rebscher)
2.1 Über „wen“ reden wir, wenn wir von Kunden-, Versicherten-und Patientenorientierung reden?
2.2 Bedarfsorientierte Patientenkontakte
2.3 Beurteilungsperspektiven
2.4 Integrierende Kontaktebenen
3 Patientenorientierung bei Leistungskatalogentscheidungen in der gesetzlichen Krankenversicherung
(Jeanine Staber)
3.1 Einführung
3.2 Struktureller Hintergrund für Nutzerbeteiligung in der gesetzlichen Krankenversicherung: Das Prinzip der Selbstverwaltung
3.3 Patienten und Versicherte als Nutzer der gesetzlichen Krankenversicherung
3.4 Definition des Leistungskatalogs in der gesetzlichen Krankenversicherung
3.5 Beteiligung des Nutzers an der Definition des Leistungskatalogs
3.6 Welcher Nutzer soll über die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung entscheiden?
3.7 Leistungskatalogdefinition durch die Versicherten – eine Skizze
3.8 Zusammenfassung und Ausblick
4 Welchen Stellenwert haben Patienten und ihre Vertretung bei der gesetzlichen Qualitätssicherung?
(Ilona Köster-Steinebach)
4.1 Wo sollte Patientenorientierung in der Qualitätssicherung greifen?
4.2 Patientenbedürfnisse – verwirklicht oder vergessen in der Qualitätssicherung?
4.3 Patientenverständliche Berichterstattung: Risiko oder Chance?
4.4 Patientenbeteiligung bei der Festlegung der Qualitätssicherung: Status quo und Verbesserungspotenzial
Instrumente und Wege für Patientenorientierung
5 Selbsthilfe als Wegbereiterin für mehr Patientenorientierung
(Ursula Helms)
5.1 Selbsthilfe in Deutschland
5.2 Ziele und Wirkungen der Selbsthilfe
5.3 Rahmenbedingungen für chronisch kranke und behinderte Menschen
5.4 Selbsthilfe und Patientenorientierung
5.5 Schlussbetrachtung
6 Ehrenamtliche Patientenfürsprecher an Krankenhäusern – ein wirksames Instrument der Patientenorientierung?
(Sonja Schenk)
6.1 Einleitung
6.2 Ehrenamtliche Patientenfürsprecher
6.3 Patientenfürsprecher aus drei Perspektiven
6.4 Die Patientenfreundlichkeit des Amtes
6.5 Patientenfürsprecher in Bremen
6.6 Stimmungsbild der Bremer Patientenfürsprecher
6.7 Fazit
7 Der mündige Patient zwischen E-Health und Cybermedizin: Hilfreiche oder unheilvolle Informationen aus dem Internet?
(Dietmar Löffner)
7.1 Das Internet als neue Informationsquelle
7.2 Die Qualität von Patienteninformationen im Internet und deren Auswirkung auf die Arzt-Patienten-Kommunikation
7.3 Schlussbetrachtung
8 Patientensicherheit und Patientenbeteiligung: Wie Patienten zu sicheren Versorgungsprozessen beitragen können
(Constanze Lessing, Günther Jonitz)
8.1 Die vielen Rollen des Patienten
8.2 Was wünschen sich Patienten und was motiviert sie?
8.3 Beispiele aus dem Aktionsbündnis Patientensicherheit
8.4 Patientenbeteiligung und Patientensicherheit aus Sicht der Wissenschaft
Durchsetzung und Perspektiven von Patientenorientierung
9 Gesundheitskompetenz fördern – Souveränität der Bürger und Patienten im Gesundheitswesen stärken
(Marie-Luise Dierks, Gabriele Seidel)
9.1 Gesundheitskompetenz gleich Health Literacy?
9.2 Gesundheitskompetenz der deutschen Bürger und Patienten – ein Blitzlicht
9.3 Gesundheitskompetenz stärken
9.4 Fazit
10 Patientenpartizipation: Entscheidungsteilhabe für mehr Gesundheit
(Susanne Hartung)
10.1 Gesundheitsförderung: Stärkung von Gesundheitsressourcen
10.2 Erklärungsansätze für die gesundheitliche Relevanz von Partizipation
10.3 Individuelle und soziale Hindernisse für Partizipation
10.4 Fazit
11 Patientenorientierung und Partizipative Entscheidungsfindung in der Integrierten Versorgung
Gesundes Kinzigtal
(Achim Siegel, Ulrich Stößel)
11.1 Merkmale und Ziele der Integrierten Versorgung Gesundes Kinzigtal (IVGK)
11.2 Drei Dimensionen patientenorientierter Maßnahmen in der IVGK
11.3 Partizipative Entscheidungsfindung in der IVGK aus Sicht der Patienten – Resultate einer kontrollierten Kohortenstudie
11.4 Patientenzufriedenheit mit den „Ärzten des Vertrauens“ und der integrierten Versorgung im Kinzigtal – erste Ergebnisse einer Trendstudie
11.5 Resümee
12 Patientensicherheit als Qualitätsmerkmal – Qualifizierung als Merkmal von Patientenorientierung
(Michael Rosentreter, Johanne Pundt)
12.1 Einleitung: Hintergrund und Ziel
12.2 Wandel der Arzt-Patienten-Beziehung
12.3 Kernaspekt: Sicherheit erfordert Kommunikation
12.4 Vom Problembewusstsein zum Handeln
12.5 Rahmenbedingungen für Qualifizierungsmaßnahmen zur Patientensicherheit
12.6 Fazit
Anhang
Autoren
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Vorwort
Das Thema Patienten- bzw. Nutzerorientierung zieht sich wie ein roter Faden durch die gesundheitspolitischen und gesundheitswissenschaftlichen Diskussionen der letzten Jahrzehnte. Wann immer man jedoch Patienteninterviews anschaut und am besten vorher die Jahre eliminiert, in denen sie durchgeführt wurden, zeigt sich, dass sie sich erschreckend ähneln – vor allem in ihrer Kritik am Versorgungswesen. Patienten bzw. Nutzer fühlen sich unzureichend beachtet, ungenügend einbezogen, nicht gewürdigt und nicht respektvoll behandelt. Oft sogar gegenteilig: Sie sehen sich als Objekt betrachtet und dem System und seinen Akteuren ausgeliefert. Klagen darüber ziehen sich seit Jahren durch Patienteninterviews (und auch durch die Fachliteratur), sodass der Eindruck entsteht, trotz aller Diskussionen über Patienten- bzw. Nutzerorientierung habe sich der Versorgungsalltag relativ wenig verändert.
Und doch haben die vergangenen Jahre auch in Deutschland einen deutlichen Progress beschert, was die Stärkung der Patientenpositionen anbetrifft. Stichwortartig seien einige wichtige Stationen erwähnt: Seit den 1990er-Jahren schreitet der Ausbau der Patientenberatung und -information sukzessiv voran, seit der Gesundheitsreform 2000 auch der der Unabhängigen Patienten-und Nutzerberatung. Mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz 2008 wurde ergänzend die flächendeckende Einrichtung von Pflegestützpunkten und Pflegeberatung beschlossen. Zudem erfolgte eine Stärkung der Patientenrechte: Im Jahr 2002 wurde zunächst die Charta der Patientenrechte verabschiedet und ein Jahr später konnte erstmals ein Vertreter für die Belange der Patienten – eine Patientenbeauftragte – von der Bundesregierung eingesetzt werden. 2004 wiederum hielten Vertreter von Patientenorganisationen Einkehr in wichtige Entscheidungsgremien und haben dort zwar kein Stimm-, aber ein Mitspracherecht in vielen versorgungsrelevanten Fragen. Schließlich wurde 2013 ein Patientenrechtegesetz verabschiedet. Dieses sind einige Stationen, die sich ergänzen ließen, etwa um Schritte zur Sicherung von Transparenz.
Insgesamt zeigen sie, dass die Realisierung von Patienten- bzw. Nutzerorientierung voranschreitet. Ein befriedigender Zustand ist jedoch noch nicht erreicht, zumal sich die Implementation vieler beschlossener Reformen schwierig darstellt. Auch die erwähnten Patientenäußerungen und vor allem die in der letzten Zeit erschienenen Befunde zum Health Literacy Niveau der deutschen Bevölkerung unterstreichen, wie zahlreich die bestehenden Herausforderungen bei der Realisierung von Patienten- bzw. Nutzerorientierung sind. Sie belegen damit auch, dass ein Buch zu diesem Thema nach wie vor wegweisend und sinnvoll ist. Allein die Auswahl der Autoren, als auch die facettenreichen Beiträge lassen hoffen, dass es die Diskussionen über Patienten- bzw. Nutzerorientierung durch weitere Impulse und Anregungen bereichert.
PROF. DR. DORIS SCHAEFFER
Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld;
AG Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft und u.a.
Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
Einleitung
Patientenorientierung: Wunsch oder Wirklichkeit?
JOHANNE PUNDT
Einstimmung in das Thema
Obwohl der Begriff „Patientenorientierung“ in den letzten Jahren an Profil gewonnen hat, ist es nach wie vor nicht einfach, eine geeignete Definition auszumachen. Der Terminus wird – je nach Kontext – ganz unterschiedlich diskutiert und heute vermehrt als Oberbegriff subsumiert, der je nach Einstellung der Akteure im Gesundheitswesen differieren kann (vgl. z. B. Feuerstein, Badura, 2001; Reibnitz et al. 2001; Klusen et al., 2009; Ose, 2011; Hoefert, Härter, 2011). So wird aus Sicht von Ökonomen die Unterstützung einer effizienten Steuerung der Gesundheitsversorgung in den Mittelpunkt gerückt, während Patientenvertreter dem Thema Autonomie und Gewährleistung von Patientenrechten Beachtung schenken und das Pflegepersonal wiederum den Subjektcharakter des Patienten im Zusammenhang von Betreuung und Therapie als zentralen Aspekt der Patientenorientierung ansieht. Innerhalb der Krankenhausorganisation spielt beim Thema Patientenorientierung die Weiterentwicklung von Qualitätsmanagement eine wichtige Rolle, denn hier werden Elemente wie Beschwerdemanagement, Patientensicherheit und -zufriedenheit berücksichtigt. Die Ursache der verschiedenen Sichtweisen hängt u. a. mit dem Prozess struktureller Gesundheitsreformen zusammen, in die die Vertiefung um das Thema Patientenorientierung integriert ist.
Eine Vielzahl an Publikationen widmet sich seit Jahrzehnten dem komplexen Thema. Sie sind kaum überschaubar, denn sie betrachten je nach Zielsetzungen und Fragestellungen Strukturen, Prozesse, Konzepte, Elemente, Verhaltensweisen, Interessen, Bedürfnisse und Instrumentarien der Patientenorientierung. Von neutraler Stelle hat insbesondere der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) – damals noch Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen – in seinen Gutachten 2000/20011 und 20032 das Thema aufgenommen und es konzeptionell mit der Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen verknüpft (vgl. SVR, 2001, S. 148). Dies löste unter allen Akteuren eine intensivere Auseinandersetzung mit der Patientenorientierung aus als je zuvor. In der Folge ist das Thema parteiübergreifend zum Bestandteil der politischen Agenda geworden. Gleichwohl ist der Begriff nach wie vor „nebulös“ (vgl. Schaeffer, 2001, S. 49) und „bisweilen auch breit interpretierbar“ (vgl. Hoefert; Härter, 2011, S. 11).
Patientenorientierung meint, sich auf die spezifische Rolle der Patienten, ihre (subjektiven) Bedürfnisse, Rechte und (objektiven) Interessen zu fokussieren. Sie setzt auf der Makro-Ebene an, beispielsweise bei den politischen Rahmenbedingungen oder der Gesetzgebung. Diese wirken auf die Meso-Ebene der Strukturen und Institutionen ein mit dem Ziel, auf der Mikro-Ebene – also der Arzt-Patienten-Beziehung – erwünschte patientenbezogene Effekte zu erreichen. Gleich ob man von Kunden, Versicherten, Nutzern, Bürgern, Laien, Konsumenten, Bewertern (vgl. Dierks et al., 2001) oder eben von Patienten spricht, es ändert nichts daran, dass diese Menschen einerseits Empfänger von Gesundheitsleistungen sind und anderseits für ihre Gesundheit selbst sorgen müssen. Zu der altbekannten Rolle sind neue hinzugekommen. Sie alle existieren nebeneinander, sodass ein und dieselbe Person mehrere Rollen gleichzeitig wahrnehmen kann.
Doch bekanntlich hat jede Medaille zwei Seiten. Eine zeigt sich durch die beliebte Sentenz: „Der Patient steht im Mittelpunkt.“ Seine Präferenzen und Erwartungen an die Leistungserbringer, Kostenträger und an das Gesundheitssystem insgesamt haben sich deutlich gewandelt. Sowohl die Aktivitäten von Beratungsstellen und Verbänden als auch Maßnahmen zur Stärkung der Patientenautonomie, -beratung und -versorgung vonseiten des Gesetzgebers haben das Selbstmanagement der Patienten gefördert. Hierzu zählen z. B. neue Versorgungsinitiativen wie etwa die Partizipative Entscheidungsfindung sowie professionelle Beratungskonzepte. Empowerment ist hier das Stichwort.
Und selbst auf der politischen Ebene ist der Patient präsenter geworden, wenn auch nicht durchgängig mit aktivem Stimmrecht. Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten sind dennoch vorhanden, etwa in Gestalt des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, der Patientenvertreter auf Landesebenen sowie der Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss, deren selektive Beteiligung und Etablierung auf Anraten des SVR zustande kamen.
Die andere Seite der Medaille – nicht minder komplex – weist auf die Probleme des Patienten hin, denen er ausgesetzt ist, wenn er als passiver Empfänger von Gesundheitsleistungen und als Kostenfaktor betrachtet wird, wenn er keine neutrale, qualitätsgesicherte medizinische Informationen erhält, wenn seine gesundheitsbezogene Versorgung nicht bedürfnisgerecht verläuft oder wenn ihm keine Entscheidungsrechte hinsichtlich Transparenz und Mitbestimmung seiner Behandlungsverläufe eingeräumt werden. Eine rigide Kostenausrichtung und eine strenge sektorale Gliederung scheinen daher im Widerspruch zur Patientenorientierung zu stehen. Sollen Maßnahmen zur verbesserten Patientenorientierung ihr Ziel wirklich erreichen, ist eine klärende Diskussion erforderlich.
Der vorliegende Themenband wird sich daher ausführlich den beiden zuvor skizzierten Seiten der Medaille widmen. Dabei wird er aus praxisnaher Perspektive aufzeigen, dass bei der Patientenorientierung Wunsch und Wirklichkeit nicht immer miteinander übereinstimmen. Die zwölf Beiträge heben hervor, dass Patienten Orientierung benötigen, um Rechte, Wahlmöglichkeiten und Selbstsorgepotenziale erkennen und nutzen zu können und um als „Koproduzenten von Gesundheit“ (vgl. SVR, 2003, S. 275) einen zentralen Beitrag zum Behandlungserfolg zu liefern. Und sie zeigen, dass Patienten in ihren spezifischen Rollen Problemen ausgesetzt sind, die zur Vernachlässigung, Missachtung und zum Verkennen ihrer Möglichkeiten und Chancen führen können.
Dazu werden in den nachfolgenden Beiträgen vielfältige Dimensionen angesprochen, die sich auf ökonomische, ethische, soziologische und versorgungspolitische Komponenten beziehen. Im ersten Teil geht es um die politischen Konsequenzen für Patientenorientierung, wenn Christoph Kranich – wie gewohnt kritisch – über das neue Patientenrechtegesetz berichtet und dabei das oft postulierte Leitbild des Patienten als mündigen Konsumenten im Gesundheitswesen im Kontrast zum Bürger und Kunden diskutiert. Für den Autor spielt das Vertrauen zwischen dem Professionellen (Arzt) und dem Patienten (Laien) eine zentrale Rolle, damit ein partnerschaftliches und kooperationsbereites Verhältnis entstehen kann. Dieses neue Verhältnis soll den Patienten aber nicht mit Gesundheitswissen überfordern. Zudem muss es die Grenzen der Patientenautonomie berücksichtigen.
Im nächsten Beitrag weist Herbert Rebscher unmissverständlich auf die unterschiedlichen Interessenlagen und Perspektiven der Kunden im wettbewerblichen Krankenversicherungssystem hin. Er segmentiert und differenziert die Kundenbedürfnisse mit ihren möglichen gesundheitspolitischen und gesundheitsökonomischen Folgen und fordert, das Verständnis der Kundenorientierung zu präzisieren. Es folgt Jeanine Staber, die sich mit den Entscheidungen des Leistungskatalogs der GKV auseinandersetzt. Die Autorin analysiert, inwiefern Patienten bei der Definition des Leistungskatalogs mitwirken, und diskutiert, in welchem Maße die Präferenzen der Patienten adäquat bei der Leistungskataloggestaltung bedacht werden sollen und mit welchen Schritten dies umgesetzt werden kann. Welche Wege zur Patientenorientierung in diesem Kontext gelingen können, legt Ilona Köster-Steinebach in ihrem Beitrag dar. Sie mahnt die Gewährleistung von Patienteninformationen an und zeigt Maßnahmen auf, in denen Patientenorientierung innerhalb der externen Qualitätssicherung realisiert werden könnte. Die Autorin begründet das Verbesserungspotenzial der Patienteninteressen mit den nicht adäquat vertretenen Positionen der Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss.
Im zweiten Teil des Themenbands geht es um Instrumente und Wege der Patientenorientierung. Vier Beiträge gehen der Frage nach, wie die Patienten verstärkt zu autonomem Handeln befähigt werden können. Entscheidend forciert worden ist die Patientenorientierung von der Selbsthilfebewegung, auf die sich Ursula Helms konzentriert. Mit dem Wettbewerbsstärkungsgesetz von 2007 wurden die Krankenkassen verpflichtet, Selbsthilfegruppen und -organisationen zu fördern. Die Autorin betont diese aktive Rolle, appelliert an die Akteure der Gesundheitswirtschaft und betont, dass eine umfassende patientenorientierte Versorgungsausrichtung, die diesen Namen verdient, nur unter Beteiligung der Selbsthilfevereinigungen und -gruppen zu bewältigen ist. Ähnlich argumentiert Sonja Schenk, die sich in ihrem Beitrag mit den Aufgaben eines Patientenfürsprechers auseinandersetzt. Die Autorin fragt nach dem Einfluss, den die Ländergesetzgebung auf die Wahrnehmung und Ausübung dieser ehrenamtlichen Position im Krankenhaus hat, und reflektiert kritisch diese Möglichkeiten, die vom Selbstverständnis der stationären Einrichtungen abhängen.
Welche zentrale Rolle valide Gesundheitsinformationen für Patienten spielen, wird in dem Beitrag von Dietmar Löffner deutlich. Längst ist bekannt, dass immer mehr Patienten ihre Ärzte mit Informationen aus dem Internet konfrontieren. Es stellt sich für den Autor aber die Frage, wie seriös und geeignet diese im Cyberspace zur Verfügung stehenden Informationen sind, um sich ggf. eigenverantwortlich (wenn auch kooperativ) für oder gegen eine medizinische Maßnahme entscheiden zu können. Im Ergebnis wird ein Kriterienkatalog präsentiert, der die Qualität ausgewählter Informationsseiten bewerten soll und dem Patienten damit wichtige Empfehlungen an die Hand gibt.
Stichwort Patientensicherheit: Um diesem Thema aufgrund der zunehmenden Meldungen von medizinischen Behandlungsfehlern und Schäden höchste Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, stellen Constanze Lessing und Günther Jonitz in ihrem Beitrag fest, dass eine aktive Beteiligung der Patienten auch dazu dient, Fehler in der Gesundheitsversorgung so weit wie möglich zu vermeiden. Die beiden Verfasser erörtern, welche Inhalte und Kommunikationsformen es ermöglichen, Patienten in die Mitgestaltung der Patientensicherheit einzubeziehen. Sie zeigen auf, inwieweit Kampagnen zur Aktivierung der Patienten beitragen und konfrontieren den Leser mit Fragen über die Initiativen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und über die Bedarfe, die von Patientenseite zur eigenen Sicherheit eingefordert werden müssen.
Im dritten und letzten Teil werden in vier weiteren Beiträgen Möglichkeiten zur Durchsetzung und Perspektiven der Patientenorientierung präsentiert. Einerseits beziehen sich die Autoren dabei auf die Stärkung der Patientenkompetenz, auf seine Interessen und die damit verbundene Förderung der Patientensouveränität sowie auf die Chancen und Grenzen partizipativer Versorgungswege; andererseits werden Qualifizierungspotenziale für Ärzte aufgezeigt, die als wichtiges Qualitätsmerkmal im Sinne der Patienten eingestuft werden können.
Marie-Luise Dierks und Gabriele Seidel setzen sich kritisch mit dem Ansatz der Health Literacy auseinander, diskutieren wissenschaftliche Konzepte der Gesundheitskompetenz und verfolgen aktuelle Initiativen zu dessen Weiterentwicklung am Beispiel verschiedener Initiativen (z. B. der „Patientenuniversität“), die sich an Erwachsene, aber auch explizit an Schüler und Jugendliche wenden. Achim Siegel und Ulrich Stößel gehen auf neue Entwicklungen zur Partizipativen Entscheidungsfindung (SDM) ein. Sie analysieren im Rahmen der Integrierten Versorgung des Gesunden Kinzigtals die SDM-Implementierungsversuche und zeigen auf, wie sich das Potenzial für patientenorientierte Versorgungsangebote auf die Patientenzufriedenheit auswirkt. Darüber hinaus legen sie dar, welche Interventionen (Patientenschulungen, Informationsveranstaltungen) und vor allem welche institutionellen Prozesse und Hindernisse bei der Mitgestaltung zu berücksichtigen sind.
Susanne Hartung beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit den vielfältigen Einflussmöglichkeiten der Gesundheitskompetenz auf die Partizipation der Patienten. Die Autorin stellt im Sinne des Public Health Ansatzes beispielhafte Gesundheitsressourcen und ihre Barrieren in Zusammenhang zur Entscheidungsteilhabe und erklärt an einem Beispiel, wie relevant gesundheitliche Wirkungen für die partizipative Diskussion sein können. Den Abschluss bilden die Autoren Michael Rosentreter und Johanne Pundt, die nicht die Perspektive der Patienten in Punkto Sicherheit, sondern die Sicht der Leistungserbringer in diesem Kontext sichtbar machen möchten. Sie zeigen auf, dass gerade die Informationsasymmetrie und das Machtgefälle zwischen Arzt und Patient eine gelungene Kommunikation der Beteiligten erschwert. Nach Meinung der Verfasser könnte durch gezielte Aufklärungsarbeit in Form eines speziellen Qualifizierungsangebots für Mediziner eine Bewusstseinserweiterung in Richtung Patientensicherheit realisiert werden. Zur ärztlichen Patientenorientierung, so die Autoren, gehöre neben der fachlichen Kompetenz unbedingt die Möglichkeit, diese in (kommunikative) Handlungen umzusetzen.
In ihrer Gesamtheit beleuchten die in dem vorliegenden Themenband zusammengefassten Beiträge das facettenreiche und überaus komplexe Thema der Patientenorientierung umfassend und interdisziplinär. Sie spiegeln nicht nur die aktuelle Forschungslage wider, sondern zeigen dem Leser darüber hinaus eine Fülle möglicher Ansatzpunkte und Wege zu einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung auf. Der Themenband richtet sich somit sowohl an Studierende als auch an Wissenschaftler und Praktiker, die sich im Berufsalltag mit dem Thema befassen, um zukünftig einer wohlgemeinten Patientenorientierung hohe Priorität einzuräumen. Den Leserinnen und Lesern wünsche ich eine aufschlussreiche Auseinandersetzung mit diesem uns alle betreffenden Thema.
Literatur
Dierks, M. L. et al. (2001).Patientensouveränität. Der autonome Patient im Mittelpunkt. Nr. 195. 11/2001. Arbeitsbericht. http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2004/1882/pdf/AB195.pdf (02.10.2013).
Feuerstein, G.; Badura, B. (1991).Patientenorientierung durch Gesundheitsförderung im Krankenhaus.: Graue Reihe, Neue Folge Bd. 39. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
Reibnitz, C. von; Schnabel, P.-E.; Hurrelmann; K. (Hrsg.) (2001).Der mündige Patient. Konzepte zur Patientenberatung und Konsumentensouveränität im Gesundheitswesen. Weinheim/München: Juventa.
Schaeffer, D. (2001).Patientenorientierung und -beteiligung in der pflegerischen Versorgung. In: Reibnitz, C. von (Hrsg.): Der mündige Patient. Konzepte zur Patientenberatung und Konsumentensouveränität im Gesundheitswesen. Weinheim/München: Juventa, S. 49–60.
Hoefert, H.W.; Härter, M. (Hrsg.) (2011).Patientenorientierung im Krankenhaus. Göttingen (u.a.): Hogrefe.
Klusen, N.; Fließgarten, A.; Nebling, T. (Hrsg.) (2009).Informiert und selbstbestimmt. Der mündige Bürger als mündiger Patient. Beiträge zum Gesundheitsmanagement. Band 24. Baden Baden: Nomos.
Ose, D. (2011).Patientenorientierung im Krankenhaus. Welchen Beitrag kann ein Patienteninformations-Zentrum leisten? Wiesbaden: VS Research Verlag für Sozialwissenschaften.
SVR – Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2000/2001).Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung und Partizipation. Band 1. Baden Baden: Nomos.
SVR – Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2003).Gutachten 2003. Finanzierung, Nutzwertorientierung und Qualität. Baden Baden: Nomos.
1 Im Kapltel:„Optlmlerungdes Nutzerverhaltens durch Kompetenz und Partizipation“.
2 Im Kapltel:„Wege zur Nutzerorientierung und Partizipation“.
I Politische Rahmenbedingungen für Patientenorientierxung
1Patientenrechte als Mogelpackung. Die mündige Patientin und das Patientenrechtegesetz
CHRISTOPH KRANICH
Gibt es die mündige Patientin (und den immer mitgemeinten Patienten) wirklich? Alle reden von ihr, oft in den höchsten Tönen. Ein Beispiel:
„Der mündige Patient ist längst zum politischen Programm geworden. Dahinter steht ein so tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel, vergleichbar mit der Emanzipation der Frauen oder dem Weg zu einem vereinten Europa.“ (Schäffler, 2012, S. 22)
Das sind große Worte, da traut man sich gar nicht mehr zu zweifeln. Trotzdem möchte ich sie infrage stellen – um dasselbe dann dennoch zu fordern.
Vor gut 20 Jahren, 1992, veranstaltete der Bremer Gesundheitsladen eine Tagung mit dem Titel „Der mündige Patient – eine Illusion?“ (vgl. Kranich; Müller, 1993). Die Thesen, Themen und Forderungen von damals sind heute noch gültig, teils sogar verschärft. Sie müssen so lange immer wieder von neuem vorgetragen und angemahnt werden, bis sich einmal wirklich etwas bewegt. – Ein Beispiel:
„Der Patient sucht die Heilung – sucht dies auch der Arzt? Oder gibt es zumindest daneben andere Interessen wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Natur? Das ist eine Situation, die es ganz sicherlich erforderlich macht, die Position des Patienten zu stärken.“
Das betonte 1992 die Bremer Gesundheitssenatorin Irmgard Gaertner in ihrem einleitenden Grußwort zur Tagung (vgl. Kranich; Müller, 1993, S. 8). Heute könnte das eine Ministerin noch viel pointierter sagen. Denn die Durchdringung des Gesundheitssystems mit Fremdinteressen, die nicht die der Patientin und des Patienten sind, hat in den letzten 20 Jahren eher zu- als abgenommen.
Im selben Jahr 1992 hat übrigens auch der Sachverständigenrat – damals hieß er noch „… für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“ (folgend: Sachverständigenrat) – ein wegweisendes Kapitel über Patientenrechte in sein Jahresgutachten geschrieben. Daraus soll der folgende Satz zitiert werden:
„Eine spezielle Definition von Patientenrechten im Rahmen der allgemein anerkannten Menschenrechte ist erforderlich, da der Patient, der idealtypisch im Mittelpunkt des für ihn unterhaltenen Gesundheitswesens steht, sich durch sein Kranksein in einer Position der Schwäche und Abhängigkeit befindet und daher eines besonderen Schutzes bedarf.“ (SVR, 1992, RNr. 352, S. 105)
Das ist die Forderung nach einer Kodifizierung der Patientenrechte – und damit die Überleitung zum aktuellen Patientenrechtegesetz. Es ist allerdings keineswegs so neu und revolutionär, wie uns allenthalben glauben gemacht werden soll. Auch hierfür ein Zitat: „Insgesamt sind die Eckpunkte des Gesetzes für Ärzte nicht schädlich“ (Montgomery F.-U., zit. n. Gieseke, 2012) sagte am 6. Januar 2012 Deutschlands Ärztepräsident, Montgomery, gegenüber der Ärzte-Zeitung. (Damals lagen für das Gesetz nur erste Eckpunkte vor.) Nun ist nicht nur das für Patienten gut, was für Ärzte schädlich ist; aber wenn man Patientenrechte kodifiziert, dann geht es in erster Linie darum, ihre Rechte gegenüber den Leistungserbringern im Gesundheitswesen zu definieren und damit auch deren Rechte etwas in die Schranken zu weisen. Das betrifft naturgemäß vor allem Ärzte, denn sie sind und bleiben nun einmal die „Leitprofession“ im Gesundheitssystem. Am Ende des Beitrags wird noch einmal darauf eingegangen.
1.1Was ist das für eine Denkfigur, die „mündige Patientin“?
Das Wort „Mündigkeit“ hat mehrere Schattierungen. Juristisch bezeichnet es den Übergang von der Verantwortung der Eltern für ihre Kinder in die Selbständigkeit und Eigenverantwortung des jungen Erwachsenen. Der ist bei uns seit einigen Jahrzehnten auf das Alter von 18 Jahren festgelegt – egal, ob der junge Mensch dieser Aufgabe schon vollkommen gewachsen ist oder nicht. Philosophisch und pädagogisch dagegen meint Mündigkeit mehr eine Haltung oder Einstellung zum Leben, eine selbständige Durchdringung und Verarbeitung des Erlebten, sie hat viel mit Autonomie, Emanzipation und Kritikfähigkeit zu tun. Es geht bei der Vorstellung von der „mündigen Patientin“ also um Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und kritische Reflexion. Patienten sollen sich emanzipieren von ihren Ärzten und von der verordneten Versorgung durch ein „entmündigendes“ Medizinsystem.
Aber: Es wäre zu fragen, ob die frühere, eher unmündige Patientin nicht viel glücklicher war. Ihre Hausärztin (beziehungsweise in diesem Fall doch eher der männliche Hausarzt) war Tag und Nacht für sie da, kannte ihre ganze Familie, wusste immer, was das Beste für sie ist. Da fühlte sich die Patientin doch sehr viel aufgehobener, umsorgter und wohler als heute. Jetzt soll sie partout mündig und selbstbestimmt ihrer Ärztin oder ihrem Arzt gegenübertreten – sie wird sogar noch aufgefordert, ihren Willen in eine Patientenverfügung zu schreiben, weil sie vielleicht eines Tages gar nicht mehr fähig ist, ihn selbst zu artikulieren. Kann und will die Patientin wirklich mündig werden? Wenn jemand krank ist, Schmerzen und Fieber hat, der Kopf sich von innen leer anfühlt – kann man dann mündig, kritikfähig, autonom sein und mit Überblick und Augenmaß Entscheidungen treffen?
Ist nicht die „mündige Patientin“ das Phantasieprodukt einer neuen Welt, die durchdrungen ist von zwei Paradigmen: auf der einen Seite dem wichtigsten Leitsatz der Naturwissenschaft, Darwins Vorstellung vom „Kampf ums Dasein“ – der mich immer an die verzweifelte Einsamkeit und Ausgeliefertheit von Hermann Hesses Steppenwolf erinnert; und auf der anderen Seite dem Grundprinzip der modernen Ökonomie, dem Wettbewerb, der eigentlich auch nichts anderes darstellt, als der Darwin’sche Kampf ums Dasein, angereichert durch die beruhigende Vorstellung: wenn jede möglichst gut für sich selbst sorge, gehe es auch allen anderen gut.
Die heutige Patientin ist nicht mehr aufgehoben in der bürgerlichen oder dörflichen Geborgenheit, zu der der frühere Hausarzt gehörte. Sie ist stattdessen einer gnadenlosen Marktwirtschaft ausgeliefert, deren Akteure vor allem ihr eigenes Gewinninteresse im Auge haben. Diesem System gegenüber muss sie heute möglichst mündig und selbstbestimmt agieren lernen.
Genauso geht es uns auch in anderen Rollen. Wie sieht es mit dem Leitbild der „mündigen Bürgerin“ aus? Ihre Mündigkeit beschränkt sich auch heute noch darauf, alle vier Jahre zu einer Wahl gehen zu dürfen – wenn sie will. Doch sie will das immer seltener: Die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen ist in den letzten knapp 40 Jahren um 20 % gesunken, von 91 % 1972 auf 71 % 2009 (Bundeswahlleiter). Ist das die einzige Form, Mündigkeit auszudrücken: nicht mehr zur Wahl zu gehen?
Oder nehmen wir die „mündige Kundin“. Früher war der Kunde König. Die Kundin ließ sich vom Händler oder Dienstleister ihres Vertrauens beraten, bestellte ein Produkt oder eine Leistung, die sie brauchte, und konnte sie bezahlen. Diese Souveränität geht heute aber immer mehr verloren, denn die Vielfalt der Produkte und Leistungen ist nicht mehr zu überschauen. Immer mehr Menschen kaufen, auch wenn sie kein Geld besitzen, und verschulden sich. Die wichtigen Produkte des Lebens werden immer komplexer, schwieriger zu handhaben und gehen schneller kaputt. Die Kundin wird zur Verbraucherin. – Der Unterschied ist, dass die Kundin von ihrem Gegenüber, dem Händler oder Dienstleister, sehr individuell behandelt und betreut wird, hier sprecht man auch von der „Stammkundin“. Die Verbraucherin dagegen steht einem anonymen System, einer großen Firma oder einem ganzen Konsortium gegenüber mit einer Vielzahl unübersichtlicher Funktionen und Ansprechpartner.
Gibt es die „mündige Verbraucherin“? Die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen sind immer um ein Vielfaches stärker. Sie haben die größeren Werbeetats, die besseren Rechtsanwälte, kurz: fast alle Macht auf ihrer Seite. Diejenigen, die die Verbraucherinteressen vertreten, können nur als die „Kläffer am Bein der Mächtigen“ bezeichnet werden. Ein großes Versicherungsunternehmen gibt nur für eine einzige Werbekampagne mehr Geld aus, als allen Versicherungsabteilungen von deutschen Verbraucherzentralen in 50 Jahren für Verbraucherberatung und Verbraucherschutz zur Verfügung steht. Die Verbraucherin ist auf ganzer Linie im Nachteil: Sie wird nicht objektiv beraten; sie kann ohne Brille das Kleingedruckte nicht lesen; und selbst wenn sie es lesen kann, versteht sie die komplizierte juristische Sprache nicht; meist findet sie auch niemanden, der ihr bei alledem hilft.
Da ist die „mündige Patientin“ doch in guter Gesellschaft. Auch sie fühlt sich einem undurchsichtigen Medizinsystem ausgeliefert. Bei ihrer Hausärztin kann sie sich vielleicht noch wie eine Kundin vorkommen, aber im Krankenhaus ist ihre Lage oft noch brisanter als im Supermarkt: Wer ist hier zuständig? Wer lindert ihr Leid, wer nimmt ihr die Schmerzen, wer hilft ihr, damit sie wieder klar denken kann? Noch schlimmer: Wer schützt sie vor Operationen, die nur durchgeführt werden, weil sie mit den lukrativeren Fallpauschalen vergütet werden? Ist es nicht erstaunlich, dass 85 % der Versicherten der Techniker Krankenkasse, denen eine Wirbelsäulenoperation empfohlen wurde, nach einer systematisch geförderten Zweitmeinung gar nicht operiert werden müssen, sondern genauso gut schonend-konservativ behandelt werden könnten (TK, 2012)?
Ist die „mündige Patientin“ ein Produkt des Kapitalismus? Noch ein Zitat aus der Zeitschrift Healthcare Marketing:
„Wenn immer mehr Gesundheitsleistungen aus eigener Tasche bezahlt werden müssen, scheint es sinnvoll, die Rolle der Patienten im Gesundheitssystem zu reformieren und sie zu ›selbstbewussten Beitragszahlern‹ zu erziehen.“ (Schäffler, 2012, S. 22)
Die Patientin soll zur Mündigkeit erzogen werden – ist das nicht ein Widerspruch? Da wird die Mündigkeit nur gefördert, wenn und weil es ums Bezahlen geht. Nicht weil der Mensch ein zur Mündigkeit begabtes oder veranlagtes Wesen ist oder etwa aus demokratietheoretischen Überlegungen. Nein: Wer zahlt, schafft an, ist die Devise. Solange eine Leistung von der Krankenkasse bezahlt wird, brauchen wir keine Mündigkeit; erst wenn die Patientin selbst zur Kasse gebeten wird. Was ist das für eine Denkfigur?
1.2Neue Wege
Es führt wohl kein Weg mehr zurück zum alten Vertrauen. Die moderne Medizin ist im marktwirtschaftlichen Kapitalismus eine große Maschine geworden, bei der die Patientin der Kundin und Verbraucherin immer ähnlicher wird: „mündig“ und frei, aber auch verunsichert und ausgeliefert. Denn die Freiheit kann sie gar nicht nutzen, weil sie durch Schmerz, Leid, Krankheit, körperliche und seelische Einschränkungen noch viel weniger souverän ist als die Kundin oder Verbraucherin; und weil sie das persönliche Vertrauensverhältnis zum therapeutischen Team noch viel dringender braucht als die Kundin beim Friseur oder die Verbraucherin im Supermarkt.
Früher war das Vertrauen der Patientin zu ihrer Ärztin quasi naturgegeben. Beide spürten, dass sie füreinander da waren, und verhielten sich dementsprechend verantwortlich. Das machte es unnötig, über „Mündigkeit“ zu reden. Der Sachverständigenrat nannte dieses alte Arzt-Patient-Verhältnis „benevolenten Paternalismus“ (SVR, 1992, RNr. 363, S.107).
Ein Zerrbild dieses positiven, vielleicht etwas verklärten Bilds ist die Bevormundung der Patientin aus sachfremden Gründen, sozusagen der „malevolente Paternalismus“. Dieser ist überall dort anzutreffen, wo die Patientin noch vertrauen will, aber nicht mehr weiß, wem sie vertrauen kann. Niemand will ihre Wünsche und Bedürfnisse hören, alle handeln nach ihrer eigenen Rationalität: Die Ärzte verordnen, was ihnen am meisten Geld bringt; die Krankenkassen bezahlen nur, was am billigsten ist, und werben nur um Junge und Gesunde.
Das Leitbild von der „mündigen Patientin“ wird zum zynischen Zerrbild, wenn es in einer freien Marktwirtschaft verortet wird, wo „Jeder seines Glückes Schmied“ ist. Die Patientin kann nicht so mündig sein wie die Kundin – und selbst die ist der Brutalität der Marktgesetze häufig nicht gewachsen, fühlt sich ausgeliefert und „über den Tisch gezogen“. Für die Patientin gilt das doppelt und dreifach.
Ein positives Bild von der mündigen Patientin – dieses Mal ohne Anführungszeichen – kann man sich nur in einer ähnlich aufgehobenen Situation vorstellen wie in der romantischen Darstellung vom alten Hausarzt, nun aber auf der moderneren Grundlage größtmöglicher Autonomie und Selbstbestimmung. Da wird die Ärztin zum Dienstleister, zum Berater für die Patientin. Aber diese Vorstellung funktioniert nicht in einer Gesundheitswirtschaft, die die Gewinnmaximierung zum obersten Ziel erhebt, sondern nur in einem System, das sich an den Bedürfnissen der Patienten ausrichtet. Auch das hat der Sachverständigenrat schon passend formuliert:
„An die Stelle des ›benevolenten Paternalismus‹ muß als zeitgemäße Form der Arzt-Patient-Beziehung ein ›Partnerschaftsmodell‹ treten. Darin gibt der Arzt vermöge seines medizinischen Wissens den Rahmen vor, innerhalb dessen der Patient mit Hilfe des Arztes seine Entscheidungen trifft.“ (SVR, 1992, RNr. 363, S. 107)
Hiermit fühlt sich die Patientin aufgehoben innerhalb des Rahmens, den die Ärztin vorgibt. Und wenn ihr der Rahmen nicht der richtige zu sein scheint, sucht sie eine andere Ärztin, die einen anderen Rahmen vorgeben kann. Diese zeitgemäße Arzt-Patient-Beziehung heißt neudeutsch „Shared Decision Making“, partnerschaftliche oder Partizipative Entscheidungsfindung. Ärztin und Patientin (oder, weiter gefasst, das therapeutische Team und die Patientin mit ihrem System von Familie, Freunden usw.) teilen sich die Verantwortung. Sie treten sich nicht als Gleiche gegenüber, das sind sie nie, aber als Gleichwertige: Die Ärztin versteht etwas von der Krankheit, die Patientin von sich als krankem Menschen. Beide sind Experten auf unterschiedlichen Gebieten und können sich deshalb ergänzen. Juristisch ist die Patientin längst in dieser Position: Ohne ihre Einwilligung darf die Ärztin sie gar nicht behandeln, das wäre strafbare Körperverletzung. Genau diese Komponente zwingt eigentlich zu einem partnerschaftlichen Verhalten.
Ein ähnlicher neuer Weg sollte auch im kollektiven Verhältnis zwischen Patienten und den Akteuren im Gesundheitssystem gesucht werden, vor allem den Partnern der Gemeinsamen Selbstverwaltung, den Leistungserbringern (Ärzten und Krankenhäusern) auf der einen, den Kostenträgern (Krankenkassen und Krankenversicherungen) auf der anderen Seite, und dem Staat, bzw. der Politik, die dafür die Rahmenbedingungen aufstellen.
Zu diesen drei großen Akteuren ist nun seit 2004 ein vierter, ganz kleiner getreten, allerdings noch nicht als Akteur, sondern eher als „Passeur“: die Patientenorganisationen. Vier von ihnen – die bedeutendsten bzw. unabhängigsten – sind an Entscheidungen zu „Fragen, die die Versorgung betreffen“, zu beteiligen, so steht es in § 140 f des fünften Sozialgesetzbuches. Diese Patientenbeteiligung an der Gesundheitspolitik ist der Beginn, mündige Patienten auch auf der gesellschaftlichen Ebene zu respektieren. Genau wie auf der individuellen Ebene, sollen Patienten nicht mehr nur Leistungsempfänger sein, sondern langsam und schrittweise zu Mitgestaltern werden (vgl. Kranich, 2013). Das betrifft noch nicht die gewichtigen Entscheidungen der großen Politik, sondern zunächst nur die „kleinen“ im Gemeinsamen Bundesausschuss und einigen Gremien auf Landesebene. Die Patienten haben dort allerdings noch kein Stimmrecht, sie sind nur beratend beteiligt. Doch eines Tages werden sie volles Stimmrecht haben müssen. Alles andere wäre nur politische Beschäftigungstherapie. Komplettes Stimmrecht würde allerdings voraussetzen, dass die Patientenvertreter alles, was in diesen Gremien zu entscheiden ist, sehr genau durchschauen (vgl. Kranich, 2013). Selbst hauptamtliche Patientenunterstützer sind oft froh, dass sie nur beratende Stimme haben und nicht mitentscheiden müssen. Menschen aus Selbsthilfegruppen, ohne diesen fachlichen Hintergrund, haben es da meist noch um ein Vielfaches schwerer.
1.3Was hat das alles mit dem neuen Patientenrechtegesetz zu tun?
Nichts, oder besser fast nichts hat diese Diskussion mit dem Patientenrechtegesetz zu tun, das seit 26.02.2013 in Kraft ist. Das neue Gesetz fasst nur zusammen, was auch vorher schon galt. Allerdings waren die Patientenrechte bis dahin zu 90 % Richterrecht, und jetzt sind sie im BGB und Sozialgesetz festgeschrieben, die man im Buchhandel erwerben kann. Diese Tatsache allein ist schon ein Fortschritt. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob dadurch die Gerichte zukünftig weniger Prozesse führen müssen, denn die dürren Worte des Gesetzes bedürfen wahrscheinlich auch weiterhin der Auslegung und Anwendung auf den konkreten Einzelfall.
Vielleicht werden es Patienten jetzt etwas leichter haben, Einsicht in ihre Krankenunterlagen zu erhalten, denn das Recht auf vollständige Einsicht in ihre Akten ist dort festgeschrieben. Das ist zwar auch schon seit 30 Jahren ein unumstößliches Patientenrecht, trotzdem beschweren sich immer noch viel zu häufig Patienten darüber, dass ihnen diese Einsicht nicht gewährt wird. Es kann aber auch umgekehrt kommen, dass genau an diesem Punkt das neue Gesetz einen Rückschritt mit sich bringt: Denn bisher konnte dieses Recht nur vorenthalten werden, wenn der behandelnde Arzt im Rahmen einer psychiatrischen Behandlung begründen konnte, dass die Einsicht dem Patienten schaden würde. Diese Einschränkung findet sich auch im Gesetz – aber ohne den Zusatz, dass sie nur bei psychiatrischen Behandlungen gilt. Künftig könnte also auch der Chirurg behaupten, dass die Einsicht in die Krankenakte dem Patienten schaden könnte. Ob er allerdings damit vor Gericht Recht bekäme, bleibt fraglich. Denn das Patientenrechtegesetz sollte ja ausdrücklich die bisherige Rechtslage in Gesetzesform gießen.
Viele hatten sich von dem neuen, angeblich so wegweisenden Gesetz mehr Stärkung für die Betroffenen erhofft. So ist auch die Umkehr der Beweislast bei groben Behandlungsfehlern, die im Gesetz zu finden ist, nicht neu. Bei einfachen Behandlungsfehlern bleibt es dabei, dass der Patient dem Arzt einen Behandlungsfehler nachweisen muss. Seit 20 Jahren wird nicht nur über die Kodifizierung, sondern auch über die Weiterentwicklung der Patientenrechte diskutiert und im Grunde hat das Gesetz für den Patienten keine Neuerungen gebracht, das kritisieren zahlreiche Patientenvertreter und -berater. Bereits 1996 begann die Gesundheitsministerkonferenz (GMK), sich ausführlich mit den Patientenrechten zu beschäftigen – doch leider „gebar der Berg nur eine Maus“, nämlich eine kleine, weithin unbekannt gebliebene Broschüre, in der die existierenden Patientenrechte zusammengefasst wurden. Eine Weiterentwicklung wurde sowohl von den Leistungserbringern als auch von den Richtern und Rechtsanwälten für unnötig befunden.
Wie groß die Macht der Player im System ist, wenn es darum geht, ihre Vorherrschaft und Meinungsführerschaft zu verteidigen, zeigen aktuell die Worte des Präsidenten der Bundesärztekammer, Montgomery, von denen bereits ein Satz zitiert wurde. Er führte vor einem Jahr (vgl. Montgomery, zitiert nach Gieseke, 2012) aus, es zeichne sich bei der Entwicklung des Patientenrechtegesetzes „eine vernünftige Regelung ab, die auch Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten ist.“ Wer aber diese „Beteiligten“ waren, die „vertrauensvoll“ zusammengearbeitet haben, wird nicht verschwiegen:
„Der Gesetzentwurf entspricht im Wesentlichen dem, was wir mit dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung abgesprochen haben, und ist eine Kodifizierung des bisherigen Rechtes. Wir sehen in dem gegenwärtigen Gesetzentwurf auf den ersten Blick eine Einlösung des Versprechens, das nicht gegen die Ärzte zu formulieren.“ (Bundesärztekammer, 2012)
Man stelle sich das vor: Der Bundesärztekammerpräsident behauptet, die Ärzte haben mit dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung den Gesetzentwurf für ein Patientenrechtegesetz abgesprochen. Und der habe zugesagt, das Gesetz nicht gegen die Ärzte zu formulieren! Wenn man sich diese Aussage auf der Zunge zergehen lässt, kommen einem sehr ernsthafte Zweifel an der Möglichkeit, dass sowohl die individuelle Patientin, als auch die Patienten als gesellschaftliche Gruppe jemals wirklich mündig werden können. Was wir benötigen, sind partnerschaftliche, kooperationsbereite, eben menschliche Ärzte und keine Funktionäre, die ihre Macht schamlos demonstrieren.
Dennoch bleibt die „mündige Patientin“ ein wichtiges Ziel – ein fernes Ziel vielleicht, aber alle müssen sich an ihm orientieren, auch wenn es immer nur teilweise zu erreichen ist. Dem ersten Schritt einer Kodifizierung der Patientenrechte im BGB und SGB muss in den nächsten Legislaturperioden eine echte Weiterentwicklung im Sinne der Betroffenen folgen. Und auch die kollektiven Rechte der Patienten im Gesundheitssystem müssen unbedingt weiter ausgebaut werden – bis dahin (und das sollte keine Vision sein), dass sich das ganze System eines Tages, ohne Beeinflussung durch Fremdinteressen, nur noch nach ihren Bedarfen und Bedürfnissen richtet.
Literatur
Bundesärztekammer (2012).Montgomery zu Patientenrechtegesetz. Presseerklärung vom 17.2.2012. http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=3.71.9972.9973.10004 (08.10.2013).
Bundeswahlleiter (2013). http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/ (08.10.2013).
Gieseke, S.; Dielmann-von Berg, J. (2012).Mehr Patientenrechte – nicht gegen die Ärzte.http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/patientenrechtegesetz/article/683993/patientenrechte-nicht-aerzte.html?sh=12&h=1529428522 (08.10.2013).
Kranich, C.; Müller, C.; Bremer Gesundheitsladen e.V. (1993).Der mündige Patient, eine Illusion? Orientierung und Unterstützung im Gesundheitswesen. Patientenstellen, Qualitätsorientierung und -bewertung, selbstorganisierte Patienteninitiativen, Patientenfürsprecher im Krankenhaus, Wege und Verfahren zum Patientenrecht. Frankfurt a. M.: Mabuse-Verlag.
Kranich, C. (2013).Stimmrecht für Patienten? Dr. med. Mabuse Zeitschrift für alle Gesundheitsberufe, 203 (Mai/Juni), Frankfurt a. M.: Mabuse Verlag, S. 51–53.
SVR – Sachverständigenrat für die Konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen (1992).Jahresgutachten 1992, Ausbau in Deutschland und Aufbruch nach Europa. Baden-Baden: Nomos-Verlag.
TK – Techniker Krankenkasse (2012).Zahl der Rückenoperationen steigt, aber 85 Prozent der Eingriffe sind unnötig. Pressemitteilung der Techniker-Krankenkasse vom 23.05.2012.http://www.tk.de/tk/hessen/pressemitteilungen-2013/pressemitteilungen-2012/493684 (08.10.2013).
Schäffler, B. (2012).Mehr Pflicht als Recht. Healthcare Marketing, (8), S. 22.
2Kunden- und Patientenorientierung im GKV-Wettbewerb
HERBERT REBSCHER
Kunden- und Patientenorientierung im GKV-Wettbewerb bedarf einer differenzierten Analyse der extrem heterogenen Badarfslagen der Beteiligten und Betroffenen. Die Interessenlage und Perspektive von Kunden unterscheiden sich je nach individueller Situation in der Rolle des „zahlenden Versicherten“ und des „leistungsempfangenden Patienten“. Die Entwicklung daran angepasster Informations- und Kommunikationsstrategien von Kassen entscheidet über ein dauerhaftes und stabiles Kundenbeziehungsmanagement.
2.1Über „wen“ reden wir, wenn wir von Kunden-, Versicherten- und Patientenorientierung reden?
Wenn von „Kunden-, Versicherten- und Patientenorientierung“ im Gesundheitswesen die Rede ist, kann in aller Regel davon ausgegangen werden, dass diese Begriffe weitgehend synonym Verwendung finden bzw. keine weitergehende Differenzierung kenntlich gemacht wird. Dabei ist die Erschließung dieser Thematik im hohen Maße von der differenzierten Analyse der Bedürfnisse und des konkreten Bedarfs der Betroffenen in unterschiedlichen Lebenssituationen abhängig. Diese Unterscheidung macht das Handeln im Wettbewerb, speziell für Versicherungsunternehmen, zu einem hochkomplexen und mit allerlei Risiken unterlegten Thema. Jede Form der Kundenorientierung setzt differenzierte Kundenkenntnisse voraus. Bezüglich des gesundheitlichen Versorgungsbedarfs und des darauf abzielenden Angebots von Krankenversicherern ist von stetig wechselnden Präferenzen der individuell Betroffenen auszugehen. Es gibt in der Regel keine stabile und dauerhafte Präferenz, nicht mal in ein und derselben Person, vielmehr ist sie intraindividuell wechselnd und nur für bestimmte zeitliche Episoden stabil, die sich im Ablauf aber fundamental verändern.
Auch inhaltlich ist es für eine Krankenversicherung im Wettbewerb nicht einfach mit ihrem „Kerngeschäft“, d. h. der Absicherung vor den finanziellen Folgen teurer und dauerhafter Erkrankungsrisiken und der Mitgestaltung bei der Organisation qualitativ komplexer Versorgungsangebote, zu werben. Für den 30-jährigen gesunden Junggesellen wird ein qualitativ hochwertiges Rehabilitationsangebot genauso wenig die individuellen Präferenzen abbilden, wie die gute pflegerische Infrastruktur oder die innovativen und hochqualitativen Kardiologiekonzepte einer Krankenkasse.
Es gilt also, bevor über Kundenorientierung, ihre Inhalte und Formate, den Medieneinsatz sowie über die Bildersprache, die Unterstützungsprozesse und Serviceorientierungen geredet wird, eine Bedarfsanalyse der jeweiligen Kundensegmente zu erarbeiten.
Dabei bietet es sich an, die Kunden zunächst einmal grob in Versicherte und Patienten zu unterscheiden (vgl. Abb. 2.1), um dann in diesen „Großgruppen“ eine differenzierte Form der Bedarfsanalyse vorzunehmen.
Abb. 2.1: Versicherte vs. Patienten1
2.2Bedarfsorientierte Patientenkontakte
Setzt man sich mit den Besonderheiten des Gutes „gesundheitliche Versorgung“ auseinander, ist es hilfreich zunächst darauf hinzuweisen, dass hier typischerweise Produkte „gehandelt“ werden, die bei aller Einsicht in die Notwendigkeit vom Einzelnen nicht mit Freude „konsumiert“ oder „gewünscht“ werden. Weder der Versicherungsschutz (deshalb gibt es eine Versicherungspflicht) noch die differenzierten medizinischen Angebote (wer sie benötigt ist krank und leidet) rangieren in einer individuellen Präferenzskala der Wünsche. Es gibt große Akzeptanz für das Arrangement bezüglich Versicherung und Versorgung; es fehlen aber die Lust und das Glück, wie sie beim Konsumgüterkauf einhergehen – das macht die Kommunikation hier so schwierig.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass ca. ein Drittel der Krankenhausausgaben von gerade mal einem Prozent der Versicherten benötigt werden und 92 % aller Krankenhausausgaben sich auf 10 % der Versicherten konzentrieren (vgl. Abb. 2.2), so lassen sich bereits daraus die höchst unterschiedlichen Bedarfe für konkrete Personen ableiten. Für andere Leistungsbereiche sieht man vergleichbare „Verteilungen“.
Abb. 2.2: Das Verteilungsproblem (Jacobs; Klauber, 2007)
Zusammengefasst zeigt sich eine dramatische Form der Marktspaltung, bei der etwa 80 % der Menschen lediglich 20 % der medizinischen Leistungen abfordern (vgl. Busse, 2009). Dieser Personenkreis hat eben keinen aktuell definierten Bedarf und entsprechend keine Nutzenerwartungen in das Portfolio einer Krankenversicherung oder an ein konkretes medizinisches Versorgungsangebot. 20 % der Menschen binden ca. 80 % des gesamten Leistungsbedarfs, und hier ist die Frage nach einem bedarfsadäquaten Versorgungsangebot und einer zielgruppenspezifischen Entwicklung konkreter Versorgungskonzepte denkbar und sinnvoll. Für diese 20 % ist die Koordination und Organisation eines extrem arbeitsteiligen und von vielen Leistungserbringern mitgestalteten Behandlungsprozesses, die Kommunikations- und Beratungsqualität über einen langen Zeitraum des Leistungsbezugs, und oft auch die nachhaltige Veränderung der Lebensund Wohnsituation der Zukunft eine zentrale Beurteilungskategorie.
Abb. 2.3: Das Problem der Marktspaltung
Dieses einfache Schaubild (vgl. Abb. 2.3) kann als erste Annäherung an eine Segmentierung und Differenzierung der Bedürfnisse/des Bedarfs von Kunden dienen. Aus dieser Annäherung lassen sich jedoch bereits einige gesundheitspolitische und gesundheitsökonomische Konsequenzen ableiten: Zum Beispiel wird die mangelnde Steuerungswirkung von Selbstbeteiligungsmodellen unmittelbar einsichtig. Die aktuell vollzogene Abschaffung der Praxisgebühr zeigt dies eindrucksvoll. Daran wird aber auch deutlich, warum reine Preissteuerungsmodelle im Versorgungszusammenhang zu kontraproduktiven Wirkungen führen müssen, und deshalb – siehe das Problem der Zusatzprämien von Krankenkassen – extrem wettbewerbsverzerrende, entsolidarisierende und innovationsfeindliche Wirkungen entfalten.
Für die Frage der Kundenorientierung ist jedoch eine weitergehende Segmentierung und Präzisierung notwendig. Beginnen wir mit den 80 % der Menschen, die keinen oder nur episodenhaften, vorsorgenden und kurzzeitigen Versorgungsbedarf (20 % der Leistungen) haben (vgl. Abb. 2.4). Hier bietet sich die Segmentierung nach den altersgemäßen Lebenszyklen an, die sich z. B. in die Phasen Kindheit, Schule und Ausbildung sowie Single/junge Familien, Erwachsene und Senioren unterteilen lassen. Dies ist nur eine beispielhafte, nicht jedoch abschließende Unterscheidung.
Abb. 2.4: Segmentierung von Kundenbedürfnissen





























