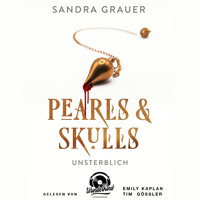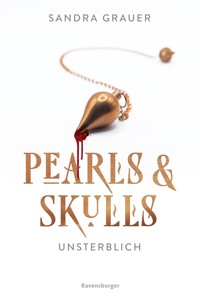
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pearls & Skulls
- Sprache: Deutsch
Verfeindet bis aufs Blut. Vereint in ewiger Liebe. Kostüme, Partys, Perlenketten: Paige würde Mardi Gras gern so ausgelassen feiern wie alle anderen in New Orleans. Stattdessen beschützt sie die Stadt mit ihrer Bikergang vor den Vampiren, die wie jedes Jahr zu Karneval einfallen. Doch dann stellt sich heraus, dass die Vampire und Biker einen gemeinsamen Feind haben. Widerwillig muss sich Paige mit einem der Blutsauger zusammentun. Lavaughn ist selbstverliebt und arrogant – und stellt doch alles infrage, was sie über die Vampire geglaubt hat ... *** Urban Vampire Romance vor der bunten Kulisse des Mardi-Gras-Festivals! Verführerisch. Geheimnisvoll. Sexy. Enemies to Lovers und Forced Proximity at its best. *** Entdecke die fantastisch-romantischen Buchwelten von Sandra Grauer bei Ravensburger: Pearls & Skulls Band 1: Unsterblich Band 2: Unvergesslich Flowers & Bones Band 1: Tag der Seelen Band 2: Kuss der Catrina Flame & Arrow Band 1: Drachenprinz Band 2: Elfenkriegerin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2025 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2025 Ravensburger Verlag Text © 2025 Sandra Grauer Dieses Werk wurde vermittelt durch die litmedia.agency, Germany. Lektorat: Franziska Jaekel Covergestaltung: verwendete Bilder von © Nick Ong, © Ilina93, © BLACKDAY, © janniwet, alle von Shutterstock Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg. Der Nutzung für Text- und Data-Mining wird ausdrücklich widersprochen.
ISBN 978-3-473-51283-6
ravensburger.com/service
Für Betty, Niklas und ChristianUnd für alle, die ihre Mama viel zu früh verloren haben
Playlist
Ram Jam Black Betty
VOILÀVoodoo
VOILÀFigure You Out
Cash Cash, Busta Rhymes, B.o.B, Neon Hitch Devil
WEAREFURY, Brassie, Kyle Reynolds Crown
Thirty Seconds To Mars Life Is Beautiful
The Struts Could Have Been Me
Steven Rodriguez Shackles
VOILÀTherapy
VOILÀDrinking With Cupid
Steven Rodriguez She Knows It
Steven Rodriguez The Devil Wears Lace
Chloe Adams Dirty Thoughts
Stileto, feat. Madalen Duke Dead Or Alive
Stileto, feat. Kendyle Paige Cravin’
Saint Chaos Blind Spot
Bohnes Vicious
Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Miche Braden Livin’ On A Prayer
Rascal Flatts Life Is A Highway
AC/DCYou Shook Me All Night Long
The Lost Fingers Black Betty
Louis Armstrong The Mardi Gras March
Elvis Presley New Orleans
Ludwig van Beethoven, Riccardo Muti, James Morris, Philadelphia Orchestra, Westminster Choir Ode an die Freude, 9. Sinfonie
Vorwort
Vier Dilogien, ein Universum.
Über zehn Jahre ist es her, dass ich die Idee von Caroline und Ash hatte, von zwei verfeindeten Hexenclans in London. Es war ein langer Weg, bis die Geschichte endlich Gestalt annahm, sie hat mich viele Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt. »Clans of London« liegt mir immer noch sehr am Herzen, und ja, ich gebe es zu, inzwischen mag ich sogar Jared. Hand hoch: Wem von euch geht es genauso?
Es folgten Kailey und Aiden, Enemies to Lovers at its best. Als ich vor sechs Jahren über »Flame & Arrow« nachgedacht habe, war noch gar nicht geplant, dass beide Dilogien ineinandergreifen. Glücklicherweise hatte ich bei den Hexenclans einen Drachen eingebaut, der später als Aufhänger für meine zweite Dilogie diente.
Die Geschichte von den Drachen und Fae war wirklich schwer zu toppen. Die »Elfenkriegerin« ist immer noch mein persönliches Meisterwerk. Ich hatte so viel Angst vor Band 2, weil es episch werden sollte und ich mir immer eingeredet habe, ich kann keine guten Actionszenen schreiben. Spoiler: Ich kann. Und es ist episch geworden.
Vor vier Jahren war bereits klar, dass meine dritte Dilogie im selben Universum spielen soll wie »Clans of London« und »Flame & Arrow«. Das Grundgerüst stand schnell, allerdings musste ich es genauso schnell verwerfen, weil das Thema bereits von einer anderen Ravensburger Autorin bearbeitet wurde. Es hat lange gedauert, bis »Flowers & Bones« zu dem wurde, was es jetzt ist. Dafür liebe ich die Dilogie umso mehr, denn am Ende war es gut, dass ich mir ein neues Thema überlegen musste. Der mexikanische Tag der Toten hat mich schon immer fasziniert, und ich bin so, so dankbar, dass ich die Geschichte von Valentina und Lily, Emiliano und Cassie erzählen durfte.
Inzwischen ist es auch schon wieder drei Jahre her, dass ich die Idee zu »Pearls & Skulls« hatte. Es war schnell klar, dass es um Vampire gehen soll, der Motorradclub kam später dazu, und da sind wir nun. Nach und nach werden alle Fäden zusammenlaufen, sodass sich ein großes Ganzes ergibt.
Aber keine Sorge, falls ihr meine anderen Bücher nicht gelesen habt, denn ihr braucht kein Vorwissen. Zusammen mit Paige und Lavaughn lernt ihr mein Universum und die Charaktere aus den vorherigen drei Dilogien kennen. In Kapitel 5 bekommt ihr quasi ein Wasbishergeschah, und am Ende findet ihr eine Liste wichtiger Figuren. Behaltet diese im Hinterkopf, wenn ihr zu Kapitel 27 kommt.
Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Paige und Lavaughn in New Orleans.
Prolog
Paige
Elf Jahre zuvor
»Hattest du Spaß, Cupcake?«
»Jaaa«, quietschte ich und hüpfte auf dem Bürgersteig über Pfützen hinweg. Es hatte geregnet, während Mom und ich auf der Mardi-Gras-Party gewesen waren. Im Moment regnete es nicht, aber am Himmel waren viele dunkle Wolken, die ein bisschen gruselig aussahen. Nicht, dass ich mich tatsächlich gruselte.
»Und dir ist auch wirklich nicht kalt in deinem dünnen Kleid?«, fragte Mom.
»Ein bisschen«, gab ich zu, weil ich sie nicht anlügen wollte. Sei immer ehrlich und sei immer du selbst, das sagte sie mir ständig. »Siehst du? Ich hätte mich doch als Vampir verkleiden sollen. Dann hätte ich jetzt einen Umhang, der mich wärmen könnte.«
Seufzend zog Mom ihre Strickjacke aus, ging in die Hocke und hängte sie mir über die Schultern. Die Jacke war viel zu groß, aber sie roch so gut nach ihr und nach Kuchen. Auf der Party hatte es King Cake gegeben. Ich liebte King Cake. Leider war das eingebackene Baby, das Glück bringen sollte, mal wieder nicht in meinem Stück gewesen.
»Ach, Paige. Du weißt doch, wie das mit den Vampiren ist.«
»Ja, ja, ich weiß. Vampire sind böse. Schon gut, Mom.«
Mit einem traurigen Lächeln sah sie mich an. »Dein Dad ist manchmal ein bisschen streng, und ich möchte auf keinen Fall, dass du dich verstellst, uns zuliebe auch nicht. Aber mit den Vampiren ist das so eine Sache. Du hast nicht die Dinge gesehen, die dein Dad gesehen hat. Du musst uns einfach vertrauen, Cupcake, okay?«
Ich nickte, weil ich Mom und Dad wirklich glauben wollte – und weil ich sie nicht enttäuschen wollte. Ich konnte Vampire auch heimlich cool finden, ohne es jemandem zu verraten.
Ein dicker Regentropfen landete auf meinem Kopf, der nächste auf meinem Gesicht und einer in meinem Nacken. Es war, als hätte jemand die Dusche angestellt, die wie in unserem alten Haus eine Weile brauchte, bis sie richtig in Gang kam. Mom strich mir noch einmal über die Arme, dann erhob sie sich und griff nach meiner Hand, während sie sich umsah. Wegen der Regenwolken war es ziemlich dunkel, auch wenn es wahrscheinlich noch gar nicht so spät war, sonst hätte ich längst im Bett liegen müssen, selbst an Mardi Gras. Und es waren auch nicht viele Menschen unterwegs im French Quarter. Wenn die Stadt munter wird, wird es für mich Zeit, ins Bett zu gehen, sagte Dad immer.
»Na komm.« Mom zog mich zu einer der Seitenstraßen.
»Aber Mom. Wir sollen doch nur die Hauptstraßen nehmen«, protestierte ich, weil Dad nicht müde wurde, das immer und immer wieder zu wiederholen.
Mom seufzte erneut. »Ich weiß, aber ich will nicht, dass du dich so kurz vor Mardi Gras erkältest. Du willst doch die Paraden nicht verpassen. Aber wenn du Angst hast …«
Ich stieß ein Schnauben aus. »Ich hab keine Angst vor Gefahr. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht«, sagte ich einen meiner Lieblingssprüche aus König der Löwen auf.
Mom lachte, klang aber nicht annähernd so lustig wie die Hyänen im Film. »Mein unerschrockenes Mädchen. Also, schnell nach Hause, damit wir noch ein bisschen in unseren Schlafanzügen kuscheln können, bevor du ins Bett musst.«
Wir liefen in die Seitenstraße, weg von den Straßenlaternen und der fröhlichen Mardi-Gras-Dekoration, die alles in Lila, Gold und Grün erstrahlen ließ. Hier war es dunkel, und es roch unangenehm. Jetzt war mir auch richtig kalt. Ich rückte noch näher an meine Mom, denn ein bisschen unheimlich war es schon. Mom zog mich schnell weiter, als vor uns plötzlich eine Art Kratzen zu hören war. Abrupt blieben wir stehen. In der nächsten Sekunde fiel laut klappernd eine Mülltonne um, und ein Schatten huschte durch die Gasse. Ein Schrei blieb mir im Hals stecken. Das war nur ein Waschbär. Die waren niedlich, und es gab keinen Grund zum Fürchten.
»Gott, habe ich mich erschreckt.« Mom fasste sich ans Herz. »Vielleicht gehen wir doch lieber zurück. Wenn dein Dad davon hört, bekommst nicht nur du Ärger.« Sie lachte erneut, aber es klang nicht so, als würde sie das wirklich witzig finden.
Wir wollten gerade zurück zur Hauptstraße, da stand plötzlich ein Mann vor uns. Er war ziemlich blass, hatte rote Augen, die echt gruselig aussahen, und als er den Mund öffnete, blitzten zwei spitze Eckzähne auf. Ein Vampirkostüm!
»Voll cool!«
Ich hatte die Worte kaum ausgesprochen, da packte mich der Mann. Im nächsten Augenblick fuhr ein Schmerz durch meinen Hals. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand zwei dicke Nadeln durch die Haut gestoßen. Ich schrie auf. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Mom einen Holzpflock aus ihrem Rockbund zog, dann stürzte sie sich auf den Mann. Er wirbelte zu ihr herum und ließ mich los. Meine Finger tasteten nach der Stelle an meinem Hals, die noch mehr brannte als die Wunde an meiner Handfläche, nachdem ich mich neulich aus Versehen mit Finns Taschenmesser geschnitten hatte. Die Haut fühlte sich warm und klebrig an, und meine Finger waren rot, als ich sie wegzog. Blut. Das war Blut. Der Mann hatte mich gebissen, und jetzt versuchte er, Mom zu beißen.
Nein, das war kein Mann, jedenfalls nicht wie Dad oder Stu. Das war … ein Vampir.
»Mom!« Meine Stimme war nur ein Krächzen.
»Lauf, Paige!«, schrie Mom. Und dann schrie sie noch einmal, als der Vampir seine spitzen Eckzähne in ihren Hals stieß.
Was sollte ich nur machen? Ich konnte Mom nicht einfach zurücklassen. Das würde ich mir nie verzeihen, aber wenn ich hierblieb, würde der Vampir am Ende uns beiden etwas antun. Hilfe! Ich musste Hilfe holen, doch mein Hals fühlte sich an, als hätte ich Sand gegessen. Wieder kam nur ein Krächzen heraus, ein jämmerliches Wimmern. Mom! Tränen schossen mir in die Augen. Mit verschleiertem Blick sah ich, wie sie sich gegen den Vampir wehrte. Ich wollte zu ihr, doch meine Beine bewegten sich nicht. Sie hielten mich kaum noch aufrecht, genau wie meine Stimme nicht mehr tat, was sie sollte.
Der Holzpflock fiel mit einem Klappern zu Boden und rollte über den nassen Asphalt. Gleichzeitig erschlaffte meine Mom und sackte in sich zusammen.
»Mom!«
Dieses Mal hallte mein Schrei von den Wänden der Gasse wider, dann ging alles ganz schnell. Ohne nachzudenken, bückte ich mich nach dem Holzpflock, der neben meinen Füßen lag, packte ihn mit beiden Händen, um ihn fest im Griff zu haben, und ging auf den Vampir zu, der sich noch das Blut meiner Mutter von den Lippen leckte. Als er sich zu mir drehte, stieß ich ihm den Holzpflock mitten ins Herz. Der Vampir kreischte wie ein wildes Tier. Erschrocken ließ ich den Pflock los, der nun in seinem Körper steckte, und wankte ein paar Schritte zurück. Er starrte von der Wunde in seinem Brustkorb zu mir, dann löste er sich vor meinen Augen in Asche auf, die vom Regen in den nächsten Gully gespült wurde.
Ich rannte zu meiner Mom und ließ mich auf die Knie fallen. Sie hatte die Augen geschlossen, da war so viel Blut an ihrem Hals.
»Mom!«, flüsterte ich, tastete nach ihrer Hand, die sich viel zu kalt anfühlte. Ich beugte mich zu ihr, hielt meine Wange über ihren Mund, ihre Nase – und spürte nichts außer Regen, Angst, Wut und Verzweiflung. Sie atmete nicht. Und in diesem Moment wusste ich, dass sie nie wieder atmen würde.
»Mom!«
Ich schrie so laut, dass ich mich beinahe selbst erschreckte. Tränen liefen mir über das regennasse Gesicht, ich schluchzte laut. Nur durch eine Nebelwand nahm ich wahr, wie eine Gruppe Frauen die Gasse betrat, doch sie kamen zu spät. Genau wie ich zu spät gewesen war. Meine Mom war tot, umgebracht von einem Vampir.
Kapitel 1
Paige
»Diese verdammten Blutsauger!« Mit bloßer Hand schlug ich nach dem Mistvieh. Zu spät. Blut klebte an meinen Fingern, und ich spürte schon jetzt den juckenden Schmerz an der Einstichstelle. Genervt knibbelte ich die kläglichen Überreste der Mücke von meiner Handinnenfläche, wo eine blasse Narbe schimmerte.
»Vielleicht solltest du dich besser auf den bevorstehenden Run konzentrieren.«
»Kümmere du dich um deinen eigenen Mist, James«, knurrte ich.
»Oho. Gut, Carrie, tragen wir das Ganze auf der Straße aus. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich fertigzumachen.« James Riley warf mir ein überlegenes Grinsen zu, bevor er das Visier an seinem Helm herunterklappte.
Ich verkniff es mir, ihn darauf hinzuweisen, dass ich Carrington hieß. Paige Carrington. »Wir werden sehen, James. Wir werden sehen«, sagte ich stattdessen.
Das Adrenalin wegen des bevorstehenden Runs und die Wut auf meinen Kontrahenten wirkten sich definitiv ungesund auf meine Herzfrequenz aus, doch das merkte man meiner Stimme nicht an. Ich hatte gelernt, meine Gefühle zu verbergen, wenn es darauf ankam. Wichtig waren jetzt nur die zwei Ks: Konzentration und Kontrolle. Gleich ging es nicht nur darum, James auf seinen Platz zu verweisen – und das würde ich auf jeden Fall tun – es ging auch um mein Leben. Ein winziger Fehler, und das war’s – im schlimmsten Fall nicht nur für mich, sondern auch für JD, Finn oder Mo. Unser Club bestand aus über hundert Leuten, wir mussten uns aufeinander verlassen können – und ich würde ihnen zeigen, dass sie sich zu einhundert Prozent auf mich verlassen konnten. Und das nicht nur, weil ich die Tochter von Conrad Carrington war.
Ein letzter tiefer Atemzug, ein letzter Blick in James’ Richtung, dann stülpte ich mir meinen eigenen Helm über das Bandana, lehnte mich nach vorn und umklammerte den Lenker meiner roten Harley FXR fester. Spürte das Gummi unter meinen Händen, den Ledersitz unter mir und den heißen Asphalt unter meinen Stiefeln. In der Ferne flirrte die Hitze, ich meinte sie sogar zu hören, so still war es in diesem verschlafenen Nest. Die Bewohner hatten sich aus Respekt in ihre Häuser zurückgezogen, nur wenige standen neugierig am Fenster und spähten zu uns hinaus. In diesem Moment waren wir alle fokussiert. Mein Vater, der links vor mir auf seiner schweren Harley saß, warf einen letzten Blick über seine Schulter, der James und all die anderen neben und hinter uns streifte, bevor er für einen Herzschlag an mir hängen blieb. Dann blickte er wieder nach vorn und hob die Hand. Fast synchron brüllten einhundert Motoren auf. Das Donnern der Maschinen brachte den Asphalt zum Beben, vibrierte in meinem Körper und schenkte mir trotz der Anspannung die Euphorie, die schon bei meinem allerersten Run wie flüssiges Glück durch meine Adern geflossen war. Dieser Moment war alles, doch er dauerte nur wenige Sekunden. Sobald mein Vater und Stu ihre Maschinen in Bewegung setzten, betätigte auch ich das Gas, und die Landschaft Louisianas raste binnen Sekunden an mir vorbei.
James, der ein hervorragender Fahrer war, legte einen ebenso guten Start hin wie ich. Ich spürte ihn neben mir, riskierte aber keinen Seitenblick, während wir das Ortsschild von Lake Arthur passierten und immer weiter beschleunigten. Mo und Finn, die neben uns gestartet waren, blieben ein Stück zurück. James und ich machten uns sofort breit, damit sie nicht von hinten an uns vorbeiziehen konnten. Mit jeder gefahrenen Meile rückten wir wieder näher zueinander, bis wir schließlich mit achtzig Meilen pro Stunde Lenker an Lenker über den Highway 26 heizten. Mein Herz legte ein vergleichbares Tempo hin, mein ganzer Körper stand unter Strom, um die Maschine unter mir in der Spur zu halten. In meinen Ohren dröhnten die Motoren, dennoch meinte ich, mein eigenes Blut rauschen zu hören. Das hier war verdammt bescheuert, waghalsig, gefährlich, aber es war auch der ultimative Adrenalinkick, es gehörte einfach dazu. Der Präsident unseres Clubs und sein Vize fuhren bei Runs immer ganz vorn, das war Gesetz, aber die zehn Plätze dahinter, die nicht weniger wichtig waren, musste man sich verdienen. Also lieferten wir anderen uns ein Straßenrennen, in dem sich nur die Schnellsten und Mutigsten am Ende durchsetzen konnten.
Ich war zwar die Tochter des Clubvorsitzenden, doch deshalb wurde mir nichts geschenkt, im Gegenteil. Immer wieder musste ich mich beweisen. Eben weil ich Conrads Tochter war – und weil ich ein zweites X-Chromosom besaß. Frauen wurden in Motorradclubs nicht geduldet, das hatte sich seit der Gründung der Hell’s Angels in den Vierzigerjahren nicht geändert. Ich war die einzige Ausnahme, und James machte es mir gern besonders schwer. Er wollte den Platz, der mir zustand, doch den würde ich ihm nicht überlassen, genauso wenig wie die Pole Position hinter meinem Vater.
Ich drängte weiter in James’ Richtung. Ihm blieb nichts anderes übrig, als nach links auszuweichen, wenn er nicht wollte, dass sich unsere Lenker ineinander verkeilten. Ich hörte ihn fluchen und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. James Riley war ein guter Fahrer, sein Problem war nur, dass er zu sehr von sich überzeugt war, vor allem wenn es um mich ging. Das wurde ihm immer wieder zum Verhängnis.
Er kam dem unbefestigten Rand des Highways ziemlich nah, und ich beschleunigte noch ein bisschen mehr, bevor etwas passieren konnte. Ich wollte keinen Unfall bauen, sondern James nur abschütteln, was mir auch gelang, doch er holte schnell wieder auf und wollte nun mich zum Ausweichen zwingen. Oh, James! Er war so berechenbar. Für den Bruchteil einer Sekunde bremste ich ab, um ihn dann links wieder zu überholen. Hinter uns ließ Mo seinen Motor aufbrüllen, doch wir wussten beide, dass die Situation nicht gefährlich gewesen war. Ich kannte meine Grenzen und würde nie über sie hinausgehen. Nicht einmal, um James auszustechen. Unser aller Sicherheit hatte oberste Priorität.
James kam mir noch ein paar Mal ziemlich nah mit seiner Maschine, halbherzige Versuche, um sein Gesicht zu wahren. Er wusste, wann er es gut sein lassen musste. Das Straßenrennen war vorbei. Ich hatte mir erneut den Platz hinter meinem Vater gesichert.
Der Fahrtwind sorgte dafür, dass ich unter meiner weinroten Kunstlederjacke nicht ins Schwitzen kam, und allmählich ließ das Adrenalin nach. Obwohl ich konzentriert bleiben musste, konnte ich mich endlich entspannen und die Fahrt genießen, die jetzt auf der Interstate 10 weiterging. Mit dem eingängigen Refrain von Black Betty auf den Lippen brauste ich hinter Dad und Stu her. Dieser Song war unsere inoffizielle Club-Hymne und unwiderruflich mit unseren Runs verknüpft. Sobald ich das rockige Gitarrenintro hörte, spürte ich den Fahrtwind in den Haaren und das Vibrieren der Harley unter mir, die Dad mir vor drei Jahren zu meinem achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte und an der wir gemeinsam stundenlang herumschraubten. Nicht einmal die Cops, die uns ab Lafayette wie so oft zurück nach Hause begleiteten, um sicherzugehen, dass wir auf der Interstate blieben und keinen Ärger machten, brachten es fertig, mir die Laune zu verderben. Einhundert Motorradfahrer in Lederkluft auf schweren Maschinen konnten schon mal beängstigend wirken. Obwohl ich die Cops durchaus verstand, nervten sie. Oft gewährten sie uns nicht einmal einen Tankstop, dabei hatten wir nicht vor, Unruhe zu stiften. Ich sowieso nicht, aber auch die anderen wollten einfach nur den Run genießen, der gerade Anfang Februar besonders wichtig war. Uns standen anstrengende Tage bevor, das hier war die letzte Chance, noch einmal Kraft und Energie zu tanken.
Als wir das Atchafalaya Basin durchquerten, ging wie auf Knopfdruck ein Ruck durch meinen Körper, die Atmosphäre um mich herum veränderte sich schlagartig. Eine unterschwellige Aggression paarte sich mit Anspannung und Vorsicht. Das schienen selbst die Cops zu merken, denn auch sie ließen ihre Blicke mehrmals aufmerksam umherschweifen, genau wie der Rest von uns. Nur mein Vater fuhr stoisch weiter, ohne das Tempo zu drosseln.
Wehmut erfasste mich, als die außergewöhnliche Landschaft an mir vorbeiraste: Mangroven, mit Louisianamoos behangene Zypressen und andere Bäume, durch die immer wieder der Sumpf durchblitzte. Der Bayou war ein faszinierendes Ökosystem, das ich viel zu selten zu Gesicht bekam. Normalerweise hatten wir hier nichts zu suchen, das war ihr Gebiet, weshalb wir für gewöhnlich sogar Umwege in Kauf nahmen. Aber nicht heute, nicht so kurz vor Mardi Gras. Die Stadt feierte bereits seit Anfang Januar, doch in den zwei Wochen vor Faschingsdienstag ging es richtig rund.
Wir veranstalteten etwa vier Fahrten im Jahr. Dabei ging es natürlich ums Fahren an sich, um das Gemeinschaftsgefühl, und darum, die Clubmitglieder anderer Chapters – Clubableger in anderen Städten – zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Der Run im Februar war aber auch die Gelegenheit, um unsere Feinde daran zu erinnern, mit wem sie es zu tun hatten.
Auch heute ließen sie uns passieren, was sicher nicht an den Cops lag. Sie würden uns angreifen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekämen, da war ich sicher. Dass sie es bisher nicht getan hatten, lag vermutlich nur daran, dass sie ihre Kräfte aufsparen wollten.
Dieses Mal ließ die Anspannung in mir auch nicht nach, als wir das Sumpfgebiet hinter uns gelassen hatten und Baton Rouge erreichten. Es dauerte nicht mehr lange, bis Mardi Gras seinen Höhepunkt erreichte und unsere Feinde wie jedes Jahr in Scharen in unsere Stadt einfallen würden. New Orleans musste sich gegen die Vampire wappnen.
Kapitel 2
Lavaughn
»Erweist du mir die Ehre, Véronique?« Ich streckte der »Tochter« unseres Anführers die rechte Hand entgegen, während ich die Linke auf dem Rücken hielt, und neigte den Kopf.
»Es wäre mir eine Ehre, Lavaughn«, erwiderte sie mit einem Knicks.
Sie legte ihre Finger in meine, und ich zog sie mit Schwung zu mir, um ihr einen Kuss zu geben. Nicki schlang ihre Arme um meinen Hals und presste sich verführerisch an mich. Schnell machte ich einen Schritt rückwärts und hielt sie an der Hüfte fest, bevor mein Körper auf ihre Avancen reagieren konnte.
»Lass uns das auf später verschieben, Darling. Ich habe Johnny eine Revanche versprochen. Du weißt, wie er ist.«
Das Weitspringen ins Wasser war ein Spaß, irgendwie mussten wir uns schließlich die Zeit vertreiben, aber Johnny nahm das Ganze ziemlich ernst. Nicki kam wieder näher, so nah, dass sie mit ihren warmen Lippen beinahe mein Ohr berührte, als sie erwiderte: »Ich nehme dich beim Wort, Lavaughn. Ich erwarte dich bei Anbruch der Morgenröte. Raphaël trifft sich in New Orleans mit diesem Anwalt aus London, wir haben also das ganze Boot für uns allein.«
»Kann’s kaum erwarten.« Ich zog sie noch einmal an mich und knabberte an ihrer Unterlippe.
Raphaël, Nickis »Vater«, sah das zwar nicht gern, aber zum Teufel mit ihm. Bei Dracula, Nicki und ich waren alt genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir ein bisschen Spaß zusammen haben wollten, ohne große Verpflichtungen einzugehen, konnte niemand etwas dagegen sagen. Am allerwenigsten Raphaël, der nicht wirklich Nickis Vater war, zumindest nicht im klassischen Sinn. Er hatte sie verwandelt und bei sich aufgenommen, nachdem sie vor einhundert Jahren von Mitgliedern des Ku-Klux-Klans beinahe ermordet worden war. Sie hatte ein ähnliches Schicksal erlitten wie er, und die beiden hatten sofort eine Verbindung zueinander gespürt. Und eine Verbindung spürten Nicki und ich auch, nur eben ein bisschen anders. Was war schon dabei? Ich hatte vor einhundertfünfzig Jahren damit aufgehört, mich vor anderen zu rechtfertigen. Auch Raphaël zuliebe würde ich nicht wieder damit anfangen, selbst wenn er unser Anführer war und ich gewisse Pläne für die Zukunft hatte, die ein gutes Verhältnis zu ihm unabdingbar machten. Verbiegen würde ich mich nicht. Das hatte ich nicht nötig.
Begleitet von Pfiffen und dem Grölen der anderen gingen Nicki und ich zum Ende des Stegs, wo Johnny und Eve bereits ungeduldig auf uns warteten.
»Habt ihr’s endlich?«, murrte mein bester Kumpel, während Eve gelangweilt eine Kaugummiblase zum Platzen brachte. Ein künstlicher Kirschgeruch stieg mir in die Nase und überdeckte für einen Moment den modrigen Gestank des Wassers, das in der Abenddämmerung vor sich hin dümpelte.
»Immer mit der Ruhe, Johnny. Oder hast du heute noch etwas vor?«
»Ich nicht, aber du.«
Schulterzuckend ging ich in die Hocke. »Und wenn schon, die Ältesten lassen mich auch ständig warten. Es wird sie sicher nicht umbringen, auch mal fünf Minuten auf mich warten zu müssen.«
Stacey hinter uns lachte schallend. Ich zwinkerte ihr kurz über die Schulter zu, bevor ich Nicki meine Hand hinhielt. In einem früheren Leben musste sie Akrobatin gewesen sein, denn schon im nächsten Moment saß sie auf meinen Schultern. Ich umfasste ihre nackten Schenkel und erhob mich wieder. Neben mir nahm Johnny Eve auf seine breiten Schultern.
»Okay, macht euch bereit«, befahl Stacey.
Ich trat an den Rand des Stegs, spürte das raue Holz unter meinen nackten Fußsohlen und die immer noch viel zu warme Brise, die über meine bloße Haut streifte. Mein Blick fokussierte sich auf das grün schimmernde Wasser vor mir. In der Ferne erkannte ich unter den mit Louisianamoos behangenen kahlen Zypressen einen Alligator, der mich direkt zu fixieren schien, doch ich zuckte nicht einmal mit der Wimper. Die Viecher ließen uns in Ruhe, seit sie auf die harte Tour gelernt hatten, dass sie sich mit uns besser nicht anlegen sollten. Sie hatten endlich akzeptiert, dass sie sich den Sumpf mit uns teilen mussten. Damit waren sie einigen von uns weit voraus, einschließlich meiner Wenigkeit. Doch um die Zukunft würde ich mich später kümmern.
»Drei … Zwei … Eins …«, zählte Stacey den Countdown herunter, wobei sie hinter jeder Zahl eine viel zu lange Pause einlegte.
Bei drei warf ich den Leuten hinter uns einen letzten Blick zu, woraufhin sie uns weiter anfeuerten, bei zwei ging ich in die Hocke, und bei eins stieß ich mich mit den Füßen von den Holzplanken ab. Nickis Jubelschrei hallte durch den Bayou, schreckte einige Steinadler auf und brachte den Alligator dazu, das Weite zu suchen, während wir regelrecht über das Wasser flogen. Schließlich tauchten wir ein. Das kühle Nass schlug über uns zusammen, gleichzeitig wurde Nicki von meinen Schultern gerissen. Ich bekam ihren Arm zu fassen und zog sie an mich, um dem Wasser weniger Widerstand zu leisten. Gemeinsam sanken wir bis auf den Grund, wo es immer kälter und die Sicht immer trüber wurde. Wir stießen uns ab, trieben wieder nach oben und durchstießen die Wasseroberfläche. Ich strich mir noch die Haare aus dem Gesicht, als Nicki bereits einen Arm in die Luft reckte, untermalt von einem Schrei, der von den Bäumen widerhallte. Unser Publikum brach in Jubel aus. Mit Genugtuung stellte ich fest, dass wir eine halbe Alligatorenlänge weiter als Johnny und Eve gesprungen waren.
Grinsend hob ich die Hand zum High Five. Nicki schlug ein, dann sprang sie auf meine Hüfte und presste ihre Lippen auf meine. Dieses Mal schaffte ich keinen Abstand zwischen uns, sondern umfasste ihren Hintern mit meinen Händen, um ihren weichen, wohlgeformten Körper eng an meinem zu spüren. Mein Unterleib reagierte sofort, Nicki stieß ein Keuchen aus.
»Das ist Folter, Lavaughn«, knurrte sie an meinen Lippen.
»Das ist ein Versprechen, Babe.«
Bevor sie etwas erwidern konnte, hallte das Dröhnen von mindestens einhundert Motoren durch den Bayou. Mein Kopf ruckte zu der Seite, wo der Krach herkam. Das waren ganz eindeutig verdammte Motorräder! Doch dann flog ein Schwarm Grünreiher über uns hinweg, und ich bemerkte, dass Stacey wie erstarrt dastand. Ihr ganzer Körper war angespannt, von den nach oben gegelten kurzen Haaren bis zu den schwarz lackierten Fußnägeln. Mein eigener Groll war vergessen. Binnen Sekunden war ich aus dem Wasser und bei ihr auf dem Steg. Stacey stieß ein Fauchen aus und ging in Angriffsposition. Ich erwischte gerade noch ihren Arm, bevor sie sich in Bewegung setzen konnte.
»Nicht«, sagte ich sanft und schüttelte den Kopf. »Sie werden ihre Strafe bekommen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.«
»Wann dann?«, fragte Stacey. »Es ist inzwischen ein Jahr her. Ein ganzes beschissenes Jahr, Lavaughn.« Ihr Kopf fuhr zu mir herum, in ihren Augen standen Tränen.
»Ich weiß, Stacey. Ich weiß«, sagte ich ruhig, obwohl in mir ein Hurrikan tobte. In Vampirjahren waren zwölf Monate nicht viel – es sei denn, man gab uns einen Grund zum Trauern. Dann fühlte sich ein Jahr an wie ein ganzes Jahrzehnt. Und bei Dracula, Stacey hatte mehr als genug zu verarbeiten.
Die Anspannung wich aus Staceys Körper. Ich ließ sie los, weil ich wusste, dass sie sich nicht länger selbst in Gefahr bringen würde, um endlich Rache nehmen zu können. Stattdessen zog ich sie in meine Arme.
»Es wird alles wieder gut. Sie werden für das büßen, was sie Genevieve angetan haben.«
Stacey nickte schwach an meiner Brust, und ich konnte nur hoffen, dass ich mein Versprechen ihr gegenüber bald würde einlösen können.
Aus den Augenwinkeln nahm ich eine Bewegung wahr und erspähte Raphaël, der über den Steg auf uns zueilte.
»Waren das Motorräder?«, fragte er alarmiert.
»Waren es«, antwortete ich.
Raphaëls Blick wanderte von Stacey, die nach wie vor bei mir Halt suchte, über Nicki, Johnny und Eve, die inzwischen ebenfalls aus dem Sumpf gestiegen waren und sich wie ein Schutzschild hinter mich gestellt hatten, bis zu den anderen, die in ein paar Metern Entfernung standen und nicht so recht wussten, wie sie sich verhalten sollten. Die Wut war nach wie vor greifbar, denn Stacey war nicht die Einzige in unseren Reihen, die die Mitglieder des Motorradclubs leiden sehen wollte. Die Wut schwelte schon seit Langem und war letztes Jahr an Mardi Gras zu einem Feuer geworden, das sich in den vergangenen Monaten immer weiter ausgebreitet hatte. Es musste endlich etwas geschehen. Noch beherrschten sich alle, hörten auf Raphaël oder die Ältesten, meistens sogar auf mich, wenn ich sie bat, noch etwas Geduld zu haben. Doch das würde sicher nicht mehr lange gut gehen. Ehrlich gesagt war ich es selbst leid, immer der Vernünftige zu sein. Seit Monaten redete ich mir vor dem Ältestenrat den Mund fusselig, doch bisher ohne Erfolg. Ich bezweifelte auch, dass mein heutiger Termin sie endlich zum Umdenken bewegen konnte. Sie wollten einfach nichts ändern, waren zu festgefahren in ihrer Meinung. Dabei hatte mir die brenzlige Situation mit Stacey wieder einmal gezeigt, wie wichtig es war, nicht einfach so weiterzumachen wie bisher.
»Alles in Ordnung?«, wollte Raphaël wissen, der wieder zu Stacey sah.
Ich nickte. »Alles unter Kontrolle.«
Schnaubend befreite sich Stacey aus meinen Armen und wischte sich wütend über die feuchten Augen. »Noch. Aber wenn nicht bald etwas passiert, kann ich für nichts mehr garantieren.« Damit rauschte sie davon.
Raphaël stieß die Luft aus, und wir wechselten einen Blick. Es hatte mich sehr viel Überredungskunst gekostet, doch inzwischen hatte ich wenigstens ihn auf meine Seite ziehen können. Nur schade, dass er mich ausgerechnet heute nicht zu meinem Termin begleiten konnte, um es den Ältesten selbst ins Gesicht zu sagen, auch wenn er bisher nicht viel Einfluss gehabt hatte. Da brauchte ich mir nichts vorzumachen. Er war zwar unser Anführer, doch bei unseren Strukturen sagte das leider nur wenig aus. Trotz seiner Position war auch er nur jemand, der Befehle entgegennahm und dafür sorgte, dass sie von allen anderen beherzigt und ausgeführt wurden. Vermutlich war ihm seine Stellung bis jetzt auch zu wichtig gewesen, um den Ältesten Kontra zu geben und ungemütlich zu werden. Doch nun, wo wir auf einer Seite standen, kam hoffentlich endlich Bewegung in die ganze Sache.
»Sag mal, warum bist du eigentlich noch hier? An deiner Stelle würde ich die Ältesten nicht warten lassen, immerhin willst du etwas von ihnen und nicht umgekehrt.«
»Als ob sie ihre Meinung über mich und meine Ansichten ändern würden, nur weil ich pünktlich bin.« Mit einem Lächeln nahm ich meine Klamotten entgegen, die Nicki mir reichte, und zog Jeans und Hemd über die nassen Shorts. »Danke, Darling, wir sehen uns später.« Mit einem letzten Augenzwinkern in ihre Richtung machte ich mich auf den Weg. Raphaël folgte mir schweigend, doch ich spürte, dass er noch etwas loswerden wollte. »Nun spuck’s schon aus.«
Er räusperte sich. »Du weißt, dass ich dich schätze, oder?«
Ich warf ihm einen amüsierten Seitenblick zu. »Kommt jetzt wieder die Leier, dass ich die Finger von Nicki lassen soll? Vielleicht solltest du das besser ihr sagen, denn sie ist es, der es verdammt schwerfällt, die Hände von mir zu lassen.«
Raphaël verdrehte die Augen. »Hältst du das für hilfreich, Lavaughn?«
Ich musste mir ein Lachen verkneifen. »Du bist ganz schön prüde für jemanden, der vor Nickis Auftauchen im Bayou dafür bekannt war, Orgien auf seinem Hausboot zu feiern.«
Stöhnend hob Raphaël die Hände. »Okay, okay. Vielleicht bin ich inzwischen wirklich zu prüde und sollte mich aus Véroniques Männergeschichten heraushalten, aber sie ist nun mal mein Mädchen, also brich ihr verdammt noch mal nicht das Herz. Verstanden?«
»Glaub mir, Nicki weiß ganz genau, was sie will, und kann sehr gut auf sich selbst aufpassen.«
Raphaël packte mich am Arm und zwang mich, stehen zu bleiben. »Ich habe dich gefragt, ob du mich verstanden hast. Wenn du auf Nickis Herz herumtrampelst, reiße ich dir dein eigenes heraus, ist das klar?«
»Glasklar«, erwiderte ich, weil ich keine Lust auf eine Diskussion hatte. Raphaël spielte sich gern als Nickis Beschützer auf, aber er würde sich nicht wieder auf die Seite der Ältesten schlagen, nur weil ich mit seiner Tochter herummachte. Außerdem war Nicki gerade mein geringstes Problem.
»Dann ist gut.« Er ließ mich los, und wir setzten unseren Weg fort. »Nun zu deinem Treffen. Soll ich dich doch besser begleiten?«
Ohne darüber nachzudenken, schüttelte ich den Kopf. Natürlich hätte ich ihn gern dabeigehabt, denn auf ihn würden die Ältesten eher hören als auf mich, aber ich musste das ohne ihn hinbekommen, um ihm und auch dem Rat zu zeigen, dass ich allein zurechtkam. Schließlich wollte ich Raphaëls rechte Hand werden.
»Das schaffe ich schon. Bereite du dich auf dein Treffen mit Smith vor, das ist wichtiger.«
Raphaël nickte. »Im Prinzip sehe ich das genauso, aber ich will dich nicht hängen lassen. Wenn du mich brauchst …«
»Bist du da, ich weiß. Ich krieg das hin, okay?« Das hoffte ich zumindest.
»Lavaughn!«
Es war nicht das erste Mal, dass Timothy meinen Namen aussprach, leicht genervt und viel zu gedehnt. Allmählich verlor ich die Geduld. Wie konnten die Ältesten nur so borniert sein? Auszuflippen war trotzdem keine Lösung, damit würde ich nichts erreichen, denn ich hatte schon oft genug versucht, die Ältesten auf diese Weise zum Umdenken zu bewegen. Es war Zeit für eine andere Strategie.
»Ich weiß, wie ich heiße, Timothy, danke.« Das konnte ich mir einfach nicht verkneifen, blieb dabei aber überaus freundlich und schlug ein Bein über das andere, um keinen Zweifel daran zu lassen, wie ruhig ich war. »Warst du nicht sogar dabei, als meine Mutter mir 1730 diesen Namen gegeben hat?«
Timothy, der zwischen Walter und Claude an dem langen Tisch vor mir saß, schloss für einen Moment die Augen und massierte sich die Nasenwurzel, bevor er sich mir erneut zuwandte. »Noch einmal, Lavaughn. Wir werden uns den Menschen nicht offenbaren. Das ist unser letztes Wort.«
»Okay.« Ich nickte und unterdrückte die Wut in meinem Bauch, statt ihr freien Lauf zu lassen. »Dürfte ich dann endlich die Gründe dafür erfahren? Versteht mich nicht falsch, ich respektiere eure Entscheidung. Immerhin seid ihr die Ältesten, ihr werdet sicher unser aller Wohl im Blick haben.« Meine neue Taktik ging auf, zumindest sahen die drei Männer vor mir einander irritiert an. Ich grinste in mich hinein.
Walter war der Erste, der reagierte. Mit zusammengekniffenen Augen musterte er mich. »Was hast du vor? Du führst doch irgendetwas im Schilde.«
»Überhaupt nicht. Ich möchte euch nur gern verstehen, das ist alles.«
Walter schüttelte den Kopf. »Du willst uns in Grund und Boden argumentieren, nachdem dich deine Wutanfälle bisher nicht zum erwünschten Ziel gebracht haben. Es hat keinen Zweck, das zu leugnen. Die Entscheidung ist gefallen, Lavaughn, sieh es ein.«
Abwehrend hob ich die Hände. »Walter, bitte. Wie soll ich die Angelegenheit abhaken, wenn ich die Hintergründe nicht verstehe?«
»Es würde nichts ändern, wenn wir uns den Menschen offenbaren«, erklärte Timothy betont geduldig. »Oder glaubst du ernsthaft, sie würden sich dem Bikerclub entgegenstellen, damit wir wieder ungehindert Zugang zu New Orleans bekommen?«
»Vermutlich nicht«, gab ich zu. »Zumindest nicht sofort.«
»Du hast gesehen, was mit den Drachen passiert ist, nachdem sich die Drachenprinzessin in diesem Fußballstadion verwandelt hat«, fuhr Walter mich an. »Oder wie die Menschen das mexikanische Mädchen, die Catrina, behandelt und die Hexenclans belagert haben. Das kannst du nicht wirklich wollen.«
»Ihr habt recht. Das Misstrauen liegt in der Natur der Menschen, aber sie sind auch lernfähig. Die Wiederwahl des Premierministers Padraig Lynch in Irland zeigt, dass zumindest ein Großteil der Iren nicht damit einverstanden ist, wie die Drachen und die Catrina behandelt wurden. Ist es nicht völlig normal, erst einmal Grenzen zu setzen und herauszufinden, wie man miteinander umgeht?«
»Wie ich schon sagte, du willst uns nur in Grund und Boden argumentieren«, wiederholte Walter gereizt. »Wo steckt eigentlich Raphaël? Warum hat er dich nicht begleitet?«
»Er bereitet sich auf sein Treffen mit Simon Smith vor. Habt ihr vergessen, dass der britische Anwalt in New Orleans ist? Wie dem auch sei, Raphaël steht voll und ganz hinter mir und findet inzwischen ebenfalls, dass wir unsere eingefahrenen Strukturen überdenken sollten.«
Claude zog missbilligend die Augenbrauen hoch. »Und dann nimmt er sich keine halbe Stunde Zeit, um uns das selbst zu sagen?«
»Nein, weil es absolut unnötig ist. Ihr könnt mir glauben. Was das angeht, würde ich euch niemals belügen.«
»Ach, und in anderen Belangen schon?«, konterte Walter.
Ich verdrehte die Augen, bevor ich diesen Impuls unterdrücken konnte. »Natürlich nicht. Und ich nerve euch auch nicht seit Wochen mit ein und demselben Thema, nur weil es mir Freude macht, sondern weil ich es für unabdingbar halte, dass wir uns Gedanken über die Zukunft machen. Die anderen Clanmitglieder werden unruhig. Wenn wir einfach weitermachen wie bisher, wird das kein gutes Ende nehmen.«
Timothy stieß ein Seufzen aus. »Und inwiefern soll es helfen, wenn wir uns den Menschen offenbaren?«
»Wir alle wünschen uns Gerechtigkeit und vor allem Freiheit. Die aktuellen Entwicklungen sind unsere Chance, endlich wieder selbstbestimmt zu agieren. Seid ihr es nicht auch leid, von einem Bikerclub an den Rand der Zivilisation gedrängt zu werden? Es ist an der Zeit, uns zurückzuholen, was einst uns gehört hat. Oder wollt ihr euch auf immer und ewig von den selbst ernannten Vampirjägern herumschubsen lassen?«
»Nein«, antwortete Timothy zu meiner Überraschung, nachdem er einen Blick mit Walter und Claude getauscht hatte. »Aber dafür brauchen wir nicht die Menschen. Hör dir unseren Plan an.«
Kapitel 3
Paige
»Conrad! Schön, Sie zu sehen.«
Simon Smith ging mit ausgestreckter Hand auf meinen Vater zu. Er erinnerte mich an Sean Connery in seinen Fünfzigern, hochgewachsen, mit kräftigem Oberkörper und dunklen Haaren, die bereits angegraut waren. Aber vor allem seine elegante und zugleich respektvolle Erscheinung ließ mich an den besten aller James-Bond-Darsteller denken. Er wirkte streng, aber zugleich fair und vertrauensvoll, sodass er einem das Gefühl gab, bei ihm gut aufgehoben zu sein, egal welche Geheimnisse man verbarg oder wie viel Dreck man am Stecken hatte. Sein Beruf war da natürlich perfekt gewählt. Er war ein Anwalt aus Großbritannien, hatte allerdings weder etwas mit Familienrecht noch mit Strafrecht zu tun. Er oder besser gesagt seine Kanzlei Beaver, Whitebait & Smith mit Hauptsitz in London und verschiedenen Dependancen – beispielsweise in Dublin, Paris, New York und eben auch in New Orleans – vertrat übernatürliche Wesen auf der ganzen Welt. Ich wusste, dass Smith gemeinsam mit einem ortsansässigen Anwalt die Belange des Vampirclans im Bayou regelte, und nahm an, dass auch die irischen Drachen und die Londoner Hexenclans ihm beziehungsweise seiner Kanzlei vertrauten. Diskretion und Stillschweigen waren quasi Bestandteil des Kanzleinamens, deshalb bekam Dad nie eine Antwort auf seine Fragen. Nicht einmal oder vor allem dann nicht, wenn es um die Vampire ging, dabei hatten wir selbst mit ihnen zu tun. Über die Drachen oder die Hexen und Magier sowie das mexikanische Mädchen, die Catrina, wussten wir nur, was in den Medien berichtet wurde.
Normalerweise arbeiteten wir nicht mit Beaver, Whitebait & Smith zusammen. Der Motorradclub hatte einen eigenen Anwalt, und den brauchten wir, denn Drogengeschäfte, Waffenhandel und andere Delikte standen bei uns an der Tagesordnung. Hin und wieder bekamen wir es aber auch mit den Fürsprechern der übernatürlichen Wesen zu tun – wenn die Vampire etwas von uns wollten und ihre Handlanger vorschickten, um uns auf den Zahn zu fühlen. In den meisten Fällen konnten sie sich das zwar sparen, denn der Club war unnachgiebig, aber mein Vater mochte Simon Smith und fand es amüsant, sich mit ihm auszutauschen. Ich war zum ersten Mal bei einem dieser Treffen dabei und ehrlich gesagt überrascht, wie gut die beiden Männer miteinander auskamen, denn sie hätten unterschiedlicher nicht sein können. Mein Dad mit seiner schwarzen Lederhose und dem Guns N’ Roses-Shirt unter der Weste, auf deren Rückseite übergroß das Patch unseres Clubs prangte und daneben der piekfein gekleidete Anwalt in blütenweißem Hemd und Anzug. Nur die Krawatte fehlte. Dad trug außerdem seinen Siebzigerjahre-Schnurrbart, den er noch nie abrasiert hatte, während Simon Smiths Gesicht makellos glatt war. Jetzt mal ehrlich, warum hatte ein Mann um die fünfzig bessere Haut als ich?
»Simon! Willkommen zurück in Nola.« Dad und der Anwalt schüttelten sich überschwänglich die Hände, dann legte mein Vater einen Arm um meine Schulter und zog mich zu sich. »Simon, das ist meine Tochter Paige. Sie ist vor Kurzem einundzwanzig geworden und wird eines Tages meinen Platz einnehmen, deshalb wollte ich sie Ihnen vorstellen.«
»Mr Smith.« Ich streckte ihm ebenfalls meine Hand entgegen und musste feststellen, dass sein Händedruck dem meines Dads in nichts nachstand.
»Bitte nenn mich Simon. Schön, dich kennenzulernen, Paige.«
»Sie studiert Jura«, warf mein Vater in den Raum und klang beinahe stolz, auch wenn ich mir das sicher nur einbildete. Er mochte meine Berufswahl nicht besonders, wobei er nichts gegen Jura an sich hatte, nur gegen meine persönlichen Pläne, was den Club betraf. Wie gesagt, unser Anwalt gehörte schon fast zu den DeathRiders. Mehr als einmal hatte er bei unseren regelmäßigen Barbecues neben Mo gesessen und lautstark über dessen Witze gelacht, die normalerweise so gut wie niemand komisch fand. Mo war unser Clubsenior und schon unter meinem Grandpa Mitglied gewesen.
Simon hob überrascht die Augenbrauen, gleichzeitig wirkte er beeindruckt. »Jura? Das hätte ich von der Tochter eines Death Riders nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Weißt du schon, in welche Richtung du gehen willst?«
»Sie wird den Club vertreten, wenn es so weit ist«, antwortete mein Vater, ohne mir die Chance zu geben, selbst etwas zu sagen.
Ich widersprach ihm nicht, weil ich keine Lust auf eine Auseinandersetzung hatte. Das war vielleicht der richtige Ort – wir hatten uns in unserem Clubhaus getroffen –, aber in Gegenwart des Anwalts gewiss nicht der richtige Zeitpunkt, deshalb lächelte ich nur. Eigentlich trug ich mein Herz auf der Zunge, doch wer wie ich umgeben von testosterongesteuerten Männern aufwuchs, die einen aus Prinzip nicht ernst nahmen, lernte schnell, was man taktisch erst einmal zurückhielt oder grundsätzlich besser für sich behielt. Periodenkrämpfe etwa waren nie ein gutes Thema.
»Nun, um ehrlich zu sein habe ich auch jemanden bei mir, meine Nichte. Sie wollte unbedingt Mardi Gras feiern und hat mich so lange bearbeitet, bis ich nicht länger Nein sagen konnte. Sie kennen das sicher, Conrad. Darf ich sie hereinbitten?«
»Natürlich«, erwiderte mein Vater, dem ich die Irritation deutlich anhören konnte. Er war mit Sicherheit nicht begeistert, einen ungebetenen Gast zu empfangen. »Warum lassen Sie Ihre Nichte denn vor der Tür warten wie einen Hund?«
»Ich wollte sie nicht einfach unangekündigt mitbringen, aber sie wird wahrscheinlich eines Tages meinen Platz einnehmen, sie studiert nämlich ebenfalls Jura. Amber?«, rief er, bevor er sich wieder uns zuwandte. »Dann lernen Sie Amber jetzt einfach ein bisschen früher kennen als geplant.«
Noch während er sprach, trat eine junge Frau ein, die maximal zwei Jahre jünger war als ich. Ansonsten war sie das komplette Gegenteil von mir. Wäre sie eine Fremde von der Straße, hätte ich sie als aufgebrezelte Tussi abgestempelt. Ihre Korkenzieherlocken waren blondiert, die Haut wirkte künstlich gebräunt, und im Gesicht hatte sie eine dicke Schicht Make-up. Auch die Fingernägel waren künstlich und knallrot lackiert, passend zu ihrem erdbeerroten, bauchfreien Top und den Riemchensandalen mit den bestimmt zehn Zentimeter hohen Absätzen. Probleme, damit zu laufen, hatte sie allerdings nicht. Mit einem Lächeln, das ehrlich und sympathisch wirkte, trat sie auf meinen Vater und mich zu und schüttelte zuerst ihm, dann mir die Hand.
»Hallo, ich bin Amber«, stellte sie sich mit britischem Akzent vor. »Ist es wirklich okay, wenn ich hier bin? Ansonsten gehe ich wieder. Wirklich, das wäre überhaupt kein Ding. In New Orleans gibt es so viel zu sehen.«
Mein Vater winkte ab. »Bleib, wenn du willst. Wir haben nichts zu verbergen. Willst du eine Cola?«
»Wir haben auch Cola Light«, fügte ich hinzu, weil ich mir sicher war, dass Amber im Geist bereits die Zuckerstücke zählte, die in einer Dose enthalten waren. Mir war das egal, aber Ernesto war süchtig nach dem Light-Zeug.
»In dem Fall gern.«
Wieder bedachte Amber mich mit diesem strahlenden Lächeln, das mehr als aufrichtig wirkte, und mich überkam das schlechte Gewissen. Vielleicht tat ich ihr mit meinen Vorurteilen unrecht. Nur weil sie sehr viel Wert auf ihr Äußeres legte und es dabei meiner Meinung nach ein wenig übertrieb, hieß das nicht, dass sie oberflächlich sein musste. Ich kannte das selbst nur zu gut. Am College wollten die Wenigsten glauben, dass ich Mitglied in einem Motorradclub war und mir jeden noch so aufdringlichen Kerl mühelos selbst vom Hals halten konnte. Offenbar durfte man als Bikerin keine langen braune Haare haben, sich nicht die Nägel lackieren – in meinem Fall rot oder schwarz und natürlich nicht aufgeklebt – und musste gänzlich auf Make-up verzichten. Aber gegen ein bisschen schwarzen Eyeliner, Wimperntusche und farblosen Lipgloss war doch nichts einzuwenden, oder?
»Du studierst also Jura in London?«, fragte ich Amber nun ehrlich interessiert, während ich Kevin, einen Prospect, in der halb offenen Küche herumwuseln hörte.
Prospects waren Anwärter auf eine Vollmitgliedschaft, die sich jedoch erst beweisen und bis zu ihrer Aufnahme als Laufburschen herhalten mussten, ähnlich wie Füchse bei einer Studentenverbindung. Kevin war bei jedem Meeting dabei, um alles vorzubereiten, für Getränke und eventuell Verpflegung zu sorgen und hinterher aufzuräumen. Dabei hatte er sich im Hintergrund zu halten. Allerdings war er noch relativ neu bei uns und ziemlich nervös, weshalb des Öfteren etwas schiefging. Deshalb verdrehte mein Vater nun auch die Augen und steuerte die Küche an.
Amber nickte. »Wobei ich gerade ein Semester in Dublin war und nicht nur Jura studiere, sondern auch englische Literatur. Seltsame Kombination, ich weiß«, fügte sie lachend hinzu. »William Shakespeare, Jane Austen und Emily Brontë haben es mir einfach angetan, überhaupt Bücher. Was ist mit dir? Hast du dich nur für Jura entschieden?«
»Ja, für viel mehr hätte ich gar keine Zeit, ich bin schließlich auch noch im Club aktiv.« Die Auseinandersetzungen mit den Vampiren nicht zu vergessen, doch obwohl ich annahm, dass Amber über die Blutsauger Bescheid wusste, behielt ich das Thema lieber für mich.
»Richtig. Das ist so cool. Du musst mir unbedingt mehr darüber erzählen.«
»Wenn sich die Gelegenheit ergibt«, erwiderte ich vage.
»Vielleicht heute Abend?«, schlug Simon Smith vor, während Kevin aus der Küche kam und eine Kanne mit Filterkaffee auf dem Tisch platzierte. »Amber kennt hier in New Orleans niemanden und muss die Abende deshalb mit ihrem alten Onkel verbringen. Wenn du noch nichts vorhast, könntest du ihr eventuell das Nachtleben von New Orleans zeigen?«
»Heute Abend?«, fragte ich, wobei meine Stimme leicht panisch klang. »Es ist Super Bowl!«
»Du kannst Amber mit zum Mardi-Gras-Ball des Polizeipräsidenten nehmen«, schlug mein Vater vor, der ebenfalls aus der Küche gekommen war und einen Sixpack Cola Light neben die Kaffeekanne stellte.
»Aber ich dachte, James geht auf den Ball.«
»James hat mich gebeten, tauschen zu dürfen. Er übernimmt dafür den nächsten Straßenumzug.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Tja, Pech. Ich bin heute Abend schon verplant.«
»Kommst du bitte mal kurz mit in die Küche?«, bat mein Vater, wobei es genau genommen ein Befehl war.
»Entschuldigung, ich wollte nicht …«, setzte Amber an.
»Das hat nichts mit dir zu tun.« Dad zog mich mit sich in die Küche. »Was soll das, Paige?«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »James will mir doch nur eins auswischen, und du machst da auch noch mit.«
»Raus!«, blaffte mein Vater, und ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass er Kevin meinte, der hinter uns aufgetaucht war.
»Aber die Tassen …«, stammelte Kevin, der mir beinahe leidtat. Ich bezweifelte, dass er noch lange bei uns bleiben würde. Dafür hatte er zu wenig Selbstbewusstsein und zu viel Respekt vor meinem Vater, dem Respekt, Ehre und Vertrauen über alles gingen. Paradox, ich weiß. So war mein Vater nun mal.
Er nahm das mit Tassen und Gläsern beladene Tablett von der Anrichte und drückte es Kevin so schwungvoll in die Hände, dass es gefährlich klirrte. Dann wandte er sich wieder mir zu.
»Jetzt hör mir mal zu. James will sich nicht einfach nur den Super Bowl ansehen, er hat einen Notfall in der Familie. Außerdem würde er mich nie in eure Stänkereien hineinziehen, das solltest du eigentlich wissen.«
»Ja, okay. Sorry. Aber kann nicht jemand anderes einspringen? Terrence zum Beispiel? Er macht sich nichts aus Football.«
»Weshalb er heute Abend für das French Quarter eingeteilt ist.«
»Ich tausche mit ihm«, sagte ich schnell. Das French Quarter war voll mit Bars und Kneipen, und in so gut wie jeder hing ein Flachbildfernseher. Das war zwar kein Vergleich zu dem Abend, den ich mit Finn und JD geplant hatte, aber auf diese Weise würde ich wenigstens etwas vom Spiel mitbekommen.
Dad stieß geräuschvoll die Luft aus. »Auf keinen Fall. Oder hast du Lust, beim nächsten Run wieder von den Cops eskortiert zu werden? Terrence kann die Aufgabe nicht übernehmen, das weißt du, und im Übrigen ist es gar nicht schlecht, wenn du statt James hingehst. Die Einladung kam von Robert Mahony persönlich, und du willst doch irgendwann in meine Fußstapfen treten. Demnach kann es nicht schaden, wenn du schon mal Kontakt zum Polizeipräsidenten aufnimmst. Oder haben sich deine Zukunftspläne geändert?« Die Stimme meines Vaters nahm einen scharfen Unterton an.
»Nein«, murmelte ich, weil ich wusste, dass ich verloren hatte. Eine der ersten Regeln, die ich auf die harte Tour gelernt hatte: Steck keine Energie in Kämpfe, die du nicht gewinnen kannst.
»Dann stell dich gut mit Mahony und zeig Flagge, sollte ein Blutsauger auf dem Ball auftauchen. Und pass bloß auf, dass der Anwaltsnichte nichts passiert«, fügte Dad etwas leiser hinzu.
Ich verdrehte die Augen und nickte. Als Smiths Nichte müsste sie vor den Vampiren eigentlich sicher sein. Ich hingegen würde – mal wieder – Sally schlucken müssen, um mich vor den Blutsaugern zu schützen. So ein Mist! Ich hätte lieber darauf verzichtet, ausgerechnet den Super-Bowl-Abend als Babysitterin zu verbringen. Schon seit Wochen freute ich mich auf JDs Jambalaya und das Footballspiel des Jahres. Missmutig zückte ich mein Handy und schrieb JD eine Nachricht, dass ich leider absagen müsste und er mir etwas von dem Reisgericht übrig lassen sollte. Dann folgte ich meinem Vater zurück in den Aufenthaltsraum, wo sich Simon Smith und Amber bereits an den großen Tisch gesetzt hatten. Kevin stand unschlüssig an der Seite.
»Du kannst gehen«, sagte mein Vater, ohne Kevin direkt anzusehen, und ließ sich auf den Stuhl am Kopfende fallen.
Kevins Blick huschte zu mir. Anscheinend war ihm nicht klar, ob die Anweisung tatsächlich ihm galt, auch wenn es mehr als offensichtlich war. Eindringlich deutete ich mit dem Kopf zur Tür, bis er sich endlich in Bewegung setzte. Ich unterdrückte ein Seufzen. Was hatte er sich nur dabei gedacht, bei uns Mitglied werden zu wollen? Und was hatte sich Dad dabei gedacht, Kevin überhaupt eine Chance zu geben? Seine Probemitgliedschaft war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Oder sah Dad etwas in ihm, das ich nicht sah?
»Also, Simon, Sie hatten bereits ein Treffen mit den …« Mein Vater zögerte kurz. »Mit Ihren Klienten hier in Louisiana?«
»Das ist richtig, und sie haben mir auch ein Anliegen mit auf den Weg gegeben. Es geht um die Zahlungen.«
Dads Augen verengten sich zu Schlitzen. »Was ist damit?«
Simon Smith goss sich in aller Seelenruhe eine Tasse Kaffee ein, bevor er antwortete. »Nun, wäre es möglich, die Zahlungen ein wenig herunterzusetzen?«
»Das kommt überhaupt nicht infrage. Jedes Jahr der gleiche Mist. Diese elenden Blut–« Mein Vater unterbrach sich selbst und schlug mit der Hand auf den Tisch.
Der Anwalt schmunzelte, statt zusammenzuzucken. »Wir können ruhig Klartext reden, Conrad. Amber weiß über die Vampire Bescheid, sonst hätte ich sie weder nach New Orleans mitgenommen noch zu diesem Treffen.«
»Dann sagen Sie den Blutsaugern, dass die Zahlungen nicht verhandelbar sind. Wenn sie in die Stadt kommen wollen, um sich von unschuldigen Menschen zu ernähren, müssen sie verdammt noch mal dafür bezahlen.«
Während sich mein Vater weiter über die Dreistigkeit der Vampire aufregte, sah ich zu Amber, die die Gelegenheit nutzte und sich zu mir beugte. »Es tut mir leid, Paige. Ich wollte dir nicht den Abend ruinieren.«
»Keine Sorge, ich hätte sowieso zu dem Ball gehen müssen, da kannst du mir auch gern Gesellschaft leisten.«
Amber lächelte beinahe schüchtern, was ich erwiderte. Mir fiel wieder ein, dass sie ein Semester in Dublin verbracht hatte, wo sich erst vor Kurzem die Drachen offenbart hatten, und dass sie aus London stammte, wo die Hexenclans dem Beispiel der Drachen gefolgt waren. Vielleicht war es wirklich nicht so schlimm, den Abend mit ihr zu verbringen, denn möglicherweise war sie weniger diskret als ihr Onkel.
Kapitel 4
Lavaughn
»Du weißt schon, dass das Ganze einem Selbstmordkommando gleicht, oder?«
»Nicht, wenn sie mich schicken.«
»Lavaughn!«
»Ja, Johnny?«
Ich erwiderte den Blick meines Freundes, der mich ansah, als wäre ich nicht ganz zurechnungsfähig. Dabei war er derjenige, der in einem Scooby-Doo-Kostüm mitten durchs French Quarter spazierte, weil er überzeugt war, die Frauen würden darauf abfahren.
Kopfschüttelnd wandte er sich wieder ab. »Du bist nicht der Erste, der die Perlen stehlen will. Rate mal, wie vielen das bisher gelungen ist. Genau, niemandem!«
Johnnys Stimme wurde immer schriller, doch damit konnte er mich nicht aus der Ruhe bringen. Wir waren in New Orleans, ich konnte endlich wieder Stadtluft schnuppern. Okay, die Duftnote im French Quarter war nicht unbedingt sensationsverdächtig. Billiges Parfüm und Deo mischten sich mit Schweiß, Zigarettenqualm und verschüttetem Bier, und darunter lag noch eine Spur menschlicher Ausdünstungen, die ich lieber nicht so genau zuordnen wollte. Aber es war die Stadt! Auf den Straßen wimmelte es von Einheimischen und Leuten aus aller Welt, die in den ausgefallensten Kostümen steckten oder sich einfach nur schick gemacht hatten. Sie tanzten zu den Melodien der Straßenmusik, die an jeder Ecke gespielt wurde, klatschten im Takt mit und lachten, zogen von Bar zu Bar oder sahen sich das Footballspiel an, das über sämtliche Bildschirme flimmerte. Gold, Grün und Lila, die typischen Farben des Mardi Gras, beherrschten das Stadtbild, und über allem hingen die Klänge des New Orleans Jazz, den ich so sehr liebte. Am liebsten hätte ich meine eigene Trompete hervorgeholt und mitgespielt. Ehrlich, mir ging das Herz auf, dabei schlug es schon seit Jahrhunderten nicht mehr in meiner Brust.
»Warum sagst du jetzt nichts?«, hakte Johnny nach.
»Ich weiß selbst, dass es bisher niemandem gelungen ist, sonst hätten die Ältesten wohl kaum mir den Auftrag gegeben.«
Er stieß ein Seufzen aus, als zweifelte er an meiner Intelligenz. »Okay, lass es mich anders ausdrücken. Wie viele sind bisher nach dem Versuch lebend zurückgekehrt? Niemand, Lavaughn, niemand! Du weißt das, ich weiß das, die Ältesten wissen das, und genau deshalb hast du diesen Auftrag bekommen. Sie wollen dich aus dem Weg räumen, weil du unbequem wirst.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Und wenn schon. Der letzte Versuch liegt einige Jahrzehnte zurück, und immerhin geht mal etwas voran.«
Johnny schnaubte. »Wenn du deinen Tod als Fortschritt betrachtest …«
Jetzt musste ich lachen. »Korrigier mich, Johnny, aber ich dachte, ich bin längst tot.«
»Schön, dass du das auf die leichte Schulter nimmst«, murrte mein Kumpel.
Ich schlug ihm auf den Rücken. »Mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Ich werde den Ältesten bestimmt nicht den Gefallen tun, bei einem popeligen Diebstahl draufzugehen.«
»Popeliger Diebstahl?« Johnny blieb stehen, die Augen so groß, dass nun wirklich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Zeichentrickhund Scooby-Doo bestand. »Lavaughn, du willst ins Clubhaus der Death Riders einbrechen, um den Gegenstand zu stehlen, der ihnen Macht über uns verleiht. Wenn sie dich erwischen – genau wie jeden anderen vor dir –, werden sie dir nicht nur den Arsch aufreißen. Sie werden dich leiden lassen, sodass du dir wünschen wirst, du wärst vor zweihundertsiebzig Jahren wirklich gestorben, und am Ende wird nichts weiter von dir zurückbleiben als ein Häufchen Asche.«
Ich verdrehte die Augen. »Seit wann bist du so melodramatisch? Wenn hier jemand Ärsche aufreißt, dann bin ich das, und zwar die der Biker. Ich dachte eigentlich, du kloppst dich darum, mir beizustehen, statt dir in die Hose zu machen.«
»Natürlich bin ich dabei«, sagte Johnny und ging weiter.
Nun war ich derjenige, der dumm aus der Wäsche schaute. Einen Moment lang starrte ich auf Johnnys Fellrücken, dann setzte ich mich schnell in Bewegung, um ihn in der Menschenmenge nicht zu verlieren. »Du bist dabei?«
»Klar, was denkst du denn?«
»Und was ist mit der ganzen Schwarzmalerei?«
Dieses Mal zuckte Johnny mit den Schultern. »Ich wollte dich nur auf die Risiken aufmerksam machen, damit du nicht leichtsinnig wirst. Du tendierst manchmal zur Selbstüberschätzung. Aber mal ehrlich, wenn ich jemandem zutraue, die verdammten Perlen zu stehlen, dann dir.«
»Hm«, machte ich nur, denn eigentlich wollte ich Johnny gar nicht mitnehmen. Das Risiko, tatsächlich als Aschehäufchen zu enden, war viel zu hoch.
»Ich bin immer an deiner Seite, Lavaughn, das solltest du nach zweihundert Jahren eigentlich wissen. Wann steigt die Nummer?«
Ich nahm meinen Instrumentenkoffer auf die andere Schulter und beschloss, vorerst keine Diskussion darüber zu führen, ob Johnny wirklich mit an Bord sein sollte. »An Mardi Gras.«
»Ich dachte, wir feiern gerade Karneval.« Er grinste, und ich verdrehte die Augen.
»Du weißt, was ich meine. Fat Tuesday. Da ist in der ganzen Stadt die Hölle los, auch die Biker feiern. Am besten, wir fallen am frühen Abend mit dem ganzen Clan in New Orleans ein. Damit rechnen die Death Riders am wenigsten.«
Johnny nickte beeindruckt. »Du hast dir ja schon richtig Gedanken gemacht. Und wen nehmen wir noch mit zum Clubhaus?«
»Niemanden. Je weniger wir sind, desto weniger Aufmerksamkeit ziehen wir auf uns. Die anderen sollen sich unter die Leute mischen und Präsenz zeigen, ohne Mist zu bauen.«
»Verstehe, klassisches Ablenkungsmanöver. Geht klar.«
Ich schlug Johnny ein weiteres Mal auf den Rücken. »Gut, dann lass uns erst mal Spaß haben. Und du willst wirklich nicht mitkommen?«
Johnny zog die Augenbrauen hoch. »Auf den Ball des Polizeipräsidenten? Wo es gesittet zugeht und ich nicht literweise Hochprozentigen in mich reinkippen kann, um nicht aufzufallen?« Demonstrativ ließ er den Blick über die feierwütige Meute schweifen. »Nein, danke, ich bleib hier. Langweil du dich mal schön ohne mich.«
Ich schmunzelte. »Oh, mein Instinkt sagt mir, dass es heute ganz und gar nicht langweilig wird. Also dann. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.«
»Sex, blood and New Orleans Jazz«, schrie Johnny unseren Schlachtruf für die Stadt so laut, dass sich einige Menschen neugierig zu uns umdrehten. Er hob die Hand zum High Five, und ich schlug ein, bevor wir in unterschiedliche Richtungen auseinandergingen.
Der Polizeipräsident wohnte in einer der historischen Villen im Garden District, durch deren Fenster man die piekfeine Ballgesellschaft beim Champagnerschlürfen und Hübschaussehen beobachten konnte. Die momentan noch aus Boxen kommende Mardi-Gras-Musik war bis auf die Straße zu hören, darunter mischte sich das bunte Stimmengewirr der Gäste. Es bestand hauptsächlich aus Small Talk, was den Passanten im Gegensatz zu mir jedoch verborgen blieb, denn wir Vampire hatten ein ausgezeichnetes Gehör. Überhaupt waren unsere Sinne viel besser ausgeprägt.
Die Säulen und Balkone der Villa waren mit Girlanden, Luftballons und Banner in Gold, Grün und Lila geschmückt, am Gartenzaun sowie in den Ästen der im Vorgarten wachsenden Eichen hingen unzählige bunte Perlenketten, die während der Paraden tausendfach von den Festwagen geworfen wurden. Angeblich war das Tradition, seit ein als Weihnachtsmann verkleideter Paradeteilnehmer vor einhundertfünfzig Jahren damit angefangen hatte, aber in Wahrheit waren die sogenannten Beads dazu da, die Menschen vor uns Vampiren zu schützen – zumindest, solange die Ketten um ihre verlockenden Hälse baumelten. Fasste unsereins die Perlen an, war es, als würde man einen in Säure getauchten Gegenstand berühren. Doch ohne Körperkontakt bestand keinerlei Gefahr. Die Ketten hielten mich also nicht davon ab, durch das Gartentor zu gehen, die wenigen Stufen nach oben zu steigen und an die Tür zu klopfen, die sogleich geöffnet wurde.
»Lavaughn Beauchamp«, stellte ich mich dem livrierten Bediensteten vor und zeigte auf meinen Instrumentenkoffer. »Robert Mahony erwartet mich.«
»Natürlich, kommen Sie bitte herein. Champagner?«