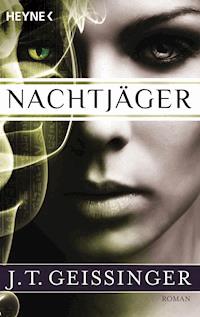12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bramble eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgeschichte, die unter die Haut geht … Für alle Fans von Dark Romance sowie D. C. Odesza, J. S. Wonda und Alessia Gold Kaylas Leben liegt in Trümmern. Kaum hat die junge Illustratorin ihre große Liebe Michael beerdigt, muss sie sich mit dem Zerfall des gemeinsamen Hauses auseinandersetzen und findet den Brief des Gefängnisinsassen Dante in ihrer Post. Sein Inhalt? Eine einzige Zeile. Ich werde ewig warten, wenn es sein muss. Gefangen in ihrer Trauer antwortet Kayla ihm, und es entwickelt sich eine Brieffreundschaft zwischen den beiden, die immer intimer wird. Während Kayla sich fragt, woher Dante sie zu kennen glaubt, wird sie von ihren wachsenden Gefühlen für den attraktiven Handwerker Aidan überrumpelt. Der Anfang einer Liebesgeschichte voller Leidenschaft, Schmerz und Geheimnisse, die tief in Kaylas Vergangenheit verwurzelt sind … Das Haus am See mit dunklem, spicy Twist von Booktok-Sensation und USA Today-Bestsellerautorin J. T. Geissinger Dich erwarten diese Tropes: - Touch her and die - High Spice - He falls first and harder Weitere Dark Romance-Bücher der Autorin: - Ruthless Creatures (Queens and Monsters 1) - Carnal Urges (Queens and Monsters 2) - Savage Hearts (Queens and Monsters 3) - Brutal Vows (Queens and Monsters 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
J. T. Geissinger
Pen Pal
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Nadine Mutz
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kaylas Leben liegt in Trümmern.
Kaum hat die junge Illustratorin ihre große Liebe Michael beerdigt, muss sie sich mit dem Zerfall des gemeinsamen Hauses auseinandersetzen und findet den Brief des Gefängninsassen Dante in ihrer Post. Sein Inhalt? Eine einzige Zeile. Ich werde ewig warten, wenn es sein muss. Gefangen in ihrer Trauer antwortet Kayla ihm, und es entwickelt sich eine Brieffreundschaft zwischen den beiden, die immer intimer wird.
Während Kayla sich fragt, woher Dante sie zu kennen glaubt, wird sie von ihren wachsenden Gefühlen für den attraktiven Handwerker Aidan überrumpelt.
Der Anfang einer Liebesgeschichte voller Leidenschaft, Schmerz und Geheimnisse, die tief in Kaylas Vergangenheit verwurzelt ist …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Hinweis
Widmung
I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
II
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
III
41. Kapitel
EPILOG
ANMERKUNG DER AUTORIN
BONUSKAPITEL
BUCHCLUB
DANKSAGUNG
LISTE SENSIBLER INHALTE / CONTENT NOTES
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit Pen Pal.
J. T. Geissinger und Bramble
Für Jay, der weiß, wie er mich im Dunkeln findet.
I
INFERNO
Der Weg ins Paradies beginnt in der Hölle.
Die göttliche Komödie
1
Es regnet in Strömen, als der Sarg meines Manns in das Erdloch hinabgelassen wird. Ein Platzregen, als würde der Himmel gerade ebenso entzweigerissen wie mein Herz.
Wie gelähmt stehe ich unter meinem Regenschirm bei den anderen Trauernden und höre dem Priester zu, der von Auferstehung und Herrlichkeit, Segen und Leid, Erlösung und der heiligen Liebe Gottes schwafelt. So viele Worte, aber alle bedeutungslos.
Alles ist bedeutungslos. In meiner Brust klafft ein Michael-förmiges Loch. Nichts ist mehr wichtig.
Wahrscheinlich fühle ich mich deshalb wie betäubt. Ich bin leer. Die Trauer hat mich zerrissen und meine Einzelteile in der Ödnis verstreut, wo sie die nächsten tausend Jahre in der sengenden Sonne brutzeln werden.
Hinter mir schluchzt eine Frau leise in ihr Taschentuch. Sharon? Karen? Eine Kollegin von Michael, der ich vor Ewigkeiten mal bei einer Fakultätsparty begegnet bin. Eine dieser schrecklichen Semesterabschlussfeiern, wo billiger Wein in Plastikbechern serviert wird und die Leute herumstehen und Small Talk machen, bis sie betrunken genug sind, um zu sagen, was sie wirklich voneinander denken.
Sharon oder Karen hinter mir hat auf dieser Party zu Michael gesagt, er sei ein Arschloch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum, aber wahrscheinlich ist das der Grund, warum sie jetzt weint.
Wenn jemand stirbt, fällt einem wieder ein, wo man dem anderen Unrecht getan hat.
Der Priester bekreuzigt sich vor der Brust. Er klappt die Bibel zu und tritt zurück.
Langsam gehe ich nach vorn, bücke mich, nehme eine Handvoll Erde vom Haufen neben dem Loch und werfe sie auf den geschlossenen Sarg. Der nasse Klumpen landet mit einem hässlichen dumpfen Aufschlag auf dem grauen Sargdeckel, das herzlose Platschen hat etwas Endgültiges. Dann rutscht die Erde seitlich herunter und hinterlässt eine braune Spur wie einen Kackstreifen.
Plötzlich zittere ich vor Wut. Ich schmecke Asche und Bitterkeit.
Was für ein dämliches Ritual das ist. Warum betreiben wir überhaupt diesen Aufwand? Die Toten können uns nicht trauern sehen. Sie sind nicht mehr da.
Ein kalter Windhauch fährt durch die Bäume und lässt die Blätter rascheln. Ich mache auf dem Absatz kehrt und gehe durch den Regen davon, blicke auch nicht zurück, als jemand leise meinen Namen schluchzt.
Ich muss jetzt mit meiner Trauer allein sein. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die gern gemeinsam eine Tragödie beweinen. Vor allem nicht, wenn es meine eigene ist.
Als ich die Eingangstür aufschließe, brauche ich einen Moment, um zu realisieren, dass ich zu Hause bin. Ich habe keinerlei Erinnerung an die Fahrt vom Friedhof hierher, aber meine Gedächtnislücke überrascht mich nicht. Seit dem Unfall bin ich wie benebelt. Als wäre mein Gehirn in dicke Wolken gehüllt.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Trauer mehr ist als ein Gefühl. Es ist auch eine körperliche Erfahrung. Wenn eine Person trauert, fluten allerlei Stresshormone den Blutkreislauf. Abgeschlagenheit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen … Die Liste der möglichen Nebenwirkungen ist lang.
Und ich habe sie alle.
Ich ziehe meine Schuhe aus und stelle sie unter den Konsolentisch im Eingangsbereich. Auf dem Weg zum Kühlschrank werfe ich meinen Wollmantel über einen Küchenstuhl. Der Regen prasselt gegen die Fensterscheiben, während ich vor dem offenen Kühlschrank stehe und versuche, mich davon zu überzeugen, dass ich Hunger habe.
Hab ich aber nicht. Ich weiß, ich sollte was essen, um bei Kräften zu bleiben, aber ich habe auf nichts Appetit. Ich lasse die Tür wieder zufallen und drücke mit den Fingern gegen meine pochenden Schläfen.
Schon wieder Kopfschmerzen. Zum fünften Mal in dieser Woche.
Als ich mich umdrehe, bemerke ich den Umschlag, der an der Obstschale auf dem Küchentisch lehnt. Ein weißes Rechteck mit sauberer Handschrift und einem roten »LOVE«-Stempel darauf.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der heute Morgen noch nicht da war.
Mein erster Gedanke ist, dass Fiona die Post reingeholt haben muss. Dann fällt mir ein, dass sie immer montags zum Putzen kommt. Heute ist Sonntag.
Wie also ist der Umschlag ins Haus gelangt?
Während ich zum Tisch gehe und den Brief in die Hand nehme, lässt ein lautes Donnergrollen die Fenster erschüttern. Ein plötzlicher Windstoß pfeift durch die Bäume draußen. Das unheimliche Gefühl verstärkt sich, als ich die Absenderadresse lese.
Washington State Penitentiary. Justizvollzugsanstalt.
Stirnrunzelnd reiße ich den Umschlag entlang der Kante auf und ziehe einen einzelnen weißen Briefbogen heraus. Ich falte ihn auf und lese laut.
»Ich werde ewig warten, wenn es sein muss.«
Das war’s. Eine einzige Zeile und darunter eine Unterschrift.
Dante.
Ich drehe das Blatt um, aber die andere Seite ist leer.
Kurz halte ich es für möglich, dass der Brief für Michael bestimmt ist. Den Gedanken verwerfe ich wieder, als ich sehe, dass er an mich adressiert ist. Mein Name steht in blauer Blockschrift vorn auf dem Umschlag. Dieser Dante, wer auch immer er ist, wollte, dass ich diesen Brief bekomme.
Aber warum?
Und worauf will er warten?
Verunsichert falte ich das Blatt wieder zusammen, stecke es zurück in den Umschlag und lasse ihn auf den Tisch fallen. Dann stelle ich sicher, dass alle Türen und Fenster verriegelt sind. Ich schließe Vorhänge und Jalousien, um den nassen grauen Nachmittag draußen zu halten, und schenke mir ein Glas Wein ein. Damit setze ich mich an den Küchentisch und starre den Umschlag an, bis mich eine seltsame Vorahnung beschleicht.
Ein deutliches Gefühl, dass etwas auf mich zukommt. Und dass es nichts Gutes ist.
Als ich mich am nächsten Tag aus dem Bett quäle, sind die Kopfschmerzen noch da, nur das beklemmende Gefühl von Angst ist verflogen. Draußen ist es grau und stürmisch, aber es regnet nicht mehr. Zumindest für den Moment. In Washington ist es das ganze Jahr über nass und bewölkt, doch der Januar ist besonders trostlos.
Ich versuche zu arbeiten, gebe aber bereits nach einer halben Stunde auf, da ich mich nicht konzentrieren kann. Was ich auch zeichne, es ist zu deprimierend. In dem Kinderbuch, das ich gerade illustriere, geht es um einen schüchternen Jungen, der sich mit einem sprechenden Kaninchen anfreundet, aber heute sieht mein Kaninchen aus, als würde es lieber eine Überdosis Paracetamol fressen als die Karotten, die ihm der Junge hinhält.
Ich stehe vom Schreibtisch auf und gehe in die Küche. Mein Blick fällt erst auf den Brief. Dann bemerke ich das Wasser auf dem Boden.
Über Nacht ist an der Zimmerdecke eine undichte Stelle entstanden. Zwei, um genau zu sein.
Ich wusste, wir hätten etwas Neueres kaufen sollen.
Doch Michael hatte kein neues Haus gewollt. Ihm war etwas Älteres mit »Charakter« lieber. Als wir vor sechs Jahren in dieses viktorianische Queen-Anne-Haus gezogen sind, waren wir frisch verheiratet und hatten mehr Energie als Geld. Wir verbrachten die Wochenenden damit, alte Teppiche rauszureißen, Löcher in der Rigipswand auszubessern und Wände zu streichen.
Etwa drei Monate lang machte es Spaß. Dann wurde es anstrengend. Am Ende wurde ein Willenskampf daraus. Wir gegen ein Haus, das auf Teufel komm raus an seinem Verfallszustand festhalten wollte, sosehr wir auch versuchten, es zu modernisieren.
Wir tauschten ein defektes Wasserrohr aus, dann ging der Durchlauferhitzer kaputt. Wir ersetzten die uralten Küchengeräte durch neue, dann entdeckten wir giftigen Schimmel im Keller. Wir drehten uns endlos im Kreis mit unseren Reparaturen und Neuanschaffungen, die an unseren Finanzen und unserer Geduld zehrten.
Dieses Jahr hatte Michael vorgehabt, das undichte Dach zu reparieren.
Manchmal frage ich mich, was wohl auf meiner To-do-Liste übrig bleiben wird, wenn ich sterbe. Aber dann zwinge ich mich, an etwas anderes zu denken, denn ich bin schon traurig genug.
Ich hole zwei Plastikeimer aus der Garage und stelle sie unter die tropfenden Stellen, dann nehme ich den Wischmopp aus dem Putzschrank. Es kostet mich fast eine Stunde, das Wasser vollständig aufzuwischen und den Boden zu trocknen. Gerade bin ich fertig, als ich höre, wie die Haustür geöffnet und wieder geschlossen wird. Ich blicke auf die Uhr an der Mikrowelle.
Zehn Uhr. Pünktlich auf die Minute.
Meine Haushälterin Fiona betritt die Küche. Als sie mich sieht, lässt sie die Plastiktüten mit Putzutensilien fallen und stößt einen markerschütternden Schrei aus.
Dass ich nicht mal erschrecke, zeugt davon, wie erschöpft ich bin.
»So schlimm sehe ich aus? Erinnere mich bitte dran, Make-up aufzulegen, bevor du nächste Woche kommst.«
Schwer atmend und kreidebleich im Gesicht stützt sie sich mit einer Hand am Türrahmen ab und bekreuzigt sich mit der anderen. »Jesses Maria und Joseph! Du hast mich vielleicht erschreckt!«
Ich runzele die Stirn. »Wen hast du erwartet? Den Weihnachtsmann?«
Anders als der Rest von Fiona ist ihr Lachen dünn und schwach. Sie ist schottischer Abstammung, mollig und attraktiv, mit strahlend blauen Augen, rosigen Wangen und kräftigen Beinen. Ihre Hände sind von der jahrelangen Arbeit als Putzfrau rau und gerötet. Sie ist über sechzig, aber so voller Energie, als wäre sie halb so alt.
Dass sie mir hilft, das Haus in Schuss zu halten, ist ein teurer Luxus, aber mit zwei Stockwerken, an die fünfhundert Quadratmeter Wohnfläche und gefühlt einer Million Ecken und Winkel, die Staub ansammeln, muss das Haus ständig geputzt werden.
Sie schüttelt den Kopf und fächelt sich Luft zu. »Puh. Du hast die alte Pumpe ganz schön zum Laufen gebracht, meine Liebe!« Sie kichert. »Das letzte Mal ist schon ein Weilchen her.« Dann wird sie ernst und mustert mich eingehend, als hätte sie mich hundert Jahre nicht gesehen. »Wie geht’s dir, Kayla?«
Ich wende den Blick ab. Es fällt mir schwer zu lügen, während ich in diese stechend blauen Augen blicke. »Mir geht’s gut. Ich versuche, mich zu beschäftigen.«
Sie zögert, als wüsste sie nicht genau, was sie sagen soll. Dann atmet sie scharf aus und macht eine hilflose Geste in Richtung Fenster und den wolkenverhangenen Puget Sound. »Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich habe es in der Zeitung gelesen. So ein Schock. Kann ich irgendwas für dich tun?«
»Nein. Aber danke dir.« Ich räuspere mich. Nicht weinen. Nicht weinen. Reiß dich zusammen. »Um die Küche brauchst du dich heute natürlich nicht zu kümmern. Ich werde jemanden suchen, der sich die Lecks anschaut. Bis dahin macht es keinen Sinn, hier sauber zu machen, wenn eh gleich wieder alles nass wird. Mein Büro muss diese Woche auch nicht geputzt werden, und …« Ich schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter. »Michaels Büro auch nicht. Ich glaube, ich lasse es erst mal so, wie es ist.«
»Verstehe«, erwidert sie leise. »Du bleibst also?«
»Ja. Ich bin den ganzen Tag hier.«
»Nein, ich meine, du bleibst in dem Haus?«
Etwas an ihrem Ton ist seltsam, als gebe es einen Subtext, den ich nicht verstehe, aber dann dämmert es mir. Sie macht sich Sorgen um ihren Job.
»Oh, ich könnte jetzt nicht verkaufen. Es ist zu früh, um so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn sich die Dinge beruhigt haben. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt denke ich gerade nur von einem Tag zum nächsten.«
Sie nickt. Einen Moment lang stehen wir uns in betretenem Schweigen gegenüber, dann deutet sie über die Schulter hinter sich. »Ich mach mich mal an die Arbeit.«
»Okay. Danke.«
Fiona hebt die Tüten vom Boden auf und wendet sich zum Gehen. Dann dreht sie sich unvermittelt noch einmal um und sagt: »Ich bete für dich, Liebes.«
Ich erwidere ihr nicht, dass sie sich den Atem sparen kann.
Ich weiß, dass ich ein verlorener Fall bin, dass kein Gebet der Welt mir helfen kann, aber deswegen muss ich ja nicht gleich unhöflich werden. Also beiße ich mir auf die Zunge, nicke und schlucke meine Tränen hinunter.
Als sie die Küche verlässt, landet mein Blick wieder bei dem Brief. Ich habe keine Ahnung, was mich dazu verleitet, aber einen Augenblick später sitze ich bereits am Tisch, um eine Antwort zu verfassen. Ich kritzele sie auf die Rückseite von Dantes Brief.
Worauf wirst du ewig warten?
Ich schicke ihn ab, bevor mich der Mut verlässt.
Es dauert ein paar Wochen, bis ich eine Antwort bekomme, und sie ist sogar noch kürzer als meine. Tatsächlich besteht sie aus nur einem Wort.
Dich.
In der rechten unteren Ecke befindet sich ein rostroter Fleck, der aussieht wie getrocknetes Blut.
2
Ich stecke den Brief ganz hinten in meine Unterwäscheschublade und bin entschlossen, ihn einfach zu vergessen. Sollte noch einer kommen, rufe ich vielleicht den freundlichen Kriminalbeamten an, der mich nach dem Unfall befragt hat, und höre mir an, was er über die Sache denkt. Vielleicht bekomme ich ihn dazu, sich diesen Dante-Typen mal genauer anzuschauen, und warte ab, was er herausfindet.
In der Zwischenzeit habe ich genug andere Baustellen, um die ich mich kümmern muss.
Außer dem Leck im Dach hat das Haus jetzt offenbar auch noch Probleme mit der Elektrik.
Der Kronleuchter im Esszimmer flackert. Wenn ich das Licht im Schlafzimmer einschalte, knistert und knackt es. Und hin und wieder läutet die Türklingel, ohne dass jemand draußen ist.
Ich habe es schon bei drei verschiedenen Dachdeckern in der Gegend probiert, aber niemand hat zurückgerufen. Jetzt warte ich auf einen Handwerker, einen Typen namens Ed. Seine Visitenkarte habe ich in der Ramschschublade im Küchenschrank gefunden, als ich nach einem Stift gekramt habe.
Keine Ahnung, warum, aber ich rechne mit einem älteren Herrn mit Glatze und Bierbauch, auf den Hüften einen Werkzeuggürtel. Als ich auf das Klopfen hin die Haustür öffne, begrüßt mich stattdessen ein schlanker junger Mann mit einem Lächeln im Gesicht und langen braunen Haaren, die von einem geflochtenen Lederband zurückgehalten werden. Er trägt ein John-Lennon-T-Shirt, ausgeblichene Jeansschlaghosen und Sandalen, in der Hand einen rostigen Werkzeugkasten aus Metall.
Er riecht nach Marihuana.
»Hey. Sind Sie Kayla?«
»Das bin ich.«
Grinsend streckt er mir die Hand hin. »Ich bin Eddie.«
Ich lächle zurück, und wir schütteln uns die Hand. Er wirkt freundlich und harmlos, zwei Eigenschaften, die ich bei Männern, die ich in mein Haus bitte, zu schätzen weiß.
»Kommen Sie rein. Ich zeige Ihnen, wo das Problem liegt.«
Er folgt mir in die Küche und erklärt, wie cool er das Haus findet.
»Cool, aber jeden Tag ein bisschen kaputter.« Ich deute auf die zwei braunen Wasserflecken an der Küchendecke.
»Ja, diese alten Häuser brauchen eine Menge Liebe und Zuwendung.« Er legt den Kopf in den Nacken, um sich die Flecken anzusehen. »Erst recht mit der Feuchtigkeit hier. Haben Sie Schimmelprobleme?«
»Nicht mehr. Darum haben wir uns schon vor einigen Jahren gekümmert. Im Moment geht es um das Leck im Dach und die Elektrik.« Ich umreiße kurz, was mit dem Licht und der Klingel los ist. »Außerdem riecht es komisch verbrannt, wenn ich den Trockner laufen lasse. Der Fernseher schaltet sich von allein aus. Und kürzlich sind auch ein paar Glühbirnen explodiert.«
Ein plötzlicher Luftzug lässt mich frösteln, sodass sich mir an den Armen und im Nacken die Härchen aufstellen. Ich schaudere und reibe mir mit den Händen über die Gänsehaut an meinen Armen.
Vielleicht sollte ich ihn bitten, die Fensterdichtungen zu überprüfen, wo er schon mal hier ist. Aber eins nach dem anderen. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo der Sicherungskasten ist.«
Eddie folgt mir in den Hauswirtschaftsraum im hinteren Teil des Hauses neben der Garage. Dort befinden sich die Waschmaschine und der Wäschetrockner sowie ein paar Schränke mit allen erdenklichen Haushaltsgegenständen.
Nachdem er die Werkzeugkiste auf dem Boden abgestellt hat, öffnet er die Metalltür des Sicherungskastens und überfliegt mit einem schnellen Blick die Schalter.
»Als Erstes überprüfe ich die Spannung und ob die Sicherungen mit der richtigen Stärke laufen. Dann sehe ich mir die Beschaffenheit der Verkabelung an. Vielleicht werden die Probleme durch Wasserschäden oder verschlissene Kabel verursacht. Und am Ende muss ich schauen, ob die Steckdosen funktionieren. Wo ist der Zähler?«
»Gleich draußen neben der Garage.«
Er nickt. »Alles klar. Den nehme ich mir auch noch vor. Das Ganze dürfte etwa eine Stunde dauern, dann werde ich eine Schätzung abgeben können, was die Reparaturkosten angeht. Passt das?«
»Das passt sehr gut, vielen Dank. Zum Dachboden geht’s oben im großen Schlafzimmer durch den Wandschrank. Die Leiter ist in der Garage.«
»Cool.«
»Rufen Sie mich einfach, wenn Sie was brauchen.«
»So machen wir’s.«
Ich überlasse ihm das Feld und gehe in mein Büro. Eine kleine Weile bin ich in der Lage zu arbeiten, dann setzen die Kopfschmerzen wieder ein: Ein dumpfes Pochen um die Schläfen herum und ein derart starker Druck hinter der Stirn, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Ich liege auf dem kleinen Sofa in dem abgedunkelten Raum, als plötzlich Eddie mit seiner Werkzeugkiste in der Tür auftaucht.
»Oh Mann, sorry. Ich wusste nicht, dass Sie schlafen. Ich wollte nur kurz die Steckdosen hier drinnen überprüfen.«
Verwirrt setze ich mich auf. »Ich habe nicht geschlafen. Nur meine Augen ausgeruht. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.«
Er nickt mitfühlend. »Ich hatte ganz schlimme Migräne.«
Hatte, Vergangenheitsform. Ich spüre einen seltsamen Hoffnungsschimmer. »Haben Sie etwas gefunden, was Ihnen geholfen hat? Bei mir hat bis jetzt nichts geholfen.«
»Sie werden lachen. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich das Licht anschalte?«
»Nur zu. Und ich werde nicht lachen, versprochen. Ich bin viel zu verzweifelt.« Als Eddie den Schalter betätigt und der Raum von Licht erfüllt wird, zucke ich zusammen. Ich versuche aufzustehen, aber mir ist zu schwindlig. Also sinke ich auf das Sofa zurück, schließe die Augen und kneife mir vorsichtig in den Nasenrücken.
Wann habe ich zuletzt etwas gegessen? Ich kann mich nicht erinnern.
Eddie schlendert umher, auf der Suche nach Steckdosen. Er ist so schlank, dass seine Schritte kaum zu hören sind. Ich habe schon Katzen gesehen, die sich lauter bewegt haben als er.
»Als ich anfing, eine Therapie zu machen, waren die Kopfschmerzen weg. Buff, Mann. Einfach weg. Hat sich herausgestellt, ich hatte einfach zu viele Gefühle angestaut.«
Ich schlage die Augen auf und sehe ihn mit einem kleinen Strommesser in der Hand auf allen vieren unter meinem Schreibtisch. Er steckt ihn in die Steckdose, hält kurz inne, während er die Anzeige abliest, dann steht er wieder auf und geht zur nächsten Steckdose, wo er den Vorgang wiederholt.
»Psychosomatisch nennt man das. Das Gehirn macht einen buchstäblich krank. Stress ist so toxisch. Irre, oder?«
»Irre«, stimme ich zu und frage mich, ob er in einer Kommune oder einem Kollektiv lebt. Solche gemeinschaftlichen Wohnformen, gegründet in den Sechzigern der freien Liebe, sind in Washington und im Großraum Seattle weitverbreitet. Leute teilen Wohnraum und Ressourcen miteinander und meiden moderne Dinge wie Mobiltelefone und gentechnisch veränderte Lebensmittel.
Ich bin ein viel zu privater Mensch, um mit Menschen, mit denen ich keinen Sex habe, auf so engem Raum zu leben, aber es liegt mir fern, jemanden wegen seiner Lebensentscheidungen zu verurteilen.
Er richtet sich auf und dreht sich zu mir um. »Ich kann Ihnen die Nummer von meinem Doc geben, wenn Sie wollen. Außer Sie meinen, dass Stress nicht Ihr Problem ist.«
»Wenn man seinen Ehemann verloren hat, zählt das als Stress?« Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Noch dazu so bissig. Normalerweise trage ich mein Herz nicht auf der Zunge, und ich bin auch nicht so sarkastisch wie Michael. Er hat auf deprimierende oder makabre Dinge oft mit schwarzem Humor reagiert, was ihm immer wieder als Gefühllosigkeit ausgelegt wurde. Ich wusste natürlich, dass es nur eine Bewältigungsstrategie war. Der Mann war ein Softie.
Eddie starrt mich verblüfft an. »Sie haben ihn verloren?«
So dumm kann man doch gar nicht sein. »Er ist gestorben.«
Jetzt wirkt er betroffen. »Oh Mann. Das tut mir so leid.«
»Danke.«
»Wie lange ist das her?«
»Silvester.«
»Ach du scheiße. Das war ja erst vor ein paar Wochen!«
Ich sollte jetzt einfach die Klappe halten. Mit jedem Wort, das ich sage, regt sich der arme Eddie noch mehr auf.
Ich hatte schon immer das Problem, dass ich mit anderen zu sehr mitfühle, was mit ein Grund dafür ist, dass ich mich eher zurückhalte. Wenn sich zusätzlich zu meinen eigenen Gefühlen noch die von anderen in mir anstauen, kann das ganz schön erdrückend sein.
»Ja. Wie auch immer.« Diesmal gelingt es mir, vom Sofa aufzustehen. Ohne Eddie anzusehen, frage ich: »Wie lautet das Urteil?«
Ich spüre seinen Blick auf mir. Wie er die Anspannung in meinem Körper und den künstlich hohen Klang meiner Stimme durchschaut. Womöglich ist er auch eher der empathische Typ, denn er hat Erbarmen mit mir und wechselt das Thema.
»Nun ja, diese undichte Stelle im Dach ist sehr ärgerlich. Sie kommt von der Dachterrasse neben dem Türmchen, das heißt, dass Sie die Schindeln abnehmen und durch das Holz sägen müssen, um das Leck zu reparieren. Mit den Giebeln, dem Türmchen und der steilen Dachneigung wird das keine leichte Aufgabe sein. Sie werden auf jeden Fall einen Fachmann brauchen.«
Mir wird flau im Magen. Sobald ein Fachmann ins Spiel kommt, wird es teuer. »Bevor ich auf Sie gestoßen bin, habe ich schon bei drei Dachdeckern angerufen, aber keiner hat sich zurückgemeldet.«
Er lacht und schüttelt den Kopf. »Ja, keine Ahnung, warum, aber diese Dachdecker-Typen haben leider den Ruf, unzuverlässig zu sein. Ich würde Ihnen gern einen empfehlen, aber ich kenne niemanden, dem ich so einen Job zutrauen würde.«
»Alles klar. Danke trotzdem. Ich versuch’s einfach weiter. Ich hatte die Hoffnung, ich könnte es vermeiden, jemanden in Seattle anzurufen, weil die noch teurer sind, aber das muss ich dann wohl.«
Nach kurzem Schweigen sagt er sanft: »Wenn Sie möchten, kann ich einen Blick auf den Kostenvoranschlag werfen, den man Ihnen macht. Sie wissen schon, damit Sie nicht über den Tisch gezogen werden.«
Weil ich allein bin, meint er. Weil ich keinen Mann habe, der für mich verhandelt.
Weil eine Frau in meiner Lage – trauernd, orientierungslos, verzweifelt – leichte Beute für Betrüger ist.
Als er lächelt, weiß ich, dass er nicht versucht, mit mir zu flirten. Er ist einfach ein netter Typ, der mir helfen will, weil er mir ansieht, dass ich nicht in der besten Verfassung bin.
Wäre die Welt doch voller solcher netten Leute.
»Das ist superlieb von Ihnen, Eddie. Aber ich komme schon klar. Ich stamme aus einer langen Reihe tougher Jersey-Girls.«
Aus seinem Lächeln wird ein Lachen. Er hat einen schiefen Schneidezahn, was ihn irgendwie sympathisch aussehen lässt. »Ich kannte auch mal so eine. Sie war kaum einen Meter fünfzig groß, aber ich hatte eine Heidenangst vor ihr.«
Ich lächle ihn an. »Auch kleine Drachen können Feuer speien.«
»Das stimmt.«
»Und wie sieht es mit der Elektrik aus? Ist es sehr schlimm?«
Er zuckt mit den Schultern. »Nein. Da ist alles in Ordnung.«
Ungläubig starre ich ihn an. »Was meinen Sie mit alles in Ordnung?«
»Ich meine, es gibt keine Probleme. Der Strom fließt gleichmäßig stark, die Sicherungen lösen nicht aus, ich kann weder Schäden in der Verkabelung finden, noch gibt es heiße Stellen, tote Steckdosen oder Wackelkontakte …« Er zuckt wieder mit den Schultern. »Da ist alles paletti.«
»Das kann nicht sein. Was ist mit dem flackernden Licht?«
»Das könnte am örtlichen Stromnetz liegen. Fragen Sie doch mal Ihre Nachbarn, ob die das gleiche Problem haben. Manche Stromleitungen hier in der Gegend sind über hundert Jahre alt. Die Ursache liegt jedenfalls nicht in diesem Haus.«
»Und die explodierenden Glühbirnen? Das ist doch auf keinen Fall normal.«
»Das kommt öfter vor, als Sie denken. Entweder hat der Hersteller den Glühfaden zu dünn gewählt, sodass er sich überhitzt hat, oder es gab einen Wackelkontakt zwischen Glühbirne und Fassung. Sie sollten ab jetzt nur noch hochwertige Leuchtmittel kaufen und sicherstellen, dass sie richtig fest eingeschraubt sind.«
Mir reißt langsam der Geduldsfaden. Hat er die Verkabelung überhaupt geprüft, oder hat er sich auf dem Dachboden nur die Birne zugeraucht?
»Okay, aber es klingelt auch an der Tür, obwohl niemand draußen steht. Und was ist mit dem Brandgeruch, wenn ich den Trockner laufen lasse? Wie erklären Sie das?«
Er zögert. Mir entgeht nicht, dass er seine Worte sorgfältig wählt.
»Ich meine … Sie waren in der letzten Zeit einem enormen Stress ausgesetzt, Mann.« Kleinlaut fügt er hinzu: »Das mit Ihrem Mann und so.«
Kurz begreife ich nicht, was er sagen will. Dann dämmert es mir, und ich muss einmal tief durchatmen, damit ich ihm nicht den Kopf abreiße. »Ich bin nicht bekloppt, Eddie, und ich leide auch nicht an Halluzinationen. Ich bilde mir die Probleme mit der Elektrik nicht ein.«
Verlegen tritt er von einem Bein aufs andere. »Ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich, als es mir nicht gut ging, Stimmen gehört und Schatten gesehen habe, die sich bewegen.«
»Ist das passiert, als Sie unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen gestanden haben?«
Seinen schmerzerfüllten Ausdruck werte ich als ein Ja.
So oder so erachte ich unsere Geschäftsbeziehung für beendet. Vielleicht kann mir ja, wer auch immer sich um mein Dach kümmert, einen Elektriker empfehlen, der nüchtern ist. »Wie auch immer, danke jedenfalls, dass Sie vorbeigekommen sind. Was schulde ich Ihnen?«
Er steckt das kleine Strommessgerät in die Gesäßtasche seiner Jeans und bückt sich nach dem Werkzeugkasten. Als er sich wieder aufgerichtet hat, schüttelt er den Kopf. »Nichts.«
»Nein, das ist nicht richtig. Sie sollten für Ihre Zeit entschädigt werden.«
Er lächelt schief. Dann wirft er sich das lange Haar über die Schulter. »Das ist sehr nett von Ihnen, aber meine Regel lautet: Wenn ich nichts finde, verlange ich auch nichts.«
Mich beschleicht der Verdacht, dass er sich diese Regel gerade ausgedacht hat, weil er Mitleid mit mir hat. »Sind Sie sicher? Ich will Sie nicht ausnutzen.«
»Nee, nee, alles gut. Aber vielleicht, wenn jemand von Ihren Freunden mal einen Handwerker braucht …«
»Werde ich Sie empfehlen. Na klar. Danke, Eddie, vielen Dank.«
Er grinst mich an und zeigt mir seinen schiefen Zahn. »Dann bin ich mal weg. Passen Sie auf sich auf, okay? Und rufen Sie mich an, wenn Sie die Nummer von meinem Doc haben wollen. Er ist wirklich der beste.«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln und lüge. »Das werde ich. Danke noch mal.«
»Machen Sie sich keine Umstände, ich finde allein raus. Man sieht sich.«
Er verschwindet. Als ich die Haustür ins Schloss fallen höre, gehe ich hin und schließe sie ab. Dann mache ich mich auf den Weg in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, und bleibe wie angewurzelt stehen, als ich den Umschlag auf dem Tisch entdecke.
Schon von Weitem erkenne ich den »LOVE«-Stempel in der Ecke und meinen Namen in blauer Blockschrift.
Der Atem bleibt mir im Hals stecken. Mein Herz pocht laut. Meine Hände zittern.
Plötzlich werden sämtliche Deckenleuchten deutlich heller.
Ein lautes Summen ist zu hören, das Licht flackert kurz, dann erlischt es komplett.
3
Liebe Kayla,
du hast mir nicht auf meinen letzten Brief geantwortet, was ich auch verstehen kann, weil du denkst, dass wir uns nicht kennen. Dass wir uns noch nie begegnet sind. Du täuschst dich. Ich könnte dich jetzt mit Details langweilen, aber vorerst vertrau mir einfach: Ich kenne dich. Und zwar in jeder Hinsicht, in der ein Mensch einen anderen kennen kann.
Ich kenne deinen Anblick, deinen Klang, deinen Geschmack und deinen Geruch.
Dein dunkelstes Dunkel und dein hellstes Licht.
Ich kenne deine schönsten und deine schlimmsten Träume, jedes Geheimnis, das du je versucht hast zu bewahren, all die namenlosen Begierden, die du nicht mal dir selbst gestehst.
Ich kenne die Gestalt deiner Seele.
Ich weiß, dass deine Hände zittern, während du diese Zeilen liest, und dass dein Herz so schnell schlägt wie die Flügel eines Kolibris. Ich weiß, dass du diesen Brief am liebsten zerreißen würdest, und ich weiß auch, dass du es nicht tun wirst.
Wie sehr ich dich berühren möchte. Deine Stimme hören. Ich kann es nicht, weil ich hier bin und du dort bist, aber die Entfernung schmälert die Sehnsucht nicht.
Ich schmecke immer noch deine Haut.
Dante
4
Ich stehe mit dem Brief in der Hand am Küchenfenster. Im grauen Nachmittagslicht lese ich ihn noch einmal. Und noch einmal. Und dann ein weiteres Mal, weil es so skurril ist und mein Verstand sich weigert, mit plausiblen Erklärungen aufzuwarten.
Wahrscheinlich, weil es keine gibt.
Flackernd erwachen die Deckenleuchten wieder zum Leben und erhellen den Raum.
Ich werfe die Hände in die Luft und rufe zur Decke: »Ich wünschte, das hättest du getan, als Mister Alles Paletti hier war!«
Dann falte ich den Brief wieder zusammen, stecke ihn in den Umschlag und lege ihn auf den Tisch. Ich schenke mir ein Glas Rotwein ein und trinke es in einem Zug aus, ehe ich den spontanen Entschluss fasse, die Sicherheit des Hauses zu überprüfen. Von Raum zu Raum gehend vergewissere ich mich, dass sämtliche Fenster und Türen fest verriegelt sind.
Als ich damit fertig bin, setze ich mich an den Küchentisch und mache eine Liste. Mit einem Stift in der Hand kann ich immer am besten denken.
Mögliche Erklärungen
• Jemand will dich verarschen
Das streiche ich sofort wieder durch, weil es offensichtlich ist, dass mich jemand verarschen will. Die Frage ist, warum? Und warum jetzt?
• Dieser Dante-Typ hat den Zeitungsartikel über den Unfall gelesen
• Er wittert Geld
• Er versucht, eine einsame Witwe auszunehmen
Kaum habe ich das niedergeschrieben, bin ich überzeugt, dass ich ins Schwarze getroffen habe.
Schließlich hockt er im Gefängnis. Um da hinzukommen, muss er etwas angestellt haben. Der Typ hat also – freundlich ausgedrückt – mindestens zweifelhafte Moralvorstellungen. Wahrscheinlich durchforstet er die Nachrufseiten sämtlicher Tageszeitungen und schickt allen neuen Witwen diese Briefe in der Hoffnung, dass eine von ihnen anbeißt und ihm zurückschreibt, damit er eine Beziehung zu ihr aufbauen und sie dazu verleiten kann, ihm große Geldsummen zu überweisen.
Aber der Brief ist zu schräg für einen derartigen Köder. Und zu konkret. Hätte er einfach geschrieben, er sei ein einsamer Mann auf der Suche nach einer Brieffreundschaft, dann vielleicht.
Aber dass er immer noch meine Haut schmeckt?
Dass er die Gestalt meiner Seele kennt?
Was soll das überhaupt heißen? Was soll jeder einzelne verdammte Satz in diesem Brief heißen?
»Nichts«, brumme ich und starre wütend auf den Umschlag. »Es ist reine Augenwischerei.«
Auf das Rätsel, wie ein Brief – schon wieder – auf meinem Küchentisch landen kann, ohne dass ich es mitbekommen habe, gehe ich absichtlich nicht ein, weil ich annehme, dass ich mich einfach nicht erinnern kann, ihn selbst mit reingebracht zu haben.
Ich tröste mich damit, dass der Brief des geheimnisvollen Dante wenigstens keine feindseligen Untertöne enthält. Zugegeben, ein bisschen unheimlich ist diese ganze »Ich kenne dich«-Geschichte schon, aber zumindest droht er mir nicht mit Gewalt.
Andererseits könnte er das vermutlich nicht. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass die Korrespondenz von Gefängnisinsassen überwacht wird. Würde er versuchen, Drohbriefe zu verschicken, würde er wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen.
Nicht dass er einen Grund hätte, mir zu drohen. Michael hatte keine Feinde, und ich habe auch keine. Als durchschnittliches verheiratetes Paar aus der Mittelschicht waren wir ständig überarbeitet und übermüdet. Unsere Vorstellung von einem tollen Freitagabend war, uns zusammen aufs Sofa zu kuscheln und einen Film anzuschauen.
Betonung auf »war«.
Wir werden das nie wieder tun.
Die plötzliche Enge in meiner Brust schnürt mir die Luft ab, und mir wird schwindlig. Ich lege den Kopf auf meinen Unterarm und lausche dem Regen, der wie Tausende von Fingernägeln gegen die Fensterscheiben trommelt.
»Ein skrupelloser Arsch von einem Verbrecher, der es auf eine wehrlose Frau abgesehen hat«, sage ich zu der Tischplatte.
Leider fühle ich mich danach kein bisschen besser. Im Gegenteil, sogar schlechter.
Was glaubt der Typ eigentlich, wer er ist, um mir so einen Schwachsinn zu schicken?
Wer auch immer er ist, er hat auf jeden Fall psychische Probleme.
Ruckartig setze ich mich auf. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist er gar nicht hinter meinem Geld her.
Vielleicht ist dieser geheimnisvolle Dante einfach verrückt.
Ich weiß nicht, welches Gefühl überwiegt: Mitleid oder Beklemmung. Wenn der arme Kerl nur eingesperrt wurde, weil er irgendeine psychische Krankheit hat, die nicht diagnostiziert wurde und eigentlich dringend behandelt werden müsste, ist das eine Sache.
Eine andere ist, dass er irgendwas getan haben muss, um im Gefängnis zu landen. Was, wenn er gewalttätig ist?
Er könnte gefährlich sein.
Ich ziehe den Brief wieder aus dem Umschlag und lese ihn noch einmal. In einer sonderbaren Anwandlung halte ich mir das Papier unter die Nase und schnuppere daran.
Ein Hauch von Zedernholz und Lagerfeuer gemischt mit dem erdigen, moschusartigen Geruch eines Manns steigt mir in die Nase.
Oder ist es der Geruch eines Tiers?
Der Gedanke beunruhigt mich. Ich falte den Brief rasch wieder zusammen und stecke ihn zurück in den Umschlag, nehme ihn mit nach oben und verstaue ihn ebenfalls hinten in meiner Unterwäscheschublade.
Als ich unten an meinem Computer sitze, suche ich nach Dachdeckern in Seattle.
Als es zwei Tage später an der Tür klingelt, bin ich gerade im Wäscheraum und falte Handtücher. Ich gehe zur Haustür und hoffe, dass diesmal auch wirklich jemand da ist, wenn ich aufmache.
Es ist jemand da.
Und dieser Jemand ist alles, was der süße, lächelnde Eddie nicht ist.
Seine Größe und Statur wirken auf mich sofort einschüchternd, ebenso seine versteinerte Miene. Er hat dunkles Haar, dunkle Augen und einen dunklen Bart, der einen breiten Kiefer verdeckt. Mit seinen ausgeblichenen Jeans, den abgetragenen Arbeitsstiefeln und dem jagdgrünen Button-down-Hemd, dessen hochgekrempelte Ärmel muskulöse tätowierte Unterarme präsentieren, sieht er aus, als käme er geradewegs aus dem Wald, wo er sich eine Hütte gebaut hat aus Bäumen, die er selbst mit einer Axt gefällt hat.
Zu meiner großen Überraschung finde ich ihn sexy.
Überraschung deshalb, weil er nicht in mein Beuteschema passt. Ich stehe eher auf den schnörkellosen Wall-Street-Typ. Einen Mann mit einem hohen Bildungsabschluss oder zwei, ausgezeichneter Hygiene und einem soliden Verständnis, wie das mit der Altersvorsorge funktioniert.
Dieser Typ aber sieht aus wie der Gründer eines Untergrund-Kampfclubs.
Er steht in der Tür und starrt mich schweigend an, also frage ich: »Kann ich Ihnen helfen?«
»Aidan.«
Als klar wird, dass da nicht mehr kommt, nehme ich an, er ist auf der Suche nach einem Aidan, von dem er denkt, dass er in meinem Haus wohnt.
»Tut mir leid, aber hier gibt es keinen Aidan.«
Kurz zeigt sich ein Ausdruck der Verachtung auf seinem versteinerten Gesicht. »Ich bin Aidan. Von Dachbau Seattle.« Er zeigt mit dem Daumen über die Schulter hinter sich, wo ein weißer Pick-up mit der roten Firmenaufschrift in der Auffahrt steht.
Peinlich berührt lache ich auf. »Oh! Sorry, ich dachte, Sie kommen erst nächste Woche.«
»Hatte eine Lücke im Terminplan«, erwidert er ohne die geringste Spur von Wärme. »Dachte, ich komme einfach mal vorbei. Wenn es gerade nicht passt –«
»Nein, nein, das passt hervorragend«, unterbreche ich ihn und öffne die Tür weit. »Bitte, kommen Sie rein.«
Er tritt über die Schwelle. Sofort fühlt sich der Eingangsbereich kleiner an. Ich schließe die Tür hinter ihm und bedeute ihm, mir zu folgen.
»Ich zeige Ihnen die undichten Stellen, wenn Sie da anfangen möchten?«
Er nickt wortlos.
Auf dem Weg in die Küche komme ich mir vor, als hätte ich einen tollwütigen Wolf im Nacken. Nein, keinen Wolf. Etwas Größeres, noch Gefährlicheres. Einen Gorilla vielleicht. Oder einen Löwen.
»Also, hier tropft das Wasser runter«, sage ich und zeige zur Decke. »Ich hatte schon einen Handwerker da, der sich die Elektrik angeschaut hat. Er hat auch einen Blick aufs Dach geworfen und gemeint, dass ein Teil der Dachterrasse beim Türmchen ersetzt werden muss.«
Aidan sieht nicht nach oben. Sein starrer, kühler Blick ist weiterhin auf mich gerichtet.
»Konnte er die Probleme beheben?«
»Nein. Nicht wirklich.«
»Was denn nun? Nein oder nicht wirklich?« Er lächelt nicht, als er das sagt. In seinem Ton und in seinem Ausdruck ist nicht das geringste Anzeichen von Humor zu erkennen.
Er ist nicht direkt feindselig, aber ich habe den Eindruck, er wäre gerade überall lieber als hier.
Ich brauche einen Moment, um die richtigen Worte zu finden, denn ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich diesen Typen überhaupt in meinem Haus haben will. Mir wird mit jeder Sekunde, die er hier ist, unwohler.
»Der Handwerker meinte, mit der Verkabelung wäre alles in Ordnung, aber die Probleme sind immer noch da.«
Aidan brummt in seinen Bart. »Ich schau’s mir an.«
»Sie machen auch die Elektrik?«
»Ich mache alles.« Er sagt das so kategorisch, als hätte ich ihn in seiner Männlichkeit verletzt. Als könnte er nicht fassen, dass ich ihm seine Fähigkeiten als Alleskönner nicht ansehe.
Ich wünschte, außer mir wäre noch jemand hier. Dann könnte ich eine vernünftige Person fragen, was eigentlich Aidans Problem ist, aber da ich allein bin, muss ich es wohl selbst herausfinden.
»Wenn Sie alles können, warum tun Sie dann nicht wenigstens so, als wären Sie ein freundlicher Mensch? Das könnte in manchen Situationen hilfreich sein. Zum Beispiel jetzt gerade.«
Seine Brauen ziehen sich zusammen. »Soll ich Ihr Haus reparieren, Fräulein, oder wollen Sie einen Kaffee mit mir trinken?«
Sein unhöflicher Ton geht mir ganz schön auf den Zeiger. »Mit wilden Tieren trinke ich keinen Kaffee. Und ja, ich würde mir wünschen, dass mein Haus repariert wird, aber ich bezahle niemanden dafür, dass er mich beleidigt. Mein Name lautet Kayla. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Frauen sind auch Individuen. Also, werden Sie sich jetzt wie ein normaler Mensch verhalten, oder möchten Sie lieber wieder gehen?«
Er verkneift sich die nächste Beleidigung, die ihm offensichtlich auf der Zunge liegt, und starrt mich böse an. Dann blickt er hinauf zur Decke und atmet langsam aus.
»Sorry«, sagt er mit rauer Stimme. »Die letzten Wochen sind ziemlich hart gewesen.«
Als er schluckt und sich ein Muskel in seinem Kiefer zusammenzieht, fühle ich mich plötzlich schlecht.
Wenn man so tief in seinen eigenen Problemen steckt, vergisst man leicht, dass andere Menschen auch welche haben.
Leise erwidere ich: »Ja, das verstehe ich.«
Er wirft mir einen Blick zu. Vorsichtig, als wäre er sich nicht sicher, ob ich ihm gleich eine Ohrfeige verpasse, weshalb ich mich noch schlechter fühle.
»Wissen Sie, was, wir fangen einfach noch mal von vorn an.« Ich strecke ihm die Hand hin. »Hi. Ich bin Kayla Reece.«
Er blickt herunter auf meine Hand. Etwas, was der Beginn eines Lächelns sein könnte, spielt um seine Mundwinkel, verschwindet aber, noch bevor es sich manifestieren kann. Er nimmt meine Hand und schüttelt sie. »Schön, Sie kennenzulernen, Kayla. Aidan Leighrite.«
Seine Hand ist riesig, rau und warm. Wie der Rest von ihm, abgesehen von der Wärme.
Ich lächle und lasse seine Hand wieder los. »Okay. Da wir das nun geklärt hätten, könnten Sie mir bitte mit meinem Dach helfen? Ich bin wirklich verzweifelt.«
Er neigt den Kopf zur Seite und mustert mich neugierig. »Kommen Sie immer so schnell über alles hinweg?«
Das Bild von Michaels Sarg, der langsam in das Erdloch hinabgelassen wird, schießt mir durch den Kopf. Mein Lächeln erlischt. In meinem Hals bildet sich ein Kloß. »Nein«, antworte ich knapp.
Aidan starrt mich weiter an. Ich kann seinem durchdringenden Blick nicht standhalten, und plötzlich will ich allein sein. Heiße Tränen steigen mir in die Augen.
Ich weiche einen Schritt zurück und verschränke die Arme vor der Brust. »Der Zugang zum Dach ist oben im großen Schlafzimmer im Wandschrank. Die Treppe rauf, dann die erste Tür rechts. Schauen Sie sich gern um. Bitte entschuldigen Sie mich.« Ich drehe mich um und lasse ihn in der Küche stehen.
Gerade noch schaffe ich es in mein Büro und ziehe die Tür hinter mir zu, bevor ich in Tränen ausbreche.
5
Sehr geehrter Dante,
ich habe kein Geld, also suchen Sie sich lieber jemand anderen, wenn das Ihr Motiv ist. Im Ernst, ich bin pleite.
Wer sind Sie? Was wollen Sie? Warum schreiben Sie mir? Sie behaupten, dass Sie mich kennen, aber Sie irren sich. Ich kenne niemanden mit Ihrem Namen, und erst recht niemanden im Gefängnis.
Ich verurteile Sie nicht, nur damit Sie das wissen. Aber ich wüsste schon gern, was Sie getan haben, um hinter Gittern zu landen.
Ach was, vergessen Sie es. Ich schreibe Ihnen nur, um Sie zu bitten, mir keine weiteren Briefe zu schicken. Den nächsten Brief, den ich von Ihnen bekomme, werde ich an einen befreundeten Kriminalbeamten weiterreichen, der sich dann um die Sache kümmert.
Mit freundlichen Grüßen
Kayla
6
Ich brauche eine Weile, um mich zu sammeln. Im Badezimmer spritze ich mir Wasser ins Gesicht und trockne mir die Augen. Dann stecke ich den Brief in den Umschlag, verschließe ihn und klebe eine Marke darauf, ehe ich ihn nach draußen zum Postkasten bringe.
Als ich in die Küche zurückkehre, ist Aidan nirgends zu sehen. Ich gehe in den Wäscheraum und falte die restlichen Handtücher, danach leere ich in der Küche die Plastikeimer in die Spüle und stelle sie wieder unter die tropfenden Stellen. Anschließend starre ich einmal mehr in den offenen Kühlschrank auf der Suche nach etwas, das ich auch diesmal nicht essen werde, weil ich keinen Appetit habe.
Der ist – wie alles andere – mit meinem Mann gestorben.
Ich mache den Kühlschrank wieder zu und lehne meine Stirn dagegen, schließe seufzend die Augen.
Genau in dem Moment kommt Aidan in die Küche.
»Alles in Ordnung?«
Ich drehe mich um und sehe ihn in der Küchentür stehen. Er mustert mich besorgt oder vielleicht auch alarmiert, es ist schwer zu sagen.
»Ernsthaft? Ich glaube, bei mir war noch nie weniger nicht in Ordnung.« Ich runzele die Stirn. »War das jetzt doppelte Verneinung?«
»Egal. Ich hab’s verstanden. Es geht Ihnen nicht gut.«
Wenn er so ist wie die meisten Männer, die ich kenne, würde er sich lieber den Arm abbeißen, als die Details zu hören, also wechsle ich das Thema. »Es wird mir gleich besser gehen, wenn Sie mir sagen, dass Sie mein Dach reparieren können.«
»Ich kann Ihr Dach reparieren.«
»Oh, wirklich?«
Er setzt eine säuerliche Miene auf. Wahrscheinlich habe ich schon wieder seine Männlichkeit verletzt.
»Tut mir leid, ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Glück, aber ich bin froh über die gute Nachricht.«
Er mustert mich prüfend. »Sie sehen nicht sonderlich froh aus.«
»Bin ich auch nicht. Das war nur eine Floskel.«
Schweigend starren wir einander an. Schließlich sagt er: »Sie werden noch viel weniger froh sein, wenn ich Ihnen sage, welche Kosten auf Sie zukommen.«
»Sollte ich mich lieber hinsetzen?«
»Keine Ahnung. Fallen Sie leicht in Ohnmacht?«
Ich runzele die Augenbrauen. »Fast hätte ich gefragt, ob Sie Witze machen, aber Humor ist wohl nicht so Ihr Ding.«
»Sie kennen mich schlecht. Es könnte auch lustig gemeint sein.«
Wieder starren wir einander ausdruckslos an. Das Totenkopf-Tattoo auf seinem Hals scheint höhnisch zu grinsen.
»Ist es denn lustig gemeint?«, frage ich.
»Nein«, lautet die prompte Antwort.
Ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen. »Perfekt. Ich bin also nicht froh, und Sie sind nicht lustig. Dieses Projekt dürfte richtig super werden.«
»Außer dass ich Sie gerade zum Lachen gebracht habe. Vielleicht bin ich also doch lustig, und Sie sind fröhlicher, als Sie glauben.«
Als ich ihn nur wortlos anstarre, sagt er: »Zumindest waren Sie es gerade kurz.«
Ist das schräg? Ich kann nicht sagen, ob es schräg ist oder nicht. Plötzlich fühle ich mich unbehaglich und unsicher. Ich räuspere mich. »Na dann. Danke dafür.«
»Keine Ursache. Mit zehntausend müssen Sie rechnen.«
Der Themenwechsel kommt so unerwartet, dass mein armes Gehirn einen Moment braucht, um zu kapieren, dass er über den Preis redet, den er für die Dachsanierung verlangen wird. »Zehn…tausend?«
»Jepp.«
»Dollar?«
»Nein, Muscheln. Natürlich Dollar.«
Ich ziehe eine Grimasse. »Und Sie behaupten, Sie machen keine Witze.«
»Ich werde Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.« Ohne ein weiteres Wort dreht er sich um und verlässt das Haus.
Ich habe keine Ahnung, ob sein Besuch damit beendet ist und er mir den Kostenvoranschlag per E-Mail schickt. Doch dann kommt er, ohne anzuklopfen, wieder herein, setzt sich mit einem Schreibblock an meinen Küchentisch und kritzelt darauf herum.
Aidan ist so groß, dass mein Tisch und meine Stühle aussehen wie Kindergartenmöbel.
Als er mir den Zettel hinhält, werfe ich einen Blick darauf. »Achttausend für die Arbeit und nur zweitausend für Material?«
Er lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor seiner Brust. »Wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen das ganze Material, und Sie machen die Arbeit selbst.«
Schlauberger. »Ich möchte einfach einen fairen Preis.«
»Das ist ein fairer Preis.«
»Wie kann Ihre Arbeitszeit so teuer sein?«
»Sind Sie eine Expertin für Baupreise?«
»Nein, aber ich habe ein gutes Auge für Bullshit.« Mit einer schnellen Handbewegung zerreiße ich den Zettel. »Und das hier ist Bullshit.«
Er schielt auf meinen Ehering. »Fragen Sie Ihren Mann, wenn Sie mir nicht glauben. Es ist ein fairer Preis.«
Eine plötzliche Hitze steigt mir in den Nacken. Mein Herz fängt an, wie wild zu pochen. Dennoch halte ich seinem Blick stand und erkläre mit fester Stimme: »Ich bin in der Lage, mir selbst ein Urteil zu bilden.«
Er verengt die Augen. Aber nicht, weil er wütend ist, sondern weil er versucht, mich zu durchschauen.
Dann flackert das Licht in der Küche und erinnert mich daran, dass dieser rüpelhafte Kerl abgesehen von Eddie, dem kiffenden Hippie, der Einzige ist, der mich zurückgerufen hat, und ich ihn vielleicht nicht sofort aus dem Haus jagen sollte.
Ich ziehe mir einen Stuhl heran und setze mich ihm gegenüber. »Ich habe keine zehntausend Dollar.«
Er sagt nichts. Starrt mich einfach nur an.
Oh, wie gern würde ich jetzt seinen Kostenvoranschlag nehmen und ihm mit den Papierkanten die kompletten Arme aufritzen. Nicht dass man die Schnitte durch die vielen Tattoos überhaupt sehen würde, aber egal. Es wäre trotzdem ein befriedigendes Gefühl.
»Ich lüge Sie nicht an, Mr. Leighrite. Ich habe keine zehntausend Dollar.«
»Ich heiße Aidan. Und wie können Sie in einem so großen Haus leben, wenn Sie kein Geld haben?«
»Das ist eine sehr persönliche Frage, die ich nicht beantworten werde. Und ich habe auch nicht gesagt, dass ich kein Geld habe. Ich habe gesagt, dass ich keine zehntausend Dollar habe.«
Er beugt sich vor, stützt die riesigen tätowierten Unterarme auf dem Tisch auf und verschränkt die Hände. »Das heißt also, wir verhandeln.«
Seine Intensität ist beeindruckend, aber er soll nicht glauben, dass er mich einschüchtern kann. Ich richte mich in meinem Stuhl auf und recke das Kinn. »Sie sagen das, als wäre Verhandeln Ihre Lieblingsbeschäftigung.«
»Ist es.«
»Hm. Ich hätte eher darauf getippt, potenzielle Kunden mit Ihrem unwiderstehlichen Sinn für Humor zu begeistern.«
»Nein. Das kommt an zweiter Stelle.«
Einmal mehr starren wir einander an. Auch diesmal ohne den geringsten Anflug eines Lächelns.
Schließlich sage ich: »Viertausend.«
Sein Schnauben verrät, was er von meinem Eröffnungsangebot hält.
»Ist immerhin das Doppelte Ihrer Materialkosten.«
»Danke, ich beherrsche die Grundrechenarten. Zehntausend.«
»Ich dachte, wir verhandeln.«
»Tun wir.«
»Dann können Sie nicht immer wieder die gleiche Summe nennen.«
»Sagt wer?«
»Sage ich!«
»Zu meinem Glück sind Sie nicht diejenige, die hier die Oberhand hat.«
Mit offenem Mund starre ich ihn entrüstet an. Dann passiert etwas Seltsames: Er lächelt.
»Ich wollte nur schauen, wie Sie reagieren, wenn ich das sage.«
Am liebsten würde ich ihn jetzt mit meinem Auto überfahren. Entschlossen antworte ich: »Viertausendfünfhundert.«
»Neuntausendneunhundertneunundneunzig.«
»Wollen Sie mich verarschen?«
»Wir haben doch bereits festgestellt, dass ich keinen Sinn für Humor habe.«
»Wenn Sie jetzt in Ein-Dollar-Schritten mit dem Preis runtergehen, sitzen wir nächstes Jahr noch hier.«
Er sieht mich gleichmütig an, seine Stimme ist kühl. »Müssen Sie denn irgendwohin, Kayla?«
Will er mich verarschen? Was genau passiert hier gerade?
Ein Donnergrollen lässt die Küchenfenster in ihren Rahmen erzittern. Der Regen nimmt zu und prasselt laut auf das Dach. Das Tröpfeln von der Decke wird schneller, das leise Pling Pling Pling scheint mich zu verhöhnen.
So wie Mister Stimmungskanone hier.
»Ich kann mir zehntausend Dollar für eine Dachreparatur nicht leisten. Und neuntausendneunhundertneunundneunzig auch nicht. Aber danke für Ihre Zeit.« Ich lasse den zerrissenen Kostenvoranschlag auf den Tisch fallen, stehe auf und schaue den Mann in meiner Küche von oben herab an. »Danke, dass Sie hergekommen sind.«
Er sieht zu mir hoch. Seine dunklen Augen wirken berechnend. »Und wenn ich Ihnen die Elektrik dafür noch mitmache?«
»Das ist sehr großzügig, aber deswegen habe ich nicht plötzlich mehr Geld auf dem Bankkonto. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben. Ich begleite Sie noch zur Tür.« Ich wende mich zum Gehen und rechne damit, dass er ebenfalls aufsteht und mir folgt. Als er es nicht tut, bleibe ich stehen und drehe mich um.
Er sitzt immer noch an meinem Küchentisch. Dabei schaut er nicht mal zu mir, sondern beobachtet das Wasser, das von der Decke in die Eimer tropft.
»Mr. Leighrite.«
Ohne den Kopf zu drehen, sagt er: »Aidan. Und wenn Sie sich fünftausend leisten können, wüsste ich jemanden, der Ihnen helfen kann.«
Ich denke darüber nach. »Hat dieser Jemand eine Lizenz?«
Kaum merklich bewegt er den Kopf, ein kurzes Schütteln, wohl um seinem Erstaunen über meine Dummheit Ausdruck zu verleihen.
Verärgert füge ich hinzu: »Ich lasse niemanden auf meinem Grundstück arbeiten, der keine Lizenz hat und nicht versichert ist. Die Gründe dafür muss ich Ihnen wohl kaum nennen.«
Seine Schultern heben und senken sich, als er ein- und ausatmet. Mit einer Hand fährt er sich durch das dichte dunkle Haar. Dann schüttelt er noch einmal den Kopf und steht auf. Er kommt zu mir rüber und starrt mich von oben herab an. »Dieser Jemand bin ich. Ich fange gleich morgen früh an. Bar oder Scheck, keine Kreditkarten.« Dann schiebt er sich an mir vorbei und verlässt, ohne mein Einverständnis abzuwarten, das Haus.
Er weiß, dass ich einverstanden bin, ich habe keine andere Wahl.
Das Arschloch hat mich gerade mattgesetzt.
7
Pünktlich um acht am nächsten Morgen klopft Mister Stimmungskanone an meine Tür.
Oder, besser gesagt, er hämmert mit aller Kraft dagegen. Als wäre er der Leiter eines Sondereinsatzkommandos mit dem Auftrag, eine Gruppe durchgeknallter Geiselnehmer auszuschalten, um das Leben Hunderter Menschen zu retten.