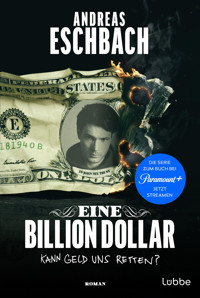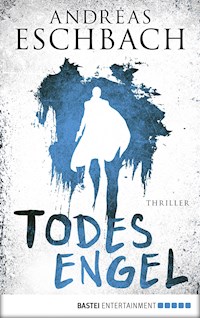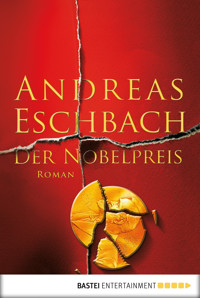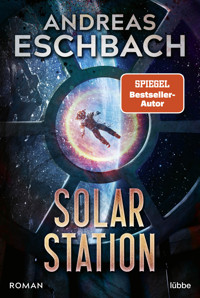
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2015: Hauchdünn und kostbar sind die Sonnensegel der japanischen Solarstation NIPPON. Von ihnen aus wird die Erde mit Energie versorgt.
Als die Energieübertragung versagt, denken Leonard Carr und die Mannschaft der Station zuerst an eine technische Panne. Doch dann geschieht ein Mord, und ein fremdes Raumschiff dockt widerrechtlich an. Entsetzt erkennt die Besatzung, daß sie Spielball in einem Plan ist, der die Station zu einer nie dagewesenen Bedrohung für die Erde werden läßt. Leonard hat nur eine Chance gegen die kalte Präzision, mit der seine Widersacher vorgehen: Er kennt alle Geheimnisse der Solarstation und weiß beim Kampf, die Gesetze der Schwerelosigkeit für sich zu nutzen ...
Der erste Thriller des neuen Jahrtausends. Eine Art Stirb langsam im Weltraum von einem der begabtesten deutschen SF-Autoren der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Über den Autor
Andreas Eschbach, 1959 in Ulm geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hochbegabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman DIE HAARTEPPICHKNÜPFER. Bekannt wurde er durch den Thriller DAS JESUS-VIDEO. Mit EINE BILLION DOLLAR (2001) stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Autoren auf. Es folgten u.a. Bestseller wie AUSGEBRANNT (2007), HERR ALLER DINGE (2010) und TODESENGEL (2013). Andreas Eschbach lebt heute als freier Schriftsteller in der Bretagne.
Andreas Eschbach
SOLARSTATION
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
© für die deutschsprachige Ausgabe 1999 by
Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Lektorat: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von © designprojects/adobestock.com; opic/adobestock.com; grandeduc/adobestock.com; Mari Dein/adobestock.com; ArtPerfect/adobestock.com; korkeng/adobestock.com; Klavdiya Krinichnaya/shutterstock.com
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-4641-8
luebbe.de
lesejury.de
PROLOG
Niemand hatte je ernsthaft die Frage gestellt, wozu sie eigentlich hier waren, und niemand hätte diese Frage ernsthaft beantworten können. Sie hatten dieses kleine Stück Dschungel zu bewachen – das wurde von ihnen erwartet. Es wurde nicht von ihnen erwartet, Fragen zu stellen.
Der Fremdenlegionär lehnte an einem der modrigen Pfosten des Holzgerüstes, das, nur mit einem Stück rostigen Wellblechs gedeckt, als Unterstand diente, und rauchte eine schlecht gedrehte Zigarette aus schlechtem guayanischem Tabak. Seine Kameraden nannten ihn Jean, aber das war natürlich nicht sein richtiger Name. Er warf einen abfälligen Blick auf den anderen Soldaten, der mit halb offenem Mund in einer der Hängematten lag und schnarchte. Zu viel Schnaps, zu lange bei den Mädchen herumgehangen auf dem Strich von Alt-Kourou. Und so verpasste er den frühen Morgen, die beste Zeit des Tages. Die Luft war kühl und angenehm, das Licht klar und von einer geradezu tröstlichen Reinheit. Später am Tag, wenn die unerträgliche äquatoriale Hitze wieder auf allem lastete und man vor Insekten fast wahnsinnig wurde, würde er an diese Stunde zurückdenken und alles besser ertragen. Auch die stumpfsinnige Langeweile des Wartens auf den nächsten Raketenstart, irgendwann.
Über den buschigen Wipfeln der Urwaldbäume, von denen die Feuchtigkeit der Nacht empordampfte, erhob sich die kolossale Raketenabschussrampe wie der missglückte Turm einer modernen Kirche. Vom Meer her wehte eine frische, salzig riechende Brise.
Sie brachte ein Geräusch mit sich, das fremd durch das morgendliche Zirpen der Zikaden und das Zetern aufgeregter fremder Dschungelvögel drang. Der Fremdenlegionär, der sich Jean nannte, horchte auf. Er überlegte eine Weile, aber das Geräusch wollte sich nicht einordnen lassen. Er knurrte unwillig, warf die Zigarette weg und griff nach seiner Maschinenpistole. Wahrscheinlich wieder ein paar Kreolen, die nicht kapieren wollten, dass sie an diesem Teil des Strandes nichts zu suchen hatten. Er musste sie vertreiben, denn weiter hinten bei der alten Generatorstation schob André Wache, und das war ein scharfer Bursche. Wenn der sie erwischte, würde es Ärger geben.
Er verzichtete darauf, seinen Kameraden zu wecken. Der würde ohnehin keine große Hilfe sein, in seinem Zustand. Und es sollte nicht allzu lange dauern, bis er zurück war.
Er folgte einem schmalen Trampelpfad durch das Unterholz. Unter seinen derben Kampfstiefeln brachen trockene Zweige, und allerlei krabbeliges Kleingetier wuselte davon. Es war noch nicht hell genug, um Einzelheiten zu erkennen, und er legte auch keinen besonderen Wert darauf.
Da war es wieder, das Geräusch. Jean blieb stehen und lauschte. Ein eigenartiges, schabendes Geräusch und Schritte auf Sand.
Manchmal nahmen einige der Soldaten, die keine Wache hatten, Mädchen mit zum Strand. Aber in der Regel waren sie alle am Morgen wieder fort. Jean schob unwillkürlich den rechten Zeigefinger unter den Abzugsbügel seiner Waffe, während er sich mit der linken Hand den Weg bahnte.
Dann stand er am Strand, und sein Blick saugte sich sofort an den großen schwarzen Schlauchbooten fest, die an der Küste gelandet waren, und an den schwarzgekleideten Männern, die ihnen entstiegen. Sie trugen Waffen und schleppten Kisten, die wie Munitionskisten aussahen. Und draußen auf dem Meer ragte der schwarze Turm eines Unterseebootes aus den träge glitzernden Wellen …
Ein Überfall. Er musste Alarm schlagen, sofort. Jean drehte sich um.
Doch da stand ein schwarz gekleideter Mann auf dem Pfad, den er gekommen war, das Gesicht vermummt, und Jean sah nur seine Augen, stahlharte, erbarmungslose Augen. Noch ehe der Fremdenlegionär eine Bewegung machen konnte, wirbelte eine gleißende Klinge in der Hand des anderen. Ein greller, betäubender Schmerz durchbohrte die Kehle des Mannes, den seine Kameraden Jean genannt hatten, ein unglaublicher Schmerz, ein Schmerz wie das Aufflammen eines Blitzlichts. Jean sah an sich herab, an seiner zerknautschten, khakifarbenen Uniform, doch da war kein Khaki mehr, da war nur noch Blut, Blut, Blut.
KAPITEL 1
Sex im Weltraum ist nach wie vor eine der exklusivsten Erfahrungen unserer Zeit. Und eine der überwältigendsten dazu. Es sind bestimmt Jahrtausende vergangen seit der letzten wirklichen Neuerung auf sexuellem Gebiet: ein Orgasmus im Zustand der Schwerelosigkeit ist unter Garantie eine, und er ist mit nichts zu vergleichen, was immer man auch je zuvor erlebt hat. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für einen Menschen, sozusagen.
Die Frau, die diese Erfahrung von Zeit zu Zeit mit mir zu teilen bereit war, hieß Yoshiko und war eine zierliche, hübsche Japanerin mit langem schwarzem Haar und einer schlanken, knabenhaften Figur. Die japanische Raumfahrtbehörde stellte grundsätzlich keine Frauen mit großen Brüsten für den Einsatz auf der Raumstation ab, da man – nicht zu Unrecht – befürchtete, die Kombination von großen Brüsten und Schwerelosigkeit könnte zu einer gefährlichen Beeinträchtigung des Denkvermögens der männlichen Besatzung führen.
Auch in anderer Hinsicht muss man beim Miteinander von Mann und Frau unter Bedingungen der Mikrogravitation, wie die Schwerelosigkeit fachmännisch genannt wird, umdenken. Komplett vergessen muss man zum Beispiel alle heftigen Bewegungen beim Geschlechtsverkehr. Selbst wenn man es vermeiden kann, unsanft gegen irgendwelche spitzen, harten oder empfindlichen Einrichtungsgegenstände zu prallen, besteht für den Mann ernsthafte Verletzungsgefahr: Bei einer unbedachten Bewegung der Frau kann er sich buchstäblich den Penis brechen.
Aber wahre Leidenschaft lässt sich durch Gefahr nicht einschüchtern. Wir hatten uns in den Versorgungsraum zurückgezogen, einen kleinen Raum in der Nähe der Unterkünfte, in dem Kleidung, Wäsche und Handtücher und dergleichen gelagert wurden und dessen Wände demzufolge gut gepolstert waren, hatten die Türe hinter uns verriegelt, die Heizung aufgedreht und das Licht ausgeschaltet, sodass nur noch zwei winzige rote Kontrolllampen übrig blieben, die unser Treiben in schummriges Halbdunkel hüllten.
Ich habe mich immer gefragt, was für geheime Geschichten sich früher an Bord der Spaceshuttles abgespielt haben mochten, als zum ersten Mal weibliche Astronauten mit an Bord gingen. Ich fürchte nur, gar keine. Alle Astronauten waren immer glücklich verheiratet, und wenn sie nur halb so spießig waren, wie sie im Fernsehen gewirkt hatten, dann haben sie sich an Bord benommen wie die braven Pfadfinder.
Nun ja, das war inzwischen auch schon Geschichte. Die Jungs hatten jedenfalls ihre Chance gehabt. Heute hockten sie in Ehren ergraut mit ihren Ehefrauen zu Hause und verzehrten ihr Altenteil, während ich vierhundert Kilometer über ihren Köpfen die Erde umkreiste, verschlungen und verschmolzen mit diesem zarten, atemberaubenden Geschöpf. Und natürlich verschwendete ich in Wirklichkeit keinen Gedanken an die Raumfahrtgeschichte des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts. Um ehrlich zu sein, in meinem Hirn wäre kein einziger Gedanke, woran auch immer, zu finden gewesen. Wir schwebten nur keuchend und stöhnend in der samtroten Dämmerung, die uns umgab, uns unendlich sacht und behutsam bewegend, unsere Arme und Beine einander umwindend wie taumelnde Schlangen, und wir waren so groß wie das Universum. Wir hatten jedes Zeitgefühl verloren, jedes Gefühl für eine Trennung zwischen uns, es war uns, als hätten wir den Kosmos bereits erobert und uns einverleibt.
Yoshiko, bebend und schweißnass in meinen Armen, zwitscherte unentwegt in mein Ohr, während sie ihre langen Nägel in meinen Rücken grub, wisperte und hauchte in einem fort japanische Worte, von denen ich die meisten nicht verstand. Während ich nur grunzte und stöhnte, kam es aus ihr heraus wie ein Wasserfall. Immer wieder, wenn krampfhafte Zuckungen ihren biegsamen Körper erschütterten, keuchte sie etwas vom Sterben und von unerträglich süßen Schmerzen und solches Zeug.
Was Sex anbelangt, trennen die Japaner und uns Westler Welten. Wir Westler sind durch zweitausend Jahre Christentum verkrüppelt, und inzwischen wissen wir das. Die Japaner glauben nicht an das Christentum, und an Sigmund Freud auch nicht, und auf den ersten Blick wirkt es so, als hätten sie mit Sex beneidenswert wenig Probleme. Aber irgendwo haben sie auch ihren Schuss weg: Wenn es ihnen richtig gut kommt, wollen sie immer gleich sterben.
Irgendwann, nach Stunden, wie es schien, in denen wir auf einer einzigen, endlosen Welle von Höhepunkten geritten waren, schlichen sich Raum und Zeit wieder in unsere Wahrnehmung ein, kehrte das Bewusstsein für die normale, gewohnte Welt zurück wie ein ärgerlicher Störenfried und verscheuchte die Ekstase. Die Atmung normalisierte sich wieder, der Herzschlag beruhigte sich, und ich nahm uns wieder als zwei voneinander getrennte menschliche Wesen wahr, die einander eng umschlungen hielten. Ich roch Yoshikos Schweiß, ihren Körperduft, bohrte meine Nase liebkosend in ihr Haar und hätte sie noch ewig so halten können. Sie aber küsste mich sanft und entwand dann einen ihrer Arme den meinen, griff hinter sich und knipste das Licht wieder an. Wahrend ich noch blinzelnd versuchte, mich an die Helligkeit zu gewöhnen, hatte sie schon ihre Armbanduhr aus ihrem Kleiderbündel gefischt und die Zeit abgelesen.
»Es wird Zeit, Leonard-san«, sagte sie sanft.
Seufzend glitt ich aus ihr heraus und gab sie frei. Es wäre eine Illusion gewesen zu glauben, dass sie mich etwa liebte. Ich wusste, dass sie das nicht tat. Yoshiko war eine junge, intellektuelle Japanerin, eine echte Tochter des neuen Jahrtausends, wahnsinnig intelligent, wahnsinnig ehrgeizig und mit ihren sechsundzwanzig Jahren bereits eine der führenden Astronominnen des Landes, wenn nicht der ganzen Welt. Für eine Frau wie sie war es chic, sich eine Affäre mit einem gaijin zu gönnen, und wenn sie etwas an mir mochte, dann war es meine westliche Grobheit und Ungeschlachtheit, die sicherlich einen erfrischenden Kontrast darstellte zur allgegenwärtigen japanischen Höflichkeit. Und vielleicht auch meine im Vergleich zu japanischen Männern stärker ausgeprägte physische Ausstattung.
Obwohl ich das alles wusste und obwohl ich sie inzwischen schon eine ganze Weile kannte, war es immer wieder ernüchternd zu erleben, wie rasch und problemlos sie aus der Welt der Ekstase in die Welt des Alltags zurückkehrte. Während in mir noch alles bebte und vibrierte und ich verträumt und bedauernd zusah, wie sie ihren begehrenswerten Körper nach und nach wieder in den schmucklosen Bordoverall hüllte, schien sie in Gedanken schon ganz woanders zu sein, an der Schalttafel ihres Radioteleskops vielleicht oder mit irgendwelchen Überlegungen zu bahnbrechenden kosmologischen Theorien beschäftigt.
»Wir sollten nicht zu spät kommen, Leonard-san«, mahnte sie sanft. »Der Kommandant ist sehr beunruhigt wegen der vielen Pannen bei der Energieübertragung in letzter Zeit.«
Das war ein zarter Hinweis, nicht länger nackt durch die Gegend zu schweben, sondern mich ebenfalls wieder anzuziehen. Ich beeilte mich. Yoshiko regelte unterdessen die Heizung herunter, fing dann ihre langen Haare ein und bändigte sie wieder mit einem Haargummi.
Natürlich wusste jeder an Bord Bescheid über unsere Schäferstündchen. Trotzdem hatte es etwas Verschwörerisches an sich, wie wir die Tür des Kleiderlagers öffneten und uns umsahen. Und während wir den Gang entlang paddelten, blieb ich etwas zurück, um ihr bewundernd zuzusehen. Es würde wieder einige Tage dauern, bis ich aufhören konnte zu bedauern, dass ich ihr im Grunde nichts bedeutete.
Ich verliebe mich immer in die Frauen, mit denen ich schlafe. In dieser Reihenfolge. Wahrscheinlich ist genau das mein Problem.
KAPITEL 2
Die Anspannung auf der Brücke war mit Händen zu greifen, als wir dort ankamen. Die Blicke, die uns trafen, waren nicht einmal wissend oder anzüglich wie sonst, sondern nur ungeduldig. Der Kommandant sah nur demonstrativ auf die so genannte Missionsuhr, deren große rote Ziffern nicht die laufende Uhrzeit, sondern den Countdown für ein aktuelles Vorhaben anzeigten: in diesem Fall die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Kontaktes, noch fünf Minuten.
Wir nahmen schweigend unsere Plätze ein. In der Schwerelosigkeit setzt man sich natürlich nicht auf Stühle; das ist völlig unnötig. Es gab auf dem Boden vor den jeweiligen Schaltpulten Schlaufen am Boden, in die man die Füße steckte, und wenn man dann die Karabinerhaken, die an elastischen Schnüren an jedem Overall befestigt waren, an den entsprechenden Ösen einhakte, konnte man sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren, ohne befürchten zu müssen, in einem unachtsamen Moment davonzuschweben.
Meine Aufgabe war, die Energieflusskontrollen im Auge zu behalten. Ich blickte über die Anzeigeinstrumente, verwirrend viele, zog einen Notizzettel aus der Tasche, den ich mir vorsorglich angefertigt hatte, und heftete ihn mit einem kleinen Magneten an eine freie Fläche. Das war ein Aushilfsjob für mich, weil Taka Iwabuchi, der für den Bereich Sonnenenergie zuständig war, sich diesmal unten im Maschinendeck aufhielt, um das Funktionieren der automatischen Anlagen zu überwachen. Oder das Nichtfunktionieren, um genau zu sein. Denn seit zwei Monaten gab es ständig Pannen bei der Energieübertragung.
Noch drei Minuten.
Yoshiko hatte ihren Platz an der Erdbeobachtung eingenommen. Ich riskierte einen kurzen Seitenblick. Sie drehte an Schaltern, drückte Tasten und war ganz bei der Sache, als wenn nichts gewesen wäre. Dann bemerkte ich einen mahnenden Blick von Moriyama, dem Kommandanten, und widmete mich angelegentlich wieder meinem Kontrollpult. Wenn nur nicht alles so groß in Japanisch und nur so klein – und unvollständig – in Englisch beschriftet gewesen wäre! Auch nach all den Jahren in den Diensten der japanischen Raumfahrt tat ich mich mit dem Lesen der japanischen Schrift immer noch schwer. Okay, ich konnte die Tageszeitung von Tokio entziffern, die wir täglich heraufgefaxt bekamen, aber in der Zeit, die ich für die Titelseite brauchte, hatte ich früher die New York Times einmal ganz durchgelesen.
Noch zwei Minuten.
»Hawaii, hier spricht die Raumstation NIPPON. Bitte kommen.« Das war Sakai, der für Funk, Datenübertragung und allgemeine Kommunikation zuständige Operator. Ein verschlossener, humorloser und ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, den ich noch nie mit jemandem aus der Crew ein längeres Gespräch hatte führen sehen. Wahrscheinlich hatte er sich beruflich der Kommunikation verschrieben, weil er sie privat absolut nicht beherrschte. Auch dass er fließend Englisch sprach, änderte daran nichts.
»NIPPON, hier Hawaii«, drang die Stimme des Funkers unten an der Empfangsanlage aus dem Lautsprecher. »Wir haben Sie geortet.«
»Hawaii, wir sind bereit für den Empfang Ihres Leitstrahls in« – er blickte auf die Missionsuhr – »einer Minute und vierzig Sekunden.«
»Bestätigt. Wir sind synchron.«
Ein meckerndes Lachen quittierte diese Durchsage. Sie stammte von James Prasad Jayakar, dem Computerspezialisten, den auf seinen eigenen Wunsch hin alle nur Jay nannten. Er war der Sohn eines indischen Physikers und einer englischen Kybernetikerin und vor kurzem direkt von Cambridge weggekauft worden. Wenn man sich nicht an seinem, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich eigenwilligen Charakter stieß, war gut mit ihm auszukommen, und wenn man bedachte, dass diese Dienstschicht – er war mit dem vorletzten Shuttle vor vier Monaten an Bord gekommen – sein erster Aufenthalt im Weltraum war, dann hielt er sich erstaunlich gut.
Alle Augen fixierten nun die Missionsuhr. Die Sekunden verstrichen so langsam, als ginge der Zeit ausgerechnet jetzt der Sprit aus.
In Hawaii ging in diesen Minuten die Sonne unter, und von dort aus gesehen tauchten wir am nördlichen Horizont auf, als winziger, aber mit bloßem Auge gut sichtbarer Punkt am klaren Abendhimmel. In wenigen Augenblicken würden sie uns einen Laserstrahl entgegenschicken, der genau auf unseren Energiesender gerichtet sein würde. Und an diesem Laserstrahl entlang sollte unsere Energie hinab zur Erde fließen, um dort von einem riesigen Empfängergitter aufgenommen zu werden, das, beinahe einen Quadratkilometer groß, nördlich der kleinen Insel Nihoa im Pazifik dümpelte.
Das hatte auch schon funktioniert. Nur seit zwei Monaten war der Wurm drin.
Noch fünfundvierzig Sekunden.
Jeder denkt, das Aussehen der Raumstation sei leicht zu beschreiben, solange er es noch nicht versucht hat. Klar, man weiß, dass es sich um eine Versuchsstation handelt, die hauptsächlich gebaut wurde, um verschiedene Aspekte der Energiegewinnung aus Sonnenlicht und der Übertragung von Energie aus dem Weltraum zur Erde zu erforschen und die zugehörige Technologie zu entwickeln. Und man kann sich auch denken, dass die Raumstation dazu ziemlich große Flächen haben muss, die im Volksmund als Solarzellen oder Sonnenpaddel bezeichnet werden. Was man sich aber nicht denken kann, ist, wie groß diese Flächen tatsächlich sind.
Am eindrücklichsten fand ich eine Beschreibung, die einmal in einem von der japanischen Raumfahrtbehörde herausgegebenen Prospekt stand. Stellen Sie sich vor, hieß es dort, Sie hätten eine kreisrunde Scheibe feinen weißen Papiers, einen halben Meter im Durchmesser, gerade so groß, dass ein Erwachsener sie mit ausgestreckten Armen umfassen kann. Durch den Mittelpunkt dieser Scheibe sei eine kleine Nadel gesteckt. Der winzige Kopf dieser Nadel – das ist die eigentliche Raumstation. Hier leben, arbeiten und schlafen die Mitglieder der Besatzung; hier werden wissenschaftliche Experimente aller Art gemacht, und hier sind auch alle Maschinen untergebracht, die zur Versorgung mit Wasser und Atemluft erforderlich sind. Die Spitze der Nadel ist in Wirklichkeit eine hundertfünfzig Meter lange, ölbohrturmartige filigrane Stabkonstruktion, an deren Ende der Energiesender sitzt. Und die Papierscheibe – das sind die Solarzellen.
Nur dass es keine Solarzellen im herkömmlichen Sinn sind. Es handelt sich um eine hauchdünne Folie, die nur unter Schwerelosigkeit hergestellt werden kann – und die wir deshalb hier an Bord herstellen –, die zwischen lächerlich mageren Trägern aufgespannt ist und die eine Energieausbeute von ungefähr hundert Watt je Quadratmeter liefert. Und dieser Quadratmeter hat, inklusive der Träger und Energieleitungen, eine Masse von durchschnittlich gerade mal zehn Gramm – weitaus weniger als Papier also.
Und das Ganze ist wirklich riesig. Es schneidet unser Sichtfeld buchstäblich in zwei Hälften. Wenn wir in der Station aus einem Fenster sehen, sehen wir ringsum diese endlose, wie frisch gefallener Schnee schimmernde Fläche, die bis zum Horizont reicht, und darüber den halben Sternhimmel. Und um diese Jahreszeit auch nur die halbe Erde, die immer am Rand der Scheibe entlangwanderte.
Man kann im Weltraum, wo alle Belastungen durch Schwerkraft und Luftwiderstand wegfallen, wirklich riesenhafte Gebilde bauen, ohne Probleme zu bekommen. Mitsubishi Industries dachte zurzeit darüber nach, die nächste Version einer Solarstation zu sponsern, unter der Auflage, dass die Sonnenfläche in Form des Mitsubishi-Firmenlogos und so groß gebaut würde, dass sie mit bloßem Auge von der Erde aus gesehen werden konnte. Ich weiß auch genau, was sich Coca-Cola und McDonald’s zu diesem Thema ausgedacht hätten, wenn sie heute noch die Firmen gewesen wären, die sie in meiner Jugend gewesen waren.
»Noch zehn Sekunden«, sagte Moriyama.
Ich starrte meine Anzeigeinstrumente an und bedauerte, nicht aus dem Fenster schauen zu können, was ich sonst oft tat bei den Übertragungsmanövern. In dem Moment nämlich, in dem die darin erzeugte Energie floss, wurde die sonst blendend weiße Fläche auf einmal tiefschwarz, und vor dem Hintergrund des Alls wirkte das, als verschwände sie von einem Moment zum anderen spurlos.
»Wir empfangen den Leitstrahl!«, verkündete Sakai. »Energie frei!«, befahl Moriyama.
Das galt mir. Ich legte den entsprechenden Hebel um und bildete mir ein, dass ein feines Rucken durch die ganze Station ging. Die Anzeigen wanderten rasch in die grünen Bereiche. »Energie fließt«, verkündete die Stimme Iwabuchis aus dem Lautsprecher der Bordsprechanlage.
»NIPPON, hier Hawaii. Wir empfangen Sie mit zwei Prozent der Nennleistung.«
»Go-fun. Wir warten fünf Minuten, dann erhöhen wir«, ordnete Moriyama an.
»Hawaii, hier NIPPON«, sagte Sakai. »Wir senden für fünf Minuten nur den Orientierungsstrahl.«
»Verstanden, NIPPON.«
Gespanntes Schweigen. Es war nichts zu hören, kein Wummern von Maschinen, kein Surren und kein Rattern, nichts. Was die normale sinnliche Wahrnehmung anbelangte, hätte alles ebensogut ein Computerspiel sein können.
Jay brach das Schweigen mit dem Wort, das alle gefürchtet hatten. »Vibrationen.«
Ein Fluch auf Japanisch, der sicher nicht für unsere Ohren gedacht war, kam über die Sprechanlage. Iwabuchi. Ich verstand kein Wort, aber Yoshiko neben mir schien zu erröten. »Strahl beginnt zu wandern«, sagte sie dann, »ist aber noch im Zielbereich.«
»Vibrationen werden stärker«, verkündete Jay.
»Strahl verlässt den Zielbereich!«, rief Yoshiko. Unter der Konsole vor mir ertönte ein hässliches, schnappendes Geräusch, ein Geräusch wie von einer Axt, die ein Halteseil mit einem Hieb kappt, und auf einem Bildschirm erschien eine rot blinkende Meldung, dass die automatische Abschaltung erfolgt war, weil die Steuerung des Energiestrahlers den Leitstrahl verloren hatte.
»Abschaltung«, blieb mir zu verkünden, obwohl alle das Geräusch gehört hatten und seit Wochen genau wussten, was es bedeutete.
»NIPPON, hier Hawaii. Wir empfangen Sie nicht mehr.«
»Hawaii, wir hatten eine Notabschaltung infolge Zielverlustes«, erwiderte Sakai.
Ein halb unterdrückter Fluch, den diesmal ich verstand und die anderen nicht, Jay vielleicht ausgenommen. »Könnt ihr euch nicht mal etwas Originelleres einfallen lassen, NIPPON?«
Moriyama schaltete sich ein, wohl weil er wusste, dass Sakai mit derlei launigen Bemerkungen nichts anzufangen wusste. »Hawaii, hier Moriyama. Haben Sie die Wanderbewegungen des Strahls registriert?«
»Ja. Wir können Ihnen die Aufzeichnungen hochschicken.«
»Dozo. Tun Sie das bitte.«
»Wollen Sie es noch einmal probieren?«
»Nein, das hat keinen Zweck. Wir müssen erst den Verlauf des heutigen Versuchs analysieren. Ehe wir keine neuen Anhaltspunkte für die Fehlerursache haben, werden wir nur wiederholen, was wir ohnehin schon wissen.«
»In Ordnung, NIPPON. Dann bis in zwei Tagen wieder?«
»Hai«, sagte Moriyama. »Bis in zwei Tagen.«
Eine Weile behielt er in einer Haltung dumpfen Brütens die Hand am Mikrophonschalter. Wir schalteten unsere Geräte ab, soweit das erforderlich war, und sahen ihn abwartend an. »Hat jemand einen Vorschlag zu machen?«, fragte er schließlich.
»Wir könnten …«, begann Jay sofort, wurde aber vom Kommandanten scharf unterbrochen.
»Sie habe ich dabei nicht gefragt, Mister Jayakar! Was Sie tun werden, steht bereits fest. Sie werden aufhören zu essen und aufhören zu schlafen und jedes einzelne Bit an Aufzeichnungen überprüfen, das wir von diesem Versuch haben, und Sie werden bis zum nächsten Rendezvous mit Hawaii den Fehler gefunden haben. Von Ihnen will ich keine Theorie und keinen Vorschlag, sondern schlicht und einfach den Fehler! Haben wir uns verstanden?«
Jay atmete einmal geräuschvoll ein und ebenso geräuschvoll wieder aus und sagte dann behutsam: »Ich denke, das war unmissverständlich, Sir. Zum Glück habe ich vor dem Versuch noch einmal feste Nahrung zu mir genommen …« Er löste seine Karabinerhaken. »Ich gehe an das Terminal im Maschinendeck.«
Wir sahen ihm nach, wie er sich von Handgriff zu Handgriff bis zum Türschott hangelte, das bereitwillig vor ihm auffuhr und sich hinter ihm zischend wieder schloss.
Moriyama atmete seufzend aus. »Shitsurei shimash’ta. Wir stehen unter Druck. In ein paar Tagen kommt der Shuttle, und falls wir irgendwelche Geräte oder Teile benötigen, um den Fehler zu beheben, sollte uns das möglichst vorher einfallen, sonst müssen wir wieder zwei Monate warten.«
Dazu fiel niemandem von uns etwas ein. Sakai wirkte, als ginge ihn das Ganze nichts an; er beobachtete den Bildschirm, der die Übertragung der Aufzeichnungen aus Hawaii protokollierte.
»Ma«, meinte Moriyama schließlich. »Das war’s für heute. Ich danke Ihnen. Arigato gozaimas.«
Als wir uns losschnallten, fügte er beiläufig hinzu, gerade so, als sei ihm das eben eingefallen: »Chotto, Mister Carr, Sie würde ich gerne noch einen Moment in meinem Büro sprechen.«
Yoshiko sah mich an, ich sah Yoshiko an. Mister Carr. So nannte er mich nur, wenn es ernst wurde. Ich sah, wie ein gehässiges Grinsen Sakais Mundwinkel umspielte.
KAPITEL 3
Das Büro des Kommandanten war ein kleiner Verschlag am Ende des Stationsmoduls, das die Steuerzentrale beherbergte. Hier erledigte er die Verwaltungsarbeit, die mit der Führung der Raumstation verbunden war. Man hätte nur mit Mühe zwei Telefonzellen aus dem Raum machen können, so eng war er, und die Wände waren übersät mit Papieren, festgeklammerten Ordnern, Übersichtstafeln und eng bekritzelten Faxmeldungen, alle mit Magneten festgepinnt. Ein kleiner Schreibtisch war an der Wand befestigt, und daneben ein ganz normaler Personalcomputer mit flachem Bildschirm, Kanji-Tastatur und einem Tintenstrahldrucker.
»Nehmen Sie Platz«, sagte Moriyama.
Er hatte zwei ›Hühnerstangen‹ in seinem Büro, wie wir die dünnen Plastikgestelle nannten. Sie waren ebenfalls magnetisch am Boden verankert und hatten kleine Sitzkissen am oberen Ende, auf denen man sich mit den Karabinerhaken seines Bordanzugs festzurren konnte. Auf diese Weise wurde das Becken fixiert, und für Schreibarbeiten oder beim Essen war dies eine angenehme und bequeme Körperhaltung.
Ich schnallte mich also fest und erwartete eine Standpauke wegen meines ungezügelten Sexuallebens.
»Mister Carr«, begann Moriyama, der sich gleichfalls festgeschnallt hatte, »Sie erinnern sich sicher, dass Sie hier an Bord als Maintenance and Security Operator angestellt sind.« Er sah mich nicht an dabei.
»Ja«, sagte ich. Maintenance Operator – das war die beschönigende Umschreibung für den Job eines Hausmeisters. Meine Aufgabe war es, alles sauber und in Schuss zu halten. Keine leichte Arbeit und auch keine unwichtige, aber dass sie auch nur annähernd so angesehen war wie die irgendeines anderen Crewmitglieds, davon konnte keine Rede sein. Ich war die Putzfrau, basta.
»Ich spreche hier mit Ihnen«, fuhr der Kommandant fort, »in Ihrer Eigenschaft als Sicherheitsbeauftragter.«
Ich nickte nur noch. Jetzt kommt es, dachte ich, und meine Zunge schien plötzlich ausgetrocknet und am Gaumen festgewachsen zu sein.
»Ich glaube, es ist Sabotage«, sagte Moriyama.
Zuerst verstand ich überhaupt nicht, wovon er sprach. »Wie bitte?«
»Sabotage«, wiederholte der Kommandant. »Wir haben alle technischen Möglichkeiten durchprobiert, und es ist noch nicht einmal ein Anhaltspunkt für einen Fehler aufgetaucht. Die Steuerung der Energieübertragung hat lange Zeit funktioniert, und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Ich denke, jemand hat sie sabotiert.«
Ich musste erst einmal erleichtert aufatmen, ehe ich etwas sagen konnte. Ich war wirklich darauf gefasst gewesen, mir höchst unangenehme Ermahnungen wegen meiner Affäre mit Yoshiko anhören zu müssen; Ermahnungen, in denen die Worte Pflichtvergessenheit und Unpünktlichkeit und dergleichen vorgekommen wären. Dann wurde mir bewusst, wie lächerlich meine Erleichterung war im Vergleich zu dem ungeheuerlichen Verdacht, den Moriyama gerade geäußert hatte.
»Aus welchem Grund sollte jemand unsere Versuche zur Energieübertragung sabotieren wollen?«, fragte ich, weil mir nichts Besseres einfiel.
»Ano-ne«, brummte Moriyama überrascht. »Da kann ich mir eine ganze Menge Gründe vorstellen. Wussten Sie, dass es bereits zwei Bombenattentate auf unser Versuchsgelände auf Hawaii gegeben hat? Natürlich kann man nichts beweisen, aber alles deutet darauf hin, dass hinter den Anschlägen dieser Verein seniler Schwachköpfe steckt, der sich Gemeinschaft Erdöl exportierender Staaten nennt und der immer noch nicht begriffen hat, dass in fünf bis zehn Jahren sein letztes Fass Öl abgefüllt sein wird.«
»Sie glauben, dass die OPEC uns einen Agenten an Bord geschickt hat?«
»Oder eine der Erdölgesellschaften. Denken Sie nur einmal daran, was alles an dunklen Machenschaften ans Licht kam, als die Exxon Corporation in Konkurs ging. Ich glaube nicht, dass die Konkurrenz besser ist. Wenn unser Konzept funktioniert, dann bricht das Solarzeitalter an, und das bedeutet das sichere Ende für jede Art von Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen. Mit anderen Worten, das sichere Ende für Shell, British Petroleum, Mobil, Texaco …«
»… Nippon Oil …«, warf ich ein.
»Das ist etwas anderes«, wies mich Moriyama zurecht. »Die japanische Industrie hat immer langfristig gedacht, die westliche dagegen immer nur bis zum nächsten Quartalsabschluss. Wäre es anders gewesen, wäre eine Raumstation wie diese schon vor zehn Jahren gebaut worden, und zwar unter der Regie aller amerikanischen Energieerzeuger.«
Ich nickte.
Ich sah Moriyama an, wie er da saß und auf ganz unjapanische Art die Dinge beim Namen nannte. Er musste an die fünfzig Jahre alt sein, und sein Haar begann schon an vielen Stellen weiß zu werden. Auf eine natürliche Weise strahlte er Autorität aus, und er war der Einzige an Bord, mit dem ich mich auf der Erde gern in irgendeiner Kneipe getroffen hätte, um über die Welt und das Leben zu diskutieren. Er hatte mir einmal erzählt, dass er ein paar Jahre in Santa Barbara, Kalifornien, studiert hatte, und wir hatten herausgefunden, dass wir uns im Sommer 1990 zur gleichen Zeit im Flughafen von San Francisco aufgehalten haben mussten. Er war damals zurück nach Japan geflogen, ich dagegen nach Kansas City, um mich von meinen Eltern zu verabschieden. Damals war ich Kampfflieger der US Air Force gewesen, und ich hatte einen Befehl in der Tasche getragen, der mich in die Wüste von Saudiarabien beorderte, zu einer Operation namens Desert Shield …
»Davon abgesehen«, fuhr er fort, »kann ich mir auch politische Gründe vorstellen. In Ihrem schönen Heimatland zum Beispiel gibt es viele Leute, die den Weltraum als amerikanisches Territorium betrachten. Grundsätzlich sind sie zwar dafür, dass die Menschen das All erobern, aber sie haben etwas dagegen, dass diese Menschen Schlitzaugen haben.«
Ich hob die Augenbrauen. »Dann müssten Sie eigentlich mich verdächtigen.«
Er sah mich an und lächelte. »Sie sind es nicht.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Dai rokkan«, sagte er und klopfte sich mit dem Zeigefinger auf den Nasenflügel. »Spürnase. Sechster Sinn.«
Nun gut, was mich anbelangte, trog ihn sein sechster Sinn durchaus nicht. Ich ließ die Gesichter der Crew vor meinem inneren Auge Revue passieren. »Gibt es jemanden, den Ihr dai rokkan im Verdacht hat?«, fragte ich.
»Leider nicht. Bisher kann ich mich dem Problem nur auf rationale Weise nähern.« Und das war ihm nicht geheuer. Japaner legen sehr viel Wert auf ihre Intuition. Schlussfolgerungen, die auf rein logischem Weg zustande kommen, stehen sie sehr misstrauisch gegenüber.
Moriyama zog einen Ordner aus seinem Halteclip und schlug ihn auf. Darin war der Schichtplan eingeheftet. »Die Pannen fingen am vierten Tag nach dem Rückflug des letzten Shuttles an. Seither ist keine einzige Energieübertragung mehr geglückt. Was die Frage aufwirft, ob es etwas mit diesem Schichtwechsel zu tun hat.« Die Raumstation wurde alle zwei Monate von einem Spaceshuttle angeflogen, das neue Vorräte brachte, neue Geräte für die wissenschaftlichen Versuche und die Ablösung für ein Drittel der neunköpfigen Mannschaft.
»Mit dem letzten Shuttle kam zum Beispiel Sakai.« Moriyama sah mich an und seufzte. »Ein merkwürdiger Mensch. Er versteht alles von Kommunikationstechnik, aber von allem anderen scheint er nicht die geringste Ahnung zu haben, und außergewöhnlich schwer von Begriff ist er außerdem. Ich frage mich manchmal, wie er die psychologischen Eignungstests bestanden hat.«
Ich versuchte, mir Sakai vorzustellen, wie er im Maschinendeck umherschlich und raffinierte Manipulationen an den Steuerungsautomaten vornahm, aber es gelang mir einfach nicht. »Iwabuchi kam auch mit dem letzten Shuttle«, fuhr Moriyama fort. »Und das ist ja nun der genialste Techniker, den ich je gesehen habe. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, aus welchem Grund, aber er könnte es bewerkstelligen, dass die Steuerung nicht mehr funktioniert.«
Ich blickte auf den Schichtplan. Der dritte neue Name, der dort stand, war Yoshiko Matsushima.
»Aber selbstverständlich ist jeder andere auch verdächtig«, meinte der Kommandant. »Die zeitliche Übereinstimmung mit einem Schichtwechsel kann Zufall sein, oder ein Ablenkungsmanöver.«
»Wenn es Sabotage ist«, gab ich zu bedenken, »dann könnte es auch sein, dass uns einer der drei, die beim letzten Schichtwechsel von Bord gingen, das faule Ei hinterlassen hat.«
Moriyama starrte eine Weile nachdenklich auf das Blatt Papier vor sich. Dann klappte er den Ordner zu und stellte ihn neben sich in die Luft, wo er schweben blieb, unmerklich langsam in Richtung Tür driftend.
»Mir wäre es auch lieber, wenn ich nur Gespenster sähe, Leonard«, sagte er. »Trotzdem – ich habe das Gefühl, dass irgendetwas an Bord nicht stimmt. Das Gefühl von Gefahr. Eine Staubwolke am Horizont. Ich möchte, dass Sie sich umsehen, unauffällig Augen und Ohren offen halten. Sie können sich überall in der Station aufhalten, ohne verdächtig zu wirken, und fast jeder an Bord unterschätzt Ihre Intelligenz. Meine Landsleute tun das, rassistisch wie sie nun einmal sind, wegen Ihrer Hautfarbe, und die anderen, weil Sie keinen akademischen Grad haben. Nutzen Sie das bitte aus.«
Über dieses Thema hatten wir uns schon öfters unterhalten. Moriyama kannte die andere Seite. Während seines Studiums in Kalifornien hatte er jobben müssen, in einem Restaurant, in dem auch seine reichen Kommilitonen verkehrten, und hatte das ganze Spektrum von Herabsetzung, Verachtung und Diskriminierung erlebt. Und seit ich in Japan lebte, hatte ich in Gedanken schon tausendmal meinem Freund Joe von der Fliegerakademie Abbitte geleistet, meinem Freund Joe, dem Schwarzen aus Washington, D.C., der mir vergeblich versucht hatte zu erklären, wie man sich fühlte als Neger, als Nigger, als Mensch zweiter Klasse. »Wenn dich jemand anschaut und du genau spürst, dass sein Blick nur bis zu deiner Haut reicht und keinen Millimeter tiefer, und du siehst, dass ihm das schon reicht, um dich zu beurteilen, dich in eine Schublade zu stecken – das ist Diskriminierung, und wenn du das nicht erlebt hast, dann weißt du nicht wie sich Ungerechtigkeit anfühlt.« Das pflegte er immer zu sagen, und ich hatte geglaubt, ihm mitfühlend zuzuhören, und überhaupt, ich war ja kein Rassist, denn ich hatte einen guten Freund, der schwarz war, und das machte mir überhaupt nichts aus. Aber ganz tief unten dankte ich natürlich dem Schicksal, dass es mich als Mitglied der Herrenrasse hatte zur Welt kommen lassen und mir damit diese Probleme erspart blieben. Nie im Leben hätte ich es für möglich gehalten, dass ich mich eines Tages wie ein Mensch zweiter Klasse fühlen könnte, weil ich ein Weißer war. Aber trotz all ihrer wohlerzogenen Höflichkeit ließen es einen die Japaner, vor allem die jungen, nie vergessen, dass man nicht das unerhörte Glück gehabt hatte, als Japaner zur Welt zu kommen.
»Okay«, versprach ich. »Ich schnüffle ein bisschen herum.« Moriyama sah mir forschend in die Augen. Dann, als müsse er sich einen Ruck geben, öffnete er eine Schublade unter seinem Schreibtisch und nahm ein Blatt Papier heraus, das am Rand einen roten Streifen hatte.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen meine Befürchtungen eindringlich genug habe deutlich machen können«, erklärte er mit ungewöhnlichem Ernst. »Deshalb will ich Ihnen eine Mitteilung zeigen, die ich vor vier Wochen erhalten habe und über die Sie bitte Stillschweigen bewahren. Sie kennen Professor Yamamoto?«
Ich nickte. Ich erinnerte mich dunkel an ein Seminar an der Universität von Tokio, auf dem er über verschiedene Konzepte raumgestützter Sonnenenergiegewinnung referiert hatte. Yamamoto hatte das Steuerungssystem des Energiesenders entwickelt, und wir hatten ihn um Rat fragen wollen, als die Störungen auftraten. Es hatte jedoch geheißen, er liege mit einem schweren Herzinfarkt im Krankenhaus und sei nicht ansprechbar.
Moriyama reichte mir das Blatt. Es war eine verschlüsselte Mitteilung, die er eigenhändig mit dem Code des Kommandanten entschlüsselt hatte:
VERTRAULICH. PROFESSOR YAMAMOTOWURDEVORZWEI WOCHENVON UNBEKANNTENAUSSEINEM WOHNHAUSENTFÜHRT. ESFEHLTJEDE SPUR. WIRHALTENDEN VORFALLEINSTWEILENGEHEIM. ISA, TOKIO, SICHERHEITSABTEILUNG.
Ich starrte das Papier an. Jetzt spürte ich sie auch, die Staubwolke am Horizont. Den Geruch von Gefahr.
»Regt das Ihre Phantasie an?«, fragte Moriyama.
»Ja«, nickte ich und reichte ihm das Blatt mit dem roten Rand, auf dem in japanischen Schriftzeichen Streng vertraulich stand, zurück.
Ich war schon am Gehen, als er plötzlich sagte: »Ach, und wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, Leonard …«
Ich fasste den Haltegriff neben der Tür und wandte mich noch einmal um. Moriyama lächelte plötzlich verschmitzt. Er hatte die ganze Zeit nicht gelächelt, seit wir den Raum betreten hatten.
»Von Mann zu Mann«, meinte er. »Achten Sie auf Ihren Bartwuchs. Ganz gleich, was sie Ihnen erzählen – japanische Frauen mögen keine Bartstoppeln.«
Ich fuhr mit der Hand über mein Kinn. Es kratzte wie Sandpapier. Jetzt musste ich auch grinsen.
»Danke«, sagte ich.
KAPITEL 4
Ich hatte eine kurze Dusche genommen – da die Japaner Reinlichkeitsfanatiker sind und es ihnen bei der Körperhygiene fast nicht heiß genug sein kann, verfügte die Raumstation trotz der ansonsten sehr beengten Wohnverhältnisse über eine geradezu gigantische Dampfduschkabine –, und nun stand ich nackt vor dem Spiegel im Waschraum, die Füße in den Bodenschlaufen eingehakt, und rasierte mich, während ich zu überlegen versuchte, wie ich vorgehen wollte.
Aus irgendeinem Grund war es ausgerechnet die Tätigkeit des Rasierens, die mich regelmäßig in Hochstimmung versetzte. Immer, wenn ich mein Gesicht im Spiegel betrachtete, während ich mir das Kinn mit Rasierschaum eincremte, wurde mir mit atemberaubender Klarheit bewusst, dass ich mich im Weltraum befand, dass hinter diesem Spiegel nur ein schmaler Wandschrank war, hinter dem Wandschrank ein paar dünne Rohre und elektrische Leitungen, dann noch eine daumendicke Isolierwand – und dahinter begann unmittelbar das allumfassende, unauslotbare Nichts, dieser unermessliche, leere Raum, der alle Sterne und Planeten enthielt, der größer war als jedes Menschen Vorstellungskraft, diese niemals endende Weite, von der niemand ahnen konnte, welche Wunder und welche Schrecken sie bereithielt für den, der es fertig brachte, sie zu bereisen. Ich hatte die äußerste Grenze erreicht. Mein Leben war nicht einmal ein Aufblitzen vor dem unendlichen Abgrund der Zeit, mein Körper nur ein schwaches, zerbrechliches, verletzliches Gebilde, und trotzdem war ich hier.
Doch die Euphorie, die ich dabei empfand, entsprang nicht einem billigen Triumph, sondern einem Gefühl tiefster Übereinstimmung mit mir selbst. Wenn es etwas gab im Leben, von dem ich überzeugt war, dann davon, dass ich das Recht hatte, hier zu sein. Mit fast religiöser Inbrunst glaubte ich, dass das Universum es von mir erwartete. Ich weiß noch, wie mein Vater einmal bei einem nächtlichen Spaziergang zum Himmel deutete, an dem unglaublich viele Sterne leuchteten wie reinstes Geschmeide – ich muss damals ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, und wir lebten in einem verschlafenen kleinen Ort in Kansas, inmitten von Landwirtschaft und endlosem flachen Land –, und sagte: »Schau dir das an, Leonard, all diese Sterne. Wir Menschen sind wirklich nichts.«
Und ich stand da, den Kopf in den Nacken gelegt, ließ mein Herz vom Anblick des Firmaments wärmen und versuchte zu verstehen, was mein Vater wohl gemeint haben konnte. »Aber Daddy«, sagte ich schließlich, »wenn wir nicht da wären, um sie anzuschauen, würden die Sterne doch ganz umsonst leuchten.« In diesem Moment war mir klar geworden, dass wir Menschen keine Parasiten im Universum sind. Wir Menschen – oder, weniger anthropozentrisch gedacht, Wesen mit Bewusstsein – sind es, die der Existenz des Universums erst Sinn verleihen.
Okay, ich gebe zu, dass es eine Menge Leute gibt, bei denen man nicht das Gefühl hat, dass sie viel zu diesem Sinn beitragen. Vielleicht war es das Rasieren. In ihrer Blütezeit hatte die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, einige Millionen Dollar auf die Entwicklung eines weltraumtauglichen Trockenrasierers verwendet, der mittels einer Art eingebauten Staubsaugers die beim Rasieren entstehenden staubfeinen Bartpartikel zuverlässig einsaugen sollte, damit sie nicht durch die Luft schwirrten und in irgendwelchen elektronischen Anlagen Katastrophen anrichteten. Irgendwann hatte man diese Entwicklungen ergebnislos abgebrochen und schlicht verfügt, dass die Astronauten sich nass zu rasieren hätten: jeder handelsübliche Rasierschaum aus der Drogerie an der Ecke war imstande, die Bartpartikel zu binden und damit das Problem zu lösen. Und seither rasieren sich Raumfahrer, so sie es tun, nass.
Auf der Erde rasiere ich mich immer noch trocken. Ich hatte es bis zuletzt aufgeschoben, das Nassrasieren wenigstens einmal zu üben, und vor meinem ersten Shuttlestart, vor dem Abflug zum Tanegashima Raumfahrtgelände, hatte ich mir in einem kleinen amerikanischen Laden auf dem Flughafen von Tokio ein sündhaft teures Nassrasur-Set gekauft, von Gillette, wohl um mich meiner nationalen Identität zu versichern. Am ersten Morgen in der Raumstation machte ich dann zwei aufschlussreiche Erfahrungen: erstens, dass Schwerelosigkeit das Erlernen des Nassrasierens nicht erleichtert, und zweitens, dass Blut sich – anders als Wasser, das unter Schwerelosigkeit ziemlich große Kugeln bilden kann – in einen feinen roten Nebel verwandelt, und herzlichen Glückwunsch, wenn man den mit einem Schwamm wieder einsaugen muss.
Mit derlei Erinnerungen beendete ich meine Rasur, reinigte den Klingenkopf und packte alles in mein Fach. Dann wusch ich mir die Hände – man macht das im Weltraum mit Hilfe eines nassen Schwammes, betätigte die Heißluftbrause, um alle noch umherschwirrenden Wassertröpfchen zu beseitigen, und verließ die Waschzelle, um mich in meiner Kabine anzuziehen. Auf dem Weg dorthin kam ich an den Bodybuilding-Geräten vorbei, an denen wir regelmäßig trainierten, um den schädlichen Einwirkungen der Schwerelosigkeit vorzubeugen, Muskelschwund etwa, Brüchigwerden der Knochen oder einer Erscheinung, die man orthostatische Intoleranz nennt: der Effekt, dass nach der Rückkehr ins Schwerefeld der Erde das Gehirn unzureichend mit Blut versorgt wird, wenn man aufrecht steht. Natürlich funktionierten diese Geräte nicht mit Gewichten, wie dies in einem irdischen Fitness-Studio der Fall gewesen wäre, sondern mit Federn und hydraulischen Kolben, und die weitaus meisten Geräte befassten sich mit den Muskeln der unteren Körperhälfte: es war nicht Ziel, mit einem Schwarzenegger-Bizeps aus der Erdumlaufbahn heimzukehren, sondern die Beinmuskulatur, die bei Wegfall der Erdanziehung am schnellsten verkümmerte, in Form zu halten.
Es gab zwei Wohntrakte auf dem Crew-Deck, jeweils mit fünf Kabinen. Eine Kabine stand in der Regel leer, weil die Raumstation eine Normalbesatzung von nur neun Personen hatte, und wurde als Lagerraum benutzt. Während in meinem Trakt die Hygiene- und Fitnesseinrichtungen lagen, befand sich im anderen Trakt die so genannte Messe, das hieß die automatische Küche und ein kleiner Gemeinschaftsraum mit einem großen runden Tisch, an dem man essen, lesen oder magnetische Brettspiele spielen konnte. (Nach sieben Jahren in Japan spielte ich allerdings immer noch so schlecht Go, dass ich für die japanischen Crewmitglieder ein völlig uninteressanter Gegner war.) Natürlich gab es auch ein Videogerät und eine Sammlung – größtenteils japanischer – Videofilme.
Die Kabine wäre angenehm groß gewesen, wenn es sich dabei um einen Kleiderschrank gehandelt hätte – aber als Wohnraum war sie doch etwas beengend, obwohl man außer an Platz an nichts gespart hatte. Jede Kabine verfügte über einen Anschluss an die Datenbank des Bordcomputers, die genug Lesestoff bot, selbst wenn man während des halbjährigen Aufenthalts nichts anderes zu tun gehabt hätte als zu lesen, ferner über eine eigene Sprechanlage, eine teure Designer-Leselampe an einem biegsamen Hals, etlichen Stauraum für persönlichen Krimskrams und sogar ein Abspielgerät für diese neuartigen Micro-Discs: kleine Speicherelemente von der Größe einer Vierteldollarmünze, die sechzig Minuten Musik in CD-Qualität enthielten – die ideale Soundtrackmaschine für den Raumfahrer mit leichtem Gepäck.
Und eine kleine Sichtluke hatte meine Kabine, knapp handtellergroß. Ich schob die Blende beiseite und sah hinab auf die geplagte Erde, auf der es so viel unüberschaubarer zuging als früher. Wir überflogen gerade Afrika, und über dem Hoggar Massiv ging die Sonne auf. Wir sahen zurzeit immer nur Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge auf der Erdoberfläche, weil die Raumstation die Erde auf einer von Pol zu Pol laufenden Kreisbahn umrundete, auf der sie selber die meiste Zeit des Jahres nicht in den Erdschatten eintauchte. Vielleicht lagen dort unten jetzt gerade Männer, die den Sonnenaufgang hinter den Läufen ihrer Maschinengewehre erlebten.