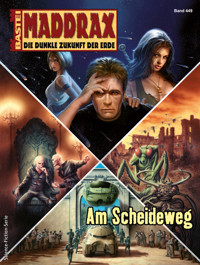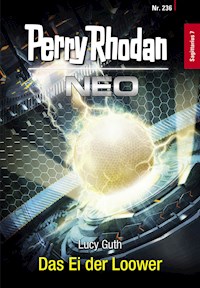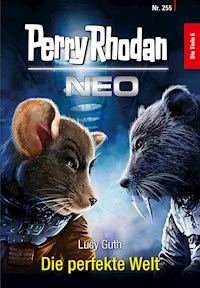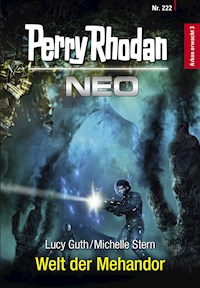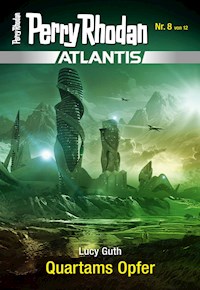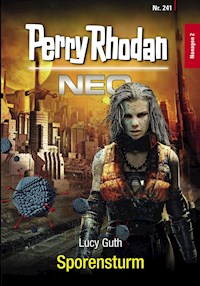
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 2090: Ein halbes Jahrhundert nachdem die Menschheit ins All aufgebrochen ist, bildet die Solare Union die Basis eines friedlich wachsenden Sternenreichs. Aber die Sicherheit der Menschen ist immer wieder gefährdet: durch interne Konflikte und externe Gegner. Beispielsweise sucht eine unheimliche Macht die Galaxis heim – das Dunkelleben. Eigentlich hat Perry Rhodan gehofft, diese Gefahr im galaktischen Zentrum gebannt zu haben. Nach seiner Rückkehr muss er aber erkennen, dass der Feind längst nicht besiegt ist. Denn der machtgierige Iratio Hondro steht weiterhin unter dem Einfluss des Dunkellebens. Plophos hat Hondros Gewaltherrschaft mittlerweile abgeschüttelt, aber dann bricht der Kontakt zur terranischen Kolonie Epsal ab. Perry Rhodan begegnet seinem Widersacher erneut und wird mit Hondros gefährlichster Waffe konfrontiert – einem verheerenden SPORENSTURM ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 241
Sporensturm
Lucy Guth
Cover
Vorspann
1. Juckreiz
2. Krisensitzung
3. Im Rechenherz
4. Geiselnahme
5. Keine Wahl
6. Sabotage
7. Erdbeeren
8. Exorzismus
9. Auf der Krankenstation
10. Fluchthilfe
11. Aufbruch
12. Bargespräche
13. Bruchlandung
14. In der Steuerzentrale
15. Der Pilzdschungel
16. Der Plan
17. Der Fremde im Kopf
18. Begegnung im Pilzdschungel
19. Labyrinth
20. Machtlos
21. Gewissensbisse
22. Angriff der Sporen
23. Mit dem Kopf durch die Wand
24. Drohnen im Einsatz
25. Tekeners Wut
26. Ménage-à-trois
27. Dicht am Herzen
28. Mit einem blauen Auge davongekommen
29. Krankenbesuch
Impressum
Das Jahr 2090: Ein halbes Jahrhundert nachdem die Menschheit ins All aufgebrochen ist, bildet die Solare Union die Basis eines friedlich wachsenden Sternenreichs. Aber die Sicherheit der Menschen ist immer wieder gefährdet: durch interne Konflikte und externe Gegner. Beispielsweise sucht eine unheimliche Macht die Galaxis heim – das Dunkelleben.
Eigentlich hat Perry Rhodan gehofft, diese Gefahr im galaktischen Zentrum gebannt zu haben. Nach seiner Rückkehr muss er aber erkennen, dass der Feind längst nicht besiegt ist. Denn der machtgierige Iratio Hondro steht weiterhin unter dem Einfluss des Dunkellebens.
Plophos hat Hondros Gewaltherrschaft mittlerweile abgeschüttelt, aber dann bricht der Kontakt zur terranischen Kolonie Epsal ab. Perry Rhodan begegnet seinem Widersacher erneut und wird mit Hondros gefährlichster Waffe konfrontiert – einem verheerenden SPORENSTURM ...
1.
Juckreiz
Es kribbelte, prickelte und juckte. Dann brannte es ein wenig, ehe der Juckreiz sich verstärkte. Unruhig verzog Memde Abimola den Mund und fuhr sich im Halbschlaf mit den Händen übers Gesicht.
Mühsam kämpfte er sich aus dem Traum hervor, der ihn eben noch fest im Griff gehabt hatte. Darin war es um seine Arbeit gegangen, um die Fusionsreaktoren in der Maschinensektion der CREST II. Etwas war mit ihnen nicht in Ordnung gewesen, und er als diensthabender Plasmatechniker trug die Verantwortung. Es war ein unangenehmer Traum gewesen; nicht ganz ein Albtraum, aber hart an der Grenze. Trotzdem fiel Abimola das Aufwachen schwer. Er wollte weiterschlafen und sehen, ob er diesen verflixten Fusionsreaktor, der seltsam rot leuchtete, nicht wieder auf Kurs bringen konnte. Doch das Kribbeln hielt ihn davon ab. Das Jucken holte sein Bewusstsein an die Oberfläche. Das Prickeln machte ihn wahnsinnig.
»Nicht schon wieder!« Abimola stöhnte, als sein Geist vollends die Grenze zwischen Traum und Wachzustand überquerte und er bemerkte, dass er sich mit den Fingernägeln durchs Gesicht kratzte. Er zwang sich, damit aufzuhören, und setzte sich auf. Er wusste genau, dass er es nur schlimmer machte, wenn er daran herumkratzte. Aber dieses Wissen half nichts: Der Juckreiz wurde so stark, dass er kurz darauf erneut mit den Fingerkuppen über sein vom Schlaf verquollenes Gesicht fuhr. Er grunzte frustriert und stand auf, um in seine Hygienezelle zu gehen. Mit beiden Händen spritzte er sich kaltes Wasser ins Gesicht und hoffte, dass es ihm Linderung verschaffen würde.
»Eigentlich wollte ich doch ausschlafen«, murmelte er, während ihm das Wasser vom Gesicht tropfte. Vor ihm lag eine Freischicht, und er nutzte diese Zeit gern, um etwas länger liegen zu bleiben.
Doch wenn das Jucken einmal eingesetzt hatte, war es sinnlos, es weiter mit Schlafen zu versuchen. Das hatte er in den vergangenen Tagen leidvoll feststellen müssen. Vor einem Monat war die CREST II von Raumpiraten gekapert und fast das gesamte Personal mit einem Pilz infiziert worden. Dieser sogenannte Halteparasit hatte alle gefügig für die Befehle der Druuwen gemacht. Zwar war das grüne Zeug längst wieder aus ihren Gesichtern verschwunden; Abimola gehörte jedoch zu jenem einen Prozent der Mannschaft, in deren Körper sich nach wie vor Überreste des Pilzes herumtrieben.
Er hasste diese Vorstellung. Normalerweise war er ein geselliger und positiver Mensch. Doch wer einmal erlebt hatte, wie es war, unter der Kontrolle dieses Parasiten zu stehen, würde wohl nie wieder ein reiner Optimist sein. Ihm schauderte allein bei der Erinnerung daran, wie er sich gefühlt hatte. Ihm war alles gleichgültig gewesen, er hatte nur reagiert, war zu eigenen Aktionen nicht mehr fähig gewesen – außer zu jenen, die sein Leben aufrechterhielten, wie essen und schlafen. Er hatte lediglich funktioniert wie eine Maschine. An dem Abend, als sie den Pilz losgeworden und von der seltsamen Forschungsstation auf Carxtröll-Fabb geflüchtet waren, hatte sich Abimola seit langer Zeit mal wieder einen Scotch genehmigt.
»Trinken Sie regelmäßig?«, hatte Sud gefragt, als er ihr das bei einer Therapiesitzung erzählt hatte.
Diese medizinischen Betreuungstermine waren denjenigen vorbehalten, die das Pech hatten, noch Myzelfragmente in sich zu tragen. Abimola mochte Sud, doch die Therapiesitzungen waren ihm zuwider.
»Nein, im Gegenteil«, hatte er geantwortet. »Ich bin zwar kein Antialkoholiker, aber ich habe schon vor Jahren gemerkt, dass Alkohol mir nicht guttut. Deshalb habe ich damit aufgehört. An jenem Abend allerdings ... brauchte ich einfach einen Scotch.«
Sud hatte genickt und die Behandlung fortgesetzt. Bestrahlung mit UV-Licht gehörte ebenso dazu wie die Injektion von Antimykotika. Manchmal legte Sud zudem ihre kleinen Hände auf Abimolas breites Gesicht und setzte ihre sonderbaren Fähigkeiten ein. Ihm war das unangenehm – nicht Suds Berührung an sich; die fand er entspannend, und sie linderte den Juckreiz. Aber die Situation machte ihn unruhig: Er war ein großer, breitschultriger Mann. Dass ein winziger Pilz ihn derartig und über Wochen in Verlegenheit brachte, kratzte an seinem Stolz.
Die Erinnerung an den Behandlungstermin weckte in ihm den Wunsch, die Medostation aufzusuchen und sich etwas Wirkungsvolles gegen das Jucken verabreichen zu lassen. Andererseits sträubte sich etwas in ihm dagegen. »Gbaga, ich habe Freischicht! Ich werde die Zeit nicht mit einer weiteren Therapiesitzung verschwenden – ich muss erst morgen wieder dorthin.« Er fluchte nicht gern, und wenn, dann in seiner Muttersprache Yoruba.
Während er sich anzog, verschwand der Juckreiz. Erleichtert trank Abimola einen Vitaminsaft, ehe er sein Quartier verließ. Sein Ziel war das Freizeitzentrum dieser Sektion.
Eine schöne Massage und ein Aufguss in der Sauna, das ist jetzt genau das Richtige. Diese Juckerei kommt garantiert vom Stress. Ich werde meine Freischicht ausgiebig genießen und ausspannen.
Als Memde Abimola einige Stunden später an der Bar des Freizeitzentrums saß, vor sich ein Energiegetränk und ein paar Chickenwings vom ertrusischen Wurgahuhn mit Chilisoße, hatte er sein Ziel erreicht: Er war vollkommen entspannt. Erstaunlich, was für einen Effekt es hat, sich mal so richtig durchkneten zu lassen.
Er bedauerte zwar, dass auf dem Raumschiff keine menschlichen Masseure zur Verfügung standen, denn an deren Fingerspitzengefühl kam keine Maschine heran. Doch auch der Massageroboter hatte seine Sache erstaunlich gut gemacht. Jede Verspannung war aus Abimolas Körper gewichen, und vom Juckreiz merkte er überhaupt nichts mehr.
»Hallo, Memde«, erklang eine schüchterne Stimme neben ihm.
Er wandte den Kopf und grinste breit. Es war Donna Stetson, eine Positronikpsychologin aus dem SENECA-Team. Die beiden hatten sich vor einiger Zeit im Freizeitzentrum kennengelernt, als Memde Abimola über seinem Ayobrett brütete. Zu seiner Überraschung hatte Stetson ihn angesprochen, weil sie das traditionelle Yorubaspiel kannte und ihn zu einer Partie auffordern wollte. Inzwischen trafen sie sich häufig zu Ayospielen.
»Hallo, Donna«, gab er die Begrüßung zurück. »Ich fürchte, heute habe ich keine Zeit für eine Partie – mein Dienst beginnt gleich.«
»Meiner auch.« Stetson sah ihn mit ihren weit auseinanderstehenden, graugrünen Augen an, ernsthaft wie immer. Obwohl sie so etwas wie Freunde geworden waren, hatte Abimola die junge Frau bislang nur selten lächeln sehen. Sie hatte nicht viele Freunde an Bord, denn sie war introvertiert und wirkte in den Augen vieler etwas verschroben. Sie hatte ihm gegenüber selbst zugegeben, auf dem Feld zwischenmenschlicher Interaktion ihre Defizite zu haben.
Er indes kam gut mit ihr klar, und er war sicher, dass sie viel mehr Freunde haben könnte, wenn sie bereit wäre, auf andere zuzugehen. Mittlerweile wusste er, dass sie ihn damals nur auf das Ayospiel angesprochen hatte, weil sie so begeistert gewesen war, jemand anderen zu treffen, der es kannte.
»Was hast du hier getrieben?«, fragte Abimola. Stetson hatte, von ihren Spielpartien abgesehen, nicht viele Hobbys, die sie ins Freizeitzentrum führten.
»Ich war ein paar Bahnen schwimmen.« Sie setzte sich neben ihn auf einen Barhocker.
Er musste grinsen. Sie gaben wahrscheinlich ein skurriles Bild ab: die kleine, blasse Donna Stetson und Mende Abimola, ein breitschultriger, fast zwei Meter großer Yoruba mit ebenholzschwarzer Haut. Ein Gegensatz, wie er größer nicht sein könnte.
»Du schwimmst immer nur, wenn du ein Problem zu lösen hast«, sagte er. »Macht SENECA dir Kummer?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, SENECA ist toll – ein echter Schatz.« Vermutlich war Stetson die Einzige an Bord der CREST II, die von der Positronik auf diese Weise sprach. Angeblich war der Hauptrechner des Raumschiffs auf dem Weg, eine tatsächliche Künstliche Intelligenz zu werden. Abimola verstand nicht viel davon. Stetson hingegen redete immer voller Begeisterung darüber.
»Was ist es dann? Wieder Ärger mit Kollegen?«
Sie nickte und verzog unglücklich den Mund. Am liebsten hätte er sie tröstend in den Arm genommen, denn in solchen Momenten wirkte die junge Frau wie ein trauriges Kind. Doch er wusste, dass sie mit Körperkontakt nicht besonders gut umgehen konnte.
»Gina Rossi aus dem SENECA-Team hält mich offenbar für unqualifiziert. Sie redet mit mir, als ob ich fünf Jahre alt wäre.«
»Dann sag ihr, dass sie das lassen soll.« Abimola seufzte. Er hatte Stetson häufig genug zugeredet, dass sie sich durchsetzen solle. Aber es fiel ihr unendlich schwer. »Sie hat kein Recht, so mit dir umzugehen. Ich wette, du bist viel cleverer als sie.«
Sie lächelte wie gewöhnlich nicht, doch er sah die Freude in ihren Augen. »Es ist nett, dass du das sagst. Manchmal, wenn sie so mit mir redet und ich nicht weiß, wie ich reagieren soll, komme ich mir gar nicht clever vor.«
»Das ist ...« Ein scharfer Schmerz schoss Memde Abimola durch den Kopf. Er sog heftig die Luft ein. Und da war er wieder: der Juckreiz. Sein Gesicht kribbelte, als marschiere eine Ameisenarmee über seine Haut. Er wischte sich fahrig über das Gesicht.
Stetson betrachtete ihn verwirrt. »Geht es dir gut?«
Er stand auf. »Ich kann nicht weiter mit dir reden«, murmelte er. »Ich muss mich für den Dienst fertig machen.«
»Oh«, sagte Donna Stetson. »Okay.«
Ohne sich zu verabschieden, ging Memde Abimola. Er kehrte in sein Quartier zurück und zog seine Dienstkleidung an, konnte dabei keinen klaren Gedanken fassen. Das Jucken trieb ihn fast in den Wahnsinn. Dazu hatte sich ein drückender Kopfschmerz gesellt, der seinen Schädel zum Bersten bringen wollte. Als er den Leitstand der Reaktorsektion erreichte, war ihm speiübel. Und das sah man ihm wohl an.
»Abimola, was ist denn mit Ihnen los?«, fragte Isadora Phelps, die derzeit diensthabende Ingenieurin.
»Alles in Ordnung, Ma'am«, brachte Abimola hervor. »Ich ... Es juckt nur wieder ein bisschen.«
»Sie sehen aus, als hätte man Sie durch den Fleischwolf gedreht.« Phelps schürzte die Lippen. »So lasse ich Sie auf keinen Fall Dienst machen. Sie gehen sofort auf die Medostation und lassen sich durchchecken, klar?«
»Zu Befehl, Ma'am.«
2.
Krisensitzung
Wenige Stunden zuvor
Es tat gut, wieder an Bord der CREST II zu sein. Perry Rhodan freute sich über jede Gelegenheit, wenn er mit seinen beiden Söhnen zusammenarbeiten konnte, wie während der Mission ins Capellasystem. Doch er war froh, dass die NATHALIE nun im oberen Haupthangar des 1500-Meter-Kugelraumers abgestellt war. Er fühlte sich auf dem Raumboot seiner Söhne immer nur wie ein Gast – und das war er schließlich auch. Mit der CREST II war es etwas völlig anderes. Jeder Schritt gab ihm das Gefühl von Vertrautheit, fast von Heimat. Er kam sich auf dem Weg zum Konferenzraum etwas albern vor, weil er das Bedürfnis verspürte, wie ein alter Farmer auf seinem Land überall nach dem Rechten zu sehen. Trotzdem nutzte er den Weg, um einen kurzen Blick in die verschiedenen Abteilungen zu werfen, an denen er vorbeischlenderte.
Vielleicht hatte seine Stimmung etwas damit zu tun, was auf Plophos geschehen war. Nach den Erlebnissen dort tat es gut, dass es immer noch Menschen gab, die an die Terranische Union glaubten und sich in ihren Dienst stellten.
»Bei Ihnen alles in Ordnung, Rufus?«, rief er dem Chefingenieur jovial zu, als er seinen Kopf kurz in dessen Arbeitsraum steckte.
»Sicher, Sir«, antwortete Rufus Darnell perplex; es war an Bord der CREST II nicht üblich, dass Vorgesetzte Kontrollrundgänge unternahmen.
Darnells Gesichtsausdruck brachte Rhodan dazu, sein Tun zu unterlassen und einfach weiter zur angesetzten Besprechung zu gehen. Er hatte nicht vor, seine Mannschaft zu verwirren. Schließlich hatte er eigentlich mit der Schiffsführung nichts zu tun. Nicht, dass mich unsere Leute noch für einen Kontrollfreak halten ...
Auf halbem Weg zum Konferenzraum meldete sich Rhodans Multifunktionsarmband. Das Komsignal verriet ihm, wer ihn kontaktieren wollte, und er runzelte die Stirn.
»Reg, was ist so dringend, dass du es mir nicht in zwei Minuten sagen kannst?«, fragte Rhodan, nachdem er die Audioverbindung angenommen hatte. Reginald Bull würde nicht persönlich im Konferenzraum sein, sondern per Holo zugeschaltet werden. Der Systemadmiral und derzeitige Protektor der Terranischen Union war mit der TERRANIA unterwegs.
»Ich wollte zuerst unter vier Augen mit dir reden – oder eher unter vier Ohren«, drang Bulls Stimme aus dem Akustikfeld.
Rhodan blieb stehen und sah sich um. In der Nähe war die Tür zu einem kleinen Positronikraum, in den er sich nun begab. Wenn es Bull um ein vertrauliches Gespräch ging, wollte Rhodan es nicht unbedingt auf einem Gang führen, selbst wenn er mithilfe des Armbands ein schallisolierendes Feld um sich aufbauen konnte.
»Was ist los? Ist etwas auf Plophos vorgefallen?« Rhodan ließ die Tür mit einem Knopfdruck zugleiten.
»Nein, darum geht es nicht – dort ist die Lage nach wie vor schwierig.« Bull seufzte. »Diese Sturköpfe lehnen weiterhin jede Hilfe der Erde ab, was den Wiederaufbau angeht. Sie beharren auf ihrer Eigenständigkeit.«
»Nach Iratio Hondros Spielchen haben sie Angst davor, erneut in eine Abhängigkeit zu geraten, das ist nur verständlich.«
»Vielleicht, doch durchaus besorgniserregend. Nach Imart ist Plophos bereits die zweite Kolonie, die sich aus der Solaren Union lösen will ...«
»Mit Druck kommen wir dort nicht weiter. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Aber das ist nicht der Grund, warum du mich vorab sprechen wolltest?«
»Nein.« Bull klang ernst, und das alarmierte Rhodan. Sein Freund war sonst stets zu Scherzen aufgelegt, selbst wenn die Situation noch so schwierig war. »Die Verbindung nach Epsal im Altairsystem ist abgerissen.«
Kurz schloss Rhodan die Augen und atmete tief durch. Nicht noch eine Kolonie. Die Struktur der Union zerbröckelt immer mehr. »Wissen wir bereits Genaueres?«
»Leider nein. Wir haben nur einen verstümmelten Notruf empfangen. Und dann – nichts mehr. Das wird in der Beratung Thema sein, und ich wollte, dass du schon vorab davon weißt.«
»Danke. Das wird für Diskussionsstoff sorgen. Wir sehen uns gleich im Konferenzraum.«
Rhodan beendete das Gespräch und machte sich wieder auf den Weg. Zu seinen Sorgen war eine weitere hinzugekommen.
»Die Aussicht, mit Epsal eine weitere Kolonie zu verlieren, ist alarmierend.« Es war Maui John Ngata, der die düstere Prognose aussprach.
Im Konferenzraum hatten sich neben Rhodan und seiner Frau Thora auch ihre Söhne Thomas und Farouq versammelt, sodass es fast wie ein gemütliches familiäres Beisammensein gewirkt hätte – wenn nicht zugleich mehrere Kommunikationshologramme zugeschaltet gewesen wären. Lebensgroß, als wären sie tatsächlich vor Ort, saßen Reginald Bull, Stella Michelsen die Administratorin der Terranischen Union, sowie Nike Quinto, der Leiter der streng geheimen Abteilung III mit am Tisch. Ngata hatte man ebenso hinzugebeten – nicht nur, weil er als Präsident der Solaren Union die Auflösung seiner Schöpfung mit großer Sorge betrachtete, sondern auch, weil er ein exzellenter Ratgeber war.
»Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht«, sagte Michelsen. »Allein die wirtschaftlichen Folgen sind katastrophal.«
»Einmal davon abgesehen: Wir müssen natürlich nachsehen, was auf Epsal los ist – vielleicht braucht man dort unsere Hilfe«, meinte Thomas Rhodan da Zoltral, der wie immer pragmatisch dachte.
»Sicher – aber das ist nicht ganz einfach.« Perry Rhodan rieb sich die kleine Narbe an seiner Nase. »Denk an Plophos – dort war man nicht gerade erbaut davon, plötzlich die Terranische Flotte auf der Schwelle stehen zu haben, trotz aller Probleme. Wir müssen mit Fingerspitzengefühl vorgehen.«
»Wenn es auf Epsal ähnliche Probleme gibt wie auf Plophos, ist die Lage zu ernst, um zögerlich vorzugehen.« Bull legte die Hände aneinander und stützte sein Kinn darauf. »Ich habe Flottenkontingente in alle Kolonien geschickt, um die Lage zu überprüfen – natürlich mit Vorsicht. Und die ersten Rückmeldungen stimmen mich nicht gerade glücklich.«
Rhodan verspürte einen Knoten des Unbehagens in seinem Magen. »Was besagen sie?«
»Es scheint, dass sich weitere Planetenmaschinen durch eine Art Aktivierungsimpuls eingeschaltet haben und seither fremdartige Hyperimpulse abstrahlen.« Er sah Rhodan direkt an. »Diese Aktivierung erfolgte exakt zu dem Zeitpunkt, an dem du im Gadenhimmel die Neunturmanlage neu justiert und dadurch den Hyperstrudel von Sagittarius A* in immer schnellere Rotation versetzt hast.«
Der Knoten zog sich zusammen.
»Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert.« Thora Rhodan da Zoltral legte die Hände auf den Tisch.
»Mit guten Vorsätzen«, verbesserte Rhodan reflexartig.
Seine Frau warf ihm einen scharfen Blick zu, ignorierte die Bemerkung jedoch ansonsten. »Also dürfte auch die Planetenmaschine auf Epsal aktiv geworden sein.«
»Das würde mich nicht wundern«, sagte Rhodan. »Die einst von den Loowern erbaute Anlage im Gadenhimmel hat neun Türme – und in der Lokalen Blase gibt es neun Planetenmaschinen. Das ist kein Zufall. Nathalie sprach von einem zweiten Nonagon im Raumsektor der Solaren Union.«
»Du meinst also, pro Turm wurde eine Maschine in Gang gesetzt?« Farouq Rhodan da Zoltral legte den Kopf schief.
»Genau das.« Rhodan stieß den Atem scharf zwischen seinen Zähnen aus. »Wie ich sagte: Nathalie hat ein ›Nonagon‹ erwähnt. Ich bin mir ziemlich sicher – nein, eigentlich weiß ich, dass es sich dabei um die neun Kolonialwelten mit ihren Maschinen handelt, die gemeinsam eine gigantische weitere Neunturmanlage darstellen.«
»Aber wozu soll eine solch riesige Anlage benötigt werden?«, rätselte Michelsen. Man sah ihr an, dass ihr diese Thematik zu abstrakt war.
Sie war nicht dabei. Sie hat die Looweranlage nicht gesehen, und sie hat nicht mit Nathalie gesprochen.
»Darauf habe ich keine Antwort«, räumte Rhodan ein.
Bull prustete. »Und ich bin mir sicher, dass uns eine mögliche Antwort überhaupt nicht gefallen würde.«
»Wie auch immer sie lauten mag, wir werden sie im Hier und Jetzt nicht finden«, konstatierte Ngata. Missbilligend sah er zu Reginald Bull hinüber, dessen Blick sich sofort verfinsterte. Nach all den Jahren waren sich Bull und Ngata noch immer nicht richtig grün, auch wenn sie einander respektierten. »Ihr Engagement in allen Ehren, doch ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, Schiffe der TU in die Kolonien zu entsenden. Das aktuelle Verhältnis zwischen den Siedlern und der Terranischen Union ist nicht das allerbeste.«
»Das wissen wir alle«, mischte sich Quinto mit seiner hohen Stimme ein. »Die einen nehmen der Union die Tatsache übel, dass sie es nicht geschafft hat, Plophos von Iratio Hondro zu befreien. Die anderen sehen in ihm einen Freiheitskämpfer, der sich erfolgreich vom Joch der Erde gelöst und einen eigenen Weg eingeschlagen hat.«
Rhodan verstand, warum Quinto dieses Thema anschnitt. Die Rolle des ehemaligen Obmanns Hondro war Quinto ein besonderer Dorn im Auge, weil die Abteilung III den Kerl einfach nicht zu fassen bekommen hatte; nicht mal seine besten Agenten, die zufällig Rhodans Söhne waren. Thomas und Farouq Rhodan da Zoltral wirkten angemessen betreten. Für die beiden war Hondro ebenfalls ein frustrierendes Thema, weil er ihnen schon so oft durch die Finger geschlüpft war.
»Sir, wir sollten mit der CREST II nach Epsal fliegen und die Suche nach Hondro dort fortsetzen«, wandte sich Thomas an seinen direkten Vorgesetzten Quinto. »Ich habe das Gefühl, dass dieser Mistkerl auch da seine Finger im Spiel hat.«
»Soso, ein Gefühl? Wenn es Sie tröstet, mein Instinkt sagt mir etwas ganz Ähnliches. Und er hat mich selten in meinem Leben getäuscht.« Nike Quinto grinste breit. »Von meiner Seite aus haben Sie den Befehl, auf Epsal nach Hondro zu suchen. Sofern die CREST II zufällig ebenfalls diesen Weg einschlägt, können Sie gern mitfliegen.«
»Das wird sie auf jeden Fall.« Rhodan blickte auffordernd in die Runde. »Oder sieht das jemand anders? Mir ist klar, dass die politische Situation sensibel ist, John. Aber das Letzte, was wir von Epsal empfangen haben, ist ein Notruf. Das können wir nicht ignorieren.«
3.
Im Rechenherz
»Kaffeepause!«, rief Jonas Göller fröhlich quer durch das sogenannte Rechenherz – ein sechseckiger Glaskasten inmitten der Positronikzentrale der CREST II, in dem das neunköpfige SENECA-Spezialistenteam seine Arbeitsplätze hatte.
Grundsätzlich war ein fähiger Informatiker, Positronikpsychologe, IT-Techniker oder Programmierer von fast jeder Stelle des Raumschiffs aus in der Lage, mit SENECA zu arbeiten. Die Komponenten der Schiffspositronik waren dezentral überall an Bord verteilt; auf diese Weise würde selbst der komplette Ausfall mehrerer Untereinheiten nicht den Gesamtrechner lahmlegen.
Aber irgendwo muss jede Spezialeinheit ihr Hauptquartier haben – da ist die primäre Positronikzentrale der CREST II wohl für uns angemessener als eine verstaubte Nebenstelle auf einem der unteren Decks, dachte Donna Stetson.
Rechenherz – der Name gefiel ihr. Denn so fühlte sie sich in dem mit Bedienpulten und Holokonsolen vollgestopften Glaskasten: nicht nur rein örtlich in der Mitte der positronischen Bordaktivitäten, auch intuitiv nah beim Herzen von SENECAS Hauptkomponenten.
Sie sah zu Göller auf – er war Mitte vierzig und ein netter Kerl, der sie von Anfang an freundlich im Team aufgenommen hatte. Ihm zuliebe wäre sie gern mit zu der kleinen Kaffeepause gegangen, die sich die Spezialistengruppe etwa alle zwei Stunden gönnte. Doch sie wusste, dass sie derzeit keine gute Gesellschaft abgeben würde. »Dieses Mal ohne mich – ich muss noch etwas fertig machen«, sagte sie. »Ich halte hier die Stellung.«
Es war zwar nicht so, dass unbedingt jemand im Rechenherz zurückbleiben und Dienst schieben musste. In der Positronikzentrale arbeiteten zahlreiche weitere Fachleute, die ständig mit der Verbesserung der Basisroutinen und einer Anpassung der Grundprogrammierung beschäftigt waren. Denn auch ein selbstlernendes neuronales System wie SENECA benötigte Wartung und Kontrolle, damit seine Abermillionen, von elektrischen Impulsen gesteuerten Elemente getreulich das taten, was sie tun sollten.
Das SENECA-Team stellte lediglich eine Eliteeinheit unter diesen Fachleuten dar, die in drei Schichten arbeiteten. Sie waren diejenigen, die auf die eine oder andere Weise besonderen Zugang zu SENECAS Routinen und Funktionen fanden und versuchten, sein Wachstum nachzuvollziehen, zu dokumentieren und wenn möglich zu lenken. Sei es wie bei Jonas Göller, dem Programmierer, der ein spezielles Gespür für die binären Komplexitäten des Grundcodes hatte, oder wie bei Gina Rossi mit ihrem tiefgreifenden Verständnis für die neuronalen Strukturen, die sie als Biologin auf eine ganz andere Weise wahrnahm.
Dass Stetson seit einigen Wochen ebenfalls zu dieser illustren Runde gehörte, konnte sie noch immer nicht ganz glauben.
Rossi auch nicht, und das ließ sie Stetson wieder einmal spüren. »Unser Nerd-Girl ist wohl mit den Hausaufgaben nicht fertig geworden.« Rossis Stimme klang, als ob sie einen Witz machen wollte; wieder einmal bemerkte Stetson, dass die Augen ihrer Kollegin nicht mitlachten. Im Gegensatz zu »Rechenherz« war Nerd-Girl eine Bezeichnung, die Stetson nicht mochte. Rossi hatte ihn ihr am ersten Tag verpasst, nachdem Stetson auf speziellen Wunsch von SENECA in das Team berufen worden war. Rossi hielt hartnäckig an dem spöttischen Spitznamen fest, obwohl ihn keiner außer ihr benutzte.
Stetson senkte den Blick und erwiderte nichts, während Gina Rossi und Jonas Göller den Glaskasten verließen. Als die Türen hinter ihnen zuglitten, sperrten sie das eifrige Raunen und Tuscheln des umliegenden Großraumbüros aus und schlossen Stetson in Stille ein.
»Warum hat Miss Rossi diese Bemerkung gemacht?«
Als SENECAS Stimme urplötzlich in die Ruhe des Glaskastens hallte, wäre sie beinahe vor Schreck vom Sessel ihrer Arbeitsstation gefallen. Sie hatte eine halb liegende Sitzposition eingestellt, obwohl sie lieber im Stehen arbeitete. Doch derzeit fühlte sie sich erschöpft, und wahrscheinlich reagierte sie deshalb schreckhaft auf SENECAS Äußerung.
Eigentlich sollte Stetson mittlerweile daran gewöhnt sein, denn SENECA hatte sie bereits mehrfach angesprochen, wenn sie allein im Rechenherz war. Und soweit sie wusste, war sie die Einzige, der SENECA so viele Fragen stellte.
»Du meinst Gina Rossi?« Stetson zog ihre Holotastatur wie einen Schutzschild näher an sich heran. »Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht in der Lage, in ihrer Feindseligkeit mir gegenüber einen Sinn zu erkennen.«
SENECA und Donna Stetson hatten zwei Dinge gemeinsam: ihr Problem, die Logik menschlichen Verhaltens zu durchschauen, und ihren Willen, diesen Umstand durch Nachforschungen zu verbessern.
»Ist sie wütend, weil Sie nicht mit in die Kaffeepause gegangen sind?«
»Ich weiß es nicht. Aber ich denke, sie ist eigentlich ganz froh, dass ich hiergeblieben bin. Und ich bin es auch.«
»Wie meinen Sie das?«
Sie tippte ein paar Zahlen ein, um eine Subroutine neu zu parametrisieren. SENECA hatte festgestellt, dass in jüngster Zeit gegen Mitte der Freischichten vermehrt Eiswürfel im Freizeitzentrum benötigt wurden, was die KI auf ein neues Modegetränk namens »Sagittarius-Sternenzauber« zurückführte. Deshalb wollte die Positronik die Produktion entsprechend umstellen, um energieeffizienter zu arbeiten. Solche minimalen Korrekturen waren im Grunde keine Aufgabe für das SENECA-Team; Stetson hatte sich einfach etwas gegriffen, um eine Ausrede zu haben. Sie überlegte, wie sie SENECA ihr Dilemma verständlich machen konnte. Sie begriff es selbst nicht gänzlich.
»Ich habe das Gefühl, heute keine angenehme Gesellschaft zu sein, selbst wenn Gina Rossi kein Problem mit mir haben sollte. Ich hatte ein irritierendes Erlebnis und möchte lieber für mich sein, um darüber nachzudenken.«
»Das bedauere ich.« Eine programmierte Floskel. Natürlich konnte eine emotionslose KI kein Bedauern empfinden. »Soll ich die Unterhaltung mit Ihnen beenden?«
»Nein, schon gut.«