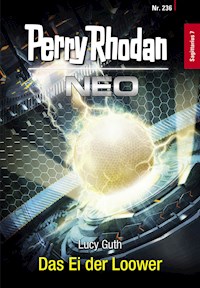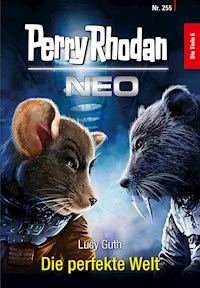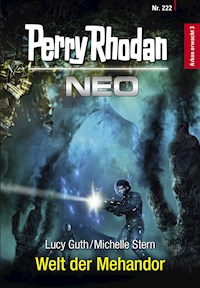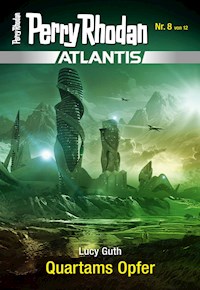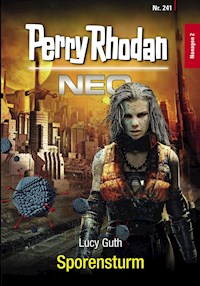Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2116: Nachdem die Menschen zahlreiche Schwierigkeiten überwunden haben, hoffen sie auf eine friedliche Zukunft. Auf der Erde und den Kolonialwelten arbeitet man vertrauensvoll an gemeinsamen Projekten, häufig zusammen mit Partnern aus anderen Sternenreichen. Aber dann erscheint ein neuer Gegner: ein mysteriöser Junge mit blauen Haaren, der Laumae heißt, sich aber auch als Primat bezeichnet. Er hat ein klares Ziel: Perry Rhodan muss sterben. Nur wenn Rhodan getötet wird, so glaubt Primat, ist es möglich, eine Katastrophe von der Milchstraße abzuwenden. Es gelingt zwar, Laumae zeitweilig festzunehmen. Er kann jedoch entkommen und taucht in einer der Kuppelstädte des Erdmonds wieder auf. Als er dort ein verheerendes Chaos anrichtet, greifen Perry Rhodan und seine Gefährten ein. Sie wollen den Amoklauf von Primat beenden – dabei geraten sie in schwere MONDBEBEN ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 335
Mondbeben
Lucy Guth
Michael Tinnefeld
Cover
Vorspann
Prolog
1. Der Wal und das Feuer
2. Die Sache mit den Gefühlen
3. NATHANS eigenes Süppchen
4. Vier Frauen und ein Mausbiber
5. Mesh-Gerüchte
6. Was wirklich geschah
7. Verwirrt I
8. Eine Art Rettungsmission
9. Erd-Sonnenaufgang
10. Verschüttet
11. Man hat immer eine Wahl
12. Selene City
13. Zombie-Apokalypse
14. Die Spur verliert sich
15. Es wird kalt
16. Nicht doch!
17. Verwirrt II
18. In den Untergrund
19. Der Schrank springt auf
20. Durch die Reaktorhallen
21. Bruchlandung
22. Der Tau des Himmels
23. Nichts Besonderes
24. Träume aus Asche
25. Keine Erlösung
Epilog
Impressum
PERRY RHODAN – die Serie
Im Jahr 2116: Nachdem die Menschen zahlreiche Schwierigkeiten überwunden haben, hoffen sie auf eine friedliche Zukunft. Auf der Erde und den Kolonialwelten arbeitet man vertrauensvoll an gemeinsamen Projekten, häufig zusammen mit Partnern aus anderen Sternenreichen.
Aber dann erscheint ein neuer Gegner: ein mysteriöser Junge mit blauen Haaren, der Laumae heißt, sich aber auch als Primat bezeichnet. Er hat ein klares Ziel: Perry Rhodan muss sterben. Nur wenn Rhodan getötet wird, so glaubt Primat, ist es möglich, eine Katastrophe von der Milchstraße abzuwenden.
Es gelingt zwar, Laumae zeitweilig festzunehmen. Er kann jedoch entkommen und taucht in einer der Kuppelstädte des Erdmonds wieder auf. Als er dort ein verheerendes Chaos anrichtet, greifen Perry Rhodan und seine Gefährten ein. Sie wollen den Amoklauf von Primat beenden – dabei geraten sie in schwere MONDBEBEN ...
Prolog
»Der Countdown läuft. Die Werte im ultrahochfrequenten Band sind eindeutig. Zeta-Phase. Der Prozess läuft.«
Analyse: Froul Kaveer, Präliminarien
1.
Der Wal und das Feuer
Pina Hailamas Lieblingspflanzen starben ab.
Da die Niedrigschwerkraft des Erdmonds hektische Bewegungen bestrafte, ging Hailama routiniert bedächtig in die Hocke. Sie strich ihre braunen, schulterlangen Haare nach hinten und aktivierte die Stirnkamera, die mit ihrem Multifunktionsarmband gekoppelt war. Das Gerät würde alles in Bild und Ton aufzeichnen, was in Hailamas Sichtfeld geschah. Die Neunundvierzigjährige arbeitete in einer Hydroponikanlage am westlichen Stadtrand von Selene City und war Biochemikerin mit Leib und Seele. Sogar in ihrer Stadtwohnung im Zentrum unterhielt sie ein kleines Labor und teilte alles, was das Zusammenspiel zwischen Pflanzen, Erdreich und chemisch-physikalischen Wechselwirkungen betraf, mit ihrem Mesh-Publikum.
»Ist die Wasserversorgung der hydroponischen Anlage defekt?«, begann sie ihren Bericht laut.
Knapp und auch für Laien leicht verständlich, beschrieb Hailama für ihre späteren Zuschauer alles, was sie tat. Dies war mit ihrem Vorgesetzten Hector DeWisch abgesprochen. Denn die hydroponischen Gärten wurden zwar von der Stadtverwaltung betrieben, waren der Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich.
Um ein eigenes Mikroklima zu gewährleisten und einen nachteiligen Austausch mit der Stadtluft zu verhindern, überspannte eine oval geformte, undurchsichtige Kuppel das künstlich bewässerte und beleuchtete Biotop. Der kleine Dom bildete einen separaten Bereich innerhalb der deutlich größeren Kernkuppel, die Selene City mit einem Basisdurchmesser von zehn Kilometern überspannte. Einige weitere Stadtteile und Vororte lagen unter externen Nebenkuppeln, die mit dem Hauptdom sowie untereinander verbunden waren. Das komplexe Kuppelsystem bot zwei Millionen Einwohnern Schutz.
Sofern es keine Projekte betraf, deren Ergebnisse von der Mondregierung in Cape Armstrong noch nicht für die Allgemeinheit freigegeben waren, hatte Hailama DeWischs offizielle Genehmigung. Sie durfte ihre audiovisuellen Drei-D-Inhalte frei im Mesh zur Verfügung stellen, dem interstellaren Kommunikations- und Datennetz, das normalerweise sämtliche Welten der Terranischen Union, der TU, miteinander verband.
Ihr Vorgesetzter teilte ihre Begeisterung für die Lunarbotanik ohnehin und war sich nicht zu fein, sich auch selbst schmutzig zu machen. Das mochte sie an ihm. Wie Hailama kroch wohl auch er gerade zwischen Pflanzen und Sträuchern herum. Hailamas Kollegin Kari Valma hatte an diesem Vormittag ebenfalls Dienst. Stimmfetzen der beiden drangen schwach zu ihr herüber.
Hailama betastete die untersten Blätter der Mammut-Sigastaude, die auf dem Humus auflagen. Sie kräuselten sich, waren welk und bräunlich verfärbt. Die Biochemikerin wendete die Blätter, betrachtete ihre Unterseite und kommentierte: »Keinerlei Anzeichen von Pilzbefall.« Sie fischte eine stabförmige Sonde, doppelt so lang wie ihr Zeigefinger, aus einer Tasche ihrer Arbeitsmontur und schob sie ins Erdreich. Die Spitze leuchtete rot auf.
Das erhärtete ihren Verdacht. »Die Wasseraufnahme über das flache Wurzelwerk der Staude ist gestört. Was seine Ursache in der künstlichen Bewässerung im Boden haben muss. Laut der Überwachungspositronik liegt jedoch keine Störung vor.«
Sie sah sich um. Die Nachbarstauden wiesen dieselben Verfärbungen auf. Bei einigen erreichte die Gelbfärbung bereits die Spitzen der schlanken Pflanzen, die eine maximale Wuchshöhe von einem Meter hatten.
Blätter raschelten, als sei Wind aufgekommen. Unmöglich, dachte Hailama, die hydroponische Anlage ist ein geschlossenes System.
Das Rascheln nahm zu. Sie erhob sich. Wahrhaftig! In einiger Distanz schwangen Äste und Blätter von Obstbäumen hin und her. Was auch immer diese Unruhe ausgelöst hatte – es näherte sich.
Ein Beben lief wie eine Welle durch den Boden. Hailama verlor in der geringen Gravitation für einen Moment den Kontakt zum Untergrund, bevor sie wieder aufsetzte und sachte mit den Armen ruderte, bis sie ihr Gleichgewicht zurückgewann. Die Welle schüttelte die Pflanzen, bewegte sich von der Biochemikerin weg und setzte sich knapp hundert Meter weit bis zur Kuppelwand fort.
Ein lauter Akustikalarm gellte auf.
»Hector! Kari!«, rief Hailama ihren Vorgesetzten und ihre Kollegin. »Was geht hier vor?«
Ein gutes Stück entfernt tauchten deren Köpfe aus dem Pflanzenreich auf. Sie blickten sich irritiert um.
Kari Valma zeigte aufgeregt in die Luft. Bevor Hailama dort etwas erkennen konnte, riss ein zweiter, ungleich heftigerer Erdstoß sie von den Beinen. Sie stürzte, konnte sich aber mit Armen und Händen abfangen. Sie vernahm ein beängstigendes Knirschen, als habe die Statik der bogenförmigen Kuppelträger Schaden genommen.
Die Helligkeit ringsum nahm ab. Hailama vermutete, dass einige der Normallicht- und UV-Fluter der Hallendecke ausgefallen waren. Metall zersprang mit gequält klingendem Kreischen. Die Biochemikerin vernahm einen Schrei. War das Valma gewesen? Oder DeWisch? Noch auf den Knien hockend, sah Hailama auf. Etwas schob sich vor die Lampen in der Kuppeldecke und zerriss die dortige Sprinkleranlage.
Warum tritt aus den beschädigten Leitungen kein Wasser aus,? dachte sie.
Das Etwas, das die Verdunkelung verursachte, wirkte auf absurde Art und Weise lebendig. Es schwebte meterhoch über Hailamas Kopf, wuchtig, mit einer blau-grauen, borkig anmutenden Haut, übersät von hellen, pockenartigen Erhebungen. Dazu kam ein riesiges, halb geöffnetes Maul. Zum entgegengesetzten Ende hin lief das Ding schlank aus, um sich abschließend horizontal aufzufächern. Eine Schwanzflosse! Hailama erinnerte sich nur widerwillig. Ihr war der Anblick vertraut. Sie hatte so etwas schon als Kind gesehen, in ihrer Heimat Hawaii. Vielleicht auch später, in ... Aber daran wollte sie nicht denken.
Das Wesen maß zehn Meter oder mehr und hatte keine Zähne im Maul, sondern etwas wie Lamellen. Nichts Geringeres als ein Wal, möglicherweise ein Grauwal, schwebte über ihr und bewegte die Schwanzflosse träge auf und ab.
War Hailama verrückt geworden? Es gab keine Tiere im Umkreis, erst recht keine in dieser Größe und durch die Luft schwebend. Aber DeWisch und Valma mussten das Ding ihren Reaktionen zufolge ebenfalls gesehen haben.
Weitere Meereslebewesen schwammen durch die Luft, gesellten sich zu dem Wal, zerstörten die verbliebenen Reste der Sprinkleranlage und verursachten eine weitere Verdunklung der Halle. Delfine? Haie? Hailama wollte es nicht konkret wissen. Sie lebte auf dem Mond, hatte die Erde hinter sich gelassen. Von irgendwoher flackerte es.
Etwas schob sich zwischen den Stauden auf die Biochemikerin zu. Es raschelte, und sie gewahrte einen dunklen Umriss. Sie machte sich flucht- und sprungbereit. Sie wusste um ihre gute Körperbeherrschung. Auch bei geringer Schwerkraft erreichte sie schnell eine hohe Laufgeschwindigkeit. Sie griff nach einem Astschneider und hob ihren Arm.
»Pina! Ich bin's«, rief die füllige Valma schnaufend, die auf allen vieren auf sie zukroch.
»Was ... Was bedeutet das?« Hailama wies nach oben. »Und was ist mit Hector?«
Valma benötigte ein paar Sekunden, um Atem zu holen. Beide Frauen blieben in der Hocke. »Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er konnte sich in Sicherheit bringen. Hinter mir ist Feuer ausgebrochen.«
Das Flackern! Nun konnte Hailama es auch riechen. Rauchschwaden breiteten sich aus. Und war da nicht ein Knistern? Wo blieben die verdammten Sicherheitsroboter?
»Wir müssen hier raus!« Hailama wies nach Süden. »Dort ist der nächste Ausgang.«
Sie hob den Kopf. Hinter Valma stiegen Funkennester auf und berührten die Ozeantiere, die nach wie vor über ihnen kreisten. Der Schwarm geriet in Bewegung. Der Wal schob sich voran, senkte sich herab. Die beiden Frauen ließen sich flach auf den Bauch fallen. Der Koloss wälzte sich wenige Handbreit über ihren Köpfen vorbei und rasierte dabei die Spitzen der Stauden ab. Äste knackten, als er durch die Obstplantage pflügte. Die anderen Fische folgten ihm.
»Was für ein Albtraum!«, japste Valma. Ihre Finger gruben sich in Hailamas Knöchel. »Woher kommen diese Viecher? Sind das Aliens? Oder dreht NATHAN durch?«
NATHAN? Seltsamerweise hatte Hailama selbst schon an die Hyperinpotronik gedacht. Aber einen Zusammenhang mit diesen Wesen und ihrem Angriff konnte sie nicht herstellen. Handelte es sich überhaupt um einen Angriff?
Wieder splitterten Äste in unmittelbarer Nähe. Diesmal war es nicht der Wal. Einer der kleineren Fische – ein Hai? – schwebte heran und tauchte in die ohnehin schon malträtierte Pflanzenwelt. Er hielt geradewegs auf Hailama und Valma zu.
»Los!« Die Biochemikerin richtete sich auf und ergriff beherzt die Hand ihrer Kollegin.
Valma, deren Gesicht vor Panik verzerrt wirkte, sprang zu kraftvoll auf. Sie hob vom Boden ab und zog Hailama ein Stück mit, sodass beide in der Luft schwebten. Der Hai war sofort heran, änderte aber im letzten Moment seine Richtung, als habe etwas anderes sein Interesse erregt. Seine Schwanzflosse streifte Hailama und drückte ihr wie mit einem Boxhieb die Luft aus dem Brustkorb.
Sie fiel neben ihrer Freundin auf den Rücken. Für einen bangen Moment befürchtete sie, nicht mehr atmen zu können. Wahrscheinlich waren einige Rippen geprellt. Endlich strömte Luft in ihre Lungen. Sie war rauchig.
Hailama presste die Zähne zusammen und richtete sich wieder auf. Hinter ihnen loderten Flammen in einer undefinierbaren Schwärze. Vom Wal und anderem fliegenden Getier war momentan nichts zu sehen.
Ein neuer Schrei. Stammte er von DeWisch? Hatte ihr Vorgesetzter es nicht geschafft, sich in Sicherheit zu bringen? Etwas wuselte durch die pflanzlichen Überreste. Ein blauer Haarschopf. Der Rauch wurde dichter und nahm Hailama die Sicht.
»Komm!« Sie spürte ein Zerren am Arm. Valma zog sie Richtung Ausgang. »Wir haben es gleich geschafft.«
Hailama blickte sie an. »Da ist ein Kind. Glaube ich. Wir müssen es vor dem Feuer retten.«
»Bist du verrückt? Wie sollte ein Kind hier reinkommen, ausgerechnet jetzt? Wir müssen ...« Ein Hustenanfall schüttelte Valma.
Hailama riss sich von Valma los und machte kehrt. Die Freundin rief ihr etwas hinterher, das Hailama nicht mehr verstand. Hailamas Blick huschte suchend über die zerstörten Pflanzen. Inzwischen waren sämtliche Kunstlichter ausgefallen. Es gab nur noch das durch den Brand verursachte, verwirrende Spiel aus Licht, Schatten und Rauch.
Da! Wieder sah Hailama einen Haarschopf. Und ein ausgezehrtes Gesicht. Waren die Haare vorhin wirklich blau gewesen? Im Flackern des Feuers schimmerten sie dunkelblond, fast aschefarben, was am fehlenden Weißlicht liegen mochte.
»Hey, du!«, rief sie. Geschickt stieß sie sich in flachem Winkel ab, trat wieder auf, ignorierte die Schmerzen in den Rippen, stieß sich erneut ab, immer schneller, und beschleunigte auf diese Weise im bestmöglichen Verhältnis aus Kraft und Gleichgewicht.
Es war ein Junge, der vor den Flammen floh. Er hatte offenbar die Orientierung verloren und kam mit der schwachen Mondschwerkraft nicht zurecht. Immer wieder sprang er ungewollt zu weit in die Höhe und strampelte mit Armen und Beinen. Vier helle Felder schimmerten durch die Dunkelheit und den Rauch zu ihnen, markierten die nächstgelegenen Notausgänge. Der Junge nahm sie nicht wahr.
Hailama rief ihn erneut, so laut es ihr schmerzender Brustkorb zuließ. Er hielt inne und sah sich hektisch um. Er erspähte die Biochemikerin, die in einem Bogen auf ihn zuflog. Seine Augen weiteten sich. Er lehnte den Oberkörper zurück, als wolle er vor Hailama fliehen – in Richtung des Feuermeers.
»Warte!«, schrie sie und atmete flach, um keinen Hustenanfall zu bekommen. »Ich will dir helfen. Ich kenne den Weg hier raus.«
Helle Flammen schlugen in die Höhe. Hitze breitete sich aus. Der Junge zögerte.
Dann war Hailama heran und packte ihn an den Schultern, drückte ihn in Richtung des nächsten Ausgangs. Aber er war wie versteinert und setzte ihr Widerstand entgegen. Mit weiterhin aufgerissenen Augen starrte der Junge an ihr vorbei.
Sie folgte seinem Blick. Das Kind hatte keine Angst vor ihr gehabt, sondern vor dem, was auf sie zukam. Hinter Hailama näherte sich der Wal. Er schlitterte über den Boden wie über eine ölige Fläche. Die noch verbliebenen Äste und Pflanzenreste flogen wie Geschosse zur Seite. Das Ungetüm durchbrach alle Flammen, die in seinen Weg schlugen, und schob brennendes Buschwerk vor sich her.
Es war keine Zeit und kein Raum mehr, um auszuweichen. Hailamas Knie gaben nach, sie sackte zu Boden, zusammen mit dem Jungen. Beide streckten die Arme von sich, als könnten sie sich auf diese Weise vor dem Unheil, das auf sie zuraste, noch wegducken.
Vergebens. Der Tod war da – und berührte Hailama. Das Feuer griff nach ihr. Es raubte ihr den Atem, versengte ihr die Haut, Wimpern und Haare.
Allerdings war es danach nicht der Wal, der sich über sie und das Kind hinwegschob und sie zermalmte. Stattdessen stürzte eine Wolke aus schwarzer, wirbelnder Asche auf sie nieder. Hailama schrie. Aber es war keine Hitze, die sie verbrannte. Die dicken, rußigen Flocken waren kalt. Eiskalt. Die Kälte stach wie Nadeln durch ihre Haut, durch ihr Fleisch, erreichte die Knochen, fuhr die Arme herauf, sammelte sich im Nacken und stieß wie ein auf den absoluten Nullpunkt abgekühlter Dolch in ihr Gehirn.
Eine Erinnerung flutete in ihr Bewusstsein ...
Sie war so müde. Und traurig. Alles war schwer. Wozu sich noch aufraffen? Sie umklammerte ihren Plüschhaluter – das Letzte, was ihr geblieben war. Eigentlich war sie zu alt für ein Stofftier. Wenn sie ins Heim ginge, müsste sie auch ihn aufgeben. Wollte sie das? Wollte sie das letzte Vertraute loslassen und weiterhin vorspielen, keine Immune zu sein? Wie sollte das gehen? Sie hatte keine Kraft mehr. Und wozu überhaupt? Es würde ja niemals wieder besser werden.
Ihre Mutter war tot. Sie war ermordet worden. So viele Jahre hatte sie unter Aphilikern gelebt und überlebt. Mama hatte Pina von klein auf beigebracht, wie man verheimlichte, eine Immune zu sein. Wie man nicht auffiel, denn sonst konnten schlimme Dinge passieren. Ganz schlimme Dinge. So wie in diesem Augenblick.
Ein Arbeitskollege war ihrer Mutter auf die Schliche gekommen und hatte sie angeschwärzt. Pina wusste nicht, wie Mama zu Tode gekommen war. Eine andere Arbeitskollegin, ebenfalls eine Immune, die im selben Haus lebte, hatte Pia gerade noch gewarnt.
Kurz danach waren die Häscher gekommen und hatten sie mitgenommen.
Mit ausdruckslosem Gesicht hatte Pina auf der Bettkante gehockt. Die Ausdruckslosigkeit musste sie nicht mal vorspielen. Den Plüschhaluter hatte sie zuvor im Zimmer ihrer Mutter versteckt. Nicht, um ihn eines Tages wiederzufinden. Sie machte sich keine Illusionen Sie würde ihn nie wiedersehen. Genauso wie sie niemals mehr einen Fuß in die kleine Wohnung in dem verfluchten Zwanzigtausendseelenort an der nordamerikanischen Westküste setzen würde, gefühlte Lichtjahre von ihrer eigentlichen Heimat entfernt. Wo sie sich sicher gefühlt hatte. Warum nur hatten sie Hawaii verlassen? Es musste irgendwas mit dem Widerstand zu tun haben. Ihre Mutter hatte nur bruchstückhaft darüber gesprochen. Um sie zu schützen, wie sie gesagt hatte.
Pina hatte alles, was sie als Immune hätte verraten können, loswerden müssen. Und was war naheliegender und glaubwürdiger, als das Stofftier im Zimmer ihrer enttarnten Mutter zu verstecken, neben anderen Dingen, deren Besitz die Aphiliker als Beweis für eine Gefühlskrankheit einstufen würden?
Es war ihr zwar wie Verrat an ihrer Mutter vorgekommen, die Pina nie mehr wiedersehen würde und von der sie sich nicht hatte verabschieden können. Aber das war die beste Tarnung, und so hätte Mama es gewollt. Wie sehr Pina gewünscht hatte, dass dieser Ernstfall niemals eintreten würde!
An diesem Tag, kurz nach ihrem zwölften Geburtstag, war es doch geschehen.
Vielleicht würden sie den Plüschhaluter unter den anderen gefühlsduseligen Dingen ihrer Mutter nicht finden. Pina klammerte sich an diese Hoffnung. Irgendwie gab ihr das Halt. Der einzige Halt, den sie hatte, als die Männer sie abholten.
Sie brachten sie in eins der Kinderheime, aus denen genauso wenig nach außen drang wie aus den Stummhäusern. Niemand wusste konkret, was man dort mit den Kindern und Jugendlichen anstellte. Experimente? Folter?
Pina dachte nicht darüber nach. Es war ihr egal. Ihre Mutter war tot. Was sollte es Schlimmeres geben? Sie musste auch diesen Gedanken sofort wieder verdrängen, weil sie Traurigkeit in ihrer Brust aufsteigen spürte. Tränen würden sie verraten! Fragen, die wie Verhöre wirkten, ließ sie stoisch über sich ergehen. Natürlich waren die Aphiliker skeptisch. Eine Immune mit einer aphilischen Tochter? Hatte nicht doch etwas Emotionales auf das Kind abgefärbt? War Pina kontaminiert? ...
Kräftige Arme zerrten Hailama in die Gegenwart zurück sowie sie und den Jungen auf die Füße. Sie taumelte und fand ihr Gleichgewicht erst wieder, als Valma eine Hand auf ihre Schulter legte. Mit der anderen schob die Kollegin Hailama und das Kind vor sich her. Bis auf ein gelegentliches Flackern war es dunkel. Dicker Rauch hatte sich breitgemacht. Hailama hielt sich ein Stück Ärmeltuch vor den Mund, um nicht dauerzuhusten.
Valma stieß Hailama und den Jungen durch zwei selbsttätig hintereinander auf- und wieder zugleitende Doppeltüren, die eine ähnliche Funktion wie eine Raumschiffschleuse erfüllten.
Endlich! Endlich waren sie draußen. Hailama sog frische Luft ein. Nicht zu tief, denn dann war es, als stießen Messer in ihre Rippen. Dennoch: Wie gut das tat!
Sie öffnete die zusammengekniffenen Augenlider. Und zuckte zusammen, als etwas Großes in die hydroponische Anlage schmetterte, in der das Feuer gewütet hatte. Wieder bebte der Boden, wieder hieß es, die Beine in die Hand nehmen und wegrennen.
2.
Die Sache mit den Gefühlen
Haki Robinson riss die Augen auf, als sein Privatschweber auf einer der Gleiterbahnen mitten in Selene City abrupt abbremste und zum Stehen kam. Sein Oberkörper fiel nach vorn, wurde aber von einem Prallfeld automatisch abgefedert. Der Puls des 78-jährigen Statikers raste, was er als äußerst unangenehm empfand. Und das an seinem freien Vormittag! Wieder mal wünschte sich Robinson die Zeit der reinen Vernunft zurück. Der Aphilie, wie sie gemeinhin genannt wurde, als sei sie eine Krankheit gewesen. Wieder mal verfluchte er sich sogleich dafür.
Ein schwarzer Schatten war auf die Gleiterbahn gehuscht: ein dunkelhäutiges Kind, das seinem winzigen Spielroboter nachgerannt war, der offenbar eine Fehlfunktion hatte und erratisch umhertorkelte. Momente später trat ein Erwachsener von gedrungener Statur mit ebenfalls tiefbrauner Haut auf die Gleiterbahn. Ein Lunarer? Der Mann nickte Robinson mit zusammengekniffenen Lippen zu. Sollte das ein Dankeschön sein? Es fiel Robinson schwer, Gefühle zu lesen, bei sich selbst ebenso wie bei anderen. Er war unsicher. Sollte er zurücknicken? Seine Augen füllten sich mit Feuchtigkeit. Warum passiert das?
Der Mann schnappte sich den Roboter, der immer wieder gegen die Abgrenzung zum Fußgängerbereich stieß, und schob das Kind von der Fahrbahn. Beide verschwanden im Menschenstrom der Passanten.
Mit geringer Geschwindigkeit nahm der Schweber seinen bodennahen Flug wieder auf. Robinson sah weiterhin durch einen Tränenfilm. Er wischte ihn aus den Augen, aber seine Tränendrüsen produzierten emsig Flüssigkeitsnachschub. Warum? Er fuhr sich durch die grauen Haarsträhnen und betastete seinen ebenfalls grauen, kurz gehaltenen Vollbart.
Das Bild des Manns, vermutlich der Vater, der sich um das Kind gesorgt und es von der Straße genommen hatte, ging ihm nicht aus dem Kopf. Lag es daran? Robinson selbst konnte sich kaum an seinen Vater erinnern. Er war die meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend in einem Internat aufgewachsen und hatte seine Eltern nur selten zu Gesicht bekommen. Wenn doch, ging es meist darum, etwas zu regeln oder zu organisieren, nie um Gefühle. Die hatte er auch nicht vermisst. Warum also die verdammten Tränen?
Er lenkte seine Gedanken auf sicheres Terrain, um die Gefühle sowie die Fragen, auf die er ohnehin keine Antwort erhielt, sozusagen auszuhungern. Er dachte an die Gruppe der Mondbewohner, die sich analog den irdischen Terranern stolz als »Lunarer« bezeichneten. Diese auf dem Erdmond zum Teil schon seit Generationen dauerhaft heimischen Menschen waren durch künstliche Veränderung ihres Genoms an die im Vergleich zu Terra erheblich niedrige Schwerkraft und intensivere Sonnenstrahlung von Luna angepasst.
Lunarer waren meist eher kleiner und körperlich schwächer als durchschnittliche Erdgeborene, hatten relativ dunkle, melaninreiche Haut. Dazu kamen dichte, kräftige, ebenfalls melaningesättigte Haare, die auf zahlreichen Körperpartien wuchsen. Sie verfügten über eine gesteigerte Muskel- und Beweglichkeitskontrolle, was ihnen eine fast artistische Gewandtheit in allen Arealen von Luna ermöglichte, wo die natürliche Gravitation von nur einem Sechstel der Erdschwerkraft nicht künstlich erhöht war.
Robinsons Ablenkungsstrategie zeigte erste Wirkung. Der Tränenfluss ließ nach, war aber noch nicht gänzlich versiegt. Gut, weiter! Robinson zog Verbindungen zu den Paddlern.
Diese aus Andromeda stammenden, humanoiden Fremdwesen unterhielten oft eine gute Beziehung zu den Lunarern. Ob sie sich aufgrund der Hautfarbe verbunden fühlten? Diese Assoziation erschien Robinson interessant. Die Haut der Paddler war sogar noch dunkler als die der Lunarer, nämlich pechschwarz. Und viele Lunarer färbten sich die Haupthaare blutrot sowie trugen ihre Bärte auf eine ähnliche Art und Weise wie die Paddler. Robinson entschied, dass seine Schlussfolgerung korrekt sein müsse.
Er seufzte. Ja, die Paddler! Sie waren begnadete Techniker, Handwerker und noch vieles mehr. Wie gern hätte Robinson die Zeit zurückgedreht. Er hatte handwerkliche Tätigkeiten als Hobby für sich entdeckt, allerdings erst vor zwei Jahren. Etwas in den Händen zu halten und zu bearbeiten, beruhigte sein häufiges Gedanken- und Gefühlskarussell. Für eine Weile fand dann er so etwas wie innere Ruhe.
Wie gern würde er dieses Hobby – vielleicht war es auch seine persönliche Therapie – zum Beruf machen, aber dazu fühlte er sich zu alt. Deshalb setzte er stattdessen die Tätigkeit fort, die er schon während der Herrschaft der reinen Vernunft auf der Erde ausgeübt hatte: als Statiker bei der Stadtplanung. Nur eben mittlerweile auf Luna, in Selene City, einer der größeren Siedlungen auf der erdzugewandten Mondseite, die allesamt von komplexen Kuppelsystemen überspannt wurden.
Robinson hatte gehofft, auf Luna neu anfangen und alle belastenden Erinnerungen hinter sich lassen zu können. Erinnerungen, die indes erst mit dem Untergang des Zeitalters der reinen Vernunft belastend geworden waren. In dem komplett neuen Umfeld hatte er zudem lernen wollen, besser mit dem Wust an Gefühlen umzugehen, die ihn seit der sogenannten Heilung von der Aphilie plagten. Beides war nicht in Erfüllung gegangen.
Stattdessen hatte er nach wie vor Schwierigkeiten, mit der geringen Mondschwerkraft zurechtzukommen. Mikrogravitatoren waren leider teuer und fraßen viel Energie. Nur die wenigsten auf dem Mond lebenden Menschen und Außerirdischen konnten sich diese Geräte leisten, die in der unmittelbaren Körperumgebung die gewohnte Normgravitation ihrer Heimatwelt schufen. Es hatte lange gedauert, bis Robinson sich angewöhnt hatte, nur langsam und behutsam zu gehen sowie grundsätzlich zurückhaltend zu agieren. Ruckartige, schwungvolle Gesten, Schritte und Armbewegungen galt es zu vermeiden.
War es für andere, die von Geburt an immun gegen die Aphilie gewesen waren, eigentlich ebenso schwierig, Gefühle zu verstehen und zu verändern wie für ihn? Robinson bezweifelte es. Er ärgerte sich, dass er so viel Aufwand betreiben musste, um wieder klarsehen zu können. Und ärgerte sich über seinen Ärger. Ein ewiger Teufelskreis aus anstrengenden Gefühlen.
Mühsam konzentrierte er sich wieder auf seine Besorgungen. Er erreichte den Westrand von Selene City, parkte seinen Gleiter, stieg aus und ging zum lokalen Marktareal hinüber. Er tauchte ein in das dortige Getümmel von Händlern, Käufern und Neugierigen. So etwas hätte ihm in der Zeit der Vernunft keine Probleme bereitet. Er hätte lediglich sich und sein Ziel vor Augen gehabt und wäre gleichmütig durch die Menge geglitten.
Nun jedoch strömten von allen Seiten irritierende Sinneseindrücke auf ihn ein: Gelächter, Geschrei, blinkende, piepende Geräte, stechende Gerüche, Terraner, Lunarer, Paddler, die meisten zu Fuß unterwegs, einige in Elektrorollstühlen. Viele Lunabewohner, die sich keine Mikrogravitatoren leisten konnten, bewegten sich in der Niedrigschwerkraft schneller und sicherer mithilfe eines solchen Gefährts fort. Alles wuselte kreuz und quer und löste Gefühle aus. Mehrmals wurde Robinson angerempelt. Seine Hände zitterten, und er verkrampfte innerlich.
Er versuchte, seine Atmung zu kontrollieren, was ihm in schlaflosen Nächten meist half. Dann schaute er von seinem Bett aus durch die transparente Stadtkuppel gern ins All. Allerdings war dieser Himmel in den langen Mondnächten nicht schwarz, übersät mit weißen Lichtpunkten, sondern schimmerte in einem Blauton. Das lag an dem gigantischen Energieschirm, der das Solsystem umhüllte und schützte. Wenigstens war stets die zumindest teils von der Sonne beleuchtete Erde zu sehen – eine blau schimmernde Kugel auf blauschwarzem Hintergrund. Robinson nahm an, dass andere Wehmut zu dem sagten, was er dabei empfand. Es war angenehm und brachte einen gewissen inneren Trost und Frieden. Auch Erleichterung mischte sich darunter, dass Terra so weit weg war. Und somit das, was er dort getan hatte.
Er steuerte auf seinen Lieblingsstand zu. Bei dem Anblick lächelte er, das erste Mal an diesem Tag. Es war einer der seltenen Momente mit einem angenehmen Gefühl. Freude?
»Haki!«, rief der Verkäufer, als er Robinson erkannte. Momentan belagerten keine weiteren Kunden seinen kleinen Freiluftladen. »Schön, dass du vorbeischaust.« Er war etwa im selben Alter wie Robinson – und saß in einem Rollstuhl.
Robinson nickte in Richtung der Fortbewegungshilfe. »Damit habe ich ja dich noch nie gesehen, Marvin. Was nützt er dir hinterm Verkaufstresen?«
»Ah, bist du wieder im analytisch-aphilischen Verarbeitungsmodus?« Marvin zeigte auf die eigene Stirn und beschrieb mit dem Finger eine kreisende Bewegung. »Das Ding ist funkelnagelneu! Habe mir die Bauteile hierherliefern lassen und sie heute früh frisch zusammengesetzt. Das hätte kein Paddler besser hingekriegt.« Marvin strahlte über das ganze Gesicht. »Jetzt muss ich ihn natürlich testen. In dieser Sitzhöhe komme ich viel besser an die unteren Regale ran. Und er ist sehr bequem. Willst du mal Probe sitzen?«
Robinson überlegte kurz und sagte dann: »Warum eigentlich nicht?«
Beide lachten. Marvin betätigte eine Schaltung. Ein Teil des Verkaufstresens zwischen ihm und Robinson fuhr summend in die Höhe, um Marvin zu ermöglichen, samt Rollstuhl nach vorn zu kommen. Plötzlich stockte das Paneel in Brusthöhe.
Mehrere Explosionen ließen den Boden erbeben. Robinson verlor das Gleichgewicht und landete auf den Knien. Es schrillte unangenehm in den Ohren. Der Ton mischte sich mit dem Aufheulen einer Alarmsirene.
Gedämpft, wie durch Watte um seinen Kopf, vernahm Robinson ein Stöhnen. Er konnte den Boden nur verschwommen sehen, fühlte sich benommen. Schatten huschten in den Augenwinkeln vorüber. Er blickte auf. Der Verkaufstresenteil hatte sich, vermutlich infolge der Erschütterungen, wieder gesenkt und lastete schwer auf Marvins Schultern. Der Ladenbesitzer saß zusammengekrümmt im Rollstuhl. Von ihm stammte das Stöhnen.
Zu schnell sprang Robinson auf und schwebte einen Moment in der Luft. Er fluchte. Nicht schnell und ruckhaft bewegen! Immerhin klärte sich sein Blick.