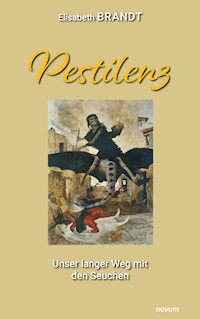
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Infektionskrankheiten begleiten Menschen seit der "Stunde Null" ihres Bestehens. Fatale Seuchen traten aber erst in dauerhaften Siedlungen und durch Tierhaltung in regelmäßigen Abständen auf. Verbunden mit unserem Kampf gegen Infektionen sind Namen, deren medizinische Leistungen unvergessen sind, wie Pasteur, Semmelweis, Koch und Florence Nightingale. Aber auch dunkle Epochen wie die Experimente am Menschen in der NS-Zeit oder die Verbreitung von Krankheiten durch Eroberer wie Kolumbus und Pizarro gehören zum Seuchennarrativ. In neuester Zeit konnten nicht einmal zahllose Warnungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) letztendlich die Ausbreitung von COVID‑19 verhindern. Dieses Buch zeigt eindringlich, wie gefährlich Infektionskrankheiten auch für unsere globalen Wissensgesellschaften sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum 3
Prolog 4
Einleitung 7
Teil 1 - Von der Gottesstrafe zur Pandemie 9
Was ist Was? 9
Der Preis der Zivilisation 16
Seuchengeschichten 19
Teil 2 - Späte Diagnose 26
Beweise 27
Aussagen 29
Indizien 32
Teil 3 - Chroniken des Unheils 35
Frühgeschichte 35
Erste Schriftkulturen 43
Klassische Antike 46
Mittelalter 54
Neuzeit 61
Industrialisierung und Kolonialzeit 78
Moderne 105
Teil 4 - Die Wurzeln des Übels 121
Umweltzerstörung 123
Fledermäuse 128
Ein hoher Preis für billiges Fleisch 131
Klimawandel 136
Das große Sterben 141
Migration 146
Globalisierung 148
Urbanisierung 150
Eine Frage des (Lebens-)Stils 152
Das dreckige Dutzend 160
Teil 5 - Die Geißel der Menschheit 168
Der schlimmste Feind 168
Apokalyptische Reiter 173
Heulen und Zähneklappern 176
Wunderliche Erzählungen 184
Infektionen und Innovationen 192
Teil 6 - Der ewige Kampf 196
Die Tochter des Gottes 197
Heiler und Heilige 206
Die Dame mit der Lampe 221
Lady Marys Triumph 236
Das gefleckte Monster 240
Auf der Spur der Seuche 242
Ausgrenzung und Abschottung 245
Wenn aus dem Spiel Ernst wird 251
Irrwege 254
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie? 264
Liste der in diesem Buch erwähnten Infektionskrankheiten 276
Literaturverzeichnis 292
Abbildungsverzeichnis 347
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-740-1
ISBN e-book: 978-3-99131-741-8
Lektorat: Leon Haußmann
Umschlagfoto: Ausschnitt aus einem Gemälde von Arnold Böcklin; Reprografie aus Kunstbuch2. Handelsblatt3. Kunstmuseum Basel, Online Collektion, Gemeinfrei CC0
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: siehe Bildquellennachweis
www.novumverlag.com
Prolog
„Die Krankheiten wandern hin und her, so weit die Welt ist, und bleiben nicht an einem Ort. Will einer viele Krankheiten erkennen, so wandert er auch – wandert er weit so erfährt er viel und lernt viel kennen.“ Paracelsus (1493–1541)
Die karge Mansarde ist eiskalt und die junge, bleiche Frau zittert so stark, dass das Publikum auch schon fröstelt. Ihr Geliebter muss sie stützen, während er zärtlich versichert, sie sei schön wie die Morgenröte. Das Kompliment ist zu dick aufgetragen, seine Liebste seufzt im lyrischen Sopran, er meine wohl den Sonnenuntergang. Dem Zuschauer schwant, es geht zu Ende. Opernfreunde erkennen den Zweigesang, in dem die todkranke Mimi und ihr Rodolpho tränenreich Abschied voneinander nehmen. Mit seiner überirdisch schönen Musik machte Giacomo Puccini in seiner OperLa Bohémedie verblassende Stickerin unsterblich, auch wenn sie laut Libretto gerade der Tuberkulose erliegt. Wie Mimi hauchten und husteten damals viele Menschen ihr Leben aus, weil sie von Schwindsucht zerfressen wurden. Weil Puccini und viele andere das Dahinschwinden an der garstigen Infektion ästhetisch aufwerteten, unterschätzen wir, welch unendliches Leid die Seuche verursacht. Bis heute bringt sie Jahr für Jahr 1,5 Millionen Menschen einen qualvollen Tod, ganz ohne Soundtrack. Puccinis Oper zeigt klangvoll, warum die Heimsuchung Seuche sich nicht auf Erreger, Symptome und Krankheitsverläufe reduzieren lässt. Genau darum geht es in dem vorliegenden Buch, ich möchte das Ur-Trauma Plage mit all seinen Facetten und Komplexitäten betrachten. Als Anthropologin bewege ich mich dabei im Grenzbereich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. In meinem Fach nutzen wir Erkenntnisse aus vielen Disziplinen, um die Wirklichkeit der Menschen in geschichtlichen und vorgeschichtlichen Zeiträumen zu erforschen. Auch wie der Mensch sich entwickelt und dabei seine Umwelt verändert hat, interessiert meine Zunft. Ebenso haben natürlich auch Ökosysteme ihre Bewohner geprägt, nicht zuletzt durch Epidemien. Was Sie erwartet, ist ein Zeitreiseführer, eine Tour durch die lange Geschichte der Plagen, Seuchen und Pandemien. Wie in jedem Fremdenführer werden wichtige Schauplätze, Ereignisse und Traditionen beschrieben, um anschaulich den Horizont zu erweitern. Ich möchte Sie verständlich und ansprechend über ein elementares Thema informieren, das sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht. Meine Erzählung reichere ich nicht nur durch viele Fakten an, sondern auch durch ein buntes Gemisch aus Anekdoten und Lebensläufen. Hin und wieder kommen auch Zeitzeugen zu Wort, wie zum Beispiel Sir Arthur Conan Doyle, der mal als Arzt, mal in Gestalt seiner Schöpfung Sherlock Holmes zum Leser spricht. Wie jeder gute Reiseführer soll Ihnen mein Buch Lust auf unser Reiseziel machen. Klar, Plagen und Seuchen sind auf den ersten Blick nicht gerade verlockende Destinationen. Bei näherem Hinschauen findet der Reisende aber viel Staunenswertes auf seiner Tour entlang der Spur der Naturgewalt Infektionskrankheit, die uns bis in die Gegenwart entscheidend prägt. Ich will Sie neugierig darauf machen, wie Menschen früher mit Masseninfektionen umgegangen sind. Lebensumstände und Zeitgeist einer Epoche lassen sich nicht einfach ausgraben oder nachlesen. Lange hinterließen nur gekrönte Häupter und andere Promis schriftliche Spuren. Wie es der Masse während einer Seuche erging, muss anhand eines Puzzles aus kurzen Randnotizen oder Kirchenbüchern, sowie aus archäologischen und anderen Indizien mühsam rekonstruiert werden. Welche Folgen hatten frühere Pandemien für unsere Vorfahren? Wie hat sich unsere Wahrnehmung von Seuchen geändert? Es gibt viele Parallelen, aber auch ein paar entscheidende Unterschiede zur aktuellen COVID-19 Pandemie. Kurt Tucholsky regt an, der Enge der Zeit durch das Studium der Geschichte zu entfliehen, ähnlich wie Reisende die heimatliche Beschränktheit erst in fremden Ländern begreifen. Heute beherrscht die Corona Krise unsere Wirklichkeit, durch den Vergleich mit anderen epidemischen Katastrophen können wir dieser Tyrannei durchSARS-CoV-2entkommen. Ein Streifzug durch vergangene Plagen-Epochen hilft, das gegenwärtige Pandemie-Trauma einzuordnen und relativiert so manche Verschwörungstheorie, versprochen. Und da geht noch mehr: auf unserer historischen Sightseeing-Tour sehen wir, wie Umwelt, Infektionen und unser Verhalten zusammenhängen und erkennen, welche Konsequenzen das im Hier und Jetzt für uns hat. Als ob Vergangenheitsanalyse und Gegenwartsverständnis nicht genug wären, bereitet uns dieses Buch auch auf die Zeit nach Corona vor. Da stehen nämlich, nach Meinung von Pandemie-Experten, ein paar wichtige Entscheidungen an, wenn wir die nächste Pandemie vermeiden wollen.
Einleitung
Wie für Reiseführer üblich, beginnt auch mein Zeitguide mit einer Auflistung wichtiger Vokabeln in der Landessprache. Anstelle von „merci“,„buenos dias“oder„arrividerci“ klären wir ein paar wissenschaftliche Begriffe mit Seuchenrelevanz. Dann brechen wir auf, ganz früh in der Morgendämmerung der Menschheit. Die Tour beginnt mit einer Einführung in das Woher und Warum von Epidemien, gefolgt von einigen Beispielen zur Seuchenentstehung und -ausbreitung, um der blassen Theorie Farbe zu verleihen. Dem folgt eine Exkursion in das Reich der Methoden und Quellen, die Wissenschaftlern helfen, die Plagen-Historie möglichst detailgetreu zu rekonstruieren. Hierfür wechseln wir das Genre und begeben uns in die morbid-makabre Welt des Krimis. Danach beginnt das eigentliche Sightseeing, und zwar in der Frühgeschichte. Wir besuchen spektakuläre Plagen-Schauplätze in der Steinzeit und sehen, wie Ur-Seuchen Geschichte machten. Weiter geht es in das Schriftzeitalter, wo wir zum ersten Mal mit Epidemiezeugen sprechen können, wenn auch über die Distanz vieler Jahrtausende. Die Mediziner der Antike sind da schon sehr viel beredeter und haben schockierend moderne Ansichten zum Thema Seuche. Dagegen wirkt die mittelalterlich-spirituelle Denke betreffs Plagen und anderer Leiden befremdlich, auch wenn die Epoche bei genauerem Hinschauen nicht durchweg so düster war, wie ihr Ruf. Die Neuzeit erweist sich dagegen als das eigentliche Plagenzeitalter, aber das sehen Sie sich besser vor Ort an. Während der Industrialisierung und Kolonialzeit boten sich wandelnde Gesellschaften den Seuchen ideale Biotope, besuchen Sie die malignen Habitate von Armen, Auswanderern und Arbeitern. Werden Sie dann Zeugen eines Science-Thrillers über den Kampf der ersten Mikrobiologen gegen die tödlichsten Übel ihrer Zeit. Eine wichtige Epoche also, die Sie keinesfalls auf Ihrer Besichtigungstour auslassen sollten. Schon sind wir bei unserem letzten Stopp in der Moderne. Verfolgen Sie, wie eine Revolution uns scheinbar von dem archaischen Fluch Seuche erlöste. Verlassen Sie Ihre Komfortzone, um zu entdecken, wo und warum all die neuen Infektionen entstehen, die uns plagen. Sehen Sie, weshalb die vielen Alarmzeichen für eine Rückkehr des Übels Epidemie von unserem Kulturkreis ignoriert wurden.
Die vielen Eindrücke unserer Zeitreise vernetze ich ab dem vierten Teil des Buches. Dafür werden die historischen Schnappschüsse unserer Rundreise zu einer stimmigen Kollage zusammengefügt. Zunächst erfahren wir mehr über die Ursachen von Seuchen in Natur und Kultur. Dann blicken wir auf die durchreisten Epochen zurück, fassen die Auswirkungen von Seuchen auf die Menschheitsentwicklung zusammen und vergleichen sie mit dem aktuellen Ungemach. Machen Sie sich an dieser Stelle auf ein paar überraschende Einsichten gefasst. Um nicht ganz trübsinnig zu werden, verfolgen wir nun den Kampf gegen Seuchen von den vormenschlichen Anfängen bis zur hochtechnisierten Apparatemedizin. Eigentlich eine tolle Erfolgsstory, aber auch die hat dunkle Seiten, sehen Sie selbst.
Zum Schluss unserer Tour analysieren wir gemeinsam mit Experten die COVID-19 Pandemie. Das epidemiologische A-Team gibt uns zum Ausklang auch gleich Ratschläge für eine bessere globale Seuchenresilienz.
Teil 1 - Von der Gottesstrafe zur Pandemie
vom (Aber-)Glauben zur Wissenschaft
Was ist Was?
Wir alle haben während der vergangen Monate Erfahrung mit dem Begriffswirrwarr um die aktuelle Pandemie gemacht. Mal wird von demCoronavirus, mal von SARS-CoV-2gesprochen, mal von COVID-19, Epidemie, Pandemie, Inzidenzwert … Eine Flut von Fachbegriffen prasselt auf uns ein. Der Volksmund vereinfacht, verfremdet und nimmt alles mit einer Prise Humor. So entstehen verbale Kostbarkeiten wie Nuschelmuschel oder Schnutenjardine als Spitznamen für den Mundschutz. Verschwörungsfans reden von einerPlandemie und selbst in öffentlich-rechtlichen Nachrichten werden die Begriffe Ausganssperre, Ausgangsbeschränkung oder Lockdown achtlos durcheinandergeworfen. Da fällt es leicht zu verstehen, dass auch frühere Gesellschaften für viele Krankheiten denselben Namen und viele Namen für dieselbe Krankheit gebrauchten. Dies umso mehr, als auch Ärzte wenig über Ursachen und Symptome von Krankheiten wussten und sie nicht eindeutig bestimmen konnten(1; 2).
Seuchen waren einstmals, wie andere Naturkatastrophen auch, ein scheinbar unerklärlicher Schicksalsschlag. Die Angst vor der unbegreiflichen Bedrohung führte zu Narrativen, die dem Leid einen Sinn geben sollten. Naheliegend war die Deutung einer Plage als Gottesstrafe (3; 4), unschön wurde es, wenn Sündenböcke gesucht wurden. Die fantasievollen Begründungen für viele „Strafaktionen“ an Minderheiten in betroffenen Gesellschaften erinnern fatal an moderne Verschwörungstheorien.
Die Wissenschaft hat Seuchen entmystifiziert. Man kennt ihre Ursachen, kann sich besser davor schützen und Krankheiten wirkungsvoll therapieren. Für den Laien sind die Zusammenhänge aber nach wie vor schwer zu verstehen, besonders bei einer Pandemie wie COVID-19, deren Opfer für die breite Öffentlichkeit erst sichtbar werden, wenn die Lage völlig außer Kontrolle gerät. Der Fachjargon der Experten trägt dabei wenig zur Aufklärung bei. Fundierte Erklärungen für die komplexe Seuchendynamik werden oft nur von Wenigen verstanden und von Vielen nicht angenommen.
Um mehr Klarheit zu schaffen, möchte ich darum das Begriffschaos ein wenig ordnen, auch um Missverständnisse zu vermeiden. Deshalb erkläre ich zunächst die gängigsten Begriffe in Zusammenhang mit Infektionskrankheiten.
Allgemein:
Plage
Ist abgeleitet vom griechischen Verb „plaga“ für Schlag oder Hieb. Das Wort steht für eine Strafe des Himmels, Krankheit, Leid aber auch Missgeschick, Sklaverei oder Not.
Seuche
Eine ansteckende Infektionskrankheit, die sich schnell ausbreitet.
Epidemie
Eine ansteckende Infektionskrankheit, die zeitlich und örtlich begrenzt vermehrt auftritt.
Endemie
Eine ansteckende Infektionskrankheit, die örtlich begrenzt ständig auftritt.
Pandemie
Eine Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen, die weltweit neu aber zeitlich begrenzt auftritt. Pandemien sind in der Regel mit schweren Krankheitsverläufen verbunden.
Mortalität
Kann als „Sterblichkeit“ übersetzt werden. Die Mortalitätsrate benennt den Anteil der Individuen der Gesamtpopulation, die an einer Krankheit sterben, bzw. die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Individuum der Population an der Krankheit sterben wird.
Letalität
Kann man als „Tödlichkeit“ einer Krankheit übersetzen. Letalität/Letalitätsrate bezeichnet den Anteil der erkrankten Infizierten, die durch eine Infektionskrankheit sterben, beziehungsweise mit welcher Wahrscheinlichkeit Erkrankte durch eine Infektion sterben.
Morbidität
Bezeichnet, wie viele Individuen einer Population in einem definierten Zeitraum nach einer Infektion mit einem bestimmten Erreger erkranken.
Zoonose
Ist ein Kombiwort aus den griechischen Vokabeln „zoon“ (Lebewesen) und „nosos“ (Krankheit). Der Begriff beschreibt tierische Infektionen, die auf den Menschen überspringen. Bei manchen Infektionen erfolgt die Ansteckung immer nur von Tier zu Mensch, wie bei Tollwut, Milzbrand oder dem schrecklichen Rinderwahn. Manche Keime werden nach der Ansteckung an einem Tier auch zwischenmenschlich weitergegeben, aber selten, weshalb Epidemien meist nur kurz aufflammen. Eine tragische Ausnahme ist die Ebola-Epidemie von 2013 in Westafrika. Es gibt auch Mikroorganismen, die sich bei Mensch und Tier mehr oder weniger gleich gut ausbreiten, wie zum Beispiel die Schlafkrankheit. Einige Erreger haben sich ganz auf den Menschen spezialisiert und lösen Klassiker wie Malaria, Masern und Syphilis aus (5).
Arbovirale Krankheiten (arthropod-born-viruses)
Werden von Viren ausgelöst, die Insekten und anderen Gliederfüßlern (Arthropoden) als Zwischenwirte, sozusagen Shuttles benutzen.
Infektion
Eindringen eines krankheitsauslösenden Organismus.
Infektiös
Kann man als ansteckend übersetzen.
Virulenz, Pathogenität
Bedeutet umgangssprachlich „krankmachend“. Leitet sich von dem lateinischen Wort „virulentus“ ab, was so viel wie giftig heißt.
Inkubationszeit, Latenzzeit, Verzögerungszeit
Bezeichnet die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome. Die Inkubationszeit kann Stunden, aber auch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern.
Transmission
Bedeutet so viel wie Ansteckung, also die Übertragung der Keime von einem Individuum auf ein zweites.
Bauteile:
DNA
In Molekülform codierte Bauanleitung für unseren Körper. Die Informationen für ein Protein sind jeweils zu einem Gen zusammengefasst.
Plasmid
Kleiner DNA-Ring, auf dem Bakterien neu erworbene Erbinformation speichern. Ein Bakterium besitzt mehrere Kopien seiner Plasmide, die es mit anderen Bakterien über eine temporäre „Schleuse“ austauscht.
mRNA
steht für messenger-RNA und ist eine Arbeitskopie von Teilen der DNA-Bauanleitung. Sie ist weniger haltbar und dient nur als kurzfristige Vorlage für den Zusammenbau eines neuen Proteins im Zellplasma.
Erreger:
Erreger, Pathogen, Keim
Direkter Auslöser einer Krankheit. Neben Bakterien und Viren können auch Pilze, Würmer, Einzeller oder sogar Proteinpartikel – Prionen genannt – Krankheiten verursachen. Pathogen kommt aus dem Griechischem, „pathos“ bedeutet „Leid“ und „-genes“ steht für „Verursacher von“.
Mikroben, Mikroorganismen
Ist ein Sammelbegriff für Kleinstwesen (Viren, Bakterien etc.), die einzeln nur unter dem (Elektronen-) Mikroskop erkennbar sind.
Prion
Die Welt kennt Prionen erst seit vierzig Jahren. Bei den fiesen Partikeln handelt es sich um Proteine, die auch im gesunden Körper vorkommen, vor allem im Gehirn. Faltet sich solch ein Prion-Protein falsch, wird es gefährlich, denn das entgleiste Biomolekül veranlasst auch andere Prionen, sich atypisch zu knüllen. Prionen sind also Moleküle, keine Lebewesen. Wissenschaftler ziehen es vor, Prione mit Giften gleichzusetzen, die ja ebenfalls Körperfunktionen stören.
Parasit
Ist ein Organismus, der ein anderes Lebewesen als Wirt benutzt und diesen dabei schädigt.
Virus
Viren sind Minimalisten. Eigentlich bestehen sie nur aus einem Stück DNA/RNA in einer hübschen Proteinverpackung. Sie betreiben weder eigenen Stoffwechsel noch können sie sich alleine reproduzieren. Deshalb benötigen sie Wirtszellen, die sie kapern und für sich arbeiten lassen. Weil Viren so sparsam ausgestattet sind, gelten sie ebenfalls nicht als Lebewesen. Anders als bei ihren Wirten ist ihre DNA/RNA sehr schlecht vor Kopierfehlern und Beschädigungen geschützt, deshalb neigen sie zu Mutationen und verändern sich eigentlich ständig. In unserem wissenschaftlichen Zeitalter soll es keinen Raum für Missverständnisse geben, weshalb neu auftretende Viren weltweit mit einem englischen Namen bezeichnet werden. Oft bezieht sich der Name auf Überträger (z. B.Tick-borne encephalitis virus), Symptome (z. B. severe acute respiratory-syndrom related coronavirus) oder er ist eine geografische Bezeichnung (z. B.West Nile virus). Leider sind die Namen zum Teil recht unhandlich und werden oft in noch sperrigere Akronyme verkürzt (z. B.SARS-CoV, MERSV). Es gibt auch Viren, die Bakterien befallen diese nennt man Phagen.
Bakterium
Bakterien sind einzellige Lebewesen mit einem eigenen Stoffwechsel und Reproduktionsapparat. Allerdings liegt ihre DNA als Ring nackt im Zellplasma und nicht geschützt im Zellkern wie bei uns. Zusätzlich zu der Basisausstattung an Genen haben Bakterien kleinere DNA-Ringe, sogenannte Plasmide, die sie kopieren und untereinander austauschen können. So haben sie das Beste beider Welten: Sie können sich unkompliziert und schnell per Zellteilung vermehren. Durch den Austausch ihrer Plasmidringe erwerben sie aber auch schnell neue Eigenschaften, ähnlich wie Mehrzeller, die ihre Gene bei der geschlechtlichen Vermehrung immer wieder neu durchmischen. Gerade auf Plasmiden liegen für Bakterien nützliche Eigenschaften wie Resistenzen oder Virulenzen, die sich rasend schnell innerhalb eines Bakterienstamms verbreiten können. Besser noch (für die Bakterien), Plasmide werden sogar zwischen verschiedenen Bakterienarten ausgetauscht.
Einzeller
Bei Einzellern liegt die DNA geschützt in einem Zellkern und sie haben einen eigenen Stoffwechsel und Reproduktionsapparat.
Bazillen
Das Wort stammt aus den Kindertagen der Mikrobiologie und beschreibt stäbchenförmige oder runde Bakterien. Außerdem gibt es die GattungBacillus,zu der auchB. anthracis,der Erreger des Milzbrands gehört. Der Laie setzt Bazillen gerne mit Mikroben oder Erregern gleich.
So, das reicht! Schließlich soll dieses Buch kein Lexikon werden, sondern wir wollen uns, sozusagen aus der historischen Vogelperspektive, mit Ursachen, Folgen und Dynamik von Infektionskrankheiten beschäftigen. Deswegen konzentriere ich mich auf Epi-, En- und Pandemien, die mehr oder weniger deutliche Spuren hinterlassen haben. Dazu kommen moderne ansteckende Krankheiten wie Ebola oder COVID-19, die für einen Vergleich über den Umgang früherer und heutiger Gesellschaften mit Seuchen taugen. Um der Lesbarkeit willen gehe ich auf Erreger, Krankheitsverläufe und Symptome nur ein, wenn es für das Verständnis der Zusammenhänge wichtig ist. Für Interessierte gibt es am Ende des Buchs eine Liste der angesprochenen Seuchen inklusive einer kurzen Beschreibung.
Der Preis der Zivilisation
Sesshaftigkeit
Der Blick auf die letzten überlebenden Jäger und Sammler zeigt, dass ihre mittlere Lebenserwartung sehr viel niedriger ist als die von Menschen in Industriegesellschaften. Die Yanomami, eine in Südamerika lebende Volksgruppe mit traditionellem Lebensstil, haben bei der Geburt eine Lebenserwartung von 20–22 Jahren(6). Ganz anders in Deutschland, hier liegt die Lebenserwartung bei der Geburt zwischen 79 und 83 Jahren (7). Ein zweiter Blick zeigt, dass viele Indigene aufgrund schlechter Ernährung, fehlender medizinischer Versorgung, mangelnder Hygiene oder auch unkontrollierter Gewalt so früh sterben müssen. Woran sieseltensterben, sind Epidemien, zumindest, wenn sie isoliert leben.
Humane Massenkrankheiten, die auf eine schnelle Übertragung mit kurzen Verläufen spezialisiert sind, entstanden selten in äquatornahen Zonen und das mit gutem Grund. Nirgendwo auf der Welt gibt es eine so hohe Artendichte wie in den Tropen, die meisten Spezies sind aber nur mit wenigen Exemplaren vertreten. Sich zu sehr auf eine einzelne Art zu fokussieren, ist daher keine gute Idee. Darum haben vor allem tropische Infektionskrankheiten Reservoirs in vielen verschiedenen Tierarten und sind zum Überleben nicht ausschließlich auf den Menschen angewiesen. Die Folge davon ist eine geringere Spezialisierung aufHomo sapiensals in anderen Klimazonen. Langsamer verlaufende Infektionskrankheiten gedeihen trotz niedriger Ansteckungsraten, sie benötigen daher ebenfalls nur wenige Infizierte. Auch solche Krankheiten kommen vor allem in den Tropen vor oder sind dort entstanden. Ein großer Teil der auf den Menschen spezialisierten Pathogene, wie zum Beispiel die Masern, entwickelten sich erst in gemäßigteren Zonen (5). Unsere mikrobiellen Follower können sich umso besser ausbreiten, je enger Menschen zusammenleben, auch die Gruppengröße spielt eine Rolle. Leben Menschen aber aufgrund begrenzter Nahrungsressourcen in kleinen, weit verstreuten Gruppen, und wechseln womöglich oft den Wohnort, dann haben die Erreger schlechte Karten. So kann sich eine humane Infektionskrankheit kaum ausbreiten, denn nur wenige Menschen können sich anstecken(8).
Bis vor 11 000 Jahren nutzten alle Menschen ihr Umfeld extensiv, dann begannen sie mit dem Anbau von Pflanzen und domestizierten Tiere (9). Als Landwirte veränderten sie ihr Umfeld radikal, schufen Lichtungen und störten das natürliche Gleichgewicht. Die frühen Bauern und ihre Haustiere kamen dabei in Kontakt mit neuen Mikroben. Viele dieser Organismen nutzten die Gelegenheit, sich neu zu orientieren, übersprangen Artgrenzen und spezialisierten sich auf die Eindringlinge, als neue Wirte. Schon vor 17 000 Jahren konnten Menschen dank der intensiveren Nutzung ihrer Ressourcen ihr Schweifgebiet verkleinern. Nachdem sie begannen, Getreide und Gemüse anzubauen, mussten sie nun ganz an einem Ort bleiben, um ihr Land zu bearbeiten. Auch das förderte die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, denn schon in frühen Siedlungen war die Bevölkerungsdichte 10- bis 100-mal höher als bei Jägern und Sammlern (10). Noch besser, aus Sicht von Erregern aller Art: um und in den ersten Dörfern wuchsen die Abfall- und Fäkalienhaufen. Abfallmanagement ist schließlich ein Problem, das Nomaden nicht kennen. Die schlechte Hygiene der ersten Bauern hat bis heute Spuren hinterlassen: Die versteinerten Kothaufen früher Siedlungen wimmeln von Wurmeiern und anderen Parasiten (10). Vermutlich erkannten die frühen Landwirte schnell, dass Dung auf den Feldern den Ernteerfolg verbessert, und als Brenn- und Baustoff taugt er getrocknet sowieso. Durch das Fäkalien-Recycling brachten sie Mikroorganismen in Nahrung und Häuser ein (9). Die Menschen lebten in immer größeren Gruppen, hielten immer größere Herden und bauten immer mehr an, um sich zu ernähren. Dies ist der Beginn erster Hochkulturen, aber auch der Karriere von Infektionskrankheiten (3; 8).
Abbildung 1: Tierhaltung im alten Ägypten
Tierhaltung
Noch etwas kommt den Erregern zugute: Der enge Kontakt zwischen den Menschen und ihren Haustieren. Oft hatten sich Pathogene zunächst von Wildtieren auf domestizierte Tiere ausgebreitet. Die Menschen der Jungsteinzeit teilten mit ihren Tieren die Räume, aßen ihr Fleisch, versorgten sie und verarbeiten Fell, Knochen und Dung. Solch intensiver Kontakt förderte die Übertragung von Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen und umgekehrt. Der Mensch teilt fast 150 Krankheiten mit seinen Haus- und Nutztieren, das sind 75 % aller Infektionskrankheiten (11). Viele der Organismen entwickelten sich weiter zu rein menschlichen Infektionskrankheiten, soll heißen, sie wurden direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Masern sprangen von Rindern über (12), Pocken infizierten vermutlich ursprünglich Nagetiere, die von den Getreidevorräten angezogen wurden (9). Bis vor kurzem rätselten Forscher über den Ursprung von Röteln und Mumps, nun hat man nahe Verwandte der Erreger bei Mäusen und Fledermäusen gefunden (13). Eine Vielzahl von Haus- und Wildtieren dient als Reservoir für Influenzaviren und besonders Vögel und Schweine tauschen sie gerne mit uns aus (14). Die meisten frühen Infektionskrankheiten gelten heute als Kinderkrankheiten. In der Jungsteinzeit kannte das menschliche Immunsystem die neuen Pathogene aber noch nicht und die „Kinderkrankheiten“ endeten oft tödlich. Erst nach vielen Generationen konnte das Abwehrsystem der frühen Landwirte besser mit den Keimen umgehen. Die Krankheiten verliefen allmählich milder. Dieses verhängnisvolle Drama wiederholte sich, wann immer Menschen aus verschiedenen Ökosystemen aufeinandertrafen. Jede Gruppe trug Mikroorganismen mit sich, gegen die die jeweils anderen noch keine Abwehrmechanismen entwickelt hatten (15; 16).
Seuchengeschichten
Unsere Geschichte beginnt mit den ersten Schriftkulturen, alles davor wird unter dem Begriff prähistorisch zusammengefasst. In unbeschriebenen Millionen von Jahren entwickelten wir uns in unserer Urheimat Afrika zu modernen Menschen. Mehrfach haben unserer Ahnen von dort aus die Welt besiedelt. Die vergessene Vorgeschichte umfasst bis auf die letzten 10 000 Jahre unsere ganze menschliche Existenz, kein Wunder also, dass Forscher aller Sparten davon fasziniert sind. Neben frühen Artefakten und kostbaren menschliche Überresten suchen sie nach Indizien, die Aufschluss geben über unsere graue Vorzeit. Auch beim Jetztmenschen werden prähistorische Fährtenleser fündig. Hinweise auf unsere Urgeschichte finden sich in unserem Genom, den Sprachen und Überlieferungen, aber auch in Infektionskrankheiten und traditionellem Heilwissen. Hilfreich sind auch Rekonstruktionen früher Ökosysteme mithilfe des wachsenden Wissens über Klima und Biotope in den letzten Jahrmillionen. So erfahren wir, welches Umfeld bestimmte Krankheiten fördert (17). Epidemien sind besonders interessant für Zeitdetektive wie Archäologen oder Anthropologen. Aus der Verbreitung von Infektionskrankheiten und auch den Resistenzen, die Menschen dagegen entwickeln, ziehen die Forscher Rückschlüsse auf Lebensumstände und Umweltbedingungen. Ist die Entwicklung eines Erregers mit der vonHomo Sapiensschon seit langer Zeit verwoben, spiegeln beide Genome diese gemeinsame Evolution. Mykobakterien sind solche treuen Begleiter, die sich schon seit Jahrtausenden auf den Menschen spezialisiert haben. Diese Pathogene verursachen Tuberkulose und Lepra. Beides sind Krankheiten mit langsamen Verläufen, was auf eine lange Koexistenz zwischen Wirt und Erreger deutet (18). Durch die gemeinsame Co-Evolution mit dem Menschen gibt uns die globale Verteilung verschiedener Mykobakterien-Linien Hinweise auf die menschliche Migration seit dem Aufbruch aus Afrika. Die einzelnen Linien passten sich an ihre jeweiligen Wirtspopulationen an. Als den Mikroorganismen dann in der Jungsteinzeit mehr Menschen zur Verfügung standen, wurden Mykobakterien virulenter, die Erkrankten ansteckender (18). Nach Beginn der Viehhaltung konnten Krankheiten vermehrt von Haustieren auf Menschen überspringen. Notgedrungen lernte unser Immunsystem über viele Generationen, mit den Erregern umzugehen (9). Aus verheerenden Seuchen wie Masern, Mumps und Röteln wurden vermeintlich harmlose Kinderkrankheiten. Hier nun ein paar Beispiele dafür, wie Seuchen den Alltag unserer Vorfahren spiegeln, lange bevor Geschichte geschrieben wurde.
Mörderische Malaria
Malaria ist die Mutter aller Seuchen. Schon unsere vor- und urmenschlichen Ahnen litten unter Formen des Sumpffiebers. Tatsächlich gab und gibt es nämlich verschiedene Arten des ErregersPlasmodium,der über den Stich der Anophelesmücke übertragen wird.Plasmodiumist ein Einzeller und nicht etwa ein Bakterium oder Virus. Der Unterschied ist zu fein, als dass ihn die Opfer würdigen könnten, die Auswirkungen der Krankheit sind bis heute furchtbar. Alleine 2019 starben über 400 000 Menschen an den Folgen einer Malariainfektion. Aber weil Malaria die Menschen schon so lange plagt, haben die Wirte eben auch eine Reihe von Schutzmechanismen entwickelt, allen voran den Klassiker des Biologielehrplans, die Sichelzellenanämie. Wer von einem Elternteil die Anlage zur Sichelzellenanämie erbt, bildet neben ufoförmiger normaler roter Blutkörperchen auch sichel(!)förmige Blutkörperchen aus. Damit wird Plasmodium ausgetrickst, denn der Einzeller kann sich nur in den Standard-Ufo-Blutzellen einnisten. Rote Blutkörperchen mit einem Sichelzell-Gen verformen sich bei einer Plasmodien-Infektion und werden vom den Immunzellen eliminiert. Folglich sind Träger der Sichelzellenanämie resistenter gegen Malaria (17). Aber der Preis ist hoch: wer von beiden Eltern die Anlage erbt, der stirbt noch vor dem Erwachsenenalter, die sichelförmigen Blutzellen können ihren Job im Körper einfach nicht alleine erfüllen. Dennoch finden sich Regionen in Afrika, in denen ein Drittel der Bevölkerung die Anlage zur Sichelzellenanämie hat, das sind eben jene Gegenden, die besonders stark von Malaria geplagt werden. Selten findet man so eindeutige Zusammenhänge in der Natur! (19)
Dabei haben die roten Blutzellen noch andere Abwehrmechanismen gegen die fiesen Einzeller. Da gibt es zum Beispiel die Duffy, eine negative Genvariante, bei der das Einfallportal des Plasmodiums in die Blutzelle blockiert wird. Diese Genmutation hat für den Träger keine schädlichen Nebenwirkungen. In den Malariagebieten Afrikas tragen 97 % der Bevölkerung das veränderte Gen. Sie sind damit gegenPlasmodium vivatder ältesten Malariaform immun. Leider aber nicht gegenP. falciparum,der mörderischsten aller Malariavarianten. Davor schützt der Körper sich durch die Sichelzellenanämie. Solch ein „teurer“ Schutz lohnt sich aber erst, wenn die Infektionsgefahr mit Malaria sehr hoch ist. Das wiederum hängt von der Lebensweise ab.
Solange die Menschen im tropischen Afrika umherziehende Jäger und Sammler waren, die sich in Kleinstgruppen durch dichten Wald bewegten, fielen nur wenige der Malaria zum Opfer. Je effektiver diese Gruppen aber mit Hilfe neuer Techniken und Werkzeuge ihre Ressourcen nutzten, desto größer wurden die Gruppen und desto länger konnten sie sich in einem Gebiet aufhalten. Zeitgleich nahm der Befall mit Malaria zu,Plasmodiumkonnte leichter per Mückentaxi von einem Opfer auf das andere überspringen, als die Menschen immer enger zusammenlebten. Dann begannen die Urafrikaner, per Brandrodung kleine Lichtungen zu schaffen, damit die heißbegehrten Yamswurzeln besser gediehen. Leider machten sie damit den piekenden Zwischenwirten das Leben noch leichter (17). Außerdem enthalten Yamswurzeln Inhaltstoffe, die die Sichelzellenbildung verhindern, also die Nebenwirkungen der Anämie abschwächen. Dies half der Mutation, sich trotz aller Nachteile durchzusetzen. Dummerweise mieden zudem viele Tiere die menschengemachten Lichtungen, so dass die ursprünglich sehr vielseitigen Mücken immer mehr auf den Menschen als Blutspender angewiesen waren. Auch das förderte ungewollt den Malariabefall. Eine andere Seuche, nämlich die von der Tsetse-Fliege übertragene Schlafkrankheit, verhinderte, dass die tropischen Afrikaner Haustiere domestizierten, denn nicht nur für Menschen, sondern auch für andere Arten ist die Schlafkrankheit fatal. Als Folge davon nistete sich die Anophelesmücke immer mehr in den künstlich geschaffenen humanen Habitaten ein und erkorH. sapienszu ihrem Hauptwirt, wodurch der Infektionsdruck auf die Zentral- und Westafrikaner stark zunahm. Heute sticht die gefürchtete Mücke zu 80 % bis 100 % Menschen, zum Glück für ihren blinden PassagierP. falciparum, der sich in anderen Lebewesen nicht vermehrt.
Andererseits half Malaria den Völkern, die durch ihre effektive Ressourcennutzung und immer sesshaftere Lebensweise in Afrika ihre Hauptopfer waren. Sie gehören der Volksgruppe der Bantu an. Wie oben beschrieben entwickelten sie im Laufe leidvoller Jahrtausende Gegenstrategien, die sie vor Malaria schützten. Den Jägern und Sammlern, mit denen sie ihren tropischen Lebensraum teilten, fehlte dieser Schutz. Ein Gang durch ein Bantudorf oder über eine mückenverseuchte Lichtung war da schnell todbringend. So konnten sich die Bantu in West und Zentralafrika durchsetzen. Auch die Europäer fielen dem Parasiten reihenweise zum Opfer, dies brachte Afrika den Spitznamen „Grab des weißen Mannes“ ein. Diese evolutionäre Seifenoper begann Jahrtausende vor Beginn der Geschichtsschreibung. Forscher haben sie in mühsamer Spurensuche aus den Genen von Erregern und Opfern rekonstruiert. Auch aus der modernen Verbreitung vonPlasmodienund Resistenzen, sowie aus Sprache und kulturellen Schutzstrategien, ergeben sich Hinweise. So ist die Co-Evolution von Anophelesmücke, Malaria und den Menschen ein Lehrstück über die Zusammenhänge zwischen einer Seuche und der Lebensweise des Menschen. (19)
Rätselhafte Resistenz
AIDS istdieSeuche der Moderne, als wir glaubten, das Schreckgespenst Infektionskrankheit schon mit Impfungen und Antibiotika verbannt zu haben. Die Immunschwächekrankheit ist vermutlich vor etwas mehr als 100 Jahren in Afrika entstanden und wuchs sich vor 40 Jahren zum globalen Albtraum aus. Als sich die Zahl der Infektionen häufte, bemerkten Forscher in Amerika, dass sich einige Menschen schwerer anstecken oder zumindest einen verzögerten Krankheitsverlauf haben. Es stellte sich heraus, dass sie Träger einer Mutation namens CRR5 waren, die ihre Immunzellen vor dem Angriff der häufigsten Form desHI-Virusschützt. Dem veränderten Gen fehlt ein Teil, so dass es ein bestimmtes Protein nicht mehr korrekt codiert. Dieses Protein liegt auf der Oberfläche der Immunzellen, die Angriffsziel desHIVsind. Das Protein spielt eine Schlüsselrolle bei der Übernahme der Zelle durch das Virus. Das Verblüffende: die Träger der Mutation waren alle Nachfahren von europäischen Einwanderern. Haben sie von beiden Eltern die mutierten Gene gerbt, sind sie sogar immun gegenAIDS. Weitere Studien, deckten auf, dass etwa 10 % aller Europäer die Mutation tragen. Bei Nordeuropäern sogar bis zu 14 %, bei den Südeuropäern um die 5 %. In allen anderen Kontinenten ist die Genveränderung sehr selten.(20)
Das eigentliche Mutationsereignis geschah wohl schon vor über 2 000 Jahren, aber seit etwa 700 Jahren ist es besonders für Europäer vorteilhaft, die Genveränderung zu tragen. Seit dieser Zeit stellen Genetiker nämlich einen starken Anstieg der Mutation im Erbgut der Europäer fest. Bis heute ist nicht geklärt, was den Anstieg bewirkte, der vorAIDSschützt, einer Krankheit, die erst Jahrhunderte später auf einem anderen Kontinent entstand. Vermutlich haben sich andere Erreger auf eben jene Immunzellen spezialisiert, die auch das Angriffsziel für dasHI-Virussind. Was ist vor 700 Jahren geschehen, dass die veränderten Immunzellen für ihre Träger so vorteilhaft wurden? Es ist die Epoche des schwarzen Todes, jener Seuchenwelle, die ab dem 14. Jahrhundert ein Drittel der Europäer ausrottete. Kleiner Schönheitsfehler: Die Beulenpest, Hauptverdächtige in Sachen schwarzer Tod, wird durch ein Bakterium übertragen, nicht durch einen Virus. In Versuchen mit Mäusen zeigte sich, dass das gekürzte Gen nicht vor dem Befall mit der Beulenpest schützt. Viele Forscher halten daher den Pockenvirus für den wahren Selektionsfaktor (21). Pocken sind nicht so tödlich wie die Beulenpest, waren dafür aber über viele Jahrhunderte eine ständige Gefahr. Die Beulenpest dagegen kam immer wieder in Wellen, manche Regionen blieben sogar ganz verschont. Allerdings war Südeuropa besonders schwer vom schwarzen Todeszug betroffen, so verlor allein Florenz zwei Drittel seiner Einwohner, Venedig sogar drei Viertel (14). Daher sollten bei den Südeuropäern die schützende Genveränderung mindestens ebenso häufig auftreten wie bei den Nordeuropäern. Die ist ein weiteres Indiz, das gegen die Beulenpest als Ursache der Resistenz gegenHIVspricht.
Wir wissen, dass seit dem Spätmittelalter eine ungute Kombination aus starken Bevölkerungswachstum, mangelnder Hygiene und häufigen Missernten begann. Letztere ist die Folge einer Abkühlung, genannt die „kleine Eiszeit“. Ernährungszustand und die Gesundheit der Menschen verschlechterten sich, wodurch sie anfälliger für Seuchen waren. Dazu kamen fehlenden Kanalisation und enges Zusammenleben, Verhältnisse, die buchstäblich zum Himmel stanken. Da wurden Latrinen neben den Dorfbrunnen gebaut, Leichen flach begraben, Flüsse zur Abfallentsorgung genutzt. Hygiene kam aus der Mode, denn man kannte weder die Ursachen noch die Übertragungswege von Infektionen und hielt zu häufiges Waschen für ungesund. Dies alles sind ideale Voraussetzungen für Infektionskrankheiten, weshalb vermehrt und dauerhaft Seuchen grassierten. Welche davon für die eigenartige Resistenz gegenAIDSverantwortlich ist, lässt sich noch nicht sicher sagen. Manche Experten vermuten sogar, dass es eine Kombination von mehreren Krankheiten gewesen sein könnte. Fazit: Die vielen Seuchen und die menschlichen Schutzmechanismen dagegen spiegeln auch hier die Lebensverhältnisse der Europäer des späten Mittelalters wider. Es sei noch kurz angemerkt, dass auch der bessere Schutz vor AIDS seinen Preis hat. Menschen mit dem verkürzten Gen neigen zu Darmerkrankungen und haben statistisch eine etwas kürzere Lebenserwartung (22).
Teil 2 - Späte Diagnose
oder CSI der besonderen Art
Wer in der Vergangenheit nach den Spuren von Seuchen sucht, hat drei Probleme:
Krankheiten wurden bis in die Neuzeit nicht systematisch dokumentiert.Erst seit dem 19. Jhd. Jahren wurden Krankheiten eindeutig erkannt und benannt.Nur wenige Krankheiten hinterlassen Spuren am menschlichen Körper, die nach Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden nachweisbar sind.Beweise
Bis vor 200 Jahren wurden Krankheiten selten statistisch verwendbar dokumentiert. Von Krankheiten erfahren wir fast nur in Zusammenhang mit historischen VIPs wie Kaiser Konstantin (277/280 – 337 n. Chr.). Als Konstantin an Lepra erkrankte, soll er der Sage nach ein Bad im Blut von Jungfrauen zwecks Heilung erwogen haben (23). Verheerende Seuchen mit vielen Opfern werden zwar in alten Chroniken erwähnt aber ohne solide Zahlen zu liefern. Ein gutes Beispiel sind die „Annales Fuldenses“,sie berichten wortkarg von einer „gewaltigen Pestilenz“, die 877 n. Chr. am Rhein wütete, so dass „sehr viele an Husten die Seele aushauchten.“ (24). Besonders verwirrend für den faktenorientierten Jetztmenschen ist die metaphorische Erzählweise mittelalterlicher Chronisten. Wird ein kranker Leib erwähnt, ist damit oft weder Infektion noch Epidemie gemeint, sondern eine spirituelle Krise (25). Die ergiebigsten Quellen sind Kirchenbücher, wie das des kleinen englischen Dorfes Eyeam. In dem Ort wütete im 17. Jhd. eine Epidemie, vermutlich die Beulenpest, der fast 40 % der Bewohner zum Opfer fielen. William Mompesson, der junge Rektor der Gemeinde, überredete die Eyeamer schließlich, sich selbst zu isolieren. Niemand verließ oder besuchte den 800-Seelen-Ort in den nächsten Monaten. Nachbargemeinden stellten Essen an die Ortsgrenze, das Geld für die Lebensmittel hinterlegten die Bewohner des geplagten Dörfchens zur Sicherheit in Bächen oder Essigkrügen für die hilfreichen Nachbarn. In seinem Kirchenbuch registrierte Mompesson alle Opfer der Plage, einschließlich seiner eigenen Frau. Auch die Sterbedaten vermerkte er penibel. Aufgrund der ebenfalls in das Kirchenbuch eingetragenen Heiraten und Taufen konnten Verwandtschaftsverhältnisse nachvollzogen werden, so war es möglich, auch nach 350 Jahren Infektionsketten zu rekonstruieren (26). Der Geistliche beschrieb in Briefen an seinen Onkel die dramatischen Ereignisse in Eyeam und so lernen wir die Menschen hinter den Namen im Kirchenbuch kennen. Die Kombination aus Fakten und individuellen Schicksalen, vor allem aber die freiwillige Selbstisolation, haben Eyeam weltberühmt gemacht. Nicht nur Forscher fasziniert das tragische Schicksal des kleinen Ortes (27).
Aussagen
Abbildung 2: Billls of Mortality
Die Idee, dass körperliches Unwohlsein natürliche Ursachen hatte, setzte sich erst allmählich durch. Die Menschen verstanden Gebrechen eher ganzheitlich als Ausdruck göttlichen Unwillens oder kosmischen Ungleichgewichts (28). Krankheiten reduzierten ägyptische Ärzte auf das dominierende Symptom und richteten ihre Behandlung darauf aus. Andererseits suchten besonders griechische Ärzte, schon in der Antike, neben Therapien auch nach den physischen Auslösern vonLeiden (29; 30). Anders im mittelalterlichen Europa, hier praktizierten Heiler Medizin weitgehend unbelastet von kausalen Zusammenhängen. Wohl verfügte man über überliefertes Wissen und Erfahrung, um Leiden zu lindern, ebenso wichtig waren aber philosophische und astrologische Kenntnisse. Das Universum und die Elemente, so glaubte man, beeinflussten den menschlichen Körper, daher konsultierten bis in das 16. Jhd. Ärzte die Sterne, bevor sie Gebrechen behandelten (31). Lange Zeit wurden Krankheiten nach ihren Symptomen benannt. Noch 1788 finden sich in einem Londoner Sterberegister(Bills of Mortality)Angaben wie: Schwellung, Krämpfe oder Fieber als Todesursachen. Oft sammelten nicht Mediziner die Details über Krankheitsverläufe, sondern Laien. Meist waren es Frauen, die gegen ein kleines Entgelt die Behörden über Todesfälle in ihrem Umfeld informierten (1). Erst seit dem 19. Jhd. sind Ärzte in der Lage, Krankheiten eindeutig zu benennen. Neben dem wachsenden Wissen über Naturgesetzte halfen auch technische Neuerungen wie das Mikroskop, die Verursacher von Krankheiten zu finden und die winzigen Organismen sichtbar zu machen. Bilder und Zeichnungen erlauben nur selten einen Blick in Krankenstuben und Hospitäler vergangener Epochen. Menschliche Darstellungen sind zu ungenau, um sicher auf eine bestimmte Krankheit zu schließen. Darum können Wissenschaftler nur aus Beschreibungen von Symptomen, der Geschwindigkeit, mit der sich eine Krankheit ausbreitete und der Zahl der Todesopfer Rückschlüsse auf eine Seuche ziehen. Um eine Massenerkrankung einem bestimmten Erreger zuzuordnen, sind historische Berichte aber oft zu vage und widersprüchlich (24). Erschwerend kommt hinzu, dass sich Organismen über die Jahrhunderte und Jahrtausende verändern. Insbesondere Viren, aber auch Bakterien entwickeln sich weiter. Auch COVID-19 hat in dem ersten Jahr nach seiner Entdeckung mehr als 4 000 Mutationen durchlaufen. Infektionskrankheiten konnten früher also andere Symptome haben als heute. Da sich das menschliche Immunsystem ebenfalls anpasst, können Epidemien ihren Schrecken verlieren, wie wir am Beispiel der Kinderkrankheiten sehen. Aus all diesen Gründen bleiben Ursachen und Ausmaß vieler historischen Seuchen bis heute rätselhaft.
Indizien
Die Forensik, also Techniken, mit denen Verbrechen untersucht werden, ist groß in Mode. Einige Fernsehsender bestreiten gefühlt ihr gesamtes Abendprogramm mitCrime Scene Investigation(CSI).Auch manche Autoren haben sich auf Detektive spezialisiert, die vor allem mit forensischen Methoden ermitteln. Die gefällige Mischung aus Grusel, Igitt und Wissenschaft ist populär. Auch Laien wissen, dass man anhand der Leiche auf die Todesursache schließen kann. Klar ist auch, dass die Rekonstruktion des Tathergangs umso schwerer fällt, je älter die Leiche ist. Sind die Überreste Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alt, spricht man von Paläopathologie. Die Methoden sind ähnlich, allerdings geht es um krankhafte Veränderungen, nicht um Verbrechen, obwohl der eine oder andere historische Mord einer Studie durchaus Farbe verleiht. Die Paläopathologie liefert wertvolle Informationen über Alltag und Lebensbedingungen von Menschen. Niedergeschriebene Geschichte dokumentiert dagegen bis in das 19. Jhd. hauptsächlich große Persönlichkeiten und Ereignisse. Informationen über Lebenserwartung, Ernährung und eben auch Krankheiten der breiten Masse sind rar.
In der Regel bleiben von einem toten Körper schon nach wenigen Monaten nur die Knochen übrig. Mumien sind darum besonders beliebt, denn bei ihnen hat auch das Weichgewebe die Zeiten überdauert. Man denke nur an Ötzi, dessen 5 300 Jahre alte Gletschermumie 1991 in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Jahrelange Untersuchungen produzierten nicht nur ausreichend Erkenntnisse für ungezählte Dokumentationen und Artikel, auch eine Dauerausstellung und mehrere Einzelausstellungen beschäftigen sich nur mit diesem einen Fund (32). Ägyptische und indianische Mumien sowie Moorleichen werden ebenfalls mit immer ausgefeilteren Methoden untersucht (33). Von einem Großteil der Menschheit sind aber leider, wenn überhaupt, nur Knochen übrig. Erschwerend hinterlassen Seuchen selten Spuren am Skelett, da die meisten sehr schnell zum Tode führen. Löbliche Ausnahmen aus Sicht der Paläopathologen sind Tuberkulose, Syphilis und Lepra, die langsamer töten und die Knochen verändern (34). Jede dieser Krankheiten schädigt das Skelett auf typische Weise. Fossilierte Kothaufen und Latrinen erlauben Einblicke, wie stark die Menschen von Parasiten des Magen-Darm-Trakts befallen waren. Neue Techniken liefern zusätzliche Informationen. Neben radiologischen Untersuchungen können Körper mit der Hilfe von kleinen Kameras auch von innen betrachtet werden. Besonders wertvoll ist die Molekularbiologie, die Biomarkern wie alter DNA (aDNA) Proteinen und Fetten nachspürt. In diesem molekularen Bereich arbeiten die neuen Stars der Vergangenheitsforschung, Archäogenetiker, und Paläomikrobiologen, die auch nach Jahrtausenden noch Erreger nachweisen können (35; 33). Menschliche DNA liefert ebenfalls Indizien, denn parallel zur Urbanisation steigt der Anteil an Genen, die mit verbesserter Immunabwehr in Verbindung stehen. Beispiele dafür sind die schon erwähnten Mutationen, die ihre Träger vor Malaria oder AIDS schützen.
Informativ sind auch sogenannte Sterbetafeln, in denen Alter und Geschlecht der „Bewohner“ eines Gräberfeldes oder Friedhofes festgehalten werden. In Kombination mit dem Todesdatum, das sich aus Grabsteinen oder durch andere Datierungen ergibt, kann Friedhofsdemografie betrieben werden. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben, ist je nach Alter, Geschlecht und sozialer Klasse unterschiedlich groß. Finden sich in einer Grabstätte Menschen aller Altersgruppen und beider Geschlechter in gleichen Anteilen, die alle in kurzer Zeit verstarben, ist dies ein Hinweis auf eine Naturkatastrophe, Massaker oder eben eine Seuche. Auch die Art des Begräbnisses, etwa in einem Massengrab, geben Hinweise auf die Umstände des Todes. Trotz des spärlichen Untersuchungsmaterials hilft die Paläopathologie entscheidend mit, die lückenhafte Dokumentation von Seuchen zu ergänzen. Epidemiologen liefert sie damit wichtige Einblicke in die Krankheitsevolution (33) und den Umgang früherer Gesellschaften mit Pandemien und Epidemien.
Schrumpfen Siedlungen und werden aufgegeben, oder verschwinden gleich ganze Kulturen, ist dies ebenfalls ein Hinweis auf eine Katastrophe. Es kann sich um Überschwemmungen, Dürren oder hausgemachte ökologische Desaster handeln. Auch Seuchen gehören zu den üblichen Verdächtigen. Insbesondere in frühgeschichtlichen Zeiten lässt sich das schwer rekonstruieren, da ist ein Forscher für Indizien dankbar.
Teil 3 - Chroniken des Unheils
eine Spurensuche in der Vergangenheit
Frühgeschichte
Die Anfänge von Seuchen lassen sich bis in prähistorische Zeiten zurückverfolgen. Epidemien begannen zwar erst mit der landwirtschaftlichen Revolution, doch es gibt drei Erregergattungen, die sich schon viel früher auf den Menschen spezialisierten. Neben Malaria litten unsere afrikanischen Vorfahren bereits unter Treponematosen und mykobakteriellen Infektionen.
Malaria
Im Falle von Malaria rekonstruierten Genetiker die Evolution der Infektionskrankheit, zur weltweiten Seuche. Einige Arten des ParasitenPlasmodium, des Verursachers von Malaria, haben sich hochgradig an den Menschen angepasst, ein langer Evolutionsprozess. Am ähnlichsten sind die menschlichenPlasmodiennoch denen, die Gorillas plagen (36), ein Hinweis auf gemeinsame Ahnen. Möglicherweise erkrankten schon Vormenschen an einer Form der Malaria, die sich mit dem Menschen weiter veränderte, was auf Afrika als Ursprungskontinent deutet. Als sich Homo sapiens vor 80 000 Jahren von Afrika aus über die Welt ausbreitete, hatte er Malaria bereits im Gepäck.
Tuberkulose
Palöomikrobiologen streiten darüber, wie lange Tuberkulose (TB) der Menschheit schon zusetzt (37).Mycobacterium tuberculosisGene spiegeln eine lange Co-Evolution zwischen Erreger und Mensch wider. Sicher ist, der Tuberkulose-Erreger spezialisierte sich schon in Afrika auf menschliche Wirte, da sind sich die Wissenschaftler einig. Mit dem Menschen wanderte das Pathogen bis nach Amerika. Bei verschiedenen Tierarten finden sich allerdings nahe Verwandte, die als Zoonosen ebenfalls tuberkuloseartige Schäden im menschlichen Körper verursachen. Kurzerhand werden sie mitM. tuberculosiszumMycobacterium tuberculosis Komplex (MTBC)zusammengefasst. Vermutlich stammen sämtlicheMTBC-PathogenevonM. tuberculosisab (37). Bei diesen Zoonosen ging die Evolution den umgekehrten Weg und die Erreger sprangen von den Menschen auf seine Nutztiere über. Es ist denkbar, dass der kontrollierte Gebrauch von Feuer vor 300 000 – 400 000 Jahren die Entstehung von Tuberkulose förderte. Durch Brandrodung begann der Mensch damals, seine Umwelt zu verändern, dadurch kam er vermehrt in Kontakt mit Mykobakterien-Reservoirs im Boden. Rauch schädigt das Lungengewebe und schwächt die Abwehrkräfte, das machte es leichter für die Erreger, Menschen zu infizieren. Obendrein boten Lagerfeuer als soziale Hotspots eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig anzustecken (11). Es wird spekuliert, dass die lange Latenzzeit, in der das Immunsystem den TB-Erreger unterdrücken kann, eine Anpassung des Pathogens an die Jäger- und Sammlergesellschaften war. Ohne Schaden zu verursachen, überdauert der Erreger im Wirt, bis dessen Immunsystem geschwächt wird, sei es nun durch Alter, Hunger oder eine weitere Infektion. Dann erst wird das Bakterium reaktiviert, beginnt den Wirt zu schädigen und kann neue Wirte infizieren. Durch die lange „Pause“ kann in der Familiengruppe des Erkrankten eine neue Generation nicht befallener Menschen heranwachsen. Dank seiner langen Latenzzeit konnte sichM. tuberculosisauch in kleinen menschlichen Gruppen aufH. sapiens spezialisieren, bevor dieser sesshaft wurde (37). Archäogenetiker gehen davon aus, dassM. tuberculosisvirulenter wurde, als viele Menschen in neolithischen Siedlungen dauerhaft zusammenlebten. An einer 4500 Jahre alten ägyptischen Mumie wurde Spuren einer Tuberkulose-Erkrankung entdeckt. Neben TBC- typischen Wirbelsäulenverformungen wie dem Pottschen Gibbus, die zu einem Buckel führen können, wurde auch DNA vonM. tuberculosisin Gewebeproben gefunden (33; 14). Die DNA-Funde lassen vermuten, dass die Durchseuchungsrate mit Tuberkulose bei den Ägyptern hoch war. In Europa fanden sich ebenfalls Spuren von Tuberkulose an drei jungsteinzeitlichen Skeletten. Genetische Spuren vonM. tuberculosis,wie die an einer präkolumbianischen 1 000 Jahre alten weiblichen Mumie, beweisen, dass Tuberkulose nicht erst mit den Europäern nach Amerika kam. Trotz Impfungen und Medikamenten sterben auch heute noch jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen an Tuberkulose. Keine andere Infektionskrankheit fordert so viele Opfer (37).
Lepra
M. leprae,ein naher Verwandter vonM. tuberculosis, ist ein behäbiger Erreger. Das Bakterium teilt sich sehr langsam, seine Latenzzeit kann bis zu 30 Jahre dauern, die Ansteckungsgefahr ist moderat und längst nicht jeder Erkrankte hat einen schweren Verlauf. Zurzeit leiden etwa 200 000 Menschen an Lepra (38). Die grausamen Symptome, das entstellte „Löwengesicht“, der Verlust von Extremitäten und das soziale Stigma eines „lebenden Toten“ wecken bis heute irrationale Ängste. Die Evolution der Lepra ist rätselhaft, Genetiker verorten ihren Ursprung nach Ostafrika oder den Mittleren Osten. Sie sind nicht sicher, ob …
Lepra wie ihre „Cousine“ Tuberkulose schon vor zehntausenden von Jahren mitHomo sapiensaus Afrika emigrierte, oderJahrtausende später mit bronzezeitlichen Händlern aus Asien nach Ostafrika kam.Viele Paläomikrobiologen vermuten, dass sich Lepra erst mit der Urbanisierung ausbreiten konnte, denn für eine Ansteckung ist die Krankheit auf häufigen menschlichen Kontakt angewiesen. Archäogenetiker verglichen verschiedene Linien des Lepra-Erregers und errechneten einen gemeinsamen Ursprung vor höchstens 5 000 Jahren (39). In Indien stießen Paläopathologen auf ein 4 000 Jahre altes Skelett mit den markanten Knochenveränderungen, die bei einem schweren Verlauf der Lepra auftreten (40). Das alles spricht für Theorie b. Andererseits fanden sich in einer 6 000 Jahre alten ungarischen Siedlung ebenfalls Skelette mit lepratypischen Schäden (41).
Niemand weiß, wie und wann sich Lepra in Afrika, südlich der Sahara, ausbreitete. Die ältesten Spuren finden sich im Osten des Kontinents, doch auf welchem Weg die Seuche von dort aus durch Menschen verschleppt wurde, wird noch untersucht. Sicher ist, dass Lepra schon vor der Kolonialzeit in ganz Afrika verbreitet war (42).
Treponematosen
Genetischen Untersuchungen zeigen, dassTreponemapallidumBakterien schon seit Urzeiten bei dem Menschen Erkrankungen auslösen. Die berüchtigtste Treponematose ist die Syphilis, die dank vager Assoziationen mit Lust und Wahnsinn viele Künstler fasziniert und inspiriert hat. Gemeinsam mit den Menschen verließen die korkenzieherförmigen Keime Afrika und wurden über die ganze Welt verteilt. Sie gelangten bis nach Amerika und natürlich auch nach Europa.
Pocken/Blattern
Der direkte Vorfahr des Pockenerregers entstand vor 68 000 bis 17 000 Jahren, vermuten Virologen (43). Nächste Verwandte sind auf Rennmäuse und Kamele spezialisierte Pockenarten. Immer wieder werden Ansteckungen zwischen Tieren und Menschen beobachtet, besonders Kuhpocken werden eine Schlüsselrolle im Kampf gegen „das gefleckte Monster“ Blattern spielen, doch dazu später mehr. Wahrscheinlich infizierten tierische Pocken den Menschen also schon, bevor er Haustiere hielt. Die rein menschliche Pockenform konnte aber erst entstehen, nachdemHomo sapiensvor 10 000 Jahren sesshaft wurde, also in ausreichender Dichte zur Verfügung stand. (44). Paläomikrobiologen halten die Pocken für jünger, sie verorten den Ursprung der Blattern in das Reich der Königin von Saba am Horn von Afrika. Vor 3 000 bis 4 000 Jahren wurden Handelsgüter mit dem damals neumodischen Kamel transportiert, auch nach Ostafrika, einem Habitat von Rennmäusen (45). So kamen die verschiedenen Pockenvirenstämme in Kontakt undOrthopoxvirus variolae (VARV)entstand.
Lungenpest
Erste Spuren des PesterregersYersiniapestisfinden sich in 5 000 Jahre alten Skeletten in den östlichen eurasischen Steppen (46). Archäogenetiker vermuten, dass schon vor mindesten 7 000 Jahren das harmlose BakteriumY. pseudotuberculosiszu dem tödlichen Keim mutierte, der immer wieder zum Gamechanger der Menschheitsgeschichte werden sollte. Damals, 3000 v. Chr., in der Jungsteinzeit, wurdeY. pestisaber nicht von Rattenflöhen oder Läusen übertragen, sondern über Aerosole von Mensch zu Mensch. Man bezeichnet diese Pestvariante daher als Lungenpest. Erst in der Bronzezeit um 1800 v. Chr. mutierteY. pestiserneut und konnte nun auch von Zwischenwirten wie Flöhen übertragen werden (46; 47; 48). Nun kann man sich fragen, welche Vorteile esY. pestisbrachte, den Umweg über Flöhe und anderes Ungeziefer als Zwischenwirte zu nehmen, statt direkt von Mensch zu Mensch überzuspringen. Der Teufel liegt in diesem Fall im Detail: Für den Pesterreger ist es nicht einfach, sich auf direktem Wege auszubreiten. Denn um sich anzustecken, muss man einem Erkrankten sehr nahekommen, die Ansteckungskraft ist also sehr viel geringer als etwa die desSARS-CoV-2Erregers. Außerdem schränkt der spezifische Ansteckungsweg die Auswahl an Wirtsorganismen ein. Ursprünglich kamen Pestvorläufer in Nagetieren vor, wie sie auf die menschlichen Wirte übersprangen ist noch ungeklärt. Wir wissen, dass die Steppenvölker vor 5 000 Jahren berittene Hirten waren, daher stehen ihre Pferde in Verdacht, als Bakterienreservoir fungiert zu haben (49). Mit dem Volk der Yamnaya verbreitete sich die Pestwelle weit über die eurasischen Steppen und erreichte schließlich Europa und Asien (47). Geholfen hat ihr ein Infektionsbeschleuniger: zwischen den verstreuten Kulturen hatte sich ein dichtes Handelsnetz entwickelt, vor allem dank der Pferde, mit denen große Entfernungen überwunden werden konnten. Neben Waren wurden auch Keime über weite Strecken ausgetauscht. Dann kommt es zum Einbruch: überall in Eurasien werden im 4./3. Jahrtausend v. Chr. Siedlungen aufgegeben, die Bevölkerung geht zurück, vielleicht eine Folge dieser ersten Pestwelle. Auch für Europa waren die Auswirkungen apokalyptisch. Von den damals vielleicht 8 Millionen frühen Bauern starben etwa die Hälfte an der Lungenpest. Männer waren schwerer von der Seuche betroffen als Frauen, ähnlich wie bei der aktuellen COVID-19-Pandemie. Den genetischen Spurensuchern zufolge verdrängten einwandernde Steppenreiter damals fast alle ansässigen Männer in Europa. Unklar ist, warum die Neuankömmlinge aus dem Osten weniger unter der Pandemie litten als die Europäer. Möglicherweise hatten sie eine bessere Immunabwehr, da die Pest schon seit Jahrhunderten bei ihnen wütete. Unterwarfen die Steppennomaden die sesshaften Bauern also gewaltsam, von der Pest als „Biowaffe“ unterstützt? Vielleicht erreichte die Lungenpest aber auch über Handelswege den Westen und die Pferdehirten wanderten später friedlich in die im doppelten Sinne herrenlosen Gebiete ein? NebenY. pestis





























