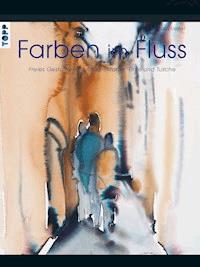37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieser Band baut auf der Pflegeassistenz auf. Er bildet die wesentlichen Inhalte der sieben Themenbereiche laut GuGK 2016 (BGBl. I Nr. 75/2016) ab und ist zum Einsatz in den Ausbildungen zur Pflegefachassistenz im 2. Ausbildungsjahr gedacht. Die Inhalte sind, wie auch in Band 1, nach Lernfeldern gegliedert und fördern so die Vernetzungskompetenz der Auszubildenden. Das Buch vermittelt zukünftigen Pflegenden die Kompetenz, Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit wahrzunehmen, um individuell auf deren Bedürfnisse abgestimmte Pflege und Betreuung zu ermöglichen. Für Lehrende und Auszubildende der Pflegeassistenzberufe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Reiter, Fenzl, Gottschling, Aiglesberger, Paminger
Pflegefachassistenz
von l. nach r.: Reiter, Paminger, Fenzl, Gottschling, Aiglesberger
Monika Reiter, MBA: DGKP, Fachpflegerin für Anästhesiepflege, Lehrerin für Gesundheitsberufe, akad. Gesundheitsbildnerin, gerichtlich beeidete Pflegesachverständige, Mediatorin, Ethikberaterin im Gesundheitswesen (AEM).
Ruth M. Fenzl, MA, MBA: DGKP, Lehrerin für Gesundheitsberufe, Gerontologin, Sachverständige des BMGF, Ethikberaterin im Gesundheitswesen (AEM).
Isabel Gottschling BEd., MEd., MBA: DGKP, Lehrerin für Gesundheitsberufe, Kommunikationstrainerin, Praxisbegleiterin für Basale Stimulation® in der Pflege.
Mag. Michael Aiglesberger, BScN, MBA: Direktor der Schule für GuKP am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Lehrer für Gesundheitsberufe, Fachpfleger für Intensivpflege.
Martina Paminger: DGKP, Lehrerin für Gesundheitsberufe, Palliativpflegefachkraft, Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Leitung der Weiterbildung Palliative Care am BFI OÖ.
Trotz größter Bemühungen ist es nicht gelungen, alle Abbildungsquellen zu eruieren.Sollten Ansprüche gestellt werden, bitten wir darum, sie dem Verlag mitzuteilen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der AutorInnen oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
2. Auflage 2024
Copyright © 2019 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Verlag, Wien, Österreich
Umschlagbild: © monkeybusinessimages & © Designer, istockphoto.com
Lektorat: Katharina Schindl, Wien
Satz und Abbildungen: Florian Spielauer, Wien
Druck: finidr
Printed in the E. U.
ISBN 978-3-7089-2444-1
E-ISBN 978-3-99111-847-3
Inhalt
Vorwort
Hinweise zum Gebrauch des Buches
Lernfeld 1
Berufliche Identität als PFA entwickeln und Verantwortung übernehmen
Rechtliche Grundlagen
Erwachsenenschutz-Gesetz (ErwSchG)
Vertretungsmöglichkeiten
ErwSchG in der medizinischen und pflegerischen Praxis
Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) – Vertiefung
Geltungsbereich
Arten der Freiheitsbeschränkung
Meldung einer freiheitsbeschränkenden Maßnahme
Alternativen zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen
Unterbringungsgesetz (UbG)
Voraussetzungen für eine Unterbringung
Voraussetzungen für eine Einweisung
Weitere Schritte im Krankenhaus
Kinder und Jugendliche im Krankenhaus
Allgemeines zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen
EACH-Charta
Rechtliche Situation
Begriffsdefinitionen
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz
Der Pflegeprozess
Pflegeassessment
Erstassessment
Reassessment
Fokussiertes Assessment
Pflegeplanung
Pflegediagnostik
Pflegeziele
Pflegeinterventionen
Durchführen von Pflegeinterventionen
Evaluierung
Delegation
Stabile Pflegesituation
Delegation, Subdelegation und Anordnung im Einzelfall
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
Definition
Grundprinzipien
Ziele
Akteure
Österreichisches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖNBGF)
Ottawa-Charta
Arbeitsmedizin und BGF
Merkmale einer qualitätsvollen BGF
Ansprüche der Betriebe und der Beschäftigten an die BGF
Arbeitsspezifische Belastungen am Beispiel des Pflegepersonals
Risikoverhalten
Folgen arbeitsbedingter Belastungen
Gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaffen
Gesundheitskompetenz
Programme der BGF
Beratung
Gesundheitszirkel
Projekte
Verhältnisprävention und Verhaltensprävention
Verhältnisprävention
Verhaltensprävention
Das BGF-Handbuch
Das kann ich!
Lernfeld 2
Ein fachliches Thema nachvollziehbar bearbeiten
Wissenschaft und Forschung
Pflegewissenschaft und Pflegeforschung
Der Gegenstand der Pflegeforschung
Pflegende in der Forschung
Der Forschungsprozess
Forschungsergebnisse finden
Forschungsergebnisse lesen und verstehen
Rahmenbedingungen für die Schriftliche Arbeit im Fachbereich
Thema
Gliederung
Formale Kriterien
Zitierregeln
Literaturverzeichnis
Das kann ich!
Lernfeld 3
Pflege von hochbetagten Menschen
Der Einzug in eine geriatrische Pflege- und Betreuungseinrichtung
Das geriatrische Basisassessment
Screening nach Lachs
Frailty
Risikofaktoren
Symptome
Folgen
Prävention
Schmerz
Barthel-Index
Sturz und Mobilität
Ernährung
Kognition
Stimmungslage
Polypharmazie
Gedächtnistraining
Multi-/Mehrspeichermodell
Gedächtnisformen
Unterstützung der Gedächtnisleistung
Gedächtnistraining als Teil der professionellen Pflege und Betreuung
Zehn Tipps zum kreativen Arbeiten mit älteren Menschen
Ideen zum kreativen Arbeiten
Aktivieren der Wahrnehmung
Kombination von Wahrnehmungsübungen
Die Zehn-Minuten-Aktivierung
Hitparade
Reise in die Vergangenheit
Erzählcafé
Dialekt und Umgangssprache
Spiele mit älteren Menschen
Das kann ich!
Lernfeld 4
Pflege von Menschen mit Behinderung, Besonderheiten in der häuslichen Pflege, Kinaesthetics
Bedeutung der Familie im zentralen Betreuungssystem
Angehörige als Ressource oder Herausforderung
Young Carers – Kinder als pflegende Angehörige
Schulung und Information
An- und Zugehörige bei Pflegeinterventionen informieren und anleiten
Unterstützung und Entlastung pflegender An- und Zugehöriger
Angehörigengespräche
Angehörigenentlastungsdienst
Ersatzpflege
Versicherungen für pflegende Angehörige
Besonderheiten in der häuslichen Pflege
Kinaesthetics
Geschichtlicher Hintergrund
Ziele
Konzepte
Interaktion
Funktionale Anatomie
Menschliche Bewegung
Anstrengung
Menschliche Funktionen
Umgebung
Das kann ich!
Lernfeld 5
Pflege von psychisch kranken Menschen
Gewaltprävention – „Red Flags“
Demenz als herausforderndes Verhalten für die Pflege
Validation
Aromapflege
Wickel und Auflagen
Musik
Licht
Snoezelen
Tiergestützte Pflege
Realitätsorientierungstraining (ROT)
Psychobiografische Pflege nach Böhm
Das kann ich!
Lernfeld 6
Pflege von Kindern und Jugendlichen
Grundlagen Kinder- und Jugendlichenpflege
Definition des Alters
Psychologische Besonderheiten
Anatomische Besonderheiten
Physiologische Besonderheiten
Wirkung von Medikamenten
Kinderkrankheiten und Krankheitsverläufe
Pflege von Neugeborenen und Säuglingen
Beobachtungskriterien
Schutz vor Auskühlung
Körperpflege
Schutz vor Infektionen
Physiologische Gewichtsabnahme
Ernährung
Sicherheit im Umgang mit dem Neugeborenen
Notfälle im Kindesalter
Hauptursachen
Präventive Maßnahmen
Verhalten im Notfall
Pflegerelevante Erkrankungen im Jugendalter
Essstörungen
Geistige Behinderung
Unterstützungs- bzw. Entlastungsangebote für An- und Zugehörige
Persönliche Assistenz
Finanzielle Unterstützung
Das kann ich!
Lernfeld 7
Pflege von Menschen mit palliativem Betreuungsbedarf
Schmerzen
Einteilung
Nozizeptorschmerzen
Neuropathische Schmerzen
Akute Schmerzen
Chronische Schmerzen
Durchbruchschmerz
Einflussfaktoren
Total pain
Schmerzanamnese
Schmerzverlauf
Schmerzlindernde Maßnahmen
Medikamentöse Schmerzbehandlung
Nicht-medikamentöse Schmerzbehandlung
Komplementäre Schmerzbehandlung
Übelkeit und Erbrechen
Ursachen
Anamnese
Therapie
Pflege
Obstipation
Ursachen
Anamnese
Therapie
Pflege
Mundtrockenheit (Xerostomie)
Ursachen
Pflege
Terminale Dehydratation
Delirantes Syndrom, Verwirrtheit, Unruhe
Therapie und Pflege
Fatigue
Symptome
Ursachen
Therapie und Pflege
Atemnot
Ursachen
Symptome
Einschätzung der Atemnot
Therapie
Pflege
Exulzerierende Wunden
Ursachen
Mögliche Probleme
Psychosoziale Begleitmaßnahmen
Wundanamnese und Wundassessment
Ziele
Schmerzen
Blutungen
Geruchsreduktion
Trauer
Trauerphasenmodell nach Verena Kast
Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens
Phase der aufbrechenden Emotionen
Phase des Suchens und Sich-Trennens
Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs
Ursachen für einen erschwerten Trauerverlauf
Komplikationen im Trauerverlauf
Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens
Phase der aufbrechenden Emotionen
Phase des Suchens und Sich-Trennens
Allgemeine Aufgaben in der Trauerbegleitung
Das kann ich!
Lernfeld 8
Pflege von chronisch kranken Menschen
Pflege bei Diabetes mellitus
Einteilung
Folgeerkrankungen
Diabetische Retinopathie
Diabetische Nephropathie/Niereninsuffizienz
Arteriosklerose
Diabetische Polyneuropathie
Diabetisches Fußsyndrom
Wichtige Verhaltenstipps für PatientInnen
Wundversorgung
Diabetes und Alter
Das kann ich!
Lernfeld 9
Pflege von akut kranken Menschen
Pflege von Menschen mit Demenz, psychiatrischen Erkrankungen und Behinderungen im Setting Krankenhaus
Perioperative Pflege
Voruntersuchungen und Aufklärung
Psychische Begleitung
Präoperative Pflege
Körperpflege
Rasur bzw. Haarentfernung
Nahrungskarenz
Darmvorbereitung
Einüben postoperativer Fähigkeiten
Vorbereitung und Prämedikation
Legen einer peripheren Venenverweilkanüle
Transport in den OP
Postoperative Pflege
Übernahme aus dem Aufwachraum
Postoperative Überwachung
Postoperative Positionierung und Mobilisation
Postoperativer Kostaufbau
Umgang mit Wunddrainagen
Subkutane Flüssigkeitssubstitution
Indikationen
Komplikationen
Vorbereitung
Applikationsstellen
Durchführung
Enterale Ernährung
Sonden
Naso-/orogastrale Sonde
Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG)
Gastrotube und Stomabutton
Enterale Nahrungsverabreichung
Sondennahrung
Komplikationen
Katheter
Katheter-Arten
Setzen/Wechseln eines Blasenverweilkatheters
Entfernen eines Blasenverweilkatheters
Harnstreifentest
Das kann ich!
Lernfeld 10
In der Organisation zur nachhaltigen Qualitätssicherung beitragen
Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibung
Stelle versus Arbeitsplatz
Anleitung in der Pflege
Information/Auskunft
Aufklärung
Schulung/Anleitung/Instruktion/Edukation
Beratung
Die Rolle der Pflege im multiprofessionellen Versorgungsteam
Pflegevisite
Primärversorgung
Nahtstellen
Settingangepasste Pflegemodelle
Das Pflegemodell nach Leininger
Das Pflegemodell nach Friedemann
Das Pflegemodell nach Peplau
Praxisanleitung
Planung der praktischen Anleitungssituation
Ablauf der praktischen Anleitungssituation
Das kann ich!
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Hinweise zum Gebrauch des Buches
Wichtige Worte im Text sind fett gedruckt.
Kernaussagen sind orange hinterlegt.
Aufgaben, Beispiele sind blau hinterlegt.
Am Ende jedes Abschnitts finden Sie eine Übersicht zur Wissensüberprüfung.
Vorwort
Dieses Lehrbuch ergänzt das Band „Pflegeassistenz Lehrbuch für die Pflegeassistenz und das 1. Jahr der Pflegefachassistenz“ und dient als Lerngrundlage für das 2. Ausbildungsjahr in der Pflegefachassistenzausbildung.
Die 2. Auflage wurde inhaltlich erweitert und umstrukturiert. Grundlage dafür stellt das Curriculum für die Pflegeassistenzausbildung dar.
Die Inhalte der Themenfelder des 2. Ausbildungsjahres laut GuKG 2016 (BGBl. Nr. 75/2016) wurden in zehn Lernfeldern dargestellt, um die Förderung der Vernetzungskompetenz zu unterstützen.
Die Zusammensetzung der zehn Lernfelder beinhaltet einerseits eine Vertiefung der Inhalte des ersten Bandes und andererseits zusätzliche Inhalte, die zum Kompetenzerwerb für die Ausübung des Berufes Pflegefachassistenz erforderlich sind.
Die Autorinnen und der Autor im Frühjahr 2024
Lernfeld 1
Berufliche Identität als PFA entwickeln und Verantwortung übernehmen
Die rechtlichen Grundlagen sind im Buch „Pflegeassistenz“ (Reiter et al. 2024) in Lernfeld 1 beschrieben. Die folgenden Inhalte beleuchten zusätzliche relevante Themen und/oder setzen sich vertieft mit bereits behandelten Themen auseinander.
Rechtliche Grundlagen
Erwachsenenschutz-Gesetz (ErwSchG)
Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz (ErwSchG) trat mit 1. Juli 2018 in Kraft und löste die bisherige Sachwalterschaft ab. Die Möglichkeiten der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Krankheiten oder vergleichbaren Beeinträchtigungen ihrer Entscheidungsfähigkeit werden dadurch erweitert. Wenn ein Mensch nicht mehr selbst entscheiden kann, mit welcher medizinischen Behandlung er einverstanden ist, benötigt er eine/n rechtliche/n StellvertreterIn.
Vertretungsmöglichkeiten
Je nachdem, wie eingeschränkt die Entscheidungsfähigkeit der betroffenen Person ist, sieht das ErwSchG vier Möglichkeiten der Vertretung vor (vgl. BMASGK 2018a; HELP. gv.at 2018a):
1. Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht kann eine Person das Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen und im Vorhinein festlegen, wer als Bevollmächtigte/r für sie entscheiden bzw. sie vertreten soll. Die Vorsorgevollmacht kommt im Fall des Verlusts der Geschäftsfähigkeit, der Einsichts- und Urteilsfähigkeit (z. B. Demenzerkrankung) oder der Äußerungsfähigkeit (z. B. längere Bewusstlosigkeit) zur Anwendung. Eine Vorsorgevollmacht muss bestimmte formale und rechtliche Voraussetzungen erfüllen.
Eine Vorsorgevollmacht kann auf folgende Arten erstellt werden:
► vollständig eigenhändig geschrieben und unterschrieben,
► vor einem Notar/einer Notarin, einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin oder bei Gericht erstellt, oder
► durch Ausfüllen eines Formulars bzw. die Vorsorgevollmacht wird von einer anderen Person geschrieben. Dann muss die Vorsorgevollmacht vom/von der VollmachtgeberIn selbst und von drei ZeugInnen unterschrieben werden.
Eine Vorsorgevollmacht kann im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) gegen eine Gebühr registriert werden. Die Vorsorgevollmacht gilt unbefristet, sie kann jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Der Widerruf/die Kündigung muss zur Wirksamkeit im ÖZVV eingetragen werden.
In einer Vorsorgevollmacht werden die Angelegenheiten, für die eine Vollmacht erteilt wird, genau geregelt. Beispielsweise kann geregelt werden: Vertretung bei Behörden, Bankgeschäften, Vermögensverwaltung, Wohnungsangelegenheiten, Gesundheitsbelangen.
2. Gewählte Erwachsenenvertretung
Mit einer gewählten Erwachsenenvertretung kann eine Person mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit eine/n VertreterIn für bestimmte Angelegenheiten wählen, diese Vertretungsform ist neu. Sie wurde für jene Fälle geschaffen, in denen nicht rechtzeitig vorgesorgt wurde. Denn hier kann, im Unterschied zur Vorsorgevollmacht, auch eine nicht mehr voll handlungsfähige Person eine/n gewählte/n ErwachsenenvertreterIn bestimmen. Voraussetzung ist, dass die betreffende Person die Tragweite der Bevollmächtigung noch in Grundzügen verstehen und sich entsprechend verhalten kann. Als VertreterIn kann eine nahestehende Person, die nicht verwandt sein muss, gewählt werden. Es können auch mehrere nahestehende Personen als gewählte VertreterInnen für jeweils einen anderen Wirkungsbereich bestimmt werden. Die gewählte Erwachsenenvertretung gilt ab der Eintragung im ÖZVV. Die Errichtung und Eintragung kann bei NotarInnen, RechtsanwältInnen oder bei einem Erwachsenenschutzverein erfolgen.
Die gewählte Erwachsenenvertretung gilt ebenfalls unbefristet, sie kann jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Der Widerruf/die Kündigung muss zur Wirksamkeit im ÖZVV eingetragen werden.
3. Gesetzliche Erwachsenenvertretung
Die gesetzliche Erwachsenenvertretung löste am 1. Juli 2018 die „Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger“ ab. Sie wird dann eingesetzt, wenn keine Vorsorgevollmacht oder gewählte Erwachsenenvertretung mehr möglich ist. Diese Vertretungsbefugnis tritt nur in Kraft, wenn sie im ÖZVV eingetragen wurde. Die Eintragung kann bei NotarInnen, RechtsanwältInnen oder bei einem Erwachsenenschutzverein erfolgen.
Gesetzliche ErwachsenenvertreterInnen können Personen aus dem Kreis der nächsten Angehörigen sein, dazu zählen: (Groß-)Eltern, volljährige (Enkel-)Kinder und PartnerInnen (Ehe, eingetragene Partnerschaft, im gemeinsamen Haushalt lebende LebensgefährtInnen) sowie Geschwister, Nichten und Neffen und in einer Erwachsenenvertreter-Verfügung genannte Personen.
Die gesetzliche Erwachsenenvertretung verschafft Angehörigen Befugnisse in gesetzlich definierten Bereichen. Die Angehörigen sind in den Bereichen, die ausgewählt werden, vertretungsbefugt. Es können sich mehrere Angehörige für unterschiedliche Bereiche eintragen lassen. Die Angehörigen unterliegen in ihrer Tätigkeit der gerichtlichen Kontrolle und die Vertretung ist auf maximal drei Jahre befristet. Spätestens nach diesem Zeitraum wird geprüft, ob die Vertretung noch nötig ist oder ob für die/den Betroffene/n eine andere Form der Vertretung oder Unterstützung besser geeignet wäre.
4. Gerichtliche Erwachsenenvertretung
Die gerichtliche Erwachsenenvertretung ersetzt die bisherige Sachwalterschaft. Die Befugnisse des/der gerichtlichen Erwachsenenvertreters/-vertreterin werden auf bestimmte und aktuell zu besorgende Vertretungshandlungen eingegrenzt. Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung für alle Angelegenheiten kann es künftig nicht mehr geben.
Alle bestehenden Sachwalterschaften werden automatisch in gerichtliche Erwachsenenvertretungen umgewandelt. Bis zum 1.1.2024 musste bei allen automatisch übergeleiteten Sachwalterschaften überprüft werden, ob sie noch benötigt werden oder ob es Alternativen dazu gibt.
Die gerichtliche Erwachsenenvertretung ist bis zur Erledigung der Aufgabe oder längstens mit drei Jahren befristet. Sie kann aber verlängert oder in eine andere Vertretungsform (gewählte oder gesetzliche Erwachsenenvertretung) umgeändert werden.
Es gibt Entscheidungen, die nicht von einem/einer Erwachsenenvertreter/In getroffen werden können. Dazu gehören: Testamentserrichtung, Errichtung einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht, Eheschließung, Adoption eines Kindes und Anerkennung der Vaterschaft.
Das Gericht kann bei der Bestellung eines/einer gerichtlichen Erwachsenenvertreters/-vertreterin anordnen, dass bestimmte Rechtsgeschäfte nur mit dessen/deren Genehmigung wirksam sein sollen, wenn das für die Abwendung einer ernstlichen und erheblichen Gefahr für die betroffene Person notwendig ist.
RechtsanwältInnen und NotarInnen können grundsätzlich maximal 15 Personen vertreten. Nur durch die Eintragung in die „Liste besonders qualifizierter Rechtsanwälte bzw. Notare“ ist eine Vertretung von mehr als 15 Personen möglich.
ErwSchG in der medizinischen und pflegerischen Praxis
Durch das Inkrafttreten des Erwachsenenschutz-Gesetzes ergeben sich in der Praxis folgende Konsequenzen (vgl. HELP.gv.at 2018b; Wallner 2018a):
► Wenn es fraglich ist, ob ein Mensch entscheidungsfähig ist, muss sich der Arzt/die Ärztin nachweislich darum bemühen, den Patienten/die Patientin in seiner/ihrer Urteilsbildung zu unterstützen.
► Die bisher gängige Unterscheidung zwischen „einfachen“ und „schwerwiegenden“ medizinischen Behandlungen fällt weg. Damit dürfen auch nächste Angehörige, die als gesetzliche ErwachsenenvertreterInnen eingetragen sind, über PEG-Sonden, Chemotherapien, Operationen in Vollnarkose etc. entscheiden.
► Es wird klargestellt, dass auch pflegerische, therapeutische, geburtshilfliche und andere gesundheitsberufliche Handlungen an PatientInnen denselben Stellvertretungsregeln unterliegen wie ärztliche Handlungen.
► Nicht entscheidungsfähige PatientInnen müssen von einem/einer Vorsorgebevollmächtigten oder (gewählten, gesetzlichen oder gerichtlichen) ErwachsenenvertreterIn vertreten werden. Der/die StellvertreterIn hat sich am (mutmaßlichen) Willen des Menschen zu orientieren.
► Auch nicht entscheidungsfähigen (aber kommunikationsfähigen) PatientInnen sind Grund und Bedeutung einer medizinischen Behandlung zu erklären.
► Jede medizinische Zwangsbehandlung (d. h. Behandlung gegen den Willen des Menschen) bedarf weiterhin einer gerichtlichen Genehmigung.
► Wenn für den Menschen Lebensgefahr, die Gefahr einer schweren Schädigung seiner Gesundheit oder starker Schmerzen besteht („Gefahr im Verzug“), darf eine medizinisch indizierte Behandlung weiterhin auch ohne Zustimmung eines Stellvertreters/ einer Stellvertreterin oder Genehmigung des Gerichts begonnen werden. Sobald die Gefahr abgewendet ist, benötigt die Fortsetzung der Behandlung aber die Zustimmung bzw. Genehmigung.
► Ein/e (gewählte/r, gesetzliche/r oder gerichtliche/r) ErwachsenenvertreterIn darf einem dauerhaften Wohnortwechsel (z. B. in ein Pflegeheim) des nicht entscheidungsfähigen Menschen nur dann zustimmen, wenn er/sie dafür eine gerichtliche Genehmigung hat. Ein/e Vorsorgebevollmächtigte/r benötigt eine gerichtliche Genehmigung nur bei einem dauerhaften Wohnortwechsel ins Ausland.
► Die Sterilisation von und medizinische Forschung an nicht entscheidungsfähigen Personen ist weiterhin äußert restriktiv geregelt.
Für die reibungslose Umsetzung des 2. Erwachsenenschutz-Gesetztes wurden Konsenspapiere mit involvierten Institutionen verfasst. Diese Leitfäden für Banken, Angehörige von Gesundheitsberufen und Heime wurden zwischen dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, den Erwachsenenschutzvereinen und weiteren Institutionen ausgearbeitet und sind online abrufbar (vgl. BMVRDJ 2018).
Der Entscheidungsbaum zeigt, wie das Erwachsenenschutz-Gesetz in der Praxis in den jeweiligen Situationen anzuwenden ist.
Das Erwachsenenschutz-Gesetz in geltender Fassung können Sie hier einsehen.
Abb. 1: Entscheidungsbaum Erwachsenenschutz-Gesetz (Wallner 2018)
Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) – Vertiefung
Im Folgenden wird auf mögliche Arten der Freiheitsbeschränkung und die Schritte der Meldung einer freiheitsbeschränkenden Maßnahme näher eingegangen. Die grundlegenden Informationen zum HeimAufG finden sich im Fachbuch „Pflegeassistenz“ im Kapitel „Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG)“ (Reiter et al. 2024).
Geltungsbereich
Das HeimAufG hat seinen Geltungsbereich in Alten- und Pflegeheimen, in Behinderteneinrichtungen (stationäre und nicht stationäre) und anderen Einrichtungen (wie Pflegeplätzen oder Tagesstätten), in denen mindestens drei psychisch oder intellektuell beeinträchtigte Personen ständig betreut oder gepflegt werden. In Krankenanstalten kommt das HeimAufG zur Anwendung, wenn bei PatientInnen eine ständige Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit bereits bei der Aufnahme ins Krankenhaus besteht oder sie eine solche während des Krankenhausaufenthalts entwickeln. Auf psychiatrischen Abteilungen kommt das UBG (Unterbringungsgesetz) zur Anwendung.
Arten der Freiheitsbeschränkung
Grundsätzlich werden mechanische, elektronische und medikamentöse Freiheitsbeschränkungen unterschieden.
Merke: Eine Freiheitsbeschränkung liegt bereits dann vor, wenn diese nur angedroht wird! Als Androhung ist bereits zu werten, wenn der/die BewohnerIn aus dem Gesamtbild des Geschehens den Eindruck gewinnt, dass er/sie seinen/ihren Aufenthaltsort nicht mehr verlassen kann. Daher ist eine Freiheitsbeschränkung auch dann gegeben, wenn die Person einen unversperrten Ort nicht verlässt, weil sie damit rechnen muss, am Verlassen gehindert oder zurückgeholt zu werden. Die Dauer einer Freiheitsbeschränkung ist unerheblich.
Zu den mechanischen Freiheitsbeschränkungen zählen beispielsweise:
► Hindern am Verlassen eines Bereiches
► versperrte Zimmer-, Stations-, Eingangstüren, um das Verlassen eines Bereichs unmöglich zu machen
► Drehknöpfe bzw. komplizierte Türöffnungsmechanismen
► labyrinthartige Gänge und Gärten
► Festhalten
► „Auszeit-Raum“ (Isolierraum)
► Entfernen von Gehhilfen bzw. diese außer Reichweite stellen
► Hindern am Aussteigen aus dem Rollstuhl oder am Aufstehen von einer Sitzgelegenheit
► Fixieren im Rollstuhl mit Gurten, Sitzhose, Sitzweste oder Leintuch
► Tisch vor einem Rollstuhl mit angezogenem Bremspedal, wenn die Person die Bremsvorrichtung nicht selbst lösen kann
► Tisch vor einem Sessel, den die Person aus eigener Kraft nicht verrücken kann
► Therapieplatte am Rollstuhl
Abb. 2: Formular zur Meldung einer freiheitsbeschränkenden Maßnahme nach HeimAufG
► Hindern am Verlassen des Bettes durch
► Seitenteile
► Gurte im Bett
► Gegenstände wie z. B. Nachtkästchen, die als Hindernis vor das Bett gestellt werden
► Fixierung der Arme am Bett (z. B. damit sich Betroffene keine Kanülen, Sonden, Katheter entfernen können)
Zu den elektronischen Freiheitsbeschränkungen zählen beispielsweise Türcodes, Alarm-/ Überwachungssysteme und Personenortungssysteme, die die Auffindung einer Person erleichtern.
Eine Freiheitsbeschränkung durch Medikamente kann vorliegen, wenn die Verabreichung von Medikamenten (z. B. Sedativa) die Bewegungsmöglichkeiten verringert bzw. den Willen zur Fortbewegung schwächt. Bei bewegungsdämpfenden Nebenwirkungen eines Medikaments, das aus eindeutigen therapeutischen Gründen indiziert ist, liegt keine Freiheitsbeschränkung vor. Laut oberstem Gerichtshof ist bei mehreren gleichwertigen therapeutischen Möglichkeiten jenes Medikament zu wählen, das die Bewegungsfreiheit am wenigsten beeinträchtigt. Grundsätzlich ist, falls möglich, immer auf eine Medikation zurückzugreifen, deren sedierende Nebenwirkung möglichst gering ist (vgl. Bürger 2014, S. 4–20).
Meldung einer freiheitsbeschränkenden Maßnahme
Die Meldung von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen hat ehestmöglich durch den/ die EinrichtungsleiterIn zu erfolgen. Meist erfolgt die Meldung bzw. Aufhebung freiheitsbeschränkender Maßnahmen via Web-Applikation. Abb. 2 zeigt, welche Informationen zur Meldung erforderlich sind und wie die jeweiligen Felder zu befüllen sind.
Informationen zum Ausfüllen des Meldeformulars finden Sie nachstehend und unter:
Wie die jeweiligen Felder auszufüllen sind, ist nachfolgend beschrieben:
1
Anzukreuzen, wenn eine Freiheitsbeschränkung oder eine Freiheitseinschränkung vorgenommen wird. Unter einer Freiheitsbeschränkung versteht man die Beschränkung der Bewegungsfreiheit ohne oder gegen den Willen der Betroffenen. Unter einer Freiheitseinschränkung versteht man die Beschränkung der Bewegungsfreiheit mit Willen der für diese Frage einsichts- und urteilsfähigen Person. Im Falle einer Freiheitseinschränkung ist unbedingt das Feld 5 („Zustimmung der einsichts- und urteilsfähigen BewohnerIn/ PatientIn/KlientIn“) anzukreuzen. ACHTUNG: Werden zu einem späteren Zeitpunkt noch andere freiheitsbeschränkende Maßnahmen gesetzt, so sind auch diese mittels Formular zu dokumentieren und zu melden!
2
Anzukreuzen, wenn eine Freiheitsbeschränkung oder -einschränkung aufgehoben wird. Jede Freiheitsbeschränkung ist bei Wegfall bereits einer der Voraussetzungen oder mit Ende der gerichtlich festgesetzten Frist aufzuheben. Siehe auch Punkt 11.
3
Anzukreuzen, wenn eine bereits durch das Gericht für zulässig erklärte Freiheitsbeschränkung über die vom Gericht festgesetzte Frist verlängert werden soll. ACHTUNG: Die Nichtaufhebung der Freiheitsbeschränkung ist spätestens 14 Tage vor Fristablauf zu melden. Als Beginn der Verlängerung ist der dem letzten Tag der vom Gericht festgesetzten Frist folgende Kalendertag anzugeben.
4
Beginn: Hier ist das Datum einzugeben, an dem die freiheitsbeschränkende Maßnahme das erste Mal gesetzt wurde. Bei der Verlängerung einer Freiheitsbeschränkung gem. § 19 Heim-AufG (siehe Erläuterungen zu
3
) ist als Beginn der Verlängerung der dem letzten Tag der gerichtlich festgesetzten Frist folgende Kalendertag anzugeben.Dauer: Hier muss die geschätzte voraussichtliche Dauer angegeben werden <unter 48 Stunden>; <über 48 Stunden oder wiederholt>; <Freitextfeld> für eine individuelle Eingabe. Dauert die freiheitsbeschränkende Maßnahme bei der ersten Vornahme länger als 48 Stunden, ist die Einrichtungsleitung für die Einholung der erforderlichen ärztlichen Dokumente gem.§ 5 Abs 2 HeimAufG verantwortlich. Siehe auch Punkt 8, 9.
5
Dieses Feld ist anzukreuzen, wenn eine Freiheitseinschränkung (d. h. Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf Wunsch der einsichts- und urteilsfähigen Person) gemeldet wird. Da auch bei Freiheitseinschränkung auf Wunsch der einsichts- und urteilsfähigen Person der Grund gem. § 6 Abs. 2 HeimAufG dokumentiert werden muss, soll die diesbezügliche Angabe in Feld 12 erfolgen (bspw. „Bewohnerin fürchtet in der Nacht aus dem Bett zu fallen“).
6
Für die Zulässigkeit einer Freiheitsbeschränkung muss eine psychische Erkrankung oder geistige Behinderung vorliegen. Dies ist hier zu dokumentieren.
Freitextfeld zur Nennung der medizinischen Diagnose
7
Für die Zulässigkeit einer Freiheitsbeschränkung muss eine ernstliche und erhebliche Selbst- und/oder Fremdgefährdung vorliegen. Ernstlich bedeutet, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit des Schadenseintrittes gegeben ist und die vage Möglichkeit einer Selbst- oder Fremdgefährdung nicht genügt. Erheblich ist eine Gefährdung dann, wenn ein gesundheitlicher Schaden eintritt, der eine längere Genesungsdauer als 24 Tage nach sich zieht (z. B. Knochenbruch, Gehirnerschütterung oder massive Beeinträchtigung des Heilungsverlaufs).
Freitextfeld zur Beschreibung der aus der Diagnose der psychischen Erkrankung und/oder geistigen Behinderung erwachsenden Selbst- und/oder Fremdgefährdung.
8
Angaben zu den ärztlichen Dokumenten gem. § 5 Abs 2 HeimAufG: Wenn ein/e BewohnerIn länger als 48 Stunden oder über diesen Zeitraum hinaus wiederholt beschränkt wird, hat die Einrichtungsleitung unverzüglich ein ärztliches Gutachten, ein ärztliches Zeugnis (§ 55 Ärztegesetz 1998) oder sonstige ärztliche Aufzeichnungen (§ 51 Ärztegesetz 1998) einzuholen, welche belegen, dass der/die BewohnerIn psychisch krank oder geistig behindert ist und im Zusammenhang damit ihr/sein Leben oder ihre/seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet. Achtung: Diese ärztlichen Dokumente müssen zum Zeitpunkt der Vornahme aktuell sein!
9
Freitextfeld zur Beschreibung des Verhaltens der betroffenen Person, für weitere Ausführungen zu Gefährdung und zu Situationen, die zur Notwendigkeit der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen geführt haben, sowie um weitere Informationen anzugeben. Da die freiheitsbeschränkende Maßnahme das gelindeste Mittel sein muss, sind insbesondere jene Alternativen zur freiheitsbeschränkenden Maßnahme anzuführen, die zuvor versucht wurden, aber zum Schutz nicht ausreichten.
11
Freiheitsbeschränkungen sind sofort aufzuheben, wenn eine der (materiellen) Voraussetzungen wegfällt oder die gerichtlich festgesetzte Zulässigkeitsfrist ausläuft. Dieses Feld ist immer dann auszufüllen, wenn Feld
2
angekreuzt wurde. Es ist das Beendigungsdatum auszufüllen und ein Aufhebungsgrund anzukreuzen:
► wegen des Einsatzes von Alternativen ist eine Beschränkung nicht mehr nötig
► Wegfall der Gefährdung: die betroffene Person zeigt kein gefährdendes Verhalten
► innerhalb der Einrichtung übersiedelt/verlegt: die betroffene Person wird weiterhin in der Einrichtung betreut, hält sich aber nicht mehr in dem Bereich auf, für den die Beschränkung gemeldet wurde
► entlassen/verzogen: die betroffene Person wird nicht mehr in der Einrichtung betreut
► verstorben: die betroffene Person ist verstorben
► sonstiger Aufhebungsgrund: anzukreuzen, wenn keiner der genannten Gründe vorliegt
16
Einzelfallmedikation (= früher sogenannte „Bedarfsmedikation“, vgl. Durchführungserlass zu § 15 GuKG), die zugleich eine Freiheitsbeschränkung darstellt. Textfeld zur Nennung der Indikation, des Therapieziels, des Medikamentennamens und der Dosierung.
Auf Dauer eingesetzte medikamentöse Therapie, die zugleich eine Freiheitsbeschränkung darstellt. Textfeld zur Nennung der Indikation, des Therapieziels, des/der Medikamentennamen/s und der Dosierung.
15
Jede Maßnahme, die es der Bewohnerin/dem Bewohner unmöglich macht das Bett zu verlassen:
► Seitenteile
► Bauchgurt
► elektronische Maßnahme
► 1 bzw. 2 Hand-/Armgurte
► 1 bzw. 2 Fuß-/Beingurte
► das Feld „Andere Maßnahme“ dient der Angabe von Freiheitsbeschränkungen, die nicht zur Auswahl vorgegeben sind. Das Freitextfeld ist zu befüllen.
13
14
Jede Maßnahme, die es der Bewohnerin/dem Bewohner unmöglich macht, den Rollstuhl oder die Sitzgelegenheit zu verlassen:
► Sitzhose
► Bauchgurt
► Brustgurt
► Therapietisch
► Tisch
► 1 bzw. 2 Hand-/Armgurte
► 1 bzw. 2 Fuß-/Beingurte
► das Feld „Andere Maßnahme“ dient der Angabe von Freiheitsbeschränkungen, die nicht zur Auswahl vorgegeben sind. Das Freitextfeld ist zu befüllen.
12
Freiheitsbeschränkungen durch Hindern am Verlassen eines Bereichs können Maßnahmen sein, die es einer Bewohnerin/einem Bewohner unmöglich machen, Teile der Einrichtung, die Einrichtung selbst oder den Garten zu verlassen:
► Zurückhalten/Androhung des Zurückhaltens
► versperrter Bereich
► Tür/Raumgestaltung Barriere
► Desorientiertenfürsorgesystem/Sensor
► versperrtes Zimmer
► Hindern am Fortbewegen mit dem Rollstuhl (Bremsen, …)
► das Feld „Andere Maßnahme“ dient der Angabe von Freiheitsbeschränkungen, die nicht zur Auswahl vorgegeben sind. Das Freitextfeld ist zu befüllen.
17
Berufsgruppenzugehörigkeit, Name und Unterschrift der anordnungsbefugten Person/en gem. § 5 Abs 1 HeimAufG.
10
Unterschrift der Einrichtungsleitung, die gem. § 7 Abs 2 HeimAufG für die Meldung der vorgenommenen Freiheitsbeschränkung an die Bewohnervertretung verantwortlich ist.
(VertretungsNetz 2016)
Alternativen zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen
Im Folgenden werden sogenannte „gelindere Maßnahmen“, die eine geeignete Alternative zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen darstellen können, zusammengefasst. Meist bietet nicht eine einzige Maßnahme, sondern die Anwendung verschiedener, aufeinander abgestimmter Maßnahmen eine erfolgreiche Alternative zu körpernahen beschränkenden Maßnahmen.
Bei einer Hin-/Weglauf-Tendenz:
► Herausfinden, wohin die Person will und warum (z. B. durch Biografiearbeit, Validation)
► Tagesstruktur anbieten (Bastelgruppen, Bewegungsrunden, ...)
► Präsenz in den Wohngruppen
► Weglaufschutz ohne verschlossenen Wohnbereich
► Bewegung unterstützen und Ruhephasen ermöglichen (Sitz-/Liegegelegenheiten im Aufenthaltsbereich)
► Beschäftigung je nach Biografie fördern
► Besuchsdienst anbieten
► Abschiednehmen vom ehemaligen Zuhause ermöglichen
► Bei der Gefahr, aus dem Rollstuhl/der Sitzgelegenheit zu rutschen:
► Gelkissen mit Abduktionskeil, Positionierungskissen, um aufrechte Sitzposition zu ermöglichen
► One Way Slide
► individuell angepasster Rollstuhl
► Bei wiederholten Aufstehversuchen:
► Geh- und Balancetraining
► Hüftprotektorhose, Sicherheitshelm
► Sensorkissen
► Mobilitätstraining mit dem Rollstuhl (Fußstützen entfernen, Radhandschuhe)
► Anti-Rutsch-Socken
► Bewegungs- und physiotherapeutische Angebote zur Verbesserung der Gangsicherheit
► exakte medikamentöse Einstufung zur Vermeidung von Gangunsicherheit
Bei der Tendenz, ständig das Bett verlassen zu wollen:
► individuellen Schlaf-Wach-Rhythmus beachten
► bei nächtlicher Aktivität Mobilisation ermöglichen
► Leibschüssel oder -stuhl anbieten
► Niederflurbett verwenden
► Sturzmatratze/Sensormatte/Sensorbalken
► randzonenverstärkte Matratze
► ggf. Bodenpflege ermöglichen (vgl. Schlaffer 2015, S. 5–8)
Tipp: Nähere Informationen, kompakt zusammengefasst, hat die Bewohnervertretung in einer Broschüre veröffentlicht.
Auf der Homepage des VertretungsNetzes stehen Informationen zum HeimAufG auch in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.
Das Heimaufenthaltsgesetz in geltender Fassung können Sie online einsehen.
Unterbringungsgesetz (UbG)
Werden Menschen in psychiatrischen Stationen „untergebracht“, kommt das Unterbringungsgesetz (UbG, Bundesgesetz vom 1. März 1990 über die Unterbringung psychisch Kranker in Krankenanstalten, StF: BGBl. Nr. 155/1990, BGBl. I Nr. 12/1997, BGBl. I Nr. 18/2010, BGBl. I Nr. 59/2017, BGBl. I Nr. 131/2017) zur Anwendung.
Voraussetzungen für eine Unterbringung
Eine Unterbringung im Sinne des Unterbringungsgesetzes liegt dann vor, wenn PatientInnen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer psychiatrischen Abteilung in einem geschlossenen Bereich angehalten oder sonstigen Beschränkungen in der Bewegungsfreiheit unterworfen werden.
Eine Unterbringung ist nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen zulässig:
1. Der/die PatientIn leidet an einer psychischen Erkrankung.
2. Es besteht eine ernste und erhebliche Gefahr für Leben und/oder Gesundheit.
3. Es gibt keine andere Behandlungs- oder Betreuungsmöglichkeit.
Das UbG legt fest, dass Einschränkungen in die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung nur unter klar definierten Voraussetzungen möglich sind. Die Einschränkungen müssen auf das Notwendigste reduziert sein und regelmäßig durch das Gericht überprüft werden. Untergebrachte PatientInnen haben das Recht auf parteiliche Vertretung und Beratung durch einen vom Krankenhaus unabhängigen Patientenanwalt. Durch den behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin muss täglich geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung noch gegeben sind (vgl. Fehr 2017, S. 4–5).
Merke: Die Patientenanwaltschaft ist eine eigenständige Institution der Länder. Sie unterstützt bei der Vertretung der Patientenrechte im Gesundheits- und Spitalsbereich. Auch die Patientenombudsstelle unterstützt unabhängig und weisungsfrei, um betroffenen PatientInnen zu ihrem Recht und zu einer besseren Betreuung zu verhelfen.
Voraussetzungen für eine Einweisung
Ein Mensch kann nur dann gegen seinen Willen in ein psychiatrisches Krankenhaus bzw. auf eine psychiatrische Station eingewiesen werden, wenn die oben beschriebenen Voraussetzungen für eine Unterbringung vorliegen. Diese müssen vom Arzt/von der Ärztin in einer persönlichen Untersuchung festgestellt und mit einer schriftlichen Bescheinigung (siehe Abb. 3) bestätigt werden. Dabei muss auch festgestellt werden, ob durch gelindere Mittel, wie beispielsweise eine ambulante Behandlung, eine Einweisung verhindert werden kann.
In Ausnahmefällen bei „Gefahr im Verzug“ (das Leben oder die Gesundheit des/der Betroffenen ist ernsthaft gefährdet) kann die Polizei eine Einweisung ohne ärztliche Bescheinigung vornehmen. Die Betroffenen sind so schonend wie möglich zu behandeln. So sollte die Untersuchung des/der Betroffenen möglichst vor Ort und ohne polizeiliche Vorführung vorgenommen werden.
Der/die Betroffene hat ein Recht auf Einsicht in alle Aufzeichnungen und Bescheinigungen, die die Einweisung betreffen (vgl. Fehr 2017, S. 4–6).
Weitere Schritte im Krankenhaus
Im Krankenhaus wird durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Psychiatrie unverzüglich festgestellt, ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung erfüllt sind. Sind alle drei Voraussetzungen (siehe Kapitel „Voraussetzungen für eine Unterbringung“) erfüllt, werden die Gründe schriftlich in einem ärztlichen Zeugnis vermerkt und der/die PatientIn wird nachweislich darüber informiert.
Abb. 3: Bescheinigung Unterbringung (Hummelbrunner 2018, S. 19)
Der/die untergebrachte PatientIn hat das Recht, eine zweite Untersuchung durch eine/n andere/n Facharzt/-ärztin für Psychiatrie zu verlangen oder über die Patientenanwaltschaft einen entsprechenden Antrag stellen zu lassen. Sind nicht alle drei Unterbringungsvoraussetzungen erfüllt oder hat die zweite Untersuchung ergeben, dass die Unterbringungsvoraussetzungen nicht vorliegen, kann der/die PatientIn selbst über den weiteren Aufenthalt bzw. die Behandlung im Krankenhaus entscheiden. Eine Unterbringung kann auch nach einer freiwilligen Aufnahme oder während eines Aufenthalts angeordnet werden. Gründe dafür können sein, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat oder der/ die PatientIn die Behandlung trotz erheblicher Gefährdung beenden möchte.
Das Krankenhaus ist verpflichtet, die Unterbringung unverzüglich an das zuständige Gericht und an die Patientenanwaltschaft weiterzuleiten. Weiters muss das Krankenhaus, mit Zustimmung des Patienten/der Patientin, eine/n Angehörige/n verständigen.
Erste Anhörung:
Das zuständige Gericht muss den/die untergebrachte/n Patienten/Patientin im Krankenhaus innerhalb von vier Tagen aufsuchen, um über die vorläufige Rechtmäßigkeit der Unterbringung zu entscheiden.
Der/die RichterIn nimmt Einsicht in die Krankengeschichte. Weiters werden der/die PatientIn, der/die Patientenanwalt/-anwältin und der/die zuständige Facharzt/-ärztin angehört. Sind die Unterbringungsvoraussetzungen nach Ansicht des Richters/der Richterin nicht erfüllt, ist eine weitere Unterbringung nicht zulässig. Der/die PatientIn kann nun selbst über den weiteren Aufenthalt/die Behandlung im Krankenhaus entscheiden, ggf. muss er/sie auf eigenen Wunsch entlassen werden. Gegen diese Gerichtsentscheidung kann der/die behandelnde Facharzt/-ärztin Einspruch („Rekurs“) erheben.
Erklärt das Gericht die Unterbringung für vorläufig zulässig, findet spätestens nach zwei Wochen eine mündliche Verhandlung (Tagsatzung) statt.
Schriftliches Gutachten:
Nach der Erstanhörung beauftragt das Gericht einen/eine vom Krankenhaus unabhängigen Facharzt/-ärztin. Diese/r hat den Patienten/die Patientin persönlich zu untersuchen und ein schriftliches Gutachten über die Voraussetzungen einer Unterbringung zu erstellen. Dieses muss rechtzeitig vor Durchführung der mündlichen Verhandlung an das Gericht, den/die behandelnde/n Facharzt/-ärztin, den/die Patientenanwalt/-anwältin und den Patienten/die Patientin übermittelt werden. Auf die Aushändigung des Gutachtens an den Patienten/die Patientin darf verzichtet werden, wenn dadurch eine Verschlechterung seines/ihres Gesundheitszustands zu erwarten wäre.
Mündliche Verhandlung:
Bei der mündlichen Verhandlung (Tagsatzung) haben alle Beteiligten (PatientIn, Patientenanwalt/-anwältin, behandelnde/r Facharzt/-ärztin, Sachverständige/r sowie Angehörige, Vertrauenspersonen mit Zustimmung des Patienten/der Patientin) die Möglichkeit, zu den Gründen der Unterbringung Stellung zu nehmen und Fragen an den/die Sachverständige/n zu stellen. Am Ende der mündlichen Verhandlung trifft das Gericht die Entscheidung, ob die Unterbringung weiter rechtmäßig ist. Ist das der Fall, wird vom Gericht eine Höchstfrist für die Zulässigkeit der Unterbringung festgelegt (Unterbringungsfrist). Der/die RichterIn muss dem Patienten/der Patientin die Entscheidung erklären und diese begründen.
Der schriftliche Beschluss über die Zulässigkeit und Dauer der Unterbringung wird dem Patienten/der Patientin, dem/der Patientenanwalt/-anwältin und dem/der behandelnden Facharzt/-ärztin innerhalb von sieben Tagen zugestellt. Gegen diesen Beschluss können der/die PatientIn, der/die Patientenanwalt/-anwältin oder ein/e Angehörige/r binnen zwei Wochen ein Rechtsmittel (Rekurs) erheben.
Liegen die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht vor, muss das Gericht die Unterbringung für nicht zulässig erklären. Auch hier kann der/die PatientIn dann selbst über den weiteren Aufenthalt bzw. die Behandlung im Krankenhaus entscheiden und muss ggf. auf seinen/ihren Wunsch entlassen werden.
Wird vom/von der behandelnden Facharzt/-ärztin noch in der Verhandlung ein Rechtsmittel gegen die Unzulässigkeit angemeldet, muss das Gericht entscheiden, ob die Unterbringung dennoch aufgehoben wird oder bis zur Entscheidung des Landesgerichts weiter aufrecht bleibt (aufschiebende Wirkung des Rekurses).
Aufhebung der Unterbringung vor Fristablauf:
Verbessert sich der Gesundheitszustand des Patienten/der Patientin im Laufe der Behandlung, sodass die Voraussetzungen für eine Unterbringung nicht mehr vorliegen, muss der/die behandelnde Facharzt/-ärztin die Unterbringung bereits vor der festgelegten Frist aufheben.
Verlängerung der Unterbringung:
Ist keine ausreichende Besserung des Zustandes des Patienten/der Patientin eingetreten, hat der/die behandelnde Facharzt/-ärztin die Möglichkeit, bei Gericht eine Verlängerung der Unterbringung zu beantragen. Dann finden wiederum eine Anhörung und eine Tagsatzung statt.
(vgl. Fehr 2017, S. 7–12)
Das Unterbringungsgesetz in geltender Fassung können Sie online einsehen.
Kinder und Jugendliche im Krankenhaus
Müssen Kinder ins Krankenhaus, ist das für alle Beteiligten eine spezielle Situation. Zur Vorbereitung gibt es zahlreiche kindgerechte Informationsbroschüren und Bücher. Krankenhäuser halten für Kinder und Jugendliche immer wieder Aktionstage ab, an denen die BesucherInnen einen Einblick in den Krankenhausalltag bekommen. So soll den Kindern die Angst vor einem möglichen Aufenthalt genommen werden.
Für die optimale Versorgung von Kindern und Jugendlichen stehen in Kinderkliniken oder auf Kinderstationen spezialisierte MedizinerInnen und Pflegekräfte zur Verfügung. Die Bereiche sind kindgerecht ausgestattet (Kindermöbel, bunte Wandfarben, Spielbereiche, …) und bieten auch die Möglichkeit der Schulbildung während des Krankenhausaufenthalts (wenn der Gesundheitszustand des Kindes das erlaubt).
Auch für Gesundheitseinrichtungen und Ausbildungsstätten gibt es hilfreiche Literatur, die dabei unterstützen soll, dass Kinder und Jugendliche adäquat versorgt werden können. Über den Verein „KiB children care“ (www.kib.or.at) ist beispielsweise ein Handbuch mit dem Titel „Mitwirkung von Kindern im Krankenhaus. Ein Handbuch für die Praxis“ verfügbar (Dedding et al. 2012).
Allgemeines zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Wesentliche Punkte bei der Unterstützung und Pflege von Kindern und Jugendlichen sind:
► Das Kind ernst nehmen und kindgerecht informieren – keine Fachtermini verwenden, dem Kind beim Blutdruckmessen das Stethoskop selbst in die Cubita legen lassen, …
► Das Kind soll alles, was es selbst machen kann, auch selbst durchführen.
► Einbindung der Familie (Eltern, Großeltern, Geschwister) – Angehörige können zur Übernahme/Unterstützung bei pflegerischen Tätigkeiten angeleitet werden.
► Die Bezugspersonen müssen informiert sein, dass sie die Aufsichtspflicht haben, wenn sie sich um das Kind kümmern.
► Die Pflegeperson ist ggf. „Vermittlerin“ im multiprofessionellen Team und sorgt dafür, dass die Bedürfnisse des Kindes von allen Beteiligten wahrgenommen werden.
► Für die Bezugspersonen sollte es eine uneingeschränkte Besuchszeit geben und ggf. auch die Möglichkeit, beim Kind zu bleiben (Mutter-Kind-Zimmer, Klappbett, …).
EACH-Charta
Die „European Association for Children in Hospital“ (Europäische Vereinigung für Kinder im Krankenhaus, EACH) setzt sich dafür ein, dass für alle Kinder in den europäischen Ländern die bestmögliche Behandlung als fundamentales Recht verwirklicht wird. Die zehn Punkte der EACH-Charta wurden auf der 1. Europäischen Konferenz „Kind im Krankenhaus“ in Leiden (Niederlande) im Mai 1988 verabschiedet. Sie stehen mit den in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 1989 vereinbarten Rechten, die sich auf Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren beziehen, im Einklang.
Die zehn Punkte der EACH-Charta sollen Eltern und Kinder auf ihre Rechte aufmerksam machen:
► Kinder sollen nur dann in ein Krankenhaus aufgenommen werden, wenn die notwendige medizinische Behandlung nicht ebenso gut zu Hause oder in einer Tagesklinik erfolgen kann.
► Kinder im Krankenhaus haben das Recht, ihre Eltern oder eine andere Bezugsperson jederzeit bei sich zu haben.
► Bei der Aufnahme eines Kindes ins Krankenhaus soll allen Eltern die Mitaufnahme angeboten werden. Sie sollen unterstützt und zum Bleiben ermutigt werden. Den Eltern sollen daraus keine zusätzlichen Kosten oder Einkommenseinbußen entstehen. Um an der Pflege ihres Kindes mitwirken zu können, sollen Eltern über die Grundpflege und den Stationsalltag informiert werden. Ihre aktive Teilnahme soll unterstützt werden.
► Kinder und Eltern haben das Recht, in angemessener Art ihrem Alter und ihrem Verständnis entsprechend informiert zu werden. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um körperlichen und seelischen Stress zu mildern.
► Kinder und Eltern haben das Recht, in alle Entscheidungen, die ihre Gesundheitsfürsorge betreffen, einbezogen zu werden. Jedes Kind soll vor unnötigen medizinischen Behandlungen und Untersuchungen geschützt werden.
► Kinder sollen gemeinsam mit Kindern betreut werden, die von ihrer Entwicklung her ähnliche Bedürfnisse haben. Kinder sollen nicht in Erwachsenenstationen aufgenommen werden. Es soll keine Altersuntergrenze für die BesucherInnen von Kindern geben.
► Kinder haben das Recht auf eine Umgebung, die ihrem Alter und Zustand entspricht und die ihnen umfangreiche Möglichkeiten zum Spielen, zur Erholung und Schulbildung gibt. Die Umgebung soll für Kinder geplant, möbliert und ausgestattet sein.
► Kinder sollen von Personal betreut werden, das durch Ausbildung und Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf die körperlichen, seelischen und entwicklungsbedingten Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien einzugehen.
► Die Kontinuität in der Pflege kranker Kinder soll durch ein Team sichergestellt sein.
► Kinder sollen mit Takt und Verständnis behandelt werden und ihre Intimsphäre soll jederzeit respektiert werden.
Die aktuelle Fassung der EACH-Charta ist online abrufbar.
Rechtliche Situation
Im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) sind in § 173 wesentliche rechtliche Grundlagen, die Kinder und Jugendliche betreffen, verankert:
„(1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das einsichts- und urteilsfähige Kind nur selbst erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. Mangelt es an der notwendigen Einsichts- und Urteilsfähigkeit, so ist die Zustimmung der Person erforderlich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist.
(2) Willigt ein einsichts- und urteilsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein, die gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn auch die Person zustimmt, die mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist.
(3) Die Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes sowie die Zustimmung der Person, die mit Pflege und Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene Aufschub das Leben des Kindes gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre.“ (RIS 2018a)
Begriffsdefinitionen (vgl. RIS 2018a)
Im ABGB finden sich folgende Begriffe, die hier näher definiert werden:
Minderjährige (Kinder) sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Begriff „Kind“ ist rechtlich ident mit dem Begriff „Minderjährige/r“. Unmündige Minderjährige sind Minderjährige, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mündige Minderjährige sind Minderjährige, die zwar das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Damit eine Person in eine Behandlung einwilligen kann, muss sie einwilligungsfähig sein. Dazu muss diese Person einsichts- und urteilsfähig sein. Einsichts- und Urteilsfähigkeit besteht dann, wenn die Person Grund und Bedeutung der Behandlung einsehen und nach dieser Einsicht ihren Willen bestimmen kann. Zur Beurteilung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit werden Kriterien wie Alter, Reife, Gesundheitszustand und Persönlichkeit der Minderjährigen herangezogen. Zu berücksichtigen sind aber auch die Schwere des Eingriffs, die mit seiner Vornahme (oder seinem Unterbleiben) verbundenen Risken und mögliche Spätfolgen auf Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Standes.
Der Begriff der medizinischen Behandlung umfasst nicht nur die medizinische Heilbehandlung (therapeutische Maßnahmen), sondern auch diagnostische, prophylaktische und schmerzlindernde Maßnahmen. Dazu gehören auch medizinisch nicht anerkannte Methoden, wie alternativ- bzw. komplementärmedizinische Verfahren. Weiters gehören dazu auch die Verabreichung von Arzneimitteln, Transfusionen, Transplantationen und kosmetische Operationen.
Zu den Berufsgruppen, die an der medizinischen Behandlung beteiligt sind, gehören neben den Angehörigen medizinischer Gesundheitsberufe auch Personen, die – etwa im Rahmen von Erster Hilfe – medizinische Maßnahmen durchführen.
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz
In Österreich ist die Arbeitszeit in verschiedenen Rechtsvorschriften gesetzlich geregelt. Für die ArbeitnehmerInnen im Gesundheits- und Sozialbereich gelten, neben dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) und anderen gesetzlichen Richtlinien, das Arbeitszeitgesetz (AZG) und das Arbeitsruhegesetz (ARG). Meist sind zusätzlich in Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen spezielle Regelungen vereinbart. Im Folgenden wird auf die Regelungen im KA-AZG bzw. im AZG und im ARG eingegangen.
Das Arbeitszeitgesetz (AZG) regelt grundsätzlich die höchste zulässige Arbeitsdauer während eines Tages (Tagesarbeitszeit) und innerhalb einer Woche (Wochenarbeitszeit). Im AZG ist auch die Mindestdauer der erforderlichen Ruhephasen innerhalb eines Arbeitstages (Ruhepausen) und zwischen zwei Arbeitstagen (Ruhezeit) festgelegt. Die wöchentliche Ruhezeit (Wochenruhe oder Wochenendruhe) und die Feiertagsruhe werden im Arbeitsruhegesetz (ARG) geregelt. Alle Arbeitszeitbestimmungen verlangen die Führung von Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitszeiten (z. B. Dienstplan).
Das österreichische Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (Bundesgesetz) ist die Rechtsgrundlage zur Regelung der Arbeitszeit für Angehörige von Gesundheitsberufen in Kranken-, Pflegeanstalten und ähnlichen Einrichtungen. Davon zu unterscheiden sind die Krankenanstaltengesetze der jeweiligen Bundesländer (Landesgesetze). Auf diese wird im Folgenden nicht näher eingegangen.
Das KA-AZG definiert in § 2 die Begriffe Arbeitszeit, Tages- und Wochenarbeitszeit wie folgt:
►Arbeitszeit ist die Zeit vom Dienstantritt bis zum Dienstende ohne die Ruhepausen.
►Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 24 Stunden.
►Wochenarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraums von Montag bis einschließlich Sonntag.
Laut § 3 KA-AZG darf eine Tagesarbeitszeit von 13 Stunden nicht überschritten werden, außer es liegen Gründe vor, die eine verlängerte Dienstzeit rechtfertigen. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit darf (im Durchrechnungszeitraum von bis zu 17 Wochen) bis zu 48 Stunden betragen, allerdings in den einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraums 60 Stunden nicht überschreiten. Ist es zur Aufrechterhaltung der Versorgung erforderlich, können in Ausnahmefällen auch verlängerte Dienste geleistet werden.
Ausnahmefälle liegen vor, wenn:
► die Betreuung von PatientInnen nicht unterbrochen werden kann oder
► eine sofortige Betreuung von PatientInnen unbedingt erforderlich wird und durch andere organisatorische Maßnahmen keine Abhilfe geschaffen werden kann.
Die Dauer eines verlängerten Dienstes darf maximal 25 Stunden betragen. Die Wochenarbeitszeit darf innerhalb eines Durchrechnungszeitraums von 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden und die Arbeitszeit in den einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraums 72 Stunden nicht überschreiten.
Laut KA-AZG liegt Überstundenarbeit vor, wenn die Tagesarbeitszeit acht Stunden bzw. bei einer anderen Verteilung der Arbeitszeit innerhalb der Woche neun Stunden, oder die Wochenarbeitszeit 40 Stunden übersteigt. Es ist allerdings auch möglich, dass im Kollektivvertrag abweichende Regelungen getroffen werden. Für Krankenanstalten, die keinen Kollektivvertrag haben, können abweichende Regelungen in Betriebsvereinbarungen getroffen werden. DienstnehmerInnen dürfen außerhalb der festgelegten Arbeitszeiteinteilung nur zu Überstundenarbeit herangezogen werden, wenn keine berücksichtigungswürdigen Interessen der DienstnehmerInnen bestehen. Für Überstundenarbeit gebührt VollzeitmitarbeiterInnen ein Zuschlag von 50 %. Grundlage für die Berechnung dieses Zuschlags ist der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende Normallohn.
DienstnehmerInnen, die Teilzeit arbeiten, unterliegen ebenfalls dem AZG. Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass teilzeitbeschäftigte ArbeitnehmerInnen zur Arbeitsleistung über das vereinbarte Arbeitszeitausmaß (Mehrarbeit) nur insoweit verpflichtet sind, als
► gesetzliche Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder der Arbeitsvertrag dies vorsehen,
► ein erhöhter Arbeitsbedarf vorliegt oder die Mehrarbeit erforderlich ist, und
► berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin der Mehrarbeit nicht entgegenstehen.
Für Mehrarbeitsstunden, die teilzeitbeschäftigte ArbeitnehmerInnen leisten, gebührt ein Zuschlag von 25 %. Dieser entfällt, wenn die Mehrarbeitsstunden innerhalb des Kalendervierteljahres oder eines anderen festgelegten Zeitraums von drei Monaten, in dem sie angefallen sind, durch Zeitausgleich im Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden oder bei Gleitzeit innerhalb der Gleitzeitperiode im Durchschnitt nicht überschritten werden. Weiters kann eine Abgeltung von Mehrarbeitsstunden durch Zeitausgleich vereinbart werden. Teilzeitbeschäftigte ArbeitnehmerInnen dürfen wegen der Teilzeitarbeit gegenüber vollzeitbeschäftigten ArbeitnehmerInnen nicht benachteiligt werden.
§ 19c des AZG regelt mögliche Abweichungen von der Normalarbeitszeit seitens des Arbeitgebers. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
► Die Abweichung muss aus objektiven Gründen sachlich gerechtfertigt sein.
► Dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin muss die Lage der Normalarbeitszeit für die jeweilige Woche mindestens zwei Wochen im Vorhinein mitgeteilt werden. Davon kann abgewichen werden, wenn dies in unvorhersehbaren Fällen zur Verhinderung eines unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils erforderlich ist und andere Maßnahmen nicht zumutbar sind.
► Berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin bzw. andere Vereinbarungen dürfen dieser Einteilung nicht entgegenstehen.
Zur Nachtarbeit ist im KA-AZG Folgendes festgelegt:
Als Nacht gilt die Zeit zwischen 22 und 5 Uhr. NachtdienstnehmerInnen sind DienstnehmerInnen, die regelmäßig oder in mindestens 48 Nächten im Kalenderjahr während der Nacht mindestens drei Stunden arbeiten (sofern in der Betriebsvereinbarung oder im Einvernehmen mit der Personalvertretung nichts anderes vereinbart wurde). NachtdienstnehmerInnen haben Anspruch auf unentgeltliche Untersuchungen ihres Gesundheitszustands (gemäß § 51 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz idgF). Diese Untersuchungen erfolgen vor Aufnahme der Tätigkeit, danach in Abständen von zwei Jahren bzw. nach Vollendung des 50. Lebensjahres oder nach zehn Jahren als NachtdienstnehmerIn in jährlichen Abständen (vgl. § 5b KA-AZG).
Weiters haben NachtdienstnehmerInnen auf Verlangen Anspruch auf Versetzung auf einen geeigneten Tagesarbeitsplatz entsprechend den betrieblichen Möglichkeiten, wenn die weitere Verrichtung von Nachtarbeit die Gesundheit nachweislich gefährdet oder die Bedachtnahme auf unbedingt notwendige Betreuungspflichten gegenüber Kindern bis zu zwölf Jahren dies erfordert. Der Dienstgeber hat auch sicherzustellen, dass NachtdienstnehmerInnen über wichtige Betriebsgeschehnisse informiert werden.
Bzgl. Ruhepausen und Ruhezeiten finden sich folgende Regelungen im KA-AZG:
Beträgt die Gesamtdauer der Arbeitszeit mehr als sechs Stunden, so ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen. Ruhepausen sind nicht am Beginn oder Ende der Arbeitszeit zu nehmen und zählen nicht zur Arbeitszeit.
Weiters ist nach Beendigung der Tagesarbeitszeit oder eines verlängerten Dienstes eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden einzuhalten. Die Ruhezeit ist eine Periode der Ruhe zwischen zwei Tagesarbeitszeiten oder einer Tagesarbeitszeit und einem verlängerten Dienst. Ruhezeiten lassen sich in tägliche, wöchentliche und Ausgleichsruhezeiten einteilen.
Die tägliche Ruhezeit ist eine nach jedem Dienst ununterbrochene elfstündige Mindestruhezeit. Ausgleichsruhezeit bezeichnet jene Ruhestunden, die als Ausgleich für eine 8 Stunden übersteigende Arbeitszeit zu gewähren sind und über die elfstündige tägliche Ruhezeit hinausgehen. Beträgt die Tagesarbeitszeit zwischen acht und 13 Stunden, ist jeweils innerhalb der nächsten zehn Kalendertage eine Ruhezeit um vier Stunden zu verlängern. Nach verlängerten Diensten ist die folgende Ruhezeit um jenes Ausmaß zu verlängern, um das der verlängerte Dienst 13 Stunden überstiegen hat, mindestens jedoch um elf Stunden.
Die wöchentliche Ruhezeit ist im ARG geregelt und sieht für jede/n DienstnehmerIn eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden pro Kalenderwoche vor. Wird an einem Wochenende nicht gearbeitet, ist die 36-stündige wöchentliche Ruhezeit im Anschluss an die Freitagsarbeitszeit zu gewähren. Dadurch entfällt am Freitag die tägliche Ruhezeit. Wird am Wochenende gearbeitet, so ist die wöchentliche Ruhezeit bereits während der Woche zu gewähren, da als Kalenderwoche ein Zeitraum von Montag bis Sonntag definiert wird.
Ein Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung kann die wöchentliche Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen abweichend von den angeführten Vorgaben regeln. In Einrichtungen, in denen eine Personalvertretung eingerichtet ist, erfolgen die Regelungen im Einvernehmen mit der Personalvertretung (vgl. RIS 2018b, 2018c).
Der Pflegeprozess
Im Band „Pflegeassistenz“ wurden bereits der Aufbau des Pflegeprozesses und die Grundlagen zur praktischen Anwendung beschrieben (vgl. Reiter et al. 2024). Im Folgenden wird auf die Anforderungen der Pflegedokumentation und die einzelnen Schritte des Pflegeprozesses näher eingegangen.
Grundsätzlich macht die Pflegedokumentation das pflegerische Handeln transparent, nachvollziehbar und überprüfbar. Neben der Qualitätssicherung dient sie ggf. auch der Beweissicherung und der Rechenschaftslegung. Die Pflegedokumentation ist ein rechtsgültiger Beweis für die geleistete Pflege und kann in zivil- oder strafrechtlichen Verfahren beispielsweise von Sachverständigen, Patientenanwaltschaft, Versicherungen und Gerichten herangezogen werden. Sie muss vollständig, richtig, zeitnah, chronologisch, der verantwortlichen Person zuordenbar und lesbar sein. Detaillierungsgrad und Umfang der Dokumentation wird von Faktoren wie dem Allgemeinzustand des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin, dem individuellen gesundheitlichen Risiko, dem mit einer Maßnahme verbundenen Gefährdungspotenzial, der erforderlichen Zusammenarbeit und Abstimmung mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe und der Aufenthaltsdauer beeinflusst. Daher sind Detaillierungsgrad und Umfang settingspezifisch anzupassen. Die Pflegedokumentation soll möglichst einfach und effizient sein. Welche Pflegeprozessschritte aus fachlicher Sicht erforderlich sind, hängt von den konkreten Erfordernissen ab, die Entscheidung darüber liegt im Verantwortungsbereich der planenden Pflegefachkraft. Ggf. gibt das jeweilige Unternehmen einen Mindestumfang der Pflegedokumentation vor. Das Führen des Pflegeprozesses (Pflegeassessment, Pflegeplanung, Durchführen von Pflegeinterventionen, Evaluierung) fällt in den Bereich der pflegerischen Kernkompetenzen. Der Prozess beginnt mit der Aufnahme und endet mit der Entlassung des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin. Die Endverantwortung für den Pflegeprozess liegt beim gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege. Allerdings sind alle professionell Pflegenden in den Prozess miteingebunden und haben eigenverantwortlich Änderungen weiterzuleiten oder ggf. Vorschläge einzubringen. Weiters ist der Pflegeempfänger/die Pflegeempfängerin in den Planungsprozess zu involvieren (vgl. Rappold et al. 2017, S. 5–8).
Pflegeassessment
„To assess“ bedeutet beurteilen, bewerten, einschätzen. Das zentrale Ziel von Assessments ist der systematische und umfassende Informationserwerb zur Einschätzung eines Zustands. In der Pflege werden Erstassessments, Reassessments und fokussierte Assessments durchgeführt. Die in der Pflege eingesetzten Assessments können aus mehreren Teilen bestehen und mithilfe verschiedener Instrumente (Skalen, Screeninginstrumente, …) durchgeführt werden. Die durch Assessments gewonnenen Daten dienen der informationsbasierten Entscheidungsfindung und bilden die Basis für den pflegediagnostischen Prozess. Assessmentinstrumente unterstützen die pflegerische Entscheidung. Die Endentscheidung über die weiteren erforderlichen Schritte liegt aber bei der planenden Pflegefachkraft.
Erstassessment
Das pflegerische Erstassessment beginnt im Rahmen des Erst-/Aufnahmegesprächs. Neben der Beobachtung des Gesundheitszustands durch die Pflegefachkraft können unterstützend Assessmentinstrumente eingesetzt werden, beispielsweise um den Verdacht eines Sturzrisikos durch eine Sturzrisikoskala zu be- oder widerlegen. Inhalt und Umfang des Erstassessments orientieren sich an der individuellen Pflege- und ggf. auch an der medizinischen Situation.
Zum Erstassessment gehören die Einschätzung des Ist-Zustands inklusive Risiken, vorhandenen Ressourcen, individuellen Verhaltensweisen, Bedürfnissen und Beeinträchtigungen im Bereich der Lebensaktivitäten, Ängsten, Sorgen und Wünschen bzw. Gewohnheiten des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin. Weiters erfolgt eine pflegerische Beurteilung des körperlichen und kognitiven Zustands, der psychischen Situation und des sozialen Umfelds sowie der Pflegevorgeschichte (Pflegeanamnese). Auch die medizinischen Diagnosen bzw. Therapien sind zu berücksichtigen. In welchem Umfang eine Risikoeinschätzung erforderlich ist, hängt vom Zustand des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin ab und liegt im Ermessen der Pflegefachkraft. Sind Risiken vorhanden, sind diese zu dokumentieren.
Bei mangelnder oder fehlender Auskunftsfähigkeit des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin können Informationen auch von An- und Zugehörigen bzw. unter Berücksichtigung sekundärer Daten (Aussagen anderer Berufsgruppen, Krankengeschichten, Dokumentation anderer Einrichtungen, Entlassungs-/Transferierungsberichte, …) erhoben werden.
Der konkrete Inhalt und Umfang der gesammelten Daten hängt von der geplanten bzw. absehbaren pflegerischen Beziehung ab. Je länger die Pflege- und Betreuungsdauer ist, desto umfangreicher wird das pflegerische Erstassessment sein und ggf. auch soziobiografische Erhebungen beinhalten.
Die Dauer der geplanten Pflegebeziehung bestimmt auch den zeitlichen Rahmen, in dem das Erstassessment abgeschlossen werden soll. Generell ist festzuhalten, dass die Informationen, die unmittelbar relevant sind, sofort erhoben werden müssen. Alle weiteren relevanten Informationen sollten in akutstationären bzw. rehabilitativen Settings innerhalb von 24 bis 48 Stunden erhoben werden. Im Langzeit- und Behindertenbereich sind relevante Informationen innerhalb der ersten 14 Tage bis zu maximal einem Monat zu erheben, in der mobilen Pflege und Betreuung innerhalb der ersten 14 Tage bzw. der ersten fünf Hausbesuche. Nach dieser ersten Informationserhebung wird die laufende Informationssammlung weitergeführt.
Reassessment
Gibt es relevante Veränderungen, so ist eine Neueinschätzung der Pflegesituation durchzuführen. Diese sollte je nach Anlass individuell und bedarfsorientiert erfolgen. Kriterien für ein Reassessment können beispielsweise sein: Veränderung des Gesundheitszustands des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin, Veränderung des Pflegebedarfs oder Rückkehr in die Langzeitpflegeeinrichtung nach einem Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt.
Für den stationären und mobilen Langzeitpflegebereich/Behindertenbereich wird alle sechs bis zwölf Monate eine Neueinschätzung des Ist-Zustandes empfohlen.
Fokussiertes Assessment
Fokussierte Assessments und Risikoeinschätzungen können für spezifische Phänomene zur Unterstützung der pflegefachlichen Einschätzung eingesetzt werden. Dazu gehören settingspezifische Erhebungen wie geriatrische Basisassessmentinstrumente (z. B. Timed „Up & Go“-Test, Barthel-Index, MNA – Mini Nutritional Assessment), Instrumente zur Erfassung der psychischen Situation (Depressionseinschätzung, Einschätzung des Suizidrisikos, …) oder Erhebungen der Alltagsfähigkeiten (FIM – Functional Independence Measure, …) (vgl. Rappold et al. 2017, S. 9–11).
Die Anwendung von Assessmentinstrumenten durch PflegefachassistentInnen erfolgt nach Anordnung/Delegation durch den gehobenen Dienst oder andere im Betreuungsprozess involvierte Berufsgruppen. Dazu ist es erforderlich, dass die durchführende Pflegekraft mit dem Assessment vertraut ist. Ggf. ist vor der Anwendung eines Assessmentinstruments eine Schulung erforderlich. Die Ergebnisse und eventuelle Vorschläge für weiterführende Interventionen werden an den gehobenen Dienst weitergegeben.
Pflegeplanung
Der zweite Schritt des Pflegeprozesses ist die Pflegeplanung. Darunter wird der kognitive Planungsprozess verstanden, der auf der Fähigkeit des kritischen Denkens basiert. Dieser Prozess findet immer statt, egal ob alle Schritte des Pflegeprozesses im schriftlich festgelegten Pflegeplan abgebildet werden oder nicht. Die Pflegeplanung besteht aus der Pflegediagnostik und dem Festlegen von Pflegezielen und Pflegeinterventionen. In Abb. 4 ist der Planungsprozess grafisch dargestellt.
Abb. 4: Pflegeplanung und Pflegeplan (Rappold et al. 2017, S. 9)
Merke: Nicht aus jedem Pflegeplanungsprozess muss ein schriftlicher Pflegeplan hervorgehen!
Pflegediagnostik
In diesem Schritt der Pflegeplanung werden die relevanten Daten aus dem Assessment mit dem vorhandenen Fachwissen der planenden Pflegefachkraft und der individuellen Situation des Pflegempfängers/der Pflegeempfängerin in Beziehung gesetzt, priorisiert und beurteilt. Gegebenenfalls leiten sich daraus Pflegediagnosen und/oder Pflegeinterventionen ab.
Pflegediagnosen sind das Ergebnis einer systematischen Beurteilung oder Einschätzung pflegerelevanter Zustände eines Individuums, einer Familie oder einer Gemeinde/ Gemeinschaft, das systematisch verschriftlicht wird. Pflegediagnosen beziehen sich auf pflegerelevante Aspekte, die der Aufrechterhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung des Gesundheitszustands bzw. der Lebensqualität oder der Gesundheitsförderung dienen oder zur Linderung von Symptomen beitragen.
In Österreich kommen unterschiedliche Pflegeklassifikationssysteme zum Einsatz (z. B. NANDA, POP, ENP). Unabhängig vom eingesetzten Pflegeklassifikationssystem hat sich bei uns das PÄSR-Schema etabliert, das heißt, Pflegediagnosen beinhalten die Beschreibung des Pflegebedarfs (Pflegephänomen), wenn ersichtlich, der zugrunde liegenden Ursache/n (Ätiologie) bzw. Risikofaktoren (bei Risikodiagnosen) und der vorhandenen Symptome und Ressourcen. So ist die Mindestanforderung für das Formulieren von Pflegediagnosen: Pflegediagnosentitel mit Risikofaktoren bzw. Symptomen und, wenn bekannt, Angabe der Ursachen (z. B. ärztlich gestellte Diagnosen) (vgl. Rappold et al. 2017, S. 14).
Ob bzw. wie viele Pflegediagnosen formuliert werden, hängt davon ab, ob im Rahmen des Aufenthalts/der Betreuungsdauer ein pflegerisch beeinflussbarer Bedarf vorhanden ist. Liegen mehrere Pflegephänomene parallel vor, wird eruiert, welche innerhalb des geplanten Aufenthalts beeinflusst werden können bzw. welche die wichtigsten sind oder zueinander in Beziehung stehen. Wichtig zu berücksichtigen ist auch, dass medizinische Diagnosen bzw. Therapien allein nicht zwingend zu einer Pflegediagnose führen müssen. Jedes individuell erhöhte Risiko erfordert eine Risikodiagnose und einen schriftlichen Pflegeplan. Generelle Risiken, die durch die Anwendung allgemeiner Standards/Leitlinien/SOPs abgedeckt werden können, erfordern keine Pflegediagnose. Liegt jedoch zusätzlich ein individuell erhöhtes Risiko vor (z. B. Immunsuppression im Zusammenhang mit Infektionsrisiko; demenzielle Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Flüssigkeitsdefizit), ist die Verwendung einer Pflegediagnose zielführend.
So sind beispielsweise in folgenden Situationen Pflegediagnosen nicht zwingend notwendig:
► bei Pflegeinterventionen, die sich primär aus der Folge der medizinischen Behandlung bzw. der multiprofessionellen Versorgung ergeben
(z. B. postoperative Unterstützung bei der Körperpflege oder Ausscheidung)
► bei entwicklungsphysiologisch bedingter Pflege (z. B. Baden eines Säuglings)
► bei einmaligen Pflegeinterventionen
► bei Pflegesituationen, die im Rahmen des Aufenthaltes/der Betreuung nicht beeinflussbar sind
► bei generellen Risiken
(vgl. Rappold et al. 2017, S. 14–16)
Pflegeziele
Im nächsten Schritt werden für den/die PflegeempfängerIn individuelle, erreichbare und evaluierbare Ziele gesetzt.
Pflegeziele sind bewertbare (evaluierbare) Zustände, Verhaltensweisen, Wahrnehmungen, Fähigkeiten oder Wissen des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Diese Zustände werden durch individuell auf den Pflegeempfänger/die Pflegeempfängerin abgestimmte pflegerische Interventionen innerhalb der Aufenthalts-/Betreuungsdauer erreicht. Pflegeziele werden vor der Beschreibung der dazu notwendigen Interventionen formuliert. Sie dienen dazu, die Wirksamkeit der durchgeführten Interventionen zu beurteilen (evaluieren).
Pflegeziele können sich auf das Erhalten, Verbessern und Fördern des Gesundheitszustands bzw. der Lebensqualität sowie das Bewältigen von Pflegebedürftigkeit und Krankheit beziehen. Ziele sind so zu formulieren, dass sie für alle Beteiligten relevant, eindeutig, klar, nachvollziehbar, erreichbar und verständlich sind. Damit Ziele bewertbar werden, müssen sie qualitative und quantitative Indikatoren enthalten. Dazu gehören beispielsweise Angaben wie Strecken in Metern, Mengen in Litern, Gewicht in Kilogramm, Häufigkeiten in Zahlen, aber auch Angaben wie „unter Anleitung“, „unter Anwesenheit und Aufsicht“ oder „selbstständig“. In Pflegezielen zu unterlassende Formulierungen sind sehr allgemeine Aussagen, wie z. B. „gut“, „ausreichend“ oder „besser“. So formulierte Ziele lassen sich nicht evaluieren, da die Angaben nicht zu messen sind.
Zu jeder Pflegediagnose muss mindestens ein Ziel nach folgenden Anforderungen formuliert sein:
► passend: auf die Pflegediagnose bezogen
► pflegeempfängerorientiert: die Ziele werden, abhängig von der Situation des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin, mit diesem/dieser vereinbart
► erreichbar: für den pflegebedürftigen Menschen
► bewertbar: enthält eine Zeitangabe, bis wann das Ziel erreicht sein bzw. evaluiert werden soll, und eine präzise Beschreibung des bis dahin erreichten Zustands
Hilfreich für die Formulierung von Pflegezielen ist die SMART-Regel:
S – spezifisch
Ist das Ziel präzise formuliert?
M – messbar
Ist die Zielerreichung überprüfbar/evaluierbar?
A – attraktiv/akzeptiert
Bringt das Ziel einen Nutzen?
R – realistisch
Ist das Ziel erreichbar?
T – terminiert
Ist ein klarer Endtermin für die Zielerreichung vorgegeben?
(vgl. Rappold et al. 2017, S. 14–16)
Pflegeinterventionen
Unter Pflegeinterventionen werden Handlungen verstanden, die in der pflegerischen Kernkompetenz des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege liegen.
Die geplanten Pflegeinterventionen sind für alle Pflegepersonen verbindlich. So wird die Kontinuität der Pflege gewährleistet und ist so lange bindend, bis eine veränderte Situation des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin eine neue Beurteilung und Planung erforderlich macht. Je nach Komplexitätsgrad der Pflegeintervention bzw. Pflegesituation werden die geplanten Interventionen vom gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege selbst durchgeführt oder entsprechend rechtlicher und fachlicher Grundlagen an andere Berufsgruppen übertragen bzw. delegiert. Alle in den Betreuungsprozess eingebundenen Pflegekräfte sind dafür verantwortlich, Veränderungen, die eine Änderung des schriftlichen Pflegeplans notwendig machen, an die zuständige Diplompflegekraft weiterzuleiten und sich mit Vorschlägen in den Planungsprozess einzubringen.
Ärztlich angeordnete Maßnahmen und Tätigkeiten unterliegen nicht dem Pflegeprozess, da sie in den Kompetenzbereich der medizinischen Diagnostik und Therapie fallen. Sie sind daher nicht im schriftlichen Pflegeplan enthalten. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist an anderer Stelle, wie in der Therapie-/Fieberkurve oder im Medikamentenblatt, zu dokumentieren.
Pflegeinterventionen müssen nachvollziehbar und handlungsleitend formuliert werden. Das kann
► unter konkreten Angaben von Maßnahmen (z. B. Anleiten zur Teilkörperwäsche von Gesicht und Oberkörper am Waschbecken),
► unter Angabe eines Handlungsspielraums (z. B. Unterstützung bei der Teilkörperwäsche je nach Wunsch/Allgemeinzustand des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin) oder
► mit Bezug auf Leitlinien/SOPs/Standards (z. B. laut SOP Vollbad) erfolgen.
Plant man die Pflegeinterventionen mit der „5-W-Regel“, ist sichergestellt, dass diese alle wesentlichen Informationen beinhalten:
1. Was ist zu tun?
2. Wie ist es durchzuführen?
3. Wie oft ist es zu tun?
4. Womit ist es zu tun?
5. Wer führt es aus?
Werden Interventionen laut organisationsspezifischen Vorgaben durchgeführt, so müssen diese für die Pflegekräfte nachlesbar sein. Eventuelle Abweichungen müssen im Pflegeplan angeführt werden. Nicht im individuellen schriftlichen Pflegeplan zu erfassen sind Handlungsschemata sowie die grundsätzliche Vor- und Nachbereitung von Pflegeinterventionen. Diese wurden im Rahmen der Ausbildung und/oder Einschulung erlernt und sind Inhalt von Lehrbüchern und/oder Einschulungsmappen der jeweiligen Organisationen. Erfordert die pflegeempfängerorientierte individuelle Pflege eine spezielle Vor-/Nachbereitung, ist diese im schriftlichen Pflegeplan zu vermerken.
Neben der Anleitung, Unterstützung oder stellvertretenden Übernahme von Handlungen umfassen pflegerische Interventionen das kontinuierliche Beobachten und Sammeln bzw. Analysieren von Daten, das Fördern und Unterstützen in den Aktivitäten des täglichen Lebens, das Vermitteln von Informationen und Fertigkeiten, das Koordinieren und Organisieren von Prozessen sowie die Beratung, Anleitung und Beaufsichtigung des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin.
Einmalige Pflegeinterventionen, die aufgrund eines punktuellen Bedarfs gesetzt werden, werden nach organisationsspezifischer Vorgabe (als Ad-hoc-Leistung oder im Pflegebericht) dokumentiert. Auch wiederkehrende Pflegeinterventionen ohne Pflegediagnosen sind Bestandteil des schriftlichen Pflegeplans.
Die Einhaltung von Prinzipien und Grundhaltungen, die handlungsleitend für Pflegeinterventionen sind (z. B. Wahren der Intimsphäre, Informieren von Betroffenen, angemessene Kommunikation, sterile Arbeitsweise), sind bei ausgebildeten Pflegepersonen vorauszusetzen, daher nicht zu planen und die Durchführung auch nicht zu bestätigen. Sogenannte Hotel-, Logistik- und Serviceleistungen müssen ebenfalls nicht geplant werden. Dazu gehören beispielsweise das Aufbereiten von Betten, das Essensservice, die Reinigung und Routinedesinfektion oder Material- und Wäschegebarung (vgl. Rappold et al. 2017, S. 19–21).
Durchführen von Pflegeinterventionen
Wie schon erwähnt, ist die Durchführung der im schriftlichen Pflegeplan vermerkten Interventionen für alle Pflegepersonen verbindlich. Die Dokumentation der erbrachten Pflegeinterventionen sowie der Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen von medizinischer Diagnostik und Therapie erfolgt im Durchführungsnachweis. Dieser kann als Leistungsnachweis herangezogen werden. Durch die Dokumentation wird bestätigt, dass die geplanten bzw. angeordneten Maßnahmen auch tatsächlich erbracht wurden.
Die durchführende Person bestätigt die Durchführung der Maßnahme mit Handzeichen oder bei elektronischer Dokumentation mit digitaler ID und Angabe von Datum sowie Zeitpunkt oder Zeitraum. Je relevanter der Zeitpunkt der Durchführung einer Pflegeintervention ist (z. B. Positionierung, Medikamentengabe), desto genauer muss der Durchführungszeitpunkt erfasst werden, unabhängig vom Dokumentationszeitpunkt.
Die Durchführungsdokumentation soll möglichst einfach und effizient sein. Die erbrachten Leistungen sollen nur einmal und an der dafür vorgesehenen Stelle dokumentiert werden (Vermeidung von Doppeldokumentation). Die Leistungsdokumentation soll möglichst unmittelbar, das heißt zeitnah erfolgen. Zeitnah bedeutet möglichst knapp nach dem Ereignis, der Beobachtung oder erbrachten Leistung, spätestens aber bis Dienstende bzw. Übergabe des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin an einen anderen Bereich (vgl. Rappold et al. 2017, S. 27).
Merke: Je akuter oder relevanter das Ereignis, desto rascher muss der Eintrag erfolgen (z. B. Sturzgeschehen)!
Evaluierung
Die Evaluation ist die systematische Bewertung und Überprüfung der Zielerreichung. Das geplante Pflegeziel (Soll) wird mit dem Pflegeergebnis (Ist) verglichen und bewertet.
Die Evaluierung kann stattfinden:
► zum festgelegten Evaluationszeitpunkt,
► bei Veränderung des Pflegezustandes oder
► bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses.
Grundsätzlich ist die fortlaufende Evaluation von der intermittierenden Evaluation zu unterscheiden. Unter fortlaufender Evaluation wird die permanente Überprüfung der Pflegeinterventionen während oder direkt nach einer Pflegeintervention verstanden. Hier wird die Reaktion des Pflegeempfängers/der Pflegeempfängerin auf die Intervention beobachtet und ggf. eine Anpassung der Pflegeinterventionen vorgenommen. Die intermittierende Evaluation findet zu einem bestimmten, im Planungsprozess bereits festgelegten Zeitpunkt statt.
Bei der Evaluierung sollten folgende Fragen berücksichtigt werden:
►