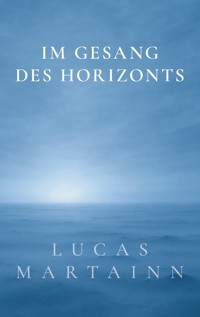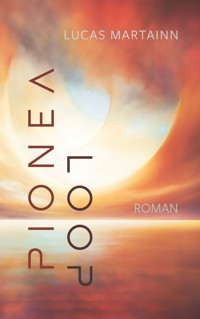Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fragment Eight Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pionéa-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Was ist das Leben, wenn man von ihm vergessen wird? Das Verschwinden von Alan und Jay, Liya und Raya, Saskia und Jarne und ihre Rückkehr in die Gegenwart haben Folgen für die Welt, die niemand vorhersehen konnte. Haben sie mit ihrer Rückkehr auch das Vergessen mitgebracht? Und was bedeutet es, das prägendste Ereignis ihres Lebens verschweigen zu müssen, um Pionéas Rückkehr nicht zu gefährden? Was Pionéa bei ihrer Rückkehr mitbringt, ist vor allem eines: ein globales Ereignis, das niemand versteht, aber alle berührt. Denn sie bringt mehr mit als sich selbst. Der zweite Band der Pionéa-Trilogie bietet ein kaleidoskopisches Geflecht von Geschichten, die wie Flüsse ineinanderfließen und von der Sehnsucht nach Ankommen getragen werden. Mit Leichtigkeit und Zuversicht legt Lucas Martainn Abschnitt für Abschnitt ein Mosaik der Hoffnung, in dem die Kraft des Erinnerns zur verbindenden, lebensgestaltenden Dynamik wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
TEIL 2
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
TEIL 3
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nachwort
LOOP – Was bisher geschah
»Shannon ist meine Tochter«, sagte Alan. »Vor ein paar Wochen hat sie zu mir gesagt: Ich bin schon fast so groß wie du. Nur noch vier Köpfe. Sie ist fünf.«
»Wir werden die nächsten Tage keinen Empfang haben«, sagte Saskia in ihr Telefon. »Ja, echt wahr, es gibt noch Gegenden auf dieser Welt ohne Empfang.« Sie hörte zu und lächelte breit. »Es ist nicht gefährlich, Mama. Mach dir keine Sorgen, wirklich, in ein paar Tagen sind wir wieder erreichbar. Also, gib Papa und Jantje einen Kuss von mir. Und gib Abercrombie einen Knuddel.«
»Ist jemand hier? Alan? Jay? Seid ihr noch da?«
»Was ist los?«, fragten Jarne und Saskia.
»Ich weiß es nicht«, sagte Pionéa.
»Das sind Raya und Liya. Sie sind heute Morgen aufgebrochen und mussten umkehren, weil sie ... weil sie den Ausgang nicht gefunden haben.«
»Wir haben ihn nicht nicht gefunden!«, rief Raya und warf etwas Imaginäres zu Boden. »Er. War. Nicht. Da!«
Liya sprach leise und fassungslos. »Wir sind in einem Loop gefangen. In einer Endlosschleife.«
»Wir müssen den Loop mir einer mininmalinvasiven Intervention durchbrechen«, sagte Sophia. Sie platzierte die letzte Diode auf der Brust des tibetischen Mönchs, die alle über Kabel mit einem Computer verbunden waren. Vor dem Computer stand etwas, das aussah wie eine große Pfeilspitze.
»Dann sehen wir uns nachher«, sagte Tenzin und schloss die Augen.
Stunden später öffnete er die Augen plötzlich wieder, als hätte er sie gerade geschlossen. »Es hat funktioniert«, sagte er und strahlte. »Es ist besser gelaufen, als wir gehofft hatten. Wir haben einen Beweis. Ich habe einen Mann gesehen. Neben ihm eine junge Frau mit blondem, gewelltem Haar. Mit einem Hund. I LOVE MY GREY MONKS, stand in großen Buchstaben auf ihrem T-Shirt. Der Hund war groß, hell, mit einem schwarzen Fleck auf der Brust.«
»Und jetzt?«, fragte Angus.
»Jetzt warten wir«, sagte Sophia.
Das war, als der weltweite Sturm begann.
»Hört ihr das nicht auch?«, fragte Liya.
»Wind«, sagte Pionéa.
»Und ich glaube, er wird lauter«, sagte Liya.
»Es ist ein Sturm. Aber er kommt nicht näher, er wird nur lauter.« Liya flüsterte. »Schau dir die Bäume an. Sie sind still. Aber das Rauschen des Windes kommt aus den Bäumen.«
»Wie kann das sein?« Rayas Stimme zitterte.
Kein Lüftchen wehte.
Der Sturm wurde tatsächlich lauter.
Im nächsten Moment klebten Raya die durchnässten Kleider am Körper. Es war taghell. Die Nacht war verschwunden. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht, fast senkrecht, getragen von einem heftigen Sturm. Der Sturm, dachte Raya, der Sturm! Er ist hier, er ist durchgebrochen!
Alan schoss durch den Regen auf die Stelle zu, die sie alle retten sollte. Er schüttelte den Kopf und holte Luft. »Wo sind wir?«
»Wir sind draußen. Wir haben es geschafft«, keuchte Jay.
»Geht es dir gut?«, fragte Angus. Pionéa nickte schnell und presste die Lippen zusammen. »Was ist mit dir passiert, Angus?«, fragte sie.
»Eure Tage im Areal …«, sagte Sophia,
»... waren für uns neunzehn Jahre«, sagte Angus.
»Das sind unsere Familien«, sagte Jarne, der mit Saskia das Fotoalbum betrachtete, das sie ihnen gereicht hatten. »Unsere Eltern. Unsere Geschwister. Du sagst, diese jungen Leute sind ... unsere Nichten und Neffen?«
»Ja«, sagte Angus. »Und wir können sagen, dass es den meisten von ihnen gut geht. Liya und Raya, es tut mir leid, aber euer Vater ist nicht mehr aufgetaucht.«
»Unser Vater wurde für tot erklärt?«, sagte Liya.
»Ihr seid alle für tot erklärt worden.«
Jarne dachte an seine Freunde. Zusammen waren sie älter geworden. Nun war er neunzehn Jahre jünger. Er hatte als Erster geheiratet. Jetzt hatten fast alle eine Familie, außer Are. Er war schon immer der Abenteurer gewesen, und anscheinend hatte sich noch keine Frau gefunden, die ihn an einen Mast binden und ihm ein Halleluja entlocken konnte.
Alan schaute auf die Fotos seiner Tochter. Das Album begann, als sie fünf Jahre alt war. So kannte er sie. So hatte er seine Tochter verlassen und bei seinen Eltern zurückgelassen.
Hier, das muss ihr erster Tag im Kindergarten sein.
Hier ist sie an ihrem siebten Geburtstag, alle vier Großeltern jubeln und klatschen, als sie ihre Kerzen ausbläst.
Hier ist sie beim Tanzunterricht. Shannon als Teenager. Es war offensichtlich, dass die Mode mit der Zeit gegangen war und an eine längst vergangene Zeit erinnerte. Wieder Shannon beim Tanzen, jetzt vielleicht siebzehn, achtzehn, auf einer Bühne.
»Wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet.«
Die vierundneunzig Gesichter auf dem Bildschirm der Pressekonferenz verschwanden und ein großes Gesicht einer jungen Frau erschien.
»Shannon!«, rief Alan und sprang auf. »Kannst du mich sehen?«
»Dad? Bist du das?«
»Shannon!« Alan schossen Tränen in die Augen.
Shannon hatte die blauen Augen und die dunklen Locken ihrer Mutter und seine dunkle Haut. Sie stieß einen überraschten Laut aus und hielt sich die flache Hand vor den Mund.
»Shannon! Bist du okay? Geht es dir gut?«
»Ja, Dad, ja!«
Der Laptop wurde zugeklappt. Der Bildschirm wurde dunkel.
»Shannon!«, rief Alan.
»Kannst du mir sagen, was mit Keon passiert ist?«, fragte Jay.
Angus sprach leise. »Kurz nach eurem Verschwinden ist er entführt und gefoltert worden. Er wurde freigelassen. Man hat ihn in einem Straßengraben am Rande des Central Parks gefunden. Doch dann verschwand er. Vielleicht war er der nächsten Wahrheit zu nahe gekommen. Niemand weiß, wo er ist oder was passiert ist. Es gibt noch etwas Unglaubliches. Die Tochter von Keons Bruder. Jack.«
»Olivia! Geht es ihr gut? Ist etwas passiert?«
»Und ob etwas passiert ist.«
»Nachdem wir versucht hatten, den Loop von außen zu durchbrechen, kam ein weltweiter Sturm auf, der etwa drei Wochen andauerte«, sagte Sophia. »Er begann mit einer Häufung von Winden rund um den Globus. Aber die Winde hörten nicht mehr auf. Vielmehr verbanden sie sich zu einem globalen Sturm, wie ihn die Welt noch nie erlebt hatte. Meteorologen haben gerätselt und alle möglichen Theorien aufgestellt, aber niemand konnte sie beweisen. Aus allen Disziplinen mischte man sich ein. Die ersten Winde sind überall auf der Welt zur gleichen Zeit entstanden. Von dort aus haben sie sich ausgebreitet.«
»Früher war ich gereist, um zu Geschichten zu kommen«, sagte Angus zu Pionéa. »Jetzt ließ ich sie zu mir kommen. Ich hatte einen Aufruf gestartet und nach Sturmgeschichten gefragt. Erlebnisse aus der Zeit des Sturms. Ich hatte vielleicht hundert Geschichten erwartet. Es kamen Tausende. Vielleicht werde ich einige davon eines Tages erzählen können. Ich arbeite daran. Aber jetzt bist du hier. Und es gibt für mich nichts anderes als dich.«
»Sag bloß nicht, dass ich wieder verschwinden muss, damit die Welt zu dieser Geschichtensammlung kommt.«
»Der Loop ist noch nicht gebrochen«, sagte Sophia. »Ihr müsst zurück. Da ist noch etwas, das mich irritiert. Ein Einheits-Event. Meine Berechnungen sagen, dass es einen Moment geben wird, in dem alles zusammenkommt.«
»Was irritiert dich daran?«
»Es ist nicht nur alles. Es ist mehr als alles.«
»Mehr als alles. Es gibt nicht mehr als alles.«
»Bis jetzt nicht«, sagte Sophia.
Der große Tisch war edel. Weißer Marmor. Links und rechts saßen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesundheitswesen, Militär, Justiz, Wirtschaft und Wissenschaft.
Das war keine Krise. »Das ist Krieg«, sagte er leise. Er machte eine Pause. »Krieg!«, schrie er.
»Befehl zum Abschuss.«
Sie sahen, wie die Raketen abgefeuert wurden.
»Jarne!«, rief Saskia, löste sich von der Säule, die sie, Liya und Jay berührten. »Ich hatte solche Angst um dich!«
»Wir sind zurück. Da, wo wir eingetreten sind.«
»Pionéa ist zurückgereist und hat die Weichen gestellt«, sagte Jarne. »Sie hat den Loop gebrochen.«
»Wir werden Pionéa nie wiedersehen.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher!«, sagte Liya aufgeregt.
»Die Chancen stehen gut, dass sie wieder in dieser Welt auftaucht«, sagte Jarne.
»Ob wir mit der ganzen Geschichte zweite Chancen bekommen haben?«
»Sieht so aus.«
»Na ja, es ist ein kompletter Reset, nicht wahr? Die letzten Tage und die letzten – oder kommenden – neunzehn Jahre sind nicht geschehen?«
»Alles deutet darauf hin, dass sie hier nicht geschehen sind«, sagte Jay.
Sie fuhren durch die Dunkelheit der Nacht. »Ich glaube, dass das, was wir erlebt haben, erst der Anfang ist und dass wir die Glücklichen waren«, sagte Alan zu Saskia. »Ich glaube, dass etwas auf uns zukommt.« Und nach einer Pause: »Ich fühle es. Ich habe Träume. Viele Träume. Flüsse, die aufeinander prallen. Welten, die enden. Düster. Voller Verzweiflung und Hoffnung.«
Alan dachte an seine Tochter. Wenn alles gut ging, würde sie sich bald an ihn schmiegen. Die Kleine.
TEIL 1
When all the people of the world
have a dream
– Jordan Rakei, Learning
Der Felsen warf einen Schatten, und im Schatten saß ein Mann. Tomas Lind war unbekümmert dem Weg um den Felsen gefolgt und blieb abrupt stehen.
»Heiliger Fliegenpilz!«, rief er mit weit aufgerissenen Augen unter seinem weißen Hut hervor. »Was machen Sie denn hier?«
»Mich ausruhen.« Der Mann stand auf und klopfte sich den Staub von der Hose. »Und Sie?«
Die Bewegung kehrte unter den Hut zurück. Sie zog ein Stofftaschentuch aus der Westentasche seines Hemdes, nahm den Fedora-Hut vom Kopf und wischte Tomas über die Stirn. Jetzt fand auch er sich wieder. »Entschuldigen Sie bitte. Ich bin erschrocken. Hier draußen erwartet man niemanden. Ich wollte auf keinen Fall unhöflich sein oder Ihre Ruhe stören.«
»Waren Sie nicht. Haben Sie nicht. Es ist eine berechtigte Frage. Meine auch.«
»Was ich hier mache? Ich ... bin auf dem Weg zum Specchio di Venere, dem Spiegel der Venus. Dem See.« Er deutete in eine Richtung.
»Das bin ich auch.«
Er setzte den Hut wieder auf. Verstaute das Taschentuch sorgfältig. »Tomas Lind. Freut mich, Sie kennenzulernen. Jetzt, wo der Schreck vorbei ist. Es ist heiß.«
»Ainos Sidirourgos. Freut mich auch. Es ist heiß. Ainos«, eine angedeutete Verbeugung.
»Tomas.« Ein Tippen an die Krempe seines Fedoras.
»Schön, dass ich nicht allein gehen muss.« Ainos lud mit ausgestrecktem Arm ein, gemeinsam dem Pfad zu folgen.
Sie setzten sich beide in Bewegung.
»Sie sind Grieche, Ainos. Dem Namen nach.«
»Mein Vater war Grieche. Meine Mutter Finnin.«
»Das ist eine ungewöhnliche Kombination.«
»In der Tat.«
»Da steckt sicher eine spannende Geschichte dahinter.«
»Das tut sie. Wie fast überall.«
Tomas lachte. »Da haben Sie recht. Sind Sie in Griechenland aufgewachsen? Ich frage, weil ich viel in Griechenland unterwegs bin.«
»Ich bin und war schon als Kind viel unterwegs. Die meiste Zeit habe ich auf den nördlichen Inseln Europas verbracht. Hebriden. Irland. Aber mein Vater stammte aus Kefalonia.«
»Die Heimatinsel von Odysseus!«
»Genau.«
»Sehr interessant. Von daher der Name Ainos? Wie der Berg Enos?«
»Wenn man sich auf den Berg selbst konzentriert, ja. Für meinen Vater, der immer in die Ferne geblickt hat, war es die Perspektive, die man vom Berg aus hat. Weitsicht, Umsicht, Überblick. So hat es mir meine Mutter erzählt. Meinen Vater habe ich nie gekannt. Er ist gestorben, als ich noch ganz klein war.«
»Das tut mir leid.«
»Wie gesagt, eine interessante Geschichte.«
Tomas schwieg. Ainos wollte das Gespräch wieder in leichtere Bahnen lenken. »Ich hatte zwei Pflegeväter, die wirklich gut Geschichten erzählen konnten.«
»Haben Sie eine Lieblingsgeschichte?«, hakte Tomas nach. Auch er wollte das Gespräch in leichtere Bahnen lenken.
»Oh ja. Die von der Ente mit der Posaune.«
»Da bin ich aber gespannt«, sagte Tomas lachend.
Also wanderten zwei Männer, die sich gerade erst kennengelernt hatten, in der Mittagshitze durch die Trockenheit auf einer kleinen Insel auf halbem Weg zwischen Sizilien und Tunesien, mitten im Mittelmeer, und der eine erzählte dem anderen die Geschichte von der Ente mit der Posaune. Also wanderten zwei Männer, die sich gerade erst kennengelernt hatten, lachend durch die Trockenheit mitten im Mittelmeer. Dann ließen sie die Geschichte schweigend nachwirken. Selbst solche Geschichten wirken.
Schließlich fragte Ainos: »Machen Sie hier Urlaub?«
»Ich bin beruflich hier.«
»Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Neuro-Mythologe. Man nennt mich auch den Begründer der archetypischen Archäologie. Mag sein. Aber Neuro-Mythologe trifft es besser.«
Ein kurzer Blick zu Ainos genügte, um weiterzusprechen. Niemand weiß, was ein Neuro-Mythologe ist, oder archetypische Archäologie. Also wanderten zwei Männer durch die Trockenheit, und der eine erklärte dem anderen, was er als Einziger auf der Welt tat.
»Das klingt faszinierend. Und was führt Sie hierher?«
»Ein Rätsel, das vielleicht mit meiner Arbeit zu tun hat, vielleicht auch nicht. Meine Mutter war – ist, trotz ihres Alters – Archäologin. Und sie hat hier auf Pantelleria, beim Specchio di Venere, einen Fund gemacht, der nicht sein kann.«
»Ach ja?«
Tomas Lind blieb stehen. Tupfte sich mit dem Tuch aus der Westentasche die Stirn ab. »Immer noch heiß.« Steckte das Tuch wieder weg. »Keine Überraschung.«
»Mhm.«
»Ich bin auf der Suche nach Zusammenhängen, deshalb bin ich hier. Meine Mutter hat einen jahrtausendealten Text gefunden, der aus unserer Zeit stammen muss.« Er setzte sich wieder in Bewegung.
»Ein prophetischer Text also«, sagte Ainos.
Tomas verstand die Bemerkung als Frage: »Auf jeden Fall. Irgendwie. Auf seine eigene, rätselhafte Weise.«
»Das klingt unglaublich.«
»Ja, das ist es. Unglaublich.«
»Ich meinte unglaublich interessant.«
»Oh. Ja, das ist es auch.« Tomas Lind war etwas irritiert, dass der Mann nicht mehr über den Text wissen wollte. Er suchte nach einem Weg, seine Irritation aufzulösen: »Sind Sie zum ersten Mal auf dieser Insel?«
»Ich war schon einmal hier. Das ist schon eine Weile her.«
»Und was machen Sie hier?«
»Man könnte mich einen Pilger nennen, aber das ist nicht ganz richtig. Ich versuche, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich bin eher ein Begleiter.«
»Ich komme immer zu spät. Vielleicht sollte ich das auch versuchen. Klingt für mich nach Lebenskunst.«
»Das scheint mir ein treffender Begriff zu sein.« Er wollte gerade erwähnen, dass er auch fast der Einzige auf der Welt war, der das tat. Aber er kam nicht dazu, denn plötzlich griff er nach Tomas’ Arm, als dieser fragte:
»Und, gelingt es Ihnen? Zur richtigen Zeit –«
—
Neun Uhr. Jantje schloss die Tür auf und trat in den Laden. Er roch nach Büchern. Nach Geschichten, die zwischen Buchdeckeln darauf warteten, zum vollen Leben erweckt zu werden.
»Guten Morgen«, sagte sie leise. Die Bücher schwiegen, aber die Geschichten in ihnen räkelten sich ein wenig, denn sie mochten Jantjes Gegenwart. Die letzten kehrten wie gerufen zurück zwischen die Buchdeckel. Zurück von ihren Reisen durch Zeiten und Räume, wenn sie sich in der Nacht frei bewegen konnten, um sich einander zu erzählen. Ja, das taten sie. Sie erzählten sich. Und brachten damit nach jeder Nacht neue Geschichten mit sich zwischen die Buchdeckel. Geschichten zwischen den Zeilen. Zwischen den Worten. Wie viele Geschichten waren unsichtbar miteinander verbunden. Alle. Es waren alle. Das wusste Jantje. Sie hatte es immer gewusst. Sie hatte schon immer in Büchern gelebt, und die Geschichten der Bücher in ihr. Ihre Schwester erforschte die Außenwelt, indem sie im Außen Geschichte fand. Sie erforschte eine ganz andere Welt. Die Geschichten kamen zu ihr.
Dieser Laden war ihre Heimat. Sie hatte sich damit einen Kindheitstraum erfüllt.
»Ein Buchladen auf einer Insel mit weniger als tausend Einwohnern«, hatte ihr Vater geknurrt, als sie begann, ihren Traum zu verwirklichen. »Mehr eine Bibliothek, wo Bücher herumstehen und verstauben.«
»Ein Ort der Geschichten, Papa«, hatte Jantje gesagt. »Sowieso, Bibliotheken sind die Kathedralen der Gegenwart.«
»Katakomben«, hatte Papa gesagt, einen Arm um sie gelegt und sie näher zu sich gezogen. Er wusste, dass Jantje ihren Kopf – oder ihr Herz – hatte und sich auch nicht von ihm von der Verwirklichung ihres Traums abbringen ließ. Gut so, hatte er gedacht. Sie hat ihren inneren Kompass. Wenigstens besteht nicht wie bei ihrer Schwester die Gefahr, dass sie die Insel verlässt und nie wiederkommt, weil die große weite Welt zu viel zu bieten hat. Und definitiv mehr Steine als diese Insel.
»Deine Schwester und ihre Steine«, hatte er geseufzt.
»Deine Tochter und ihre Steine«, hatte Jantje ihn lachend korrigiert. »Saskia und ich reisen beide gerne«, hatte Jantje gesagt, »der Unterschied ist nur, dass ich dabei an Ort bleiben kann«, und hatte auf ihre Bücher gewiesen.
Und immerhin kamen doch etwa dreihunderttausend Touristen pro Jahr. Da werden schon einige ein Buch mitnehmen. Die Insel war zwar schön, aber viel mehr als Lesen konnte man als Tourist ja dann doch nicht. Hatte Papa gedacht.
»Verkauf auf jeden Fall auch noch Postkarten. Und Leuchttürme«, hatte er gesagt. Jantje hatte gelacht und die Augen verdreht.
Sie ließ die Tür geöffnet. Der Ruf der Möwen flog herein und füllte den Raum mit weiteren Geschichten. Sie zündete das Licht an. Es war ein sanftes Licht wie dasjenige, das von Wolken auf die Erde geschickt wird, wenn die untergegangene Sonne sie erleuchtet. Es war eher eine Stimmung als ein Licht. Sie betrachtete das Hochzeitsfoto von Jarne und Saskia, das neben der Kasse stand.
»Und du, willst du nicht reinkommen, Abercrombie?«, sagte sie zu dem Hund, der an der Schwelle von der Außenwelt zur Geschichtenwelt stand und die Ohren in alle Richtungen bewegte. Er drehte sich auf der Schwelle einmal um sich selbst, legte sich hin, wo er war, und platzierte seinen Kopf zwischen den Pfoten so, dass er das Sträßchen im Blickfeld hatte.
»Ist es so schlimm bei mir?«, fragte Jantje gespielt beleidigt, lächelte, und rückte einen Leuchtturm zurecht. Abercrombie wartete. Auf Saskia und Jarne, die ihn hier zurückgelassen hatten. »Sie kommen nicht«, sagte Jantje. »Heute nicht, morgen nicht. Du musst dich noch etwas gedulden. Zwei Wochen.«
Abercrombie geduldete sich, indem er einmal tief und lautlos seufzte und unvermindert Augen und Ohren auf das Sträßchen gerichtet hielt. Tatsächlich, da kam jemand, auf einem Ding wie jenen, die ungebraucht herumstanden, und neben dem er immer herlaufen musste, wenn Jantje ihres benutzte. Doch es war klar, das war nicht Saskia, war nicht Jarne, obwohl sie auch solche Dinger hatten. Die jetzt nur herumstanden. Noch ein langer, abwertender Seufzer.
Er kannte den Menschen. Es lohnte sich nicht, den Kopf zu heben. Mit den Augen folgen und dabei die Augenbrauen etwas heben genügte. Aufstehen lag auch nicht drin. Der Mensch hatte sein Ding abgestellt, war abgestiegen und kam jetzt geradewegs auf ihn zu. Kam vor ihm zum Stehen. »Na, Crumble? Immer noch missmutig, weil sie dich nicht auf Hochzeitsreise mitgenommen haben? Das wird schon wieder.«
»Hoi Are«, sagte Jantje und trat zu Abercrombie in die Tür. »Alles gut?«
»Hoi Jantje, ja, bei dir?«
»Alles bestens.«
Sie strahlte ihn und seine wilde Chaosfrisur an. Er badete in ihrem Strahlen. So angenehm das Bad auch war, so schnell wurde es ihm auch unangenehm. Er fand eine Frage, um nicht zu lange zu baden: »Neues von unseren Turteltauben?«
Das brachte auch Jantje wieder auf eine rationalere Ebene. Ziel erreicht. »Saskia ist hin und weg von Korsika. Und Jarne von Saskia.«
Abercrombie hob den Kopf. Er hatte ihre Namen gehört.
»Sie sind gestern in ein abgelegenes Gebiet aufgebrochen«, fuhr Jantje fort. »Wir werden wohl ein paar Tage nichts von ihnen hören. An meinem Geburtstag muss sie draußen sein. Denn da muss sie mich anrufen.« Sie lachte.
»Wehe, wenn nicht.«
»Wehe. Bringst du mir neue Geschichten?«
»Du hellst schon jetzt meinen Tag auf, Jantje. Du machst aus dem Briefträger, der meistens nur schlechte Nachrichten in Form der Zeitung und Rechnungen bringt, einen Barden.«
»Es reicht, wenn du mir die Geschichten überreichst, Are, du musst sie mir nicht singen.«
»Aber darf ich?«
Sie zog eine Augenbraue hoch. Are. Flirten was das Zeug hält, aber ja nicht zu viel Nähe. Ob er auch mit den alten Damen, denen er nur schlechte Nachrichten und Rechnungen überbrachte, so flirtete? Um ihren Tag ein wenig aufzuhellen? Warum nicht? Sie streckte die Hand aus. Er überreichte ihr grinsend das Paket. Sie kniff kurz beide Augen zusammen, um ihre Freude zu zeigen.
Neue Geschichten. Neue Reisen. Neue Verbindungen. Willkommen.
—
Neun Uhr. Jantje schloss die Tür auf und trat in den Laden. »Guten Morgen«, sagte sie leise zu den Büchern. Es klang nicht so unbeschwert wie sonst, merkten die Geschichten, die sich zwischen den Buchdeckeln räkelten. Sie spürten auch, dass es nicht daran lag, dass es gestern Jantjes Geburtstag gewesen war und sie mit Freunden etwas länger gefeiert hatte und die Nacht dementsprechend kürzer war. Geschichten sind sehr feinfühlig.
Sie ließ die Tür offen und den Ruf der Möwen herein. Abercrombie rollte sich auf der Schwelle ein.
»Hey«, sagte Jantje zu dem Hund. »Es wird schon werden. Diese Gegend muss wirklich der Hammer sein. Dieses Acortu-Tal, oder wie es heißt. Der Name klingt ja schon wie aus einem geheimnisvollen Buch, findest du nicht?«
Keine Antwort.
»Saskia und Jarne haben sicher beschlossen, noch zwei, drei Tage länger zu bleiben. Jarne hat garantiert genug Hachelslach-Proviant dabei. Wie immer.«
Abercombie wuffte einmal lautlos. Nicht begeistert.
Sie schaute zu dem Hund, zu den Möwen. »Sie tauchen jeden Moment auf«, sagte sie leise zu den Vögeln, die sie nicht hören konnten.
Are tauchte in ihrem Blickfeld auf. Sie war so vertieft in ihre Gedanken, sie hatte ihn nicht kommen sehen, bis er direkt vor der Tür stand.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Ich weiß nicht. Sicher. Hoffentlich.«
»Was denn?«
»Saskia hat sich nicht gemeldet. Sie hätten vorgestern oder gestern aus der abgelegenen Gegend zurück sein müssen. Und sie hat noch nie meinen Geburtstag verpasst.«
»No news is good news. Die große Schwester wird flügge. Sie bleiben sicher noch ein wenig länger, weil’s so schön ist.«
»Das sage ich mir auch, aber mein Gefühl sagt mir etwas Anderes.« Sie lächelte ein wenig hoffnungslos. »Sie wird sich jeden Moment melden.« Ihr Gefühl sagte auch dazu etwas Anderes.
»Sicher«, sagte Are. »Keine neuen Geschichten für dich heute, sorry.«
»Ja, ich weiß. Schon gut.«
Er lächelte etwas unbeholfen. Sie lächelte etwas traurig.
»Also dann …«
»Also dann …«
Abercrombie kurz am Kopf gekrault, und davon trottete Are. Zu seinem Fahrrad. Aufgestiegen. Weggefahren. Langsam.
Jantje blickte ihm nach. Er ist verloren, dachte sie, und bemerkt es nicht. Heißt das, er ist ein wenig verloren? Bemerkt er es darum nicht? Oder so fest, so offensichtlich, dass er es deshalb nicht bemerkt? Bin ich verloren? Sind Saskia und Jarne verloren? Jantje seufzte und wandte sich den Postkarten zu, für die Jarne Hammerfotos gemacht hatte. Das Telefon würde jeden Moment klingeln. Ihr Gefühl sagte etwas Anderes.
Es klingelte nicht, das alte, schwarze Telefon, mit Wählrad und Kordel, das dastand, als hätte es sich aus der Zeit verabschiedet und wäre einfach stehen geblieben. Stattdessen standen am Nachmittag plötzlich ihre Eltern in der Tür.
»Es sind noch andere verschwunden«, berichtete ihr Vater leise. »Fünf andere. Zwei waren in einem Hotel im Ort einquartiert und nicht wie abgemacht zurückgekehrt. Man hatte jemanden losgeschickt, um sie zu finden.« Eine lange Pause, in welcher er zu Boden blickte, dann zu den Büchern, dann in ihre Augen. »Nichts.« Dann suchte er die Hand seiner Frau. Und die Hand seiner Tochter.
Mama und Papa gingen wieder. Sie nahmen Abercrombie mit. Sie würden zuhause auf Jantje warten. Jantje schloss die Tür. Sie musste noch ein paar unvermeidliche Dinge erledigen, doch sie konnte sich nicht konzentrieren. Vor allem starrte sie auf die Postkarten, als würde sie in den Dünen neben dem Leuchtturm plötzlich Saskia und Jarne erblicken. Als würden sie in der Weite des nördlichen Strandes allmählich auftauchen. Und gleich anrufen. Dass es so schön war in dieser abgelegenen Gegend, dass sie noch ein, zwei Tage verlängert hatten.
So dauerte das Erledigen viel länger. Die Geschichten und die Postkarten schwiegen. Als würden sie verharren.
Später. Noch längst nicht alles erledigt. Trotzdem. Nach Hause jetzt.
Sie öffnete die Tür und erschrak.
—
»Erzählst du mir eine Geschichte, Tante Jantje?«
»Yari! Hast du mich gerade erschreckt!«
»Ich hatte keine Zeit die Tür aufzumachen. Du hast sie geöffnet, Tante Jantje.«
Sie lächelte ein wenig. Der kleine Junge sah sie mit großen Augen an. »Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du mich Tante nennst. Erstens bin ich nicht deine Tante, und zweitens komme ich mir sehr alt vor, wenn du das tust. Himmel, du bist fünf!«
Nun ja. Seine Mutter war gleich alt wie sie. Sie kannten sich ihr ganzes Leben und waren beste Freundinnen. Das Wunder mit dem Namen Yari war einfach – zu früh in dieser Welt angekommen.
»Erzählst du mir trotzdem eine Geschichte?« Die Augen ein wenig wässrig.
Jantje ging in die Hocke, nahm Yaris beide Hände in ihre und sagte mit sehr ernster Stimme: »Niemals.«
Yaris entsetzte Augen. Darum fuhr sie schnell fort: »Niemals soll man jemandem, der nach einer Geschichte fragt, eine Geschichte verwehren.«
»Heißt das, du erzählst mir eine?«
Sie erhob sich, ohne seine Hände loszulassen. »Komm rein.«
Yari betrat vorsichtig die Bücherwelt. Jantje gefiel, wie er das machte, jedes Mal. Diese ganz natürliche Sorgsamkeit in der Gegenwart von Geschichten, die Erwachsene oft verloren hatten. Weil sie die Gegenwart vergessen hatten. Ihre Gegenwart. Jede Gegenwart. Yari spürte die Gegenwart der Geschichten noch. Und sie seine. Sie begannen sich wieder zu entspannen und zu räkeln.
»Welche möchtest du denn hören?«, fragte Jantje, als sie Hand in Hand zu den Bilderbüchern tapsten. »Doch nicht …«
»Doch.«
»Die Vergessenen? Wie immer?«
»Es ist meine Lieblingsgeschichte, Tante.«
Sie setzten sich auf bunten Kissen auf den Boden.
»Schau«, sagte Jantje und hielt Yari ein Bilderbuch hin. »Das ist eben erst gekommen. Von einem Mann und einer Ente, die Posaune spielt. Soll ich dir nicht lieber das erzählen?«
»Die Vergessenen«, sagte Yari traurig.
»Okay.« Dagegen konnte sie nichts einwenden. Schlage nie jemandem eine Geschichte aus. »Okay.« Sie sammelte sich. Sie wusste, warum Yari immer diese Geschichte hören wollte. Zuhause würde seine Mama alleine auf ihn warten und ihr dankbar sein. Sie fand das Buch. Räusperte sich.
»Nicht lesen. Erzählen«, sagte Yari mit ernsten Augen und mahnendem Finger.
Jantje lächelte ihn an. »Okay.« Sie begann zu erzählen. Schon mit den ersten Worten waren sie in ihrer eigenen gemeinsamen, von einer geteilten Traurigkeit durchwobenen Geschichtenwelt versunken.
»Sie haben uns vergessen, sagte das Mädchen in ihrem weißen Kleid traurig und rückte etwas näher zum Jungen neben ihr. Sie saßen auf der Bank am Fluss unter der großen Weide. Ihre Beine baumelten in die Leere über dem Boden. Ein dichter Blätterteppich aus gelben Blättern bedeckte ihn. Selbst auf dem Fluss schwammen Blätter. Sie bewegten sich ganz langsam. Wie Traumschiffe. Jedes ein kleines Lichtlein tragend.
Sie werden kommen. Ganz sicher. Sagte der Junge, auch ganz in Weiß, und rückte auch etwas näher.
Vielleicht suchen sie uns. Und finden uns nicht mehr.
Der Junge sagte nichts. Sie blickten auf den Fluss und sagten gemeinsam nichts. Blätter fielen in das Wasser und schwammen davon. Doch sie trugen kein Lichtlein mehr. Der Fluss wurde dunkel. Blätter fielen – und blieben da, wo vorhin eben noch der Fluss war, liegen. Das Wasser war versiegt.
Sie haben uns vergessen. Sie werden nicht wiederkommen.«
Jantje schluchzte laut auf. »Yari, muss es diese Geschichte sein? Es ist eine so traurige Geschichte. Mir ist heute nicht nach traurigen Geschichten. Kann ich dir nicht die vom Mann und der Ente erzählen? Die ist echt lustig!«
»Jetzt hast du schon begonnen, Tante Jantje. Man kann Geschichten nicht einfach abbrechen.«
Jantje nickte. Wo Yari recht hat, hat er recht. Sie wischte sich eine Träne weg. Trotzdem. »Sie ist so traurig.«
»Sie ist nur traurig, wenn sie hier endet. Tut sie aber nicht. Es ist eine Geschichte der Hoffnung. Hast du selber einmal gesagt.«
Und wieder hatte er recht. Also. Weiter.
»Der Baum hatte alle Blätter verloren, und die Blätter verloren allmählich ihre Farben. Das trockene Flussbett ruhte still und dunkel.
Sie kommen nicht wieder, sagte das Mädchen traurig.
Wir müssen sie suchen, sagte der Junge. Er nahm das Mädchen an der Hand. Gemeinsam machten sie sich auf. Sie kamen an einen Hügel, und auf dem Hügel stand ein Gebäude.
Da sind sie sicher, sagte das Mädchen. Es klang Hoffnung in ihrer Stimme.
Sie schritten durch die hohe Wiese mit duftenden Blumen, die vom Wind sanft bewegt wurden, den Hügel hinauf. Als sie näher kamen, sahen sie, dass es kein Haus war. Es war ein Tempel mit Säulen. Und noch näher: eine Tempelruine. Säulen ragten wie gebrochene Versprechen in den Himmel.
Vorsichtig gingen sie hinein. Sie betraten einen dunklen Raum. Ein einzelner Sonnenstrahl fiel durch eine Ritze in der Wand, und ein Lufthauch wirbelte Staub oder vielleicht Asche auf, die still im Licht tanzte.
Sie sind nicht hier.
Sie gingen weiter und kamen an einen wunderschönen Strand, an welchem das Meer toste, und der Wind fuhr ihnen durch das Haar.
Hier müssen sie sein, sagte der Junge.
Ja, hier ist es so schön, sagte das Mädchen. Natürlich müssen sie hier sein. Sie lachte.
Sie gingen den ganzen, langen Strand auf und ab, und er war wirklich sehr lang. Doch sie waren nicht hier. Niemand war hier. Überhaupt schien nirgendwo jemand zu sein. Erschöpft legten sie sich in den Sand, da, wo sie waren, als es dunkel wurde. Sie fielen in einen traumlosen Schlaf.
Als sie am nächsten Morgen erwachten, toste das Meer nicht mehr. Auch kein Wind ging mehr. Still. Es war ganz still.
Sie saßen am Strand und blickten auf das Meer, das ruhte wie ein unendlicher See.
Sie werden kommen. Sie werden uns holen.
Sie saßen und blickten auf das Wasser, als es zu Asche wurde. Zu einer riesigen, grauen Ebene. Und dann verschwand auch sie ganz plötzlich. Doch die beiden sahen nicht etwa den Meeresboden. Sie sahen – nichts.
Dieses Nichts bestürzte ihre Augen.
Ich glaube nicht, dass sie kommen, sagte das Mädchen ängstlich.
Hastig standen sie auf, reichten sich die Hände, und eilten so schnell sie konnten ins Landesinnere. Sie begegneten niemandem. Dafür mussten sie immer wieder Löchern ausweichen, die – nichts waren. Nicht einmal Löcher.«
Yari kuschelte sich an Jantje.
»Es wurde Abend. Sie hatten Hunger. Ihren Durst hatten sie an einem Bach gelöscht, bevor auch dieser vor ihren Augen verschwand. Erschöpft ließen sie sich unter einem großen Baum nieder, der einsam auf einer Wiese stand. Sie waren schon fast eingeschlafen, als sie von einer tiefen Stimme geweckt wurden. Sie erschraken.
Habt keine Angst, sagte die Stimme. Ich habe nur gesagt, dass ich es bedauere, euch keine Früchte anbieten zu können.
Sie blickten sich um. Wer war das? Niemand war zu sehen.
Ich bin hier, sagte die Stimme.
Hier? Wo? Wer bist du?
Hier. Die gelben Blätter über ihnen raschelten ein wenig. Die Stimme kam aus dem Baum!
Baum! Weißt du, was geschieht? Wir sind ganz allein, und die Welt scheint sich aufzulösen. Niemand kommt, um uns zu retten. Niemand!
Es kann kein Einzelner euch retten kommen. Sie haben diese Welt gemeinsam erbaut und können sie nur gemeinsam betreten, antwortete der Baum.
Wie meinst du das?
Die Menschen, die diese Welt gemeinsam erschaffen haben, und auch euch. Sie haben sich geliebt. Hatten Träume. Und dann haben sie ihre Träume vergessen. Euch vergessen. Sie haben sich auseinandergelebt. Als sie das bemerkten, versuchten sie, sich wieder zu finden. Sie haben es versucht, doch es ging nicht. Sie haben die Tore zu dieser Welt eine Weile lang wirklich wiederfinden wollen. Doch nein. Sie hatten es zu spät bemerkt. Sie hatten den Geist verloren, und der Geist ist Wind, ist Bewegung. Sie konnten nicht zurück. Deshalb löst sich diese Welt allmählich auf. Deshalb weht kein Wind mehr. Schaut nur, wie still meine Blätter sind.
Wir sind Schuld. Wir haben sie auseinandergebracht. Was haben wir getan?
Es ist nicht wegen euch. Ihr habt nichts Falsches getan. Die Welt der Menschen ist oft widersprüchlich. Entweder sie finden einen Weg, mit diesen Widersprüchen umzugehen, oder sie gehen auseinander in der Hoffnung, dass die Widersprüche dadurch heimatlos werden und verschwinden. Das tun sie aber nicht. Die Menschen vergessen die Welt, die sie zusammen erbaut und belebt haben. Die Welt, in welcher sie sich geliebt haben. Denn sie vergessen sich selbst.
Aber wirkliche Liebe vergisst nicht und kann nicht vergessen gehen, sagte das Mädchen fast ein wenig trotzig.
Das stimmt. Aber Menschen können sich selbst vergessen. Und damit diejenigen, die die Liebe nicht vergessen können. Den Teil in ihnen, der immer liebt. Das seid ihr.
Wir sind diejenigen, die die Liebe nicht vergessen können?
Ja.
Sie haben uns vergessen.
Ja.
Also doch.
Ja.
Sie fielen in einen traurigen, dunklen Schlaf, eng aneinander gekuschelt.
Der Baum blieb am nächsten Morgen stumm. Keine Vögel sangen in ihm. Geräuschlos fielen die Blätter zu Boden und wurden zu Asche.
Entsetzt rannten die beiden über die Wiese davon. Als sie sich noch einmal umdrehten, sahen sie, wie auch der Baum zerfiel. Und dann zu nichts wurde.
Sie gingen durch eine stumme, taube, klanglose Welt. Das Mädchen pflückte eine große, rote Blume und roch daran. Doch sie duftete nicht mehr. Die Welt duftete nicht mehr.
Es ist schwer sich zu erinnern ohne Düfte, sagte sie.
Sie kamen wieder zu dem Tempel. Er stand noch unverändert da. Die Kinder zogen sich in ihn zurück. Nicht in den dunklen Raum. Sie lehnten sich an die Wand zum Eingang. Das Mädchen legte die rote Blume neben sich. Von hier aus hatten sie einen weiten Ausblick über das Land, das jetzt stumm vor ihnen lag, in ihm wachsende graue Flecken, dann nichts. Sie sahen, wie die Farben verblassten. Es war nicht Abend, und doch verschwand das Licht. Es wurde nicht dunkel, denn das wäre das Gegenteil von Licht gewesen und als Gegenteil immer noch etwas und damit viel näher am Licht, als es diese Dunkelheit war. Es war ein Vergessen.
Jetzt verlor auch die Wiese vor ihnen ihre Farbe. Der Tempel begann sich aufzulösen.
Und du?, fragte sie, ganz eng an ihn gekuschelt. Wirst du mich vergessen?
Das letzte, was sich auflösen wird, ist die Erinnerung an dich.
Ja. Und das letzte, was bei mir erlöschen wird, ist die Erinnerung an dich.
Eng aneinander gekuschelt warteten sie darauf, dass sie zuerst sich selbst vergaßen, und dann –«
Jantje Blätterte langsam um ...
»– spürst du das?
Ein Windhauch!«
Kapitel 1
Lieber Angus O'Donohue,
ich habe von Ihrem Aufruf gehört. Sie sammeln Sturmgeschichten. Geschichten, die sich in der Sturmzeit ereignet haben.
Ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. In zwei Monaten werde ich 87 Jahre alt. Mein Mann starb vor neun Jahren. Seit fünf Jahren lebe ich in einer Seniorenresidenz.
Es ist ein Altersheim, aber Heim sagt man anscheinend nicht mehr, weil es einen negativen Beigeschmack hat. Dabei hat es doch mit Heimat zu tun, oder? Nun, ja und nein ...
Als ich mein kleines Zimmer bezog und mit meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in Kontakt kam, fiel mir vor allem etwas auf, was ich vorher mit meinem Mann nicht erlebt hatte. Und zwar hatten wir damit aufgehört, als er mit 58 Jahren niedergeschlagen von einem Bewerbungsgespräch nach Hause gekommen war. Er wollte sich beruflich neu orientieren, und seine Erfahrung wäre von unschätzbarem Wert gewesen. Doch es wurde jemand Jüngeres gesucht. Man wolle in die Zukunft investieren. Und er sei in seinem Alter nicht die Zukunft.
Also hatten wir beschlossen, die Zukunft zu sein.
Und hier, in der Seniorenresidenz, wurde vor allem über die Vergangenheit gesprochen.
Natürlich ist die Vergangenheit in Jahren gemessen viel größer als die Zukunft, die noch vor mir liegt. Ich rechne auch nicht damit, mindestens 174 Jahre alt zu werden. Und doch scheint es mir unverhältnismäßig, dass wir Alten die Zukunft völlig aus unserem Leben gestrichen haben. Die Gegenwart genügt uns, die Vergangenheit ist unsere Ressource.
Es ist schön, wenn die Gegenwart genügt, aber diese Gegenwart ist so von Erinnerungen durchtränkt, dass darin keine neuen Erinnerungen mehr Platz finden.
In unserem Speisesaal hängt ein Gemälde. Na ja, es hängen mehrere Bilder, Gemälde, wie man sie in einem Speisesaal einer Seniorenresidenz erwarten würde. Ein Teich mit zwei Enten. Ein Gemälde mit Farben, die vielleicht eine Blumenwiese darstellen könnten, und irgendeine Landschaft, die überall sein könnte, wo man schnell vergisst, dass man einmal da war. Aber da hängt auch ein Foto, großformatig, würdevoll gerahmt. Es zeigt eine Küstenlandschaft, und in dieser Küstenlandschaft steht ein VW-Bus, einer dieser Klassiker aus der Zeit, als ich in den besten Jahren war, und ein altes Ehepaar sitzt davor in Campingstühlen.
Manchmal scherzt jemand, die beiden säßen nur da, weil sie nicht mehr ohne Hilfe aus den Sesseln kämen. Oder dass sie dort sitzen, weil sie nicht mehr fahren können. Meistens aber bleibt das Bild einfach unbeachtet. Wahrscheinlich gehört es für viele entweder zu einer Zukunft, für die sie kein Gefäß mehr sind, oder zu einer Vergangenheit, die sie nie hatten. Oder zu Träumen, die so tief schlummern, dass sie bereits vorausgegangen sind und nicht mehr erwachen werden. Man stirbt viele Tode, bevor man wirklich geht. Die Frage ist nicht, wann man stirbt. Die Frage ist: Wann sterben die Träume?
Für mich war dieses Bild, ironischerweise das einzige Foto im Raum, immer ein Traumbild. Es spricht sowohl von Erinnerungen als auch von der Zukunft. Manchmal habe ich mich tagträumend in diesem Bild verloren, während sich der Speisesaal schon wieder leerte. Wie gerne würde ich noch einmal die Welt erobern, Küsten und Horizonte erkunden, den Duft des Salzes einatmen, die Frische des Morgens spüren, ja, einfach unterwegs sein und den Augenblick genießen.
Und manchmal wurde ich sanft oder abrupt aus meiner Betrachtung gerissen, und an einem anderen Tisch saß eine andere Frau, Alma, und ich sah, wie auch sie das Bild betrachtete, oder ich sah, wie sie mich betrachtete, wie ich das Bild betrachtete. Wir lächelten, wir hatten uns beim Träumen ertappt.
Dann kam der Sturm. Er hatte sich seit Tagen verstärkt. Nach einem Abendessen leerte sich der Saal. Da kam Alma auf mich zu. »Lass uns gehen«, sagte sie nur.
Ich sah sie fragend an.
Alma zeigte auf das Bild.
Ich sah sie an und spürte, wie das Licht aus meinem Herzen aufstieg. »Aber wie?«, fragte ich nur.
Sie lächelte.
Almas Enkelin Lida, eine sympathische junge Frau, ledig, war sofort einverstanden. Sie würde uns fahren. Mit ihrer Hilfe kauften wir uns einen VW, genau wie auf dem Foto. Ohne den Sturm wäre das nie passiert, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wir haben es auch dem Sturm zu verdanken, dass es keinen Aufschrei bei unseren Kindern und Enkeln gab, als wir unsere Pläne verkündeten. Wir hatten sie alle eingeladen und ihnen erst einmal nur den VW gezeigt. Dann kam das große Staunen und die Freude. Von unseren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern kam vor allem Kopfschütteln.
Wir gaben unsere Zimmer in der Seniorenresidenz auf und fuhren los, sobald sich der Sturm gelegt hatte. An die Küste, nach Rostock. Die kleinen Fischerboote am Alten Strom und der ikonische Leuchtturm gaben uns das Gefühl, angekommen zu sein. Aber natürlich hatte unsere Reise gerade erst begonnen. Kiel, Flensburg, wieder südwärts nach Bremerhaven, immer an der Küste entlang, in die Niederlande, nach Harlingen, wo das Knarren der Holzboote dem Hafen eine ganz eigene Melodie verleiht, nach Belgien, Brügge wie ein mittelalterliches Gemälde, und jetzt sind wir gerade in Frankreich angekommen, in Calais, und haben vom Cap Blanc-Nez aus die weißen Klippen von Dover wie ein flüsterndes Versprechen schimmern sehen. Aber wir werden nicht übersetzen, sondern weiter an der Küste entlang fahren. Nach Spanien, Portugal, am Mittelmeer entlang nach Italien, weiter, immer weiter, nie eilend, immer verweilend, so weit unser Alter uns noch trägt.
Mit herzlichen Grüßen,
Angela Messner, einst in Berlin
—
Wildschweine in der Nacht. Im Wald. Das war ungefähr der Anfang.
Wenn sie es den Kindern erzählten.
»Wovon ist das der Anfang.«
»Des Abenteuers, das entsteht, wenn die Vergangenheit zur Gegenwart wird.
Wenn sie sich auf dich legt. Wenn sie dich umhüllt.
Wenn sie kommt.
Die Unergründliche, Dunkle.«
—
»Bis zu jenem Tag hatte ich mich nicht erinnern können, je etwas anderes gewollt zu haben als zu sterben. Doch was ich auch tat, es hatte nie geklappt. Nicht, dass ich mich hätte umbringen wollen – ich war ja noch ein Kind –, nein, ich wollte erstillen, schon als kleiner Junge hatte ich es mit Mutproben versucht, was mir zu Hause der zerrissenen Kleider wegen regelmäßig Schelte einbrachte, jedoch nie eine gehörige und damit bedrohliche Tracht Prügel, die mich meiner Sehnsucht ernsthaft hätte näher bringen können.
Bis zu jenem Tag. Als ich ihn hörte. Als ich erkannte, dass ich mich mein kurzes Leben lang nach dem Falschen gesehnt hatte. Bis zu jenem Tag, an dem ich realisierte, dass ich nie hatte sterben wollen, sondern ganz da sein, so sehr, dass es mich nicht mehr gab. Doch dazu musste ich ihn hören.
Ich war damals sieben Jahre alt. Meine Mutter und mein Vater hatten mich in dieses Konzert mitgenommen. Ein weltberühmter Gitarrist würde spielen, hieß es. Ich hatte daran nicht sonderlich Interesse. Gitarrenmusik. Sie war mir recht, um zu tanzen, wenn eine ganze Gruppe aufspielte, mich wild zu gebärden, doch in einem Sessel sitzend einem einzigen Gitarristen zuzuhören? Welche Eltern nehmen einen Siebenjährigen mit in ein Gitarrenkonzert? Doch schon als die ersten Töne erklangen, noch bevor sich der Vorhang ganz geöffnet hatte – wohl, scheint es mir heute, um dem Anfangsapplaus zu entgehen –, da war ich in Einklang mit diesen Klängen, war ich in Einklang mit diesem Mann, der nicht bloß Musik spielte auf seiner Gitarre, sondern daraus Welten zauberte, vertraute und fremde, doch immer überraschend, ja, er entlockte selbst dem Vertrauten das verborgen Göttliche, und so tief und ergreifend. Da hatte ich gefunden, was ich bis anhin gesucht hatte, und ich wollte es nicht wieder verlieren. Ja, ich hatte ein Stück weit mich gefunden und wollte mich nicht mehr verlieren. Ich begann, die Gitarre zu spielen, war ein begeisterter, fleißiger und talentierter Schüler, ging aufs Konservatorium, machte mein Solistendiplom mit Bravour und bin seither in der Welt herumgereist und habe erfolgreich in den großen Konzertsälen gespielt.«
»Und nun bist du hier und erzählst mir unaufgefordert deine ganze Lebensgeschichte«, sagte der Alte, der sich zu dem Jungen gesetzt hatte, während dieser erzählte.
Und: »Was führt dich hierher?«
»Ich suche ihn, diesen Musiker, diesen Klangzauberer.«
»Ach. Wie heißt er denn?«
»Miguel Seda.«
»Ihn hast du damals gehört?«
»Ja. Kennen Sie ihn?«
»Wer kennt ihn nicht? Er war eine Legende, als er noch Gitarre spielte.« Er entzog seinen Blick der Gegenwart und richtete ihn nach damals. Als er zurückkehrte: »Heute ist er nur noch eine Legende.« Dann war er still. Schließlich fragte er: »Und du willst ihn hier finden? Hier in Italien? Und weshalb?«
»Man hat mich im Dorf hierher verwiesen, als ich nach einem Spanier fragte, vielleicht könnten Sie mir weiterhelfen. Sie seien Spanier. Niemand weiß, wo Miguel Seda ist. Vor vielen Jahren ist er verschwunden, von einem Tag auf den anderen. Einige meinten, er sei tot. Andere meinten, der Erfolg sei ihm zu Kopf gestiegen, und er sei wahnsinnig geworden. Jedenfalls weiß niemand, wo er ist, falls er noch lebt. Ich habe lange gesucht, lange geforscht, viele Leute befragt. Man sagte mir, er sei zuletzt hier gewesen. Oder hier irgendwo in der Gegend. Im Dorf kannte man niemanden mit diesem Namen. Also habe ich nach einem Spanier gefragt.« Er wies auf den Alten. »Sie waren die Antwort.«
»Ja«, sagte der Alte nachdenklich, »ein Spanier. Das bin ich auch, wenn man nicht genau hinschaut. Mehr nicht. Diese Menschen. Sie hören etwas von Spanier und schicken dich zu mir. Mein Name ist Samuel Rai.«
»Ich bin Tiago.«
»Warum suchst du ihn?«
»Ich suche einen Lehrer.«
»Ich dachte, du seist ein weltberühmter Gitarrist, der in allen großen Sälen der Welt auftritt?«
»Ich suche nicht das Technische. Ich beherrsche die Technik. Ich suche die Musik. Ihren Zauber. Die Musik ist mir zur Gewohnheit geworden. Ich spiele sie, aber ich spüre sie nicht mehr. Den Geist, die Begeisterung – ich finde sie nicht mehr. Ich erinnere mich an das Gefühl, als ich ihn damals spielen hörte, diese Tiefe und Weite, diese Stille, dieses stille Glück, doch es ist nichts als eine schattenhafte Erinnerung, leiser Nachhall aus längst vergangener Zeit, mehr Legende als Wirklichkeit, so wie auch Miguel Seda immer mehr zur Legende wurde.«
»Und doch liegt dieses Gefühl in deiner Seele und wartet darauf wieder emporsteigen zu können. Ja, er war in der Gegend. Aber das ist lange, lange her.« Der Alte lächelte nicht. Er schaute über die Terrasse auf seinen Olivenhain. »Du bist bei mir an der falschen Adresse.«
—
»Das ist kein Ort, den man einfach mal schnell besucht.«
Diese Ruhe. Der kleine Platz schien sie auszustrahlen.
»Man kann, natürlich. Viele machen das. Schnell nach Assisi. San Damiano», der Mönch deutete mit beiden Handflächen hierher, »die Basilika San Francesco, Santa Chiara. Bumm.« Er klatschte beide Handflächen zusammen. »Und weiter nach Rom. Oder Florenz.« Er zeigte in Richtung Rom. Rechts. Florenz. Links.
»San Damiano ist ein Ort der Fragen. Wer bin ich? Was soll ich tun? Wenn wir uns auf diesen Ort einlassen, wenn wir uns wirklich einlassen, dann kommen die Antworten. Natürlich kommen sie nicht so, wie ihr mich gerade hört«, sagte der Mönch zu der Gruppe junger Erwachsener, die am Rand Platz genommen hatte, »und wahrscheinlich schon gar nicht mit so einem schlimmen Akzent.« Alle lachten. Es störte die Ruhe nicht. Es war ein holländischer Akzent. »Die Antworten kommen ganz anders. Wir hören sie nicht mit den Ohren des Fleisches. Wir sehen sie nicht mit irdischen Augen. Sie kommen von ganz oben, von Gott vielleicht, oder von ganz unten, aus der Kraft der Erde, oder von ganz innen, aus der Tiefe unseres Herzens. Sobald wir genauer und länger hinschauen und uns öffnen, offenbart sich immer eine Geschichte. Dazu müssen wir aber nicht nur auf das Erzählte hören, sondern auch auf das Unerzählte. Die unerzählte Geschichte. Die dennoch da ist. Die Stille erzählt sie. Die Stille, in welcher wir zur Ruhe kommen.«
Clara schaute sich um, aber vor allem hörte sie zu. Sie war am frühen Morgen in der Basilika San Francesco gewesen und hatte das Leben des Heiligen durchwandert. Gegen den Strom der Touristen hatte sie sich dann durch die Porta Nuova aus Assisi herausgearbeitet, vorbei an einem felsigen Zeugen aus etruskischer Zeit, hinunter durch Olivenhaine, entlang der Klostermauer, an deren Seite Kräuter neu gepflanzt worden waren. Vorbei an der Statue des kleinen Mannes, der seine Stadt weltberühmt machen sollte, in seinen Mantel gehüllt, gezeichnet von Wetter und Entsagung, zufrieden lächelnd, obwohl er das alles nie gewollt hatte.
»Diese Erde«, der Mönch deutete auf den Boden, »hat eine Kraft. Dieser Ort ist nicht irgendein Ort. Das wissen – oder spüren – die Menschen seit Jahrtausenden. Schon vor San Damiano war hier ein Ort der Begegnung mit dem Göttlichen. Seit Jahrtausenden. Und so ist es geblieben. Was hat euch hierher geführt? Auch Francesco hatte eine Frage. Vielleicht wusste er nicht, wie er sie in Worte fassen sollte. Am Anfang wusste er nicht einmal, dass er eine Frage hatte. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, dass sie ihn hierher getrieben hatte. Hierher, an diesen Ort, wo vor achthundert Jahren eine kleine, verfallene Kirche stand. Und wie wir alle wissen, erhielt er eine Antwort. Vielleicht hat er es falsch verstanden, er meinte, er solle das Kirchlein wieder aufbauen, als das Kreuz zu ihm sprach und sagte: Baue meine Kirche wieder auf. Nun, das war nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn man ein sprechendes Kreuz missversteht.«
Wieder lachten alle. Eine junge Frau fragte den Mönch: »Warum hat er das Kreuz missverstanden?«
»Wie heißt du?«
»Olivia.«
»Olivia, das ist ein schöner Name. Der Name ist die dritte Gabe, die wir erhalten.«
»Was sind die ersten beiden?«, fragte ein junger Mann schnell.
»Nun, es gab eine Zeit in den Bäuchen eurer Mütter, als das Herz zum ersten Mal zu schlagen begann. Scheinbar aus dem Nichts. Dieser Herzschlag war das erste Geschenk, und wir erhalten es seit jeher immer, solange wir leben. Es war, so könnte man sagen, das Geschenk des Lebens. Und was haben wir nach der Geburt als erstes getan? Wir haben eingeatmet.« Er atmete einmal tief durch und breitete dabei die Arme ein wenig aus. »Damit sind wir voll und ganz in die Welt eingetreten. Das zweite Geschenk. Aber diese Welt ist eine Welt der Liebe, der Verbundenheit. Deshalb das dritte Geschenk, und das habt ihr von euren Eltern bekommen.«
Er blickte in die Runde und alle lächelten.
»Zurück zu dir, Olivia«, sagte er. »Warum hat er das Kreuz missverstanden? Nun. Ihr seid doch aus Amerika, oder?«
»San Francisco.«
»Da haben wir eine schöne Verbindung. Das Leben ist aus vielen solchen Verbindungen gewoben. Und wenn man sie bemerkt, und dazu muss man die Welt sehr genau lesen, dann scheinen sie zufällig zu sein. Weißt du, Olivia, wie konnte Francesco wissen, dass Gott Großes mit ihm vorhatte? Dass er dazu bestimmt war, die Welt zu verändern? Er konnte es nicht wissen. Heute vielleicht, wenn die Leute eine Idee haben, dann denken sie, sie müssen damit gleich die Welt verändern oder sie zumindest in die Welt hinausposaunen. Aber Francesco hatte keine Idee, nein, er hatte viel mehr als eine Idee, er hatte eine Vision. Und er begann, diesen Ort zu verändern. Nur diesen Ort. Er begann genau hier, wo er stand. Ohne die Absicht, damit die Welt zu verändern. Und er hat sie damit verändert.«
»Aber Gott hat nichts Großes mit uns vor.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte der Mönch ernst und heiter zugleich. »Weißt du, Olivia, ich kann es dir nicht beweisen, aber ich glaube, wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Manchmal werden wir beschenkt, ohne es gleich zu merken. Und manchmal werden wir zum Geschenk, ohne es zu merken.«
Clara hatte sich in der Nähe auf eine Steinstufe gesetzt und hörte mit. Der Mönch blickte kurz zu ihr hinüber, lächelte und wandte sich wieder der Gruppe zu.
»Und wenn ihr jetzt durch das Gebäude geht, dann schaut nicht nur auf die paar alten Mauern und die zugegebenermaßen sehr schönen Malereien. Schaut mit eurem Herzen. Mit eurem ganzen Sein. Nehmt euch Zeit. Es geht nicht schnell, wisst ihr. Wenn ihr zu schnell geht, verpasst ihr das Leben. Und wenn ihr eine Frage habt, wird die Antwort kommen. Ich danke euch, dass ihr hier seid, und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt in Assisi.«
Clara sah, wie die junge Frau, die vorhin gesprochen hatte, Olivia, auf den Mönch zuging, während die anderen im Eingang der Kapelle verschwanden. Sie war eine hübsche junge Frau, ihr dunkelblonder Bobschnitt betonte den weichen Kiefer und gab ihrem Lächeln, wie Clara wusste, den richtigen Raum: etwas behütet und doch offen.
Clara kannte diese strahlende Unaufdringlichkeit von den seltenen Models, die nicht im Mittelpunkt stehen wollen und doch alle Blicke auf sich ziehen. Diese Art von Schönheit zieht die Blicke auf sich, weil sie nichts nach außen projiziert, was den Blick vom Verweilen abhalten könnte. Viele Models tragen ihre Schönheit wie eine Rüstung. Hier aber wird der Blick wie von einer samtenen Textur empfangen, die ihn aufnimmt, ihn umfängt, ihm Wärme und Berührung schenkt. Diese Frauen sind die wahren Ikonen der Modewelt – und ja, der Welt, war sich Clara sicher –, Frauen, deren strahlende Schönheit nichts von ihrem Inneren verbirgt, weil sie ganz natürlich ist, nichts ist zu viel, kein Akzent ist zu stark, nichts ist aufgesetzt, gekünstelt oder auch nur im Geringsten unnatürlich.
Der Mönch und die junge Frau sprachen leise miteinander. Die junge Frau blickte traurig zu Boden. Er lächelte, sprach ihr zu, machte ihr das Kreuzzeichen auf die Stirn.
Es wäre ein einmaliges Foto geworden. Clara schaute weg. Das war zu persönlich, zu intim für eine Zuschauerin.
Sie stand auf und ging auf den bronzenen Francesco zu. Sie würde den anderen einen Vorsprung lassen und dann den Rundgang durch das Kloster machen.
Sie sah nicht mehr, wie der Mönch die Hand der jungen Frau nahm und etwas hineinlegte. Aber sie spürte, dass die junge Frau und die ganze Szene sie an eine Schönheit erinnerten, die sie in ihrem Alltag fast vergessen hatte.
Sie spürte, wie sich eine Entscheidung ihren Weg bahnte.
—
»Du bleibst noch etwas weg? Du kannst nicht länger wegbleiben! So war das nicht abgemacht.« Die Stimme am anderen Ende sprach schnell und klang schrill. »Wir brauchen dich hier! Was sollen wir unseren Kunden sagen?«
»Sag ihnen, dass ich krank bin«, sagte Clara.
»Krank? Das gibt es doch gar nicht in Roms Modewelt! Weißt du, wie viel Geld wir verlieren, wenn du aus einer Laune heraus aus einem Tagesausflug einen spirituellen Wellness-Urlaub machst, anstatt die Schönsten der Schönen noch schöner in Szene zu setzen? Du kommst zurück nach Rom!«
»Hör zu. Das mache ich nicht und du kannst mich nicht umstimmen.«
»Deine Reise war wohl etwas zu spirituell! Nimm dir einen Tag frei, habe ich gesagt. Einen Tag! Jetzt schwing deinen wundervollen Hintern in dein Auto und komm zurück! Wir haben morgen früh einen Termin, das muss ich dir nicht unter die Nase reiben, oder?«
»Mach dir keine Sorgen.«
»Ich soll mir keine Sorgen machen? Entspann dich, sage ich. Schalt mal ab, sage ich. Also machst du einen Tagesausflug nach Assisi. Wunderbar. Und jetzt eröffnest du mir, dass du noch ein paar Tage weg bleibst. Was hast du denn vor? Heilig werden?«
»Du verstehst nicht, ich bleibe noch weg. Ich bin die Chefin und du regelst das für mich.«
Sie beendete das Gespräch.
Schatten wurden länger.
—
Er hatte den oberen Weg in Richtung der Basilika San Francesco genommen. Während die letzten Touristen durch die Hauptgasse lärmten, schlenderte Angus durch goldenes Licht der untergehenden Sonne entgegen. San Francesco entgegen.
—
»Tja, dann gehe ich mal wieder«, sagte Tiago und stand auf. »Danke für das Wasser.«
»Keine Ursache«, knurrte der Alte und winkte ihn mit dem Handrücken weg.
»Es wird Abend. Ich ... geh dann also«, sagte Tiago noch einmal und drehte sich zögernd um.
»In Ordnung.«
»Ich werde mich schon nicht verlaufen, falls es dunkel wird, bevor ich das Dorf erreiche.«
»Wirst du nicht. Einfach immer geradeaus.«
»Danke.«
»Immer noch keine Ursache.«
Tiago wandte sich zum Gehen, als er sich nochmals umdrehte und zum Tisch zurück kam. »Meine Gitarre.« Lächelte verlegen und nahm den Koffer. »Die brauche ich vielleicht noch.«
»Vielleicht. Sicher ein sehr wertvolles Instrument.«
»Oh ja. Es ist von einem Meisterbauer aus Spanien. Eine ... Meistergitarre also.«
»Na dann achte mal darauf, dass sie ganz bleibt, wenn die Wildschweine kommen.«
Tiago stockte. »Wildschweine?« Er blickte sich ängstlich um. »Was für Wildschweine?«
»Na die, die kommen, wenn es dunkel wird und du noch nicht im Dorf bist.«
Tiago lachte nervös. »Ja, dann geh ich lieber schnell.«
»Ja.«
»Ich meine, es wäre schade um die Gitarre.«
»Das wäre es sicher.«
»Vor allem, weil sie so speziell ist. Eine Zwillingsgitarre.«
Der Alte horchte auf. »Was ist denn eine Zwillingsgitarre?«
»Sie hat einen Zwilling. Der Gitarrenbauer baute zwei gleichzeitig, aus demselben Holz. Er sagte: Wissen Sie, hatte er damals zu mir gesagt, ich werde es nie vergessen, eine gute Gitarre wird nicht hergestellt, sie muss wachsen. Sie wächst, und gleichzeitig wächst unsere Beziehung. Sie wächst, indem ich mich auf sie einlasse, so sehr, dass ich, ohne etwas zu suchen, etwas finde, das größer ist als ich selbst; in jedem Stadium des Wachstums manifestiert sich etwas, das größer ist als ich. Man nennt mich zwar einen Gitarrenbauer, doch ich bin vielmehr Zeuge der Entstehung und Liebhaber der Gitarre zugleich, als dass ich sie bauen würde. Ich liebe mein Handwerk, ich liebe das Holz, dessen Verarbeitung, die Formen, das Zusammenfügen, den Lack ... und den Klang. Jede Gitarre ist anders. Jede Gitarre hat ihren eigenen Klang, schon bevor ich das Holz auswähle, unhörbar zwar, doch spürbar.«
»Das hatte er gesagt?«, fragte der Alte.
Tiago stutzte und blickte auf die länger werdenden Schatten. »Ich glaube, ich gehe besser.«
»Du hast mir noch nicht erzählt, was das mit der Zwillingsgitarre zu tun hat, Tiago. Setz dich doch. Du hast noch Zeit. Ich interessiere mich sehr für Handwerk.«
Tiago zögerte. Der Alte machte eine einladende Geste.
»Weißt du, Olivenölherstellung ist auch ein Handwerk. Und eine Kunst. Das begreifen nur wenige. Und für die meisten, die es begreifen, ist es eine Kunst, die nur wenige verstehen. Mir scheint, dein Gitarrenbauer war auch ein Handwerker und ein Künstler, und er hat etwas verstanden. Das interessiert mich.«
Tiago trat wieder zum Tisch und stellte seine Gitarre ab. »Meinen Sie, ich habe noch genug Zeit?«, fragte er und blickte zur Sonne, die sich bereits deutlich dem Horizont näherte.
»Zeit ist immer genug. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, da soll sich das auch lohnen. Erzähl mir mehr.«
»Nun ja.« Sagte Tiago, als er sich wieder setzte. »Der Gitarrenbauer sagte zu mir: Jede Gitarre beginnt mit dem Ruf dieses Klanges, ich spüre ihn und lasse mich von ihm leiten. Spüre ich diesen Klang nicht, beginne ich nicht. Früher hatte ich diesen Fehler noch gemacht, ohne den Ruf des unhörbaren Klanges zu beginnen, lachte er, aber man ist ja auch mal jung und stürmisch. Später war es dann auch andersrum: Ich spürte den Ruf, war aber zu beschäftigt mit anderen Dingen, oder zu eigensinnig, und je länger ich dem Ruf nicht folgte, desto unzufriedener wurde ich, dann gehässig, dann aggressiv und reizbar, und schließlich teilnahmslos, als würden der Ruf und die formlose Gitarre in mir zu verrotten beginnen, und diese Dämpfe des Vermoderns fingen an, meinen Geist zu vergiften, und durch mich meine Umwelt, meine Beziehungen, bis ich dem Ruf Folge leisten würde und der Gitarre ermöglichte, durch mich Form anzunehmen.«
Der Alte lauschte.
»Es ging mir dann auch jeweils schnell wieder besser, besser und gut und sehr gut. Doch manchmal ist man einfach zu dumm, dem Offensichtlichen zu folgen, lachte er, man hat seinen eigenen kleinen Willen, nicht wahr? Na ja, hatte er gesagt, das legte sich bei mir. Ich folge dem Ruf, ich habe keine Wahl, und es stört mich nicht, dass ich keine Wahl habe, denn ich liebe es, diesem Ruf zu folgen.«
»Ah!«, sagte Samuel: »Ah.« Und als Tiago schwieg: »Gibt es noch mehr zu erzählen? Die Zwillinge?«
Tiago war eine Weile still. »Er hat nie viele fertige Gitarren bei sich. Zwei, drei, höchstens vier. Als ich zu ihm kam, in jenes spanische Städtchen, ich musste seine Werkstatt suchen in den verwinkelten Gässchen, und von außen war sie kaum zu erkennen, inmitten der Steintreppen eines kleinen Innenhofes war der Eingang. Als ich kam, waren da drei Gitarren. Ich durfte sie spielen, so lange ich wollte, und er saß bei mir, hörte zu, nickte und lächelte. Drei Tage war ich bei ihm. Als ich mich am dritten Tag für diese Gitarre entschied, die mich seitdem durch mein Leben begleitet, strahlte er. Und er sagte: Diese Gitarre ist etwas ganz Besonderes, junger Mann. Etwas ganz Besonderes. Sie hat ein Geschwister. Und auf meinen fragenden Blick: Ja, ein Geschwister. Einen Zwilling, sozusagen. Wissen Sie, wie ich sagte, ich baue jeweils nur an einer Gitarre, von Anfang bis Ende. Doch mit dieser Gitarre war es anders. Ich hörte einen anderen unhörbaren Klang – oder waren es zwei unhörbare Klänge gleichzeitig? Zwei Musiken gleichzeitig? Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben! Aber ich wusste – ich wusste! –, dass ich zwei Gitarren gleichzeitig bauen würde, wie Geschwister, wie Zwillinge, nicht identisch, aber aus demselben Holz! Und wissen Sie, was passierte? Sie wuchsen nicht nur gemeinsam, sie beeinflussten ihr Wachstum gegenseitig, es war, als würden sie sich selbst gegenseitig inspirieren und sich gegenseitig zum Geschenk zu machen! Er lachte begeistert und klopfte sich dazu auf den Schenkel. Und die andere Gitarre, hatte ich gefragt, wo ist sie? Wer hat sie gekauft? Das, junger Mann, das sollte ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Sie wurde schon vor einiger Zeit verkauft, und es schien ihre Bestimmung, lange ungehört zu bleiben. Und ich bin sicher, falls die zwei Gitarren sich wieder begegnen sollen, dann würden sie es tun. Sie werden zusammenfinden und gemeinsam erklingen, wenn es sein soll. Und es wird eine unerhörte Musik erklingen wie ein Wind, der durch die Herzen der Zuhörer weht, sie bewegt ohne eine Spur zu hinterlassen, ja, so werden sie klingen, als klingende Gegenwart der leuchtenden Stille. So hatte er gesprochen, ich sage es Ihnen!«
»Hm.« Sagte Samuel: »Hm.« Leise lächelnd. »Ein Poet noch dazu.«
»Interessant, nicht wahr?«, fragte Tiago.
»Ja, sehr interessant. Wie er nicht hinausgeht, und doch finden die Gitarren in die Welt. Sehr interessant.«
»Ich meinte das mit der Geschwistergitarre?«
»Hm? Ja«, meinte Samuel. »Sehr interessant«, mit den Gedanken scheinbar an einem ganz anderen Ort.
»Ich sollte jetzt wirklich gehen«, sagte Tiago plötzlich und stand hastig auf. Der Schatten hatte den Tisch erreicht.
»Danke für die Geschichte. Und viel Glück.«
—