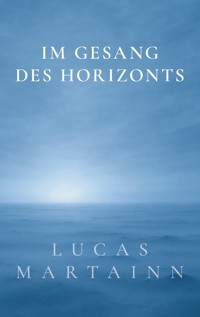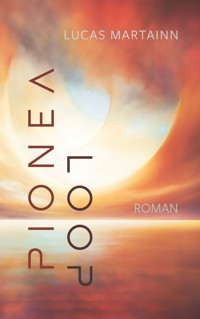
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fragment Eight Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist das Paradies, wenn man darin gefangen ist? Eigentlich sollte es nur ein kurzer Ausflug werden für Jay und Alan, zwei Freunde auf Sinnsuche, Liya und Raya, zwei ungleiche Zwillingsschwestern, Saskia und Jarne, ein frisch verheiratetes Paar, und Pionéa, die ihren Freund Angus treffen will. Doch obwohl beide zur verabredeten Zeit am vereinbarten Ort sind, finden sich Angus und Pionéa nicht. Statt den abgelegenen Küstenstreifen Korsikas wieder verlassen zu können, müssen sich die Sieben mit einer ganzen Reihe unerklärlicher Ereignisse auseinandersetzen. Als sie endlich in die Welt zurückfinden, bietet diese ihnen kein Zuhause mehr. Der Versuch, in ihr Leben zurückzukehren, entwickelt sich zu einer dramatischen, spannenden und epischen Reise, bei der die Kraft des Erzählens die entscheidenden Brücken baut. Der erste Band der Pionéa-Reihe bietet eine Erzählung voller unerwarteter Wendungen, die tiefe Verknüpfungen, verborgene Zusammenhänge und ein vielschichtiges, ja mehrdimensionales Bild des Lebens zeichnet. Eine Geschichte wie ein Boot, das zu neuen Horizonten aufbricht und die alte Welt mit einer neuen verbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
TEIL 2
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
TEIL 3
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Epilog
Nachwort
TEIL 1
Oh
Release a little piece of my hoping
Away into the wild and free
– Dave Thomas Junior, Little Piece of Nothing
Er verschwand nie vollständig und kehrte immer wieder zurück. An jenem Morgen ging Lobsang aus dem Haus und sah ihn von den Bergen herabsteigen, nachdem er die Sommermonate, so weit von der Welt entfernt wie nur möglich, auf den höchsten Gipfeln verbracht hatte.
Als Vorbote dampfte Lobsangs stiller Seufzer. Er blickte zur Schule hinüber. Sie stand auf der Höhe seines Hauses, auf der anderen Seite der Felder. Er brauchte den Kindern nicht beizubringen, auf Englisch zu fragen, wann der Bus käme. Niemand wusste es. Er würde zu seiner eigenen Zeit kommen, unten im Tal, zwei Stunden Fußweg vom Dorf entfernt.
Lobsang war auch der Fremdenführer, die wenigen Male im Jahr, wenn jemand den Weg ins Dorf fand. Wenn Touristen kamen, nahmen sie die knappe Stunde zu Fuß vom Kloster Rhizong auf sich, um den Mutterbaum zu sehen. Älter als Buddha sei dieser, erzählte Lobsang dann den Reisenden vor dem gewundenen, knorrigen Baum.
Jeden Morgen, wenn er aus dem Haus in die Kälte trat, ging er zum Mutterbaum, anstatt den direkten Weg zur Schule zu nehmen. Es war kein Umweg, es war der richtige Weg. Ihn zu berühren bringe ein gutes Leben, erzählte er den Reisenden. Das war kein Slogan für eine Touristenattraktion. Seine Mutter hatte es ihm erzählt. Und seine Großmutter. Jeden Tag seines Lebens hatte er den Mutterbaum berührt, außer in den Jahren, als er in Dharamsala zum Lehrer ausgebildet wurde. Damals hatte er vor seiner Abreise die Hand auf die uralte Rinde gelegt. Das bedeutet, du wirst eine gute Reise haben und gut zurückkehren. Hatte seine Mutter gesagt. Und es hatte sich bewahrheitet.
Aber von den Touristen, die den Mutterbaum berührten, kam keiner je wieder.
Lobsang blickte hinauf zu den Gipfeln, die das Tal und das Dorf umgaben. Dieses Jahr kommt niemand mehr, dachte er und blickte auf die frisch verschneiten Berghänge, und wenn sich doch noch jemand hierher verirrt, wird er nicht bleiben. Sie kamen immer nur kurz, die Reisenden, und niemand ließ sich je überreden, hier einen Winter zu verbringen.
Während der Schnee jeden Stein, jedes Haus und jedes Leben in seine Stille hüllt, werde ich in der dunklen, rußgeschwärzten Küche am Ofen sitzen, Yakdung verbrennen und leise innere Monologe halten.
Denn auch die Kinder, die er unterrichtete, würden an ihren Öfen ausharren und im Frühling mit schwarzen Wangen aus den Häusern kommen und in die erste Sonne blinzeln, die es über den Bergkamm schaffte.
Lobsang entließ eine weitere Dampfwolke in die Leere vor ihm.
Noch war es still. Bald würde die Schulglocke läuten und ihr Klang das Tal erfüllen. Dann würden die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner mit ihrem Gesang das Dorf und die Felder zum Klingen bringen. Sie lieferten sich ein Wettrennen mit dem herabsteigenden Schnee. Die Zeit für die Ernte war knapp. Es war ein Wettlauf um Leben und Tod. Doch von dieser Dringlichkeit war in der Melodie nichts zu hören. Sie war einfach und kurz, wiederholte sich immer und immer wieder. Sie lud die guten Geister ein und vertrieb die bösen.
Alles wiederholte sich in diesem von der Welt abgeschnittenen Dorf. Jahr für Jahr. Leben um Leben.
Doch heute war es anders.
Lobsang ließ seinen Blick zum Mutterbaum schweifen. Doch bevor er dessen rot leuchtenden Blätter erreichen konnte, stoppte ihn etwas Gelbes in einem der Felder. Er konnte nicht erkennen, was es war. Daneben etwas Rötliches. Das kannte er.
Lobsang setzte sich in Bewegung.
Tenzin, der sechsjährige Novize, stand regungslos da. Ein Besucher hatte ihm eine rote Wollmütze geschenkt, die zu groß für seinen kahlen Kopf war und ihm bis über die Augenbrauen rutschte. Die Dorfbewohner nannten ihn schon jetzt den kleinen Lama. Im Kloster erhielt er seine buddhistische Ausbildung. Dreimal in der Woche nahm er den Weg vom Kloster hierher auf sich, um mit den Kindern des Dorfes in die Schule zu gehen. Hier lernte er Englisch und Mathematik. Lobsang bereitete ihn auf die weite Welt vor. Das zischende Orakel hatte vor seiner Geburt vorausgesagt, dass er gleich zweimal in die weite Welt ziehen würde.
Doch nun stand er neben dem leuchtend gelben Objekt und war kaum größer als dieses. Lobsang hatte seine Schritte beschleunigt.
»Was hast du da?«, fragte er, als er in Hörweite war.
Tenzin drehte sich um, lächelte, als er seinen Lehrer erkannte, und hob dann sowohl die Schultern als auch die Augenbrauen.
»Ein Flugzeug muss es fallen gelassen haben«, sagte Tenzin, als Lobsang ihn erreichte. Er ließ seinen kurzen Arm langsam von oben nach unten gleiten, als wäre es langsam gefallen.
Lobsang berührte den gelben Körper. »Kunststoff.« Er klopfte darauf. »Hohl.« Er ging prüfend darum herum. Kein Fallschirm.
»Das hat kein Flugzeug abgeworfen. Sonst wäre es zerbrochen. Ein Hubschrauber, der das hier abgesetzt hätte, hätte das ganze Tal aufgeweckt.«
»Ist das ein Behälter? Kann man es öffnen und es ist etwas drin?«
»Nein.«
»Was ist es dann?«
»Das ist eine Boje. Aus dem Meer.« Nicht, dass Lobsang jemals selbst eine Boje oder das Meer gesehen hätte. »Siehst du das hier?«
Lobsang deutete auf Verkrustungen am schmalen Ende, wo die Boje in einen Ring auslief. »Das ist Salz. Hier haben sie die Boje mit einer riesigen Kette im Meeresboden verankert. Und hier«, Lobsang ging mit Tenzin zum oberen, breiteren Ende, »ist die Boje von der Sonne ausgeblichen.« Er zeigte auf weißliche Schmiere. »Und das ist ...«
»Vogelkacke«, sagte Tenzin sachlich.
Sie schwiegen.
Gut beobachtet. Nichts war zu gewöhnlich, um Wahrnehmung und Verstand zu schulen. Schon gar nicht eine Boje, die eines Morgens unversehrt im Geröll am höchsten Ende der Welt lag.
Schließlich sagte Lobsang: »Tenzin, geh und läute die Glocke. Und dann bring alle Schüler her.«
Tenzin stand stumm bei der Boje. Lobsang sah ihm an, dass der kleine Mönch versuchte, der ganzen Situation einen Sinn abzugewinnen.
»Tenzin!«
Tenzin schüttelte kurz den Kopf und eilte dann zur Schule hinauf. Die erste Morgensonne hatte die Glocke erreicht. Ein Schmetterling saß darauf, um sich zu wärmen. Tenzin betrachtete ihn interessiert, doch dann fiel ihm ein, dass er eine Aufgabe hatte. Er nahm den dicken Holzstab und schlug zuerst ganz sanft gegen das Metall. Der Schmetterling begann mit dem fast unhörbaren Klang zu vibrieren. Ob ihn das erwärmte? Er bewegte seine Flügel und flog davon. Tenzin lachte, schaute, lachte, als der Schmetterling höher und höher flog und am blauen Himmel verschwand. Tenzin winkte ihm nach.
Dann läutete er die Glocke.
Ihr Klang erfüllte das ganze Tal.
—
Die Glocke läutete vom Dorf hinüber. Ihr Klang verschmolz mit der Frauenstimme und dem Nebel. Der Junge saß vorne im Boot und blickte über den See in das endlose Grau. Sie waren an diesem Sonntagmorgen zum Fischen hinausgefahren. Das dunkle Wasser ruhte still.
»Wie geht es weiter?«, sang er mit seiner klaren Stimme, fünf Silben, zwei Töne.
Die helle Frauenstimme antwortete von hinten. »Sie bauen eine Brücke aus Träumen.«
»Wie geht es weiter?«, sang er wieder, fünf Silben, zwei Töne. Die Antwort war voller Liebe.
»Sie reist zu ihm, so schnell sie kann.«
Er lächelte. Gestern noch war er so verzweifelt gewesen wie noch nie in seinem sechsjährigen Leben. Er hatte im Wald hinter dem Haus gespielt. Er war auf einen Baum geklettert und heruntergefallen. Direkt in den Bach. Ein Bach mit wenig Wasser und vielen Steinen, die sich ihm in den Rücken drückten und ihm beim Aufprall den Atem raubten. Er lag reglos in der Kälte, die ihn umgab, und konnte eine gefühlte Ewigkeit nicht atmen. Nur seine Augen konnte er bewegen. Er sah den Ast über sich. Das Sonnenlicht, die Blätter und der Wind spielten miteinander, als ginge sie seine Lage nichts an, oder als seien sie zuversichtlich, dass alles auch ohne ihre Hilfe gutgehen würde. Auf der anderen Seite des Baches sah er den mit Farnen bewachsenen Hang. Die Farne standen still und gaben keinen Kommentar zu dem Geschehen ab. Als er seine Augen zur Seite bewegte, glaubte er, bachabwärts eine Frau mitten im Wasser stehen zu sehen. Das Wasser kräuselte sich gegen die Strömung von ihr zu ihm hin. Hörte er sie flüstern? »Atme, mein Sohn.« Er erschrak. Das weckte ihn aus seiner Starre. Er atmete ein. Es fiel ihm schwer, als läge ein Gewicht auf ihm. Beim Ausatmen gab er einen Laut von sich, der ihn erschreckte. Wie ein sterbendes Tier. Wieder einatmen, diesmal etwas leichter. Wieder der Laut. Das dritte Einatmen fiel ihm noch leichter. Er konnte seine Finger bewegen. Er konnte seinen Kopf dorthin drehen, wo er die Frau gesehen hatte. Da stand keine Frau. Langsam drehte er sich auf die Seite. Stöhnend richtete er sich auf. Er fand das Gefühl in seinen Beinen und den Boden unter den Füßen. Er rappelte sich auf und stieg verkrümmt aus dem Bach. Er setzte sich ans Ufer und atmete jetzt schnell. Sein ganzer Rücken schmerzte. Eigentlich sein ganzer Körper. Er fror. Er zitterte.
Angus kletterte den Hang hinauf. Als er sich auf dem Waldweg nach Hause schleppte, dämmerte es bereits. Seine Mutter wartete vor dem Haus und lief auf ihn zu. Sie kniete sich zu ihm, fasste ihn an den Schultern und prüfte ihn mit ihren Blicken. Dann nahm sie ihn in die Arme. Sie war warm und roch nach Mommy. Sie hob ihn hoch und trug ihn ins Haus. Er weinte in sie hinein.
Später, nach einem warmen Bad, einer heißen Suppe und seinen zögerlichen Erzählungen am Tisch, denen seine Mutter und sein Vater aufmerksam zuhörten, lag er im Bett. Seine Mutter saß am Bettrand.
»Mommy?«, flüsterte Angus leise.
»Ja, Angus?«
»Ich werde nie mehr weggehen. Ich werde immer bei dir bleiben. Das verspreche ich dir.«
Seine Mutter lächelte und nahm seine beiden Hände in ihre. Sie waren warm und fest. Mommy sagte ernst: »Angus Eoin O’Donohue. Geh hinaus und entdecke die Welt. Du wirst immer den Weg nach Hause finden. Und ich werde immer da sein.«
Sie lächelten sich an.
»Wie geht es weiter?«, sang Angus leise.
»Mit dem Himmel unter deinen Füßen blickst du auf die Ahnenkette des Lichts«, sang seine Mutter leise und so hell, dass die Nacht für einen Moment nicht mehr dunkel schien. Und wie jeden Abend sagte sie: »Möge dich nun der Gott der Träume besuchen und dir die Schönheit aller Welten zeigen.« Sie küsste ihn auf die Stirn und deckte ihn ganz zu. »Schlaf gut.«
Er hatte tief geschlafen. Jetzt sangen sie ihr Lied auf dem kleinen Fischerboot des Vaters, das schon seinem Vater gehört hatte und nach ihm benannt war. Der Name des Bootes, Seaghán, schrieb sich in verblassenden gelben Lettern hell auf das dunkle Wasser. Sie könnten ewig weiter singen. Seine Mutter würde eine Geschichte singen, solange er fragte.
»Wie geht es weiter?«, sang er auf den See hinaus. Fünf Silben, zwei Töne.
Stille. Leise plätscherte das Wasser gegen das Boot. Angus hörte seinen Herzschlag.
»Wie geht es weiter?«, sang er noch einmal. Seine Stimme zitterte ein wenig.
Keine Antwort. Angus spürte, wie sein Herz schneller schlug. Er drehte sich um. Am anderen Ende des Bootes stand sein Vater. Sein Gesicht war weiß wie der Nebel selbst.
»Sie hat sich einfach aufgelöst«, flüsterte der Vater fassungslos und sah ihn mit offenem Mund an.
»Wo ist Mommy?«
»Sie hat sich aufgelöst. In Luft.«
»Ist sie über Bord gefallen?«
»In Luft! Einfach aufgelöst! Durchsichtig geworden und weg. Weg!«
»Mommy! Mommy? Wo bist du?«, rief Angus und beugte sich über das Boot. Unter ihm nur das Spiegelbild eines verängstigten Jungen im unberührten schwarzen Wasser. Die Augen weit aufgerissen.
»Mommy!«
»Aufgelöst! Angus!« Die Stimme schrie. Dunkel und grell. Panik und Wut. »Angus!«
Kapitel 1
»Angus?«
Angus kam mit einem Einatmen aus seiner Versenkung zurück.
Clara lächelte.
Er saß in einem der Cafés auf der Piazza del Comune der kleinen Weltstadt Assisi. Goldenes Sonnenlicht malte die Hauptgasse in die Schatten, die sich auf die Piazza legten. Die Touristenströme waren weitergezogen, hatten die Gassen wie ausgetrocknete Flussbetten zurückgelassen, die Piazza wie einen trockengelegten See fernab der Geschäftigkeit des Tages. In der Nähe läuteten die Glocken von Santo Stefano wie eine Insel der Gelassenheit.
Am Tisch neben ihm saß eine Frau. Ihre dunklen Augen und ihr schwarzes Haar passten perfekt zu ihrem olivgrünen Kleid. Sie schien in Gedanken versunken.
»Entschuldigung«, sagte Angus nach einer Weile. Die Frau blickte auf. »Ich möchte Sie wirklich nicht stören. Aber ich habe Sie schon eine Weile so sitzen sehen. Und ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht ein wenig reden möchten.«
Die Frau zog eine Augenbraue hoch. »Sie haben mich beobachtet?«
»Um Himmels willen, nein. Nicht beobachtet. Bemerkt. Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Sie lächelte. »Wenn Sie möchten.« Eine einladende Hand.
Angus nahm seinen Stuhl, trat zwei Schritte an den runden Tisch und setzte sich zu ihr.
»Mein Name ist Angus. Angus O’Donohue.«
»Ich bin Clara. Clara Rai. Woher kommen Sie?«
»Ich reise viel. Ich bin nirgendwo und an vielen Orten zu Hause. Ursprünglich komme ich aus Irland.«
»Das habe ich mir gedacht. Man hört es. Und der Name. Ist Reisen Ihr Beruf? Reisejournalist? Ich habe Sie vorhin etwas notieren sehen.«
»Dann haben Sie mich auch bemerkt.«
Clara lächelte.
»So etwas in der Art, ja«, sagte Angus. »Aber ich schreibe keine Reiseführer. Ich schreibe über Orte und über Menschen. Über das Glück, berührt zu werden und berührt zu sein. Über das Bedürfnis, sich einzufinden. Und über die Sehnsucht nach Verlässlichkeit. Kurz: Ich reise, um zu erforschen, was Heimat bedeuten kann.«
»Wow. Heimat. Da sprechen Sie einen Kern in mir an. Nach einer Minute.«
Und schon sind wir mitten in einem dieser Gespräche, wie sie nur in Assisi stattfinden können, lächelte Angus. Hier kann man sich nicht fremd sein. Nicht einmal sich selbst.
»Sie werden über mich schreiben?«, fragte Clara unsicher.
»Deshalb habe ich Sie nicht angesprochen. Schreiben ist nie die Motivation. Schreiben ist der Versuch einer Integration.«
»Ich wiederhole mich: Sie sind ein Mann der Worte.« Sie wandte sich näher zu ihm hin. »Heimat. Und doch sind Sie auf Reisen. Erzählen Sie mehr, wenn Sie wollen.«
Angus hatte den Eindruck, dass sie sich entschlossen hatte, sich auf das Gespräch einzulassen, indem sie die Führung übernahm. Zumindest für den Moment. Er ging gerne darauf ein. »Ich glaube, ich bin in gewisser Weise ein Forscher.«
»Welche Frage treibt Sie an?«
»Es ist keine Frage. Eher eine These: Heimat ist da, wo sich Kreise schließen. Persönlich relevante Kreise.«
Clara schwieg. »Wenn sich Kreise schließen ...« Sie ließ es wirken. »Ist das ein Ankommen?«
»Ankommen, ja. Und sich einfinden. Dem Ankommen geht ein Weg voraus. Dem sich Einfinden eine Suche.«
»Sind Sie sicher, dass Sie kein Philosoph sind? Oder Dichter?« Clara sah Angus interessiert an, als betrachte sie jemanden, der ihr vertraut und gerade von einer großen Reise zurückgekehrt war.
Angus lächelte. »Wo ist die Grenze? Ich stamme aus einer langen Linie von Geschichtenerzählern und Geschichtenerzählerinnen. Jeder Ort, den ich besuche, hält ein Geschenk für mich bereit. Das war schon immer so. Und das Geschenk von Assisi, das war etwas ganz Besonderes. In Assisi ist das Geschenk immer eine Begegnung.«
»Immer? Sie waren schon oft hier?«
»Viele Male. Mich interessieren Orte mit einer vielschichtigen Geschichte. Und es gibt kaum einen Ort, der so voller unlösbarer Widersprüche ist wie Assisi. Diese unauflösbare Reibung ist es, die eine kreative Spannung erzeugen kann.«
»Das spüre ich auch«, sagte Clara und nickte. Dann schaute sie Angus tief in die Augen. »Verraten Sie es mir? Ihr Geschenk?«
Angus lächelte und atmete einmal kräftig ein und aus. Es waren wunderbare Augen, die ihn sahen. Sie sprachen von Sanftmut, aber auch von Entschlossenheit. Und von Verlust.
»Es ist nicht so, dass ich ein Geschenk erwarte oder suche. Ich denke nicht einmal daran. Auch nicht vorhin, als ich in der Abendsonne durch die abgelegenen Gassen der Sonne entgegen spazierte. Ich kam von oben zur Basilica San Francesco, nicht durch die Hauptgasse. In diesem Moment senkte sich die Sonne auf die Kirche zu. Bald würde sie dahinter verschwinden. Der Augenblick ruhte in sich. Die untergehende Sonne, die länger werdenden Schatten, der schwache Nebel im Tal, die Farben. Da kam aus der unteren Gasse ein alter Mönch, ein Franziskaner. Ich weiß nicht, woher er stammte, aber nach seiner Kutte zu urteilen, kam er aus einem fernen Teil der Welt. Das Ziel eines jeden Franziskaners ist es, einmal in seinem Leben das Kloster San Francesco in Assisi zu besuchen. Der Mönch setzte sich auf eine Steinmauer und beobachtete, wie die Sonne sich der Basilica näherte und die Schatten länger wurden. Ich glaubte, ihn leicht nicken zu sehen. Er war ganz da, er war genau am richtigen Ort, wir beide waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, in diesem Moment, in diesem zeitlosen Augenblick, ist dieser Mensch nach Hause gekommen. Er hat sich eingefunden. Der Kreis hat sich geschlossen.« Angus machte eine kurze Pause. »Auch ich bin ein wenig mehr nach Hause gekommen. Das Leben hat eine neue, ja sanfte Bedeutung erfahren.«
Clara schaute Angus an und sagte nichts. Eine Träne benetzte ihre Wange.
»Entschuldigen Sie, wenn ich«, beeilte sich Angus zu sagen, »wenn ich Sie damit –«
»Sie belästigen mich nicht mit Ihrer Geschichte. Sie ist wunderschön. Und ich danke Ihnen, dass Sie sie mir erzählt haben.« Sie nahm eine Serviette und tupfte sich vorsichtig die Wange ab.
»Ich glaube, ich war derjenige, der etwas Gesellschaft brauchte«, lachte Angus jetzt. »Ich wollte Assisi nicht verlassen, ohne diesen Moment mit jemandem geteilt zu haben.«
Clara lächelte.
»Ich werde morgen früh nach Rom aufbrechen. Und Sie? Werden Sie noch lange in Assisi bleiben?«, fragte er.
»Ich glaube nicht«, sagte Clara.
»Haben Sie auch ein Geschenk bekommen?«
»Ich glaube, Sie haben es mir eben überreicht.«
Angus lächelte. Die Piazza schien jetzt von einer Stille erfüllt zu sein, die auch die letzten Tagesbesucher nicht stören konnten. Das leise Plätschern des Dorfbrunnens, das von den Steinmauern widerhallte, verstärkte diese Stille noch.
Nach einer Weile sagte Clara: »Später werde ich sagen: Und in diesem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen. Aber das stimmt nicht. Plötzlich war da der nächste Schritt auf einer Reise, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Ja, ich verstehe.«
»Ich werde meinen Vater besuchen, den ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Von dem ich gar nicht wusste, wie sehr ich ihn vermisse. Bis Sie kamen und mir diese Geschichte erzählten.«
Angus schwieg. Was Clara gerade gesagt hatte, hatte wiederum etwas in ihm geweckt. Sein Blick richtete sich für einen Moment nach innen oder irgendwohin. Zu seiner Mutter. Zu ihrem Verschwinden.
Und hier waren sie.
»Angus?«
Angus kam mit einem Einatmen aus seiner Versenkung zurück.
Clara lächelte. »Und was machen Sie in Rom?«
»Ich habe einen Termin mit einem hohen Vertreter der katholischen Kirche. Worum es geht, wollte er mir nicht sagen. Aber wenn mich ein Kardinal um ein Treffen bittet, klingt das für mich wie der Beginn einer interessanten Geschichte.«
»Kann ich mir vorstellen.«
Ein kühler Wind wehte jetzt vom Monte Subasio herab durch die Gassen und erfüllte die Piazza. Angus gab der Kellnerin ein Zeichen. »Ich übernehme das. Es wird kühl. Möchten Sie mit mir essen gehen? Das meiner Meinung nach beste Restaurant in Assisi muss man erst einmal finden. Es liegt etwas versteckt.«
Clara nahm das Angebot an. Sie fanden das Restaurant dort, wo drei Mönche durch das Tor gehen. Sie wählten einen ruhigen Platz in einer Nische des Raumes mit dem hohen, hellen Gewölbe, die kleine Stube war schon zu besetzt. Sie genossen ein vorzügliches Abendessen. Der regionale Wein sprach vom Geist der Landschaft, der Besitzer des Lokals vom regionalen Wein, und Clara und Angus sprachen darüber, dass das Leben bedeutungsvoll sei.
Sie hatte ihm gedankt, als sie das Restaurant verlassen hatten, für seine Geschichten und für ihn. Sie hoffte, dass sie sich vielleicht wiedersehen würden, irgendwann, irgendwo. Er hatte ihr gesagt, dass er sich das auch wünsche.
Dass man sich immer zweimal sieht im Leben.
—
Tatsächlich. In den Gassen hatte sich doch etwas Kühle ansammeln können. Der Wind, der nachts vom Monte Subasio in das Städtchen hinabgestiegen war, hatte sich still in den Winkeln verkrochen und hoffte, nicht entdeckt zu werden. Bald würde die Sonne auch die dunkelsten Schatten erwärmen. Langsam schlich sich ihr Licht an die Häuser heran und zog den Schatten des Berges, der sich wie ein seidenes Tuch über die Ebene vor ihm gelegt hatte, behutsam zurück.
Angus machte sich zu Fuß auf den Weg zu dem kleinen Kloster außerhalb der Stadtmauern. San Damiano, ein Ort der Fragen, wie Bruder Luca ihn nannte, wenn er den Leuten den Ort näherbrachte. Es war nicht der kürzeste Weg für Angus’ nächste Etappe, aber es war der richtige. Durch die Porta Nuova verließ er die Stadt. Vorbei an den Resten der etruskischen Stadtmauer. Durch den Olivenhain. Ein paar Vögel flogen lautlos über seinen Kopf hinweg. Er hörte ihre Flügel flüstern.
Kurz vor den Klostermauern begegnete er einer jungen Frau, mit der er ein paar Worte wechselte. Neu gepflanzte Kräuter entlang der Mauern erfüllten Angus’ Geist mit flüchtigen Erinnerungen und einem inneren Lächeln. Der Schatten wich und das Vogelgezwitscher wurde lauter. Angus berührte im Vorbeigehen die bronzene Schulter des kleinen Mannes, der seine Stadt weltberühmt machen sollte, wie er, in seinen Mantel gehüllt, von Wetter und Entsagung gezeichnet, zufrieden lächelte, obwohl er das alles nie gewollt hatte. Sie lächelten beide.
Er betrat den Platz vor dem kleinen Kloster. Er spürte die Stille. Er glaubte, sie berühren zu können. Was für ein Ort. Natürlich stand hier ein Kloster, kein Wunder, dass hier ein Wunder geschehen sein soll. Unter den Grundmauern des Gebäudes hatte man weitere Fundamente einer Stätte gefunden. Schichten. Menschen hatten diesen Raum immer als einen besonderen Ort der Begegnung empfunden. Diese Ruhe. Der kleine Vorplatz schien sie auszustrahlen. Bruder Luca stand darin eingebettet, ein langer, hagerer Mönch. Sein Gesicht war ein Ausdruck asymmetrischer Ruhe. Angus hatte sich schon bei früheren Begegnungen gefragt, ob diese Unregelmäßigkeit daher rührte, dass Bruder Luca nur mit einem Auge zum Himmel blickte, während das andere fest auf die Erde gerichtet war. Eine Waage, die unermüdlich das Gleichgewicht engagierter Gelassenheit suchte und fand. Wie macht er das nur, fragte sich Angus. Kann ihm der zweite Tod nichts mehr anhaben? Angus stutzte bei diesem Gedanken, den er nicht verstand.
Luca kam auf ihn zu. Hatte er gewartet? Seine linke Hand hielt die rechte vor seinem Bauch.
»Angus.«
»Bruder Luca, guten Morgen.«
»Ich habe eine Botschaft für dich.«
»Eine Botschaft?«
»Ich wusste, dass du hier vorbeikommen würdest, bevor du Assisi verlässt. Ich hatte einen sehr lebhaften Traum. Würde man als Laie sagen.«
»Was für eine Botschaft? Von wem?«
»Wenn ein Mönch zum Boten wird, wer, glaubst du, steckt dahinter?«, lächelte Bruder Luca und öffnete die Hände ein wenig nach oben. Dann wurde er ernst. »Sie ist wichtig. Du musst sie dir merken. Versprichst du mir das?«
Angus war ein wenig irritiert. »Ich verspreche es.«
»Am besten schreibst du sie dir auf.«
Angus holte sein Notizbuch und seinen Stift aus der Tasche.
»Also hör gut zu und schreib mit:
Berühre die eine, die zwei wird
wenn zwei eins werden
und halte fest, was drei ist.
Sind sie sich im Spiegel nah,
da wo die Höhe tief und Tiefe hoch,
entsteigen dem schwarzen Loch
Anfang und Ende, die
schon immer waren.«
»... die schon immer waren«, schrieb Angus flüsternd. Dann sah er Bruder Luca an. »Ein Gedicht?«
»Wenn, dann ein miserables.«
»Was bedeutet es?«
»Ich weiß es nicht. Die Bedeutung wird sich zeigen, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Hast du es richtig aufgeschrieben?«
Angus las vor, was er sich notiert hatte.
»Sehr gut«, sagte Bruder Luca.
»Und wie bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort?«, fragte Angus.
»Indem du dich nicht widersetzt. Und indem du Augen und Ohren offen hältst. Dann wirst du den richtigen Zeitpunkt erkennen. Und jetzt geh, denn hier wirst du die Botschaft nicht verstehen. Der Weg zum Wissen ist die Tat. Geh mit Gott. Pace e bene.« Bruder Luca zeichnete Angus ein Kreuzzeichen auf die Stirn.
»Pace e bene.«
Angus ging an Chiaras Statue vorbei und hätte sie beinahe nicht bemerkt. Er schreckte aus der Tiefe seiner Verwirrung hoch. Das war wohl nicht das, was es bedeutete, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Er entspannte sich und betrachtete die kleine, zierliche Frau auf dem Sockel, die gerade erfolgreich sarazenische Söldner mit einer Monstranz in die Flucht schlug. Oder vielmehr mit ihrem entschlossenen Auftreten. Noch einmal ging er an einem bronzenen Francesco vorbei, der nun offenen Sinnes dorthin blickte, wo er einst gestorben war. Angus erreichte den breiten Pilgerweg. Er verband das Dorf mit dem Monstrum einer kalten Kirche, die über der kleinen Kapelle errichtet worden war. Die Kapelle, neben der der Heilige nackt auf dem Waldboden liegend diese Welt verlassen hatte. Wald war jetzt weit und breit keiner mehr zu sehen. Dafür stand neben der großen Kirche der kleine Bahnhof.
Im Zug las er noch einmal die Botschaft. Mehr ein Orakelspruch als eine Botschaft, dachte er. Aber er wusste, dass Bruder Luca als christlicher Mönch von einer Botschaft sprach, nicht von einem Orakelspruch.
Er rief Pionéa an. Er erzählte ihr von den Begegnungen, die er in den letzten Stunden gehabt hatte. Von der Botschaft, die sie natürlich auch nicht deuten konnte. Fast hätte er beim Abschied gesagt, dass er sie liebe. Das hatten sie sich auch schon gesagt. Aber es hatte für ihn eine neue Bedeutung angenommen. Deshalb sagte er es nicht.
Alles hat seine Zeit.
—
Pionéa stand hinten an der Reling und blickte aufs Meer hinaus. Der Boden unter ihren Füßen vibrierte sanft. Aus dem billigen Lautsprecher der Bar tönte die gesungene Frage, ob sie ewig leben und jung bleiben wolle.
Fast hätte sie zum Abschied gesagt, dass sie ihn liebe. Das hatten sie sich auch schon gesagt. Aber es hatte für sie eine neue Bedeutung angenommen. Deshalb sagte sie es nicht.
Nachdem sie ihr Gespräch beendet hatten, hatte sie ihr Mobiltelefon vorsichtshalber in ihre Hosentasche versenkt. Nicht, dass sie es aus Versehen im Meer versenkt hätte. Das hätte zu ihr gepasst. Bald würde der Empfang ohnehin von der Weite des Meeres verschluckt werden. Die Fähre hinterließ eine breite Spur im Wasser. Toulon und die französische Küste waren schon fast am Horizont versunken. Es würde noch Stunden dauern, bis Korsika auftauchte und sie in Ajaccio anlegten. Das Meer ruhte tiefblau.
Pionéa trug ihr langes schwarzes Haar offen. Sie mochte, was der Wind mit ihm machte. Das Rauschen des Salzwassers rief nach ihr. Sie lehnte sich über das Geländer, schaute an der Schiffswand hinunter und beobachtete die Strudel, die sich manchmal bildeten und in die Tiefe führten. Sie sehnte sich nach dieser Tiefe, die sie beim Freitauchen so liebte. Das dumpfe Wummern des Blutkreislaufs, das hohe Rauschen des Nervensystems, ähnlich dem Wummern und Rauschen, das die Fähre erzeugte. Das Fehlen des Atemgeräusches, der Druck auf den Körper, als wäre er in Wasser eingegossen. Wie sie sich erst nach unten kämpfen muss, leicht wie eine Boje, bis das Wasser sie aufnimmt und im freien Fall weiter nach unten führt. Komm in meine Tiefe, sei willkommen. Die anderen Sinne, die erwachen, in dieser ganz anderen Welt, immer an der Grenze, auch an der Grenze zur Traumwelt, wenn sich Tore zu anderen Welten öffnen. Delirium nennt man das, Halluzinationen. Andere Bewusstseinszustände. Es sind gefährliche Welten, die ihr diese Tiefe eröffnet. Welten, die sie umbringen würden, wenn sie sich in ihnen verlöre. In diesen Zwischenwelten fühlt sie sich zu Hause wie nirgendwo sonst. Sie liebt diese Stille. Sie ist nicht nichts. Sie ist Fülle. Nichts wird weggenommen. Die Tiefe hoch und die Höhe tief ... klang in ihr nach und sie tauchte auf.
Aus dem Lautsprecher fragte nun eine Frau, deren Stimme klang, als hätte sich eine Opernsängerin in eines der ersten Computerspiele verirrt, ob man an die Liebe nach der Liebe glaube. Sie schien sich mit dieser Frage im Kreis zu drehen. Pionéa wandte sich vom Horizont und der Tiefe zum Hier, lehnte sich an die Reling und betrachtete die anderen Passagiere. Sie mochte diese Zwischenwelt, die mit dem Warten auf die Einschiffung begann – oft auch auf die Fähre, die sich verspätete – und die die Beteiligten mit ihren Eigenheiten füllten. Sie mochte die Eigenheiten der Menschen nicht besonders. Aber hier war es anders. Hier konnte sie sie einfach betrachten.
Die arme Frau aus dem Lautsprecher hatte nun ihre Frage ohne Antwort beendet, und ein Mann mit Jungenstimme hatte übernommen. Er sang (immer noch) von einem alten Mann aus Aran, der ohne Ende umhergeht (around and around), sein Geist ein Leuchtfeuer im Schleier der Nacht. Pionéa brauchte etwas mehr Tiefgang. Sie holte ihre Kopfhörer aus dem Rucksack und wählte eine Playlist. Deep Base. Zu ultratiefen Bässen und treibenden Beats sah die Sache schon ganz anders aus. Direkt vor ihr lümmelte sich eine Familie in die blau-gelb gestreiften Liegestühle. Alle waren blond, sogar der Hund. Zuerst hatte Pionéa die Familie nicht als solche erkannt, weil sie die Eltern nicht als Eltern erkannt hatte. Sie wirkten nicht viel älter als ihre Tochter, die Pionéa auf knapp zwanzig Jahre schätzte. Sie hatte wunderschönes, langes, gewelltes Haar, das wie ein sanfter Wasserfall über den Liegestuhl fiel. Der Mann sagte etwas zu seiner Frau – Pionéa hörte nur Bum Bum – nachdem diese ihn aus seinem Schlummer gerissen und er verwirrt in Pionéas Richtung gestarrt hatte, als würde er durch sie hindurchblicken. Wahrscheinlich hatte er gerade von einem Loch im Boden geträumt, in der Nähe eines Baumes an einem Fluss, um den der alte Mann aus Aran kreiste. Eine einsame Möwe kreuzte im Gleitflug das Schiff. Ob sie auch auf dem Weg nach Korsika war? Pionéas Blick folgte ihr, bis sie als Punkt am Himmel verschwand. Die Leere ließ ihren Blick zurückkehren. Hinter der Familie tranken die obligatorischen Motorradjungs mit ihren Chicks Bier. Ihre Bierbäuche wurden nicht mehr von den Motorradklamotten zusammengehalten, die sie ausgezogen und auf den Rand des mit einem Netz überspannten Bassins gelegt hatten. Pionéas Blick wanderte über das Netz. Ein Bassin, in dem nie jemand badete. Selten schwappte Wasser darin, aber sie hatte es noch nie ohne Netz gesehen. Sie erinnerte sich an eine nächtliche Überfahrt, als sie allein an Deck gewesen war, abgesehen von ein paar schnarchenden Bierkumpels, deren leere Flaschen ziellos über den Boden rollten. Der Sternenhimmel hatte sich über sie gewölbt, und im Wasser des Bassins spiegelten sich die hellen Sterne und die junge Mondsichel. Sie konnte es sich nicht erklären, aber in diesem Moment hatte sie gespürt, dass es ein bedeutsamer Augenblick war. Diese Erinnerung vor Augen, hatte Pionéa das leise Gefühl, gerade etwas verpasst zu haben. Hatte sie soeben ein Déjà-vu erlebt? Ihr Blick schweifte suchend über das Netz, das leere Bassin, als wolle sie etwas vor dem inneren Versinken retten, doch sie wusste nicht, wonach sie suchte, ja, dass sie überhaupt suchte. Denn das, was jetzt wieder versank, war noch nicht ganz aufgetaucht.
Ihr Blick wanderte über eine Gruppe von rauchenden, plaudernden Fährenarbeitern in weißen und gelben Overalls wieder zur Reling. Dort stand eine Frau in einer blauen Bluse und genoss mit geschlossenen Augen den Wind, der ihr langes rötliches Haar wie tanzende Flammen aufs Meer hinaus trieb. Pionéa folgte diesen Flammen zum Horizont. Das Land war versunken. Auf einigen Wolkentupfern kehrte sie auf die Fähre zurück und landete auf dem Oberdeck, das sich mit zwei langen Armen wie ein U über das untere Deck legte. Am äußersten Ende standen zwei Männer. Hatten sie gerade zu ihr geschaut? Der eine war ein athletischer, schwarzer Bär mit kurzem Haar. Zuerst dachte sie, sie hätte ihn dabei ertappt, wie er einen unglaublich lustigen Witz erzählte, der jeden Moment zur Pointe kommen würde, und der Mann konnte sich kaum zurückhalten. Dann wurde ihr klar, dass es sich entweder um einen sehr langen Witz oder um seinen alltäglichen Gesichtsausdruck handeln musste. Sie kam zu dem Schluss, dass es das Alltägliche sein musste. Als befände sich die Welt immer am Rand zur Pointe, bereit zum Loslachen. Sie glaubte, seine Stimme mit dem tiefen Bass in ihrem Ohr klingen zu hören, bevor ihr klar wurde, dass seine Stimme sie nicht erreichen konnte. Der Bass passte perfekt. Sein rechtes Handgelenk war von verschiedenen Armbändern geschmückt, was eine sanfte Note betonte, die seine tiefe Erscheinung durchklang wie schwebende Harmonien über den Bässen. Der andere wirkte mit seiner schlanken Gestalt und dem etwas längeren Haar wie ein Tänzer. Obwohl er sich jetzt kaum bewegte, schien es Pionéa, als bewegten sich alle seine Gelenke fast unmerklich mit den Wellen. Nicht nur seine Bewegungen, auch sein Gesicht war eine ganze Kultur. Die hauchdünne Andeutung eines dichten Dreitagebartes deutete darauf hin, dass die Natur ihren Platz in dieser Kultur hatte. Sie betrachtete den Mann, als versuchte sich etwas in ihr zu erinnern.
Jetzt sagte der Bär etwas, das für einen Moment den Glanz aus seinen Augen stahl. Er drehte sich zum Meer und blickte, auf die Ellbogen gestützt, zum Horizont. Der Tänzer antwortete etwas und tat es ihm nach. Sie schienen zu schweigen.
Pionéa folgte ihren Blicken zurück zum Horizont.
—
»Das ist ein Riesending, nicht?«, hatte Jay bemerkt. Seine Augen hatten geleuchtet. Sie waren mit ihrem Mietwagen durch die Kontrolle gefahren und hatten sich nun in die lange Schlange der wartenden Autos eingereiht.
»Wir fahren nicht mit dem Mega Express. Unsere Fähre ist, glaube ich, die Kleine da hinten.«
»Die Süße da?«
»Sie heißt Victoria.«
»Ruby Deck, hübsch«, freute sich Jay über die Etikette, die der gelangweilte Mann nach dem Scannen des Strichcodes auf ihr Ticket geklebt hatte, während Jay breit grinste, als hätte der Gelangweilte gerade einen umwerfenden Witz erzählt. »Votre cabine, your cabin«, hatte er gesagt, und die Kabine hatte zweimal exakt gleich geklungen. Sie hatten eine Tageskabine gemietet, um sich ein wenig ausruhen zu können.
Nach kurzem Warten wurden sie von der Fähre rumpelnd, scheppernd und dann grollend in ihrem Bauchinnern empfangen. Der Mann im gelben Overall ließ sie so dicht neben den anderen parken, dass Jay es kaum mehr aus dem Wagen schaffte. Die Suche nach der Kabine gestaltete sich wie ein Lauf durch ein Labyrinth. »Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis«, stöhnte Alan. Ihr Plan war es, sich eine Mütze Schlaf zu gönnen, bevor sie sich in ihr Inselabenteuer stürzten.
Aber bis dahin war noch Zeit. Jetzt standen sie auf dem Oberdeck am Heck des Schiffes. Von hier aus hatten sie einen guten Blick auf das Meer und die Leute auf dem unteren Deck. Nur der Motor war hier oben etwas laut. Die Musik, die von unten schepperte, hatte kaum eine Chance. Das war kein Verlust. Eine Frau stand auf der anderen Seite des unteren Decks und steckte sich soeben Kopfhörer in die Ohren.
»Sie macht diese Ecke des Decks zu einem perfekten Moment«, freute sich Alan mit einem sanften Lächeln. »Schau, wie ihr Haar weht. Wie sie zufrieden beobachtet. Sind ihre Augen hell? Trotz ihrer eher dunklen Haut? So entspannt und doch wachsam, wie sie da steht, könntest du sie auf eine Bühne stellen. Mit den klaren Linien ihres Gesichts und ihres Körpers. Sie bräuchte nichts weiter zu tun. Ein abendfüllendes Programm.«
»Da werde ich fast ein wenig eifersüchtig. Was sie wohl für Musik hört?«
»Wahrscheinlich nicht den Lärm da unten.« Dieser drang schwach von der Bar unten zu ihnen herauf, kryptisch etwas von starken Armen Babylons und einem Baum an einem Fluss mit einem Loch im Boden zu ihnen tragend.
»Vielleicht fühlte sie sich inspiriert und hört das Zeug in Endlosschleife.«
Alan lachte.
»Oder Mozarts Requiem.«
»Hm.«
Das Requiem von Mozart. Das war lange Zeit ihr Ding gewesen, wenn sie zusammen unterwegs waren: in verschiedenen Situationen das Requiem von Mozart zu hören. Jedes Mal war es verblüffend, wie die Situation, in die sie gerade eintauchten, an Tiefe und Dramatik gewann. Für Alan gehörten solche Experimente zum Leben. Jay liebte sowieso fast jedes Experiment. Aber vor drei Jahren hatten sie damit aufgehört. Es wäre zu viel gewesen.
Man müsse sich langsam an die volle Realität herantasten, hatte Alan damals gesagt.
»Tut mir leid«, sagte Jay leise.
»Ich glaube, sie bewegt sich fast unmerklich zu einem Beat«, sagte Alan. »Etwas Tiefes. Mit viel Boden.«
»Du liest die Musik aus ihren unmerklichen Bewegungen?«
»Warum nicht?«
»Warum nicht.«
»Dafür kannst du mir nachher in der Kabine erzählen, wie viele Leute auf dem Deck waren. Oder wie viele Holzlatten das Deck hat.«
»Stimmt. Wir sind schon ein merkwürdiges Duo«, sagte Jay. »Als ob das etwas ändern würde.« Seufzend ließ er seinen Blick über das Meer schweifen.
»Alles ändert etwas. Wir verändern etwas. Dass wir hier stehen, ändert etwas.«
Sie stützten die Ellbogen auf die Reling, blickten hinaus auf die Weite des Meeres und schwiegen gemeinsam.
Später fanden sie einen kurzen Schlaf in der Kabine und danach einen starken Kaffee an der Bar. Korsika tauchte aus dem Meer auf. Mittags legte die Fähre in Ajaccio an. Als sie aus der stinkenden Dunkelheit des Schiffsbauchs ins Licht fuhren, öffneten sie die Fenster. Die Inselluft empfing sie warm und würzig. Sie fuhren an der Fähre entlang, vorbei an den Autoreihen der Wartenden, die nun die Insel verlassen mussten.
»Die einen kommen, die anderen gehen. Der ewige Kreislauf des Lebens«, seufzte Alan.
»Die Armen.« Jay schüttelte den Kopf.
»Bald werden wir an ihrer Stelle sein.« Alan streckte einen Arm aus dem Fenster und genoss den warmen Wind. Zehn Tage, dann würden sie hier stehen und warten, während andere genüsslich den Arm aus dem Fenster streckten, um die Insel zu begrüßen. Zehn Tage hatten sie. Die ihrem Leben hoffentlich eine neue Richtung geben würden.
Am Ausgang des Piers passierten sie eine junge Frau in gelber Weste und sehr kurzen Jeanshosen, deren Aufgabe es war, auf die offensichtliche Ausfahrt hinzuweisen. Sie hatte nichts anderes zu tun, als an ihrer Hose zu zerren.
»Sieht ein bisschen eng aus«, bemerkte Jay.
»Sie hat sicher Recht, wenn sie meint, dass jeder den Ausgang selbst sehen kann.«
»Sie hatte die Stellenanzeige gelesen: Wir suchen eine attraktive junge Frau, die in einer Leuchtweste und mit einem Walkie-Talkie auf langen Beinen herumsteht und dem einen Idioten pro Jahr, der den Ausgang nicht findet, freundlich den Weg weist.«
»Früher oder später kommt der Idiot.«
»Garantiert. Der ewige Kreislauf des Lebens.«
—
Er kannte sie. Aber er genoss sie immer wieder. Die idyllischen Landschaften, die kleinen Dörfer auf den Hügeln, die einsamen, heruntergekommenen Bahnhöfe, bevor der Zug immer tiefer in das Chaos Roms eindrang und schließlich mittendrin stehen blieb, als würde er resignieren.
Auch das Chaos hatte seinen Reiz. Eine Stadt als Prozess. Eine Stadt, die unaufhörlich entstand und zerfiel, die sich wie ein lebendiger Organismus auflöste und neu zusammensetzte. Darin Inseln der Zeit, die diesem Prozess enthoben schienen. Oder sich zumindest viel langsamer wandelten.
Eine Männerstimme, die kaum jemand beachtete, verkündete Verbindungen, und wer sie beachtete, verstand sie nicht. Sie vermischte sich so perfekt mit dem Pfeifen und Rattern der ein- und ausfahrenden Züge, mit dem Stimmengewirr und dem fernen Rauschen der Stadt, dass eine undifferenzierte Klangkulisse entstand. Vögel flatterten in den gläsernen Gewölben. Sie zwitscherten über die Geräuschkulisse hinweg, als wären sie die Einzigen, die es verdienten, gehört zu werden. Menschen eilten vorbei, jemand wurde herzlich umarmt.
Angus war stehen geblieben, als er aus der Hitze des Zuges in die Glut der Stadt trat. Noch immer spürte er die innere Stille und Weite von Assisi. Sie wollten noch ein wenig in ihm verweilen, ihm noch etwas sagen. Er stand da wie ein Schilfrohr in einem See von Menschen.
An einem solchen Ort, nicht in Rom, aber in Mailand, hatte er Pionéa kennengelernt. In einem Gedränge wie diesem. Was er jetzt fühlte, überwältigte ihn fast.
Hier stehe ich, zwischen zwei Leben. Ich schaue in die Welt und sehe in allem nur ihre Abwesenheit. Zugleich spüre ich ihre Gegenwart wie nie zuvor. Pionéa. Was wir hatten, hat sich verändert. Intensiviert durch die von außen auferlegte Distanz und Dauer. Ob sie das auch spürt? Er konnte das nicht allein spüren. Oder?
Oder doch?
Jetzt ist die Zeit, das Ungesagte auszusprechen. Das ungelebte Leben zu leben. Aber da ist auch diese leise Angst vor der ersten Umarmung nach so langer Zeit. Sie verschließt mein Herz ein wenig, statt es für die Umarmung zu öffnen. Die Angst, in Pionéa zur Erinnerung geworden zu sein, ohne dass sie diese schleichende Entfremdung erkannt und anerkannt hätte, sich einredend, alles sei noch wie früher. Verblasst zu sein, weil ich als Erinnerung genug bin und die Sehnsucht nach neuem Erleben die Sinne nicht mehr streift. Was, wenn die Leidenschaft, die bei uns immer sehr subtil, aber deutlich war, sich wie ein Parfüm verflüchtigt hat? Wenn Pionéa mich nur noch dabei haben will, um in der Vergangenheit zu baden und die Banalitäten des Alltags zu teilen, wo einst Witz und Feuer sprühten? Vielleicht auch aus Pflichtgefühl, um zu bewahren, was war, oder um es zu ehren, oder um sich mit mir zu schmücken? Doch wir gehören nicht mehr uns, wenn sie mich nicht über die Grenze hinaus umarmen will, wo der wirkliche Dialog beginnt. Wo Erinnerungen gemacht werden.
Angus schüttelte unmerklich den Kopf.
Ich stehe hier in der Zwischenwelt der Begegnungen, versunken in Zweifel und Misstrauen, von denen ich weiß, dass sie in meiner Vergangenheit wurzeln und nicht in der Gegenwart, und zugleich bin ich getragen von der Kraft der Hoffnung, dass ich Pionéa bald wieder umarmen kann, verbundener denn je. Ich werde es ihr sagen. Ich werde ihr sagen, dass ich keine Zeit verlieren möchte. Dass ich mein ganzes Leben mit ihr teilen will. Eine Familie gründen. Ob das das Ende oder der Anfang sein wird? Ich muss es wagen.
Angus stand still, innerlich und äußerlich. Jemand streifte ihn und brachte ihn ein wenig zurück. Menschen, die zu ihren Zügen eilten, die warteten, die ratlos vor einer Anzeigetafel standen. Sein Blick schweifte, aber er schaute immer noch nach innen. Er schien sich zu erinnern. Ja, es war wie eine Erinnerung. Woran nur? Woran? Er lauschte. Versank in seinem Lauschen. Vor seinem inneren Auge sah er die leeren Hallen. Die Bildschirme schwarz. Als wäre alles in eine andere Dimension versetzt worden und das Leben hätte sich woanders abgespielt. Wie viele Menschen hatten ihre Lieben verloren. Wie viele Worte waren ungesagt geblieben. Die Welt hatte uns eingeholt, wie wir es uns nie hätten vorstellen können, und war zu einer Welt der Entfernungen geworden. Jetzt suchen wir die Verbindungen, das Ankommen, die Ferne. Die Familie, Freunde, das Vertraute, das Neue. Wir suchen und finden die Umarmung der Geliebten, die so lange nicht möglich war. Diese Wiedervereinigung ist das Einzige, was uns wirklich heilen kann. Die Lautsprecherdurchsagen, die unverständlich durch die Hallen wehen, geben uns zumindest die Gewissheit, dass es einen Raum gibt, in dem Bewegung möglich ist. Dass es eine Außenwelt gibt. Dass es Verbindungen gibt. Dass es Distanzen gibt, die erkundet und überwunden werden können. Dass es Auswege gibt. Auswege. Ich werde es ihr sagen. Ich werde sie fragen.
Jemand rempelte ihn heftiger an. Er ließ seine Gedanken im Gedränge stehen und setzte sich in Bewegung. Nur das Gefühl der Liebe nahm er mit sich. Und den Entschluss, sie Pionéa zu gestehen.
Und dieses Geständnis mit der Frage zu verbinden, ob sie ihn heiraten wolle.
Auch wenn er damit alles riskierte.
—
Er nahm die Metro Richtung Vatikan bis Ottaviano und ging den Rest zu Fuß.
Das Ristorante Papalino präsentierte sich mit runden Tischen unter ausladenden Sonnenschirmen. Ein hagerer Mann um die sechzig, unauffällig schwarz gekleidet, erhob sich, als er Angus kommen sah. Nur sein weißes Kollar verriet ihn als Geistlichen. Er hob die Hand. Kardinal Durand. Sie begrüßten sich, setzten sich. Angus bestellte einen Caffè Nero. Kardinal Durand freute sich, dass Angus seine Einladung angenommen hatte. Sie sprachen über die Hitze, über Rom, über das, was in der Welt geschah. Schließlich sagte Angus, er sei gespannt, worum es bei ihrem Treffen gehe.
»Ihre Reiseberichte sind mehr als nur Reiseberichte. Sie erzählen von Menschen auf ihrem Lebensweg. Sie haben von Menschen an vielen Orten geschrieben, die für die katholische Kirche zentral sind. Rom natürlich, Assisi, St-Maximin-la-Sainte-Baume, Vézelay, um nur einige Ihrer letzten Stationen zu nennen.«
»Jeder Ort hat nicht nur eine Geschichte, sondern Geschichten. Schichten, die man abtragen kann, um neue Bedeutungsebenen freizulegen. Ich folge meiner Intuition. Es ist eher ein Fluss als ein Weg. Die Dinge geschehen auf natürliche Weise. Ich gehe dorthin, wo die Quellen tief sind.«
»Sehr schön. Wo die Quellen tief sind, finden wir oft auch die Kirche, nicht wahr?«
»Die Kirche hat über Jahrhunderte die Kultur und die Menschen geprägt. Auch immer sehr widersprüchlich.«
»Ich spüre einen kleinen Stich im Herzen, wenn Sie sagen, sie war prägend. Aber ich glaube, Sie haben Recht, diese Zeiten sind vielleicht vorbei. Die Kirche sollte eine Frage sein, stattdessen ist sie eine Aussage. Hätte sie nicht schon früh in ihrer Geschichte den Kontakt zu ihrem zentralsten Kern verloren, stünden wir heute ganz anders da.«
»Und was ist der zentrale Kern?«
»Die Kraft der Erneuerung. Die Kirche muss diese Kraft leben und vorleben. Sie muss sie nicht nur jedem Menschen zugestehen. Es ist ihr heiliger Auftrag, jeden Menschen, zumindest jeden, der hören will, zu dieser ihm innewohnenden Kraft hinzuführen und ihm zu helfen, sie zu verwirklichen. Das kann sie nur, wenn sie es selbst auch tut. Die Kirche, das sind die Menschen, die in ihrem Namen handeln. Ich zum Beispiel.«
Angus lächelte. Das waren Worte, die er nicht erwartet hatte. Dann wurde er wieder ernst. »Und warum erzählen Sie mir das? Möchten Sie, dass ich darüber schreibe? Ich bin kein Theologe. Und nicht besonders – kirchlich.«
Kardinal Durand schüttelte den Kopf. »Die Kraft der Erneuerung muss von innen kommen. Das gilt auch für die Kirche. Darum ist es nicht mein Anliegen, dass Sie von unserem Gespräch berichten. Ich habe in dieser Institution nichts zu verlieren. Ich kann diese Dinge selbst sagen, und es ist gut, wenn man sie direkt von mir hört. Aber –« Kardinal Durand hatte seinen Ellbogen auf das Tischchen gestützt und bewegte nun seine Hand abwägend, nach Worten suchend. »Wie soll ich sagen.« Immer noch suchend. Er legte die Hand ans Kinn. In der Nähe läutete eine Kirchenglocke. Ein knatterndes Moped rumpelte über das Kopfsteinpflaster. Der Lärm der Stadt drang gedämpft zu ihnen herüber. »Vielleicht könnten wir Kräfte bündeln.« Der Kardinal lehnte sich zurück.
»Wie wollen Sie Kräfte bündeln?«
»Ganz einfach: Sie könnten für uns schreiben. Im Auftrag des Vatikans reisen.«
»Sie bieten mir einen Job an?«
»So kann man es auch sagen, ja.«
»Warum?«
Kardinal Durand wog erneut ab, diesmal mit einer Kopfbewegung. »Wie soll ich sagen ...«, immer noch die Kopfbewegung. »Wir finden einfach, Sie haben eine starke und frische Stimme. Und das brauchen wir.«
Angus spürte, dass der Kardinal nicht die ganze Wahrheit sagte. »Sie wollen mich doch nicht etwa vereinnahmen?«
Kardinal Durand machte große Augen. Ertappt? Oder gespielt?
»Ich muss Ihnen nicht erklären«, fuhr Angus fort, »wie die Kirche Stimmen, die ihr hätten gefährlich werden können, entweder zum Schweigen gebracht oder vereinnahmt hat. Ich komme gerade aus Assisi, dem vielleicht deutlichsten Beispiel für die Widersprüche der Kirche. Und ich stamme aus Irland. Sie wissen, was die Kirche dort angerichtet hat.«
»Das brauchen Sie mir wirklich nicht zu erklären.« Kardinal Durand seufzte. »Unrühmlich. Schrecklich.« Und nach einem Moment des Schweigens, in welchem er nach innen zu blicken schien: »Unverzeihlich.« Er bekreuzigte sich. Nach einer weiteren Pause, in der er wieder auftauchte und sich nach außen kehrte: »Aber wir müssen verzeihen. Vergeben.« Bei diesem Wort machte er eine Faust. Wahrscheinlich, um die Kraft der Vergebung zu veranschaulichen, dachte Angus. »Und wir müssen aufpassen, dass wir die gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Die Vergangenheit gestaltet uns, aber wir gestalten die Zukunft. Wir schaffen eine freie Zukunft, indem wir die Vergangenheit integrieren und aus ihr neue Kraft für die Gegenwart schöpfen. Sie, mein Lieber, sind Ausdruck einer neuen Kraft. Also: Nein, keine Vereinnahmung. Eine Bündelung, wie gesagt. Von Kräften.« Wieder die Faust. Ob er an einen Kampf dachte?
»Seien wir ehrlich. Mein Versprechen wäre eine Zusage zur Zensur. Die wenigsten Kräfte in der Kirche sind so konstruktiv und fortschrittlich, wie Sie es zu sein scheinen.«
»Ich würde es nicht fortschrittlich nennen. Es ist das Bemühen um die einfache Wahrheit. Aber Sie haben Recht. Es sind nicht alle Kräfte so. Und die Kirche ist ein sehr komplexer Apparat für eine einfache Wahrheit.« Kardinal Durand seufzte erneut. »Zu komplex, um der Komplexität der heutigen Welt begegnen zu können. In diesem Sinne ist sie zu sehr Teil der Welt. Und das, obwohl sie sich mehr und mehr von ihr entfremdet.«
»Ihr Angebot scheint mir denn auch halbherzig zu sein.«
Kardinal Durand fühlte sich ertappt und lächelte ohne Scham: »Das ist sicher die Wahrheit. Ich habe mich zu einem Gespräch mit Ihnen bereit erklärt, weil ich Sie kennenlernen wollte. Nicht, weil ich Sie überzeugen wollte.«
»Ich fühle mich geehrt. Weshalb wollten Sie mich kennen lernen?«
Angus schien es, als hätte sich Trauer in das Lächeln des Kardinals gemischt. Warum sollte der Kardinal traurig lächeln? Er bekam weder auf seine äußere noch auf seine innere Frage eine Antwort. Stattdessen noch mehr Fragen über seine Reisen. Ob er immer allein unterwegs sei. Eine Begleiterin? Fragen nach der Begleiterin. Eine Freundin? Was sie mache. Wohin ihn der Fluss des Schreibens als nächstes treibe. Korsika? Wunderschön. Mit dieser Freundin? Weshalb Korsika? Würde es dort etwas zu entdecken geben, im Sinne von Schichten, die man abtragen könnte? Schichten der Wahrheit, die man freilegen könnte?
Korsika. Eine Insel von großer Schönheit. Ein verträumter Blick.
Angus hatte das Gefühl, dass dies eigentlich der wichtige Teil des Gesprächs war. Ein Gespräch, als käme man nach langer Zeit nach Hause und erzählte, was man alles erlebt hatte. Nach zwei Stunden verabschiedeten sie sich, ohne dass Angus das Jobangebot annahm oder Kardinal Durand es ihm übel nahm. Der Kardinal schenkte ihm ein fast väterliches Lächeln und eine leichte Verbeugung.
Angus war gerührt und ein wenig irritiert zugleich. Statt die Metro zu nehmen, ging er zu Fuß zurück zum Bahnhof. Vorbei am Castel Sant’Angelo mit seinem markanten Rundbau. Über die Brücke über den Tiber in die Via del Corso, vorbei an der kleinen Kirche San Carlino. Aber er nahm die Stadt, die er so gut kannte, kaum wahr. Die Schönheiten. Die verstopften Straßen. Das Licht. Etwas in ihm stellte Fragen, die er noch nicht wahrnehmen konnte.
Erst als er am Bahnhof stand, wurde ihm bewusst, dass er ohne jegliches Gewahrsein hierher gesteuert war. Und dass er nicht hierher gehörte. Für den Abend hatte er noch ein weiteres Treffen geplant. Erst morgen würde er mit dem Zug nach Livorno fahren. Und von dort die frühe Fähre nach Korsika nehmen. Dort würde er Pionéa in die Arme schließen und ihr sagen, was er ihr sagen wollte. Und sie nie mehr loslassen.
Dafür brauchte er ein Zeichen. Er brauchte Ringe.
Er hatte Zeit, die richtigen Ringe zu finden.
—
Es war, als würden alle Autos Korsikas durch ein Nadelöhr in die hintersten Gassen des Weltenendes fahren und ewig von ihnen wiedergekäut werden. Campujola war ein kleines Dorf mit unendlich vielen Parkplätzen und noch mehr Autos. Einen freien Parkplatz zu finden, gestaltete sich als Desaster. Jeder Quadratmeter, auf den man kein Gefährt stellen sollte, war abgesperrt. Überall blockierten sich die Fahrzeuge gegenseitig auf der Suche nach einem Platz, es ging weder vorwärts noch rückwärts, Meter für Meter bahnten sich erschöpfte Gefangene ihren Weg durch die in der Hitze kochenden Verästelungen. Am Ende der Sackgasse wartete ein Verkehrskreisel darauf, die Autos zurück ins stille Chaos und ihre Insassen zurück ins stille Leiden zu werfen.
Glücklicherweise kam ein Zimmer im Hotel Cyrnos hundert Meter hinter dem Kreisel – nur Hotelgäste und die Bewohner der hinteren Häuser durften geradeaus weiterfahren, statt die Schlaufe zu machen – mit einem exklusiven und streng gehüteten Parkplatz.
Sie hatten ihren Mietwagen vom Festland gegen einen von der Insel getauscht. Einen Abstecher zum Decathlon in Ajaccio und zwei Stunden Fahrt später stellten Jay und Alan ihren Wagen auf diesem Parkplatz ab. Sie traten ein. Zuerst sahen sie nur Dunkelheit. Aus ihr entstanden allmählich ein Mann und eine Theke.
»Bonjour, Monsieur, Alan dos Santos und Jaymes Davis. Wir haben reserviert.« Sie tasteten sich an die Theke heran.
»Willkommen«, hörten sie den Mann sagen. Er sagte es ohne zu lächeln. Soviel konnten sie jetzt erkennen. »Sie sind diejenigen, die für eine Nacht reserviert haben, dann zwei Nächte weg sind, um dann noch eine Nacht hier zu genießen.«
»Das ist richtig.«
»Und gegen einen kleinen Aufpreis darf Ihr Auto vier Nächte hier draußen seine Ruhe haben.«
»Korrekt.«
»Sie wollen wohl nach hinten ins Tal.«
»Das ist so.«
»Ihre Personalausweise bitte.«
Während der namenlose Mann ihre Personalien notierte, sprach er, ohne aufzublicken. »Es wäre mir aber lieber, Sie kämen zurück und nähmen Ihr Auto wieder mit.«
»Wie meinen Sie das?«
»Haben Sie nicht davon gehört?« Und ohne bedeutungsvolle Pause, ohne sich vorzubeugen und zu flüstern, um die beiden in ein Geheimnis einzuweihen, bemerkte er sachlich: »Es spukt im Tal.« Als würde er sagen, hier sind Ihre Ausweise zurück.
»Ach ja? Echte Gespenster?«, fragte Jay.
»Mal scheint es ein Mann zu sein, mal eine Frau. Sie kommen und gehen. Manchmal hört man sie nur. Und manche Besucher des Tals gehen und kommen nie wieder.«
»Die gefährlichen Meeresströmungen. Davon haben wir gehört«, bestätigte Alan.
»Meeresströmungen.« Auch das sagte der Mann ohne den Anflug einer Emotion, als hätte er sich eben mal die Automarke des Wagens gemerkt, den sie hinten geparkt hatten. Er blickte auf und sah die beiden an. »Das waren nicht die Meeresströmungen. Die Menschheit ist zwar dumm.« Er stützte den Ellbogen auf die Theke, drehte die Hand nach oben und zeigte mit dem Kugelschreiber in ihre Richtung. Er schwenkte ihn hin und her, als würde er sicherstellen wollen, dass er sie beide einbezog, »Aber so viele Idioten gibt es auch wieder nicht, die tatsächlich in diesen Fluten baden gehen. Und dann auf Nimmerwiedersehen weggeschwemmt werden.«
Er legte die Ausweise kommentarlos zurück auf die Theke. »Die Vermissten hingegen scheinen manchmal im Tal kurz auf- und wieder abzutauchen. Viele haben sie gesehen, aber niemand hat sie wirklich gesehen. Und doch ist es so. Das Kennzeichen müsste ich noch haben.«
»JN-115-MC«, sagte Jay. Der Mann stutzte einen Moment, bevor er schrieb. Er war es wohl gewohnt, dass Besucher an dieser Stelle der Unterhaltung noch einmal nach draußen gingen, um sich die Nummer zu merken oder die Mietpapiere zu holen, die sie im Fahrzeug zurückgelassen hatten.
»Sie meinen also, sie wurden von diesen Geistern ...«, begann Alan, um den Mann den Satz beenden zu lassen. Was er aber nicht tat. Stattdessen drehte dieser sich einmal um die eigene Achse, um einen Schlüssel von der Wand zu nehmen und ihn vor ihnen auf die Theke zu legen. »Zimmer 137. Zweiter Stock. Höher geht es nicht. Die Zimmer im Erdgeschoss beginnen mit einer Null. Und alle erst bei 29. Lange Geschichte.«
»Ich liebe Geschichten«, sagte Jay.
Der Mann hob eine Augenbraue. Dann: »Mit Meerblick. Alle haben Meerblick. Hier in der Bucht ist das Meer sanft. Wenn Sie noch etwas brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Meistens.«
Sie bedankten sich.
»Und machen Sie sich keine Sorgen«, sagte Jay von der Treppe zu dem Namenlosen zurück. »Wir glauben nicht an Geister.«
»Hm«, gab dieser zu verstehen.
Wortlos trugen sie sich und ihr Gepäck nach oben. Eine Treppe, zwei Treppen. Sie fanden die 137. Das Zimmer war klein und schlicht. Doppelbett, Tischchen, Balkon. Es roch ein wenig, als wäre es nicht erst heute Morgen, sondern schon vor Tagen oder Wochen gründlich gereinigt worden. Campujola war ein kleiner Ort, und die meisten, die länger als einen Tag blieben, bevorzugten aus unerfindlichen Gründen den überfüllten Campingplatz.
Alan stellte sein Gepäck neben dem Bett auf den Boden. Er öffnete die Tür zum kleinen Balkon und trat hinaus. Er hatte es nicht bemerkt, aber es schien, als hätte er in diesen wenigen Minuten die Wärme der Luft und den Geruch des Meeres vergessen. Jedenfalls kamen die beiden ihm als angenehme und unerwartete Überraschung entgegen, die er sofort in sich aufnahm.
Da sich die Autos im Dorf nicht vorwärts bewegten, waren sie so leise wie die Leiden ihrer Insassen. Es war ruhig hier. Das Wasser plätscherte an den Ufersteinen. Alan blickte nach links. Der Genueserturm ganz in der Nähe, den sie auf den letzten Kilometern immer wieder gesehen hatten, war jetzt von einem Hügel verdeckt. Etwas unterhalb des Turms befand sich auch der Eingang zu dem Küstenabschnitt, den sie erwandern wollten. Wo es spuken sollte. Spuken und diese Natur passen irgendwie nicht zusammen, dachte er.
Jay war zu ihm getreten, womit der Balkon voll belegt war.
»Spuken und diese Natur passen irgendwie nicht zusammen«, sagte Jay. Alan wunderte sich nicht. Solche Dinge kamen immer wieder vor.
»Nein. Es ist, als würden Wind und Wellen es den Geistern nicht erlauben, zu Geistern zu werden. Weil sie alles in sich aufnehmen und auflösen und es so in den großen Kreislauf der Natur eingliedern.«
»Ich dachte eher, dass es dafür eine dunkle Burg braucht.«
Alan deutete nach links. »Vielleicht reicht auch ein jahrhundertealter genuesischer Turm, um sich darin verkriechen zu können.«
Wenig später spazierten die beiden den Strand entlang. Auch hier war vom Autochaos nichts zu spüren, denn Chaos und Strand waren sauber durch eine Reihe heruntergekommener Häuser getrennt wie die zwei Seiten eines Herzens, jedes Haus mit einer überdachten Terrasse zum Strand hin, auf der sich ein Restaurant eingenistet hatte.
In der Bucht lagen viele Boote vor Anker, weiße Tupfer auf blauem Wasser. Weiß und blau war auch der kleine Junge im Sand, nur umgekehrt. Nur mit einer blauen Mütze bekleidet, eingehüllt in Sonnencreme. Der Rest des Strandes zeigte sich in jeder Hinsicht bunt. Sonnenschirme in allen Farben, rötlicher Sand, Menschen in allen Schattierungen. Die einen schienen seit Monaten nichts anderes zu tun, als in ihren Liegestühlen zu liegen und sich durchbacken zu lassen. Andere spielten Ball. Drei muskulöse Männer, deren Sixpacks sich bereits unter einige Schichten guten Essens und Weins zurückgezogen hatten, diskutierten wichtig. Als wären sie nicht dem Wahn der ewigen Jugend verfallen, sondern würden leben und es genießen. Wie schön, dachte Jay.
»Können wir nicht ein paar Tage hier bleiben, statt in ein einsames Tal zu wandern?«, fragte er mit Blick auf die drei Männer. Alan knuffte ihn in die Seite. Sie lachten.
»Ich meine ja nur. Ein gutes Pokerspiel würde ich auch nicht ausschlagen.«
»Um mal wieder abzuräumen.«
Sie fanden eine Terrasse, guten Wein und gutes Essen.
Auf dem Rückweg zum Hotel kamen sie am Restaurant des Amis vorbei, wo noch zwei Hummer in ihrer gläsernen Todeszelle auf ihre Verzehrer warteten.
»Restaurant des Amis. Überall sind sie, die Amerikaner«, bemerkte Jay trocken.
»Und sie denken immer, sie sind gemeint.« Alan lachte.
Neben dem Café hatte noch ein kleiner Laden mit Obst, Brot und Alkohol für die hier ankernden Touristen geöffnet. Alan und Jay kauften Birnen und Feigen für morgen. Eine engagierte, ältere Verkaufsperson, deren Geschlecht nicht auszumachen war, erzählte ihnen von ganzen Fischschwärmen, die einfach verschwänden, das seien diese chinesischen U-Boote, überall seien sie, die Chinesen, ohne dass man sie je zu Gesicht bekäme, aber man wolle es einem ja nicht glauben. Nicht einmal, wenn ihre U-Boote eine Boje weit draußen in die Tiefe rissen und mit sich zogen, denn diese Dinger verschwanden auch immer wieder, seit Jahren, ja Jahrzehnten, schon damals, das waren noch Zeiten, und nie tauchte wieder eine auf. Jay und Alan bezahlten und lächelten freundlich, aber ohne zu große Zustimmung. Sie bedankten sich und gingen ins Hotel zurück.
—
Pionéa war mit ihrem kleinen Rucksack am Hotel Cyrnos vorbei die breite Straße hinauf zum Genueserturm gegangen. Sie hatte die Informationstafeln hinter sich gelassen, ohne sie länger als einen Augenblick zu beachten. Natürlich wusste sie von den Vermissten. Angus hatte sie gebeten, wirklich nicht schwimmen zu gehen. Klar.
Sie hatte sich den Umweg über den Hügel und den Turm gespart. Sie war den schmalen Pfad durch das Dickicht in Rich